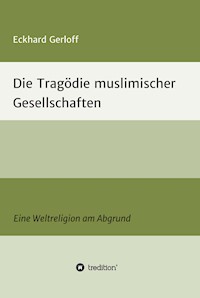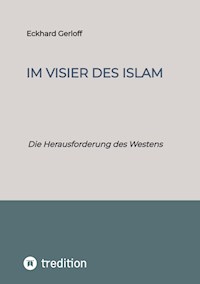
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der fundamentalistische, politische Islam fordert den Westen heraus - seine Werte und seine Kultur. Obwohl er sich selbst in einer religiösen und zivilisatorischen Krise befindet, überzieht er den Westen mit Terror und Migration. Der Westen ist herausgefordert - auch weil er seine eigenen Werte nicht glaubwürdig vertritt. Seine Militärinterventionen dienten kaum der Freiheit und Demokratie, sondern stets ökonomischen und geostrategischen Interessen. Der Westen muss seine Werte und die Menschenrechte erkennbarer und glaubwürdiger vertreten, anstatt sie nur vorzuheucheln. Eine "Aufklärung" im westlichen Sinne kann dem Islam nicht vorgeschrieben werden - man muss ihm helfen, diesen Prozess aus eigener Kraft und aus eigenem Interesse anzugehen und zu bewältigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Eckhard Gerloff Im Visier des Islam
„Wir wollen nichts von euch wissen, Feindschaft und Hass sind zwischen uns offenbar geworden für alle Zeiten, solange ihr nicht an Allah allein glaubt.“
Koran, Sure 60, Vers 4
IM VISIER DES ISLAM
Die Herausforderung des Westens
Eckhard Gerloff
Impressum
© 2022 Dr. Eckhard Gerloff
Autor: Dr. Eckhard Gerloff
Umschlaggestaltung, Lektorat und Korrektorat: Dr. Eckhard Gerloff
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN (Hardcover): 978-3-347-77906-8
ISBN (e-Book): 978-3-347-77907-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
1. 2015 – Das Jahr der Flüchtlingskrise
1.1 Migration und gesellschaftliche Disruption
1.2 Flüchtlingspolitik – ein „deutscher“ Diskurs
1.3 Muslime im europäischen Rechtsrahmen
1.4 Integration: Zwischen Hoffen und Scheitern
2. Religion – Wir und die Anderen
2.1 Christliche Werte – Verleugnung und Vermarktung
2.2 Schleichende Islamisierung
2.3 Menschen- und Gottesbilder
2.4 Scharia im Gegensatz zu „westlichen” Rechtsnormen
3. Islam und die Menschenrechte
3.1 Charta der Menschenrechte
3.2 Friedensliebe des Islam und Islamkritik
3.3 Religionsfreiheit
3.4 Antisemitismus und Islamophobie
4. Mittlerer- und Naher-Osten
4.1 Naher-Osten: Kein Frieden in Sicht
4.2 Israel – Hilft eine „europäische“ Perspektive?
4.3 Türkei – Wanderer zwischen den Welten
4.4 Westliches Scheitern in Afghanistan
5. Islam in Europa – Koexistenz oder Miteinander?
5. 1 Islamische Parteien in Deutschland
5.2 Muslimische Verbände und Organisationen
5.3 Österreich und sein Islamgesetz
5.4 Frankreich macht mobil
6. Zivilisatorisches Versagen des Islam
6.1 Islam als „Sekte“
6.2 Totaritalismus und Terror
6.3 Islam: Zivilisatorisch gescheitert!
6.4 Überleben des Islam?
Schlussbemerkungen
Verwendete Literatur
Vorwort
Der europäische Kontinent erlebte im Jahre 2015 eine Massenmigration eines bisher kaum gekannten Ausmaßes, eine Migration vor allem aus muslimisch geprägten Regionen des Nahen und Mittleren Ostens. Von dieser von vielen als neue „Völkerwanderung“ bezeichneten Fluchtbewegung in besonderem Maße betroffen war die Bundesrepublik Deutschland. Die Ursachen dieser Migration sind vielfältig: Sie sind einerseits in nicht enden wollenden, teilweise eskalierenden Bürgerkriegen, andererseits aber auch in ökonomisch-sozialen und religiös-kulturellen Auseinandersetzungen auf den Terrains des Nahen und Mittleren Ostens zu finden. Bei genauer Betrachtung sind es aber nicht allein die Gewalt und Brutalität zahlloser kriegerischer Auseinandersetzungen, sondern es sind vor allen Dingen soziale und ökonomische Probleme und eine damit einhergehende Perspektivlosigkeit, die Menschen veranlassen, Ihre Heimat zu verlassen, um in Europa, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland Unterschlupf, Frieden vor Verfolgung, Mord und Unterdrückung zu finden, aber auch wirtschaftliche Vorteile zu genießen.
„Die Welt ist auf dem Weg, ein neues Verständnis des Islam zu entwickeln, und die Überzeugung, dass die Probleme, die die Menschheit bisher nicht hat lösen können, vom Islam bewältigt werden können, ist weit verbreitet“.1 Dieses von Fetullah Gülen stammende Zitat beschreibt eine vielfach herrschende Auffassung, der Islam besäße die Kraft und das Potenzial, als allumfassende Antwort auf die Probleme der Welt und ihrer Zivilisationen zu lösen. Die Wirklichkeit spricht indes eine andere Sprache. Die meisten Ökonomien muslimischer Gesellschaften liegen am Boden und zahlreiche zivilisatorische Probleme sind ungelöst. Insbesondere der islamische Fundamentalismus in den meisten der heute 47 islamisch geprägten Staaten hat gravierende Folgen: Staat und Religion sind nicht getrennt, sondern sie bilden eine Einheit, die Scharia ist Staatsrecht, und dort, wo sie konsequent gilt, mit drakonischen Strafen für Andersgläubige, Homosexuelle und Abtrünnige. Die zweite, noch schwerwiegendere Folge ist die eklatante Benachteiligung der Frau, in ihrer durch die Scharia nur halben Rechtstellung gegenüber dem Mann, in vielfach früh erfolgter Zwangsverheiratung und in größerer Arbeitslosigkeit. Drittens die offene Wissensfeindlichkeit. In puncto Einkommen sind die meisten muslimischen Länder weltweit auf untere Ränge abgerutscht.
In der westlichen Welt ist diese Erkenntnis nicht neu – der Islam wird kaum als eine Lösung zivilisatorischer Probleme angesehen, weil er selbst eine erfolgreiche Antwort schuldig geblieben ist. Muslime und muslimische Gesellschaften zögern keinen Augenblick, aus den koranischen Verheißungen einen „Überlegenheitsdünkel“ abzuleiten und sich unter Berufung auf die Ausführungen des Koran über andere Menschen und Lebensweisen, deren Gesellschaftsform, Rechtssystem, Religion und Kultur zu erheben. Dies wird als besonders schmerzhaft empfunden.
In zahlreichen Veröffentlichungen hat eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam stattgefunden. In der Regel handelt es sich um islamkritische Publikationen2, nicht um islamfeindliche. Dennoch ist der Zorn von Muslimen über kritische Töne groß. In den Problemen der muslimischen Integration in westliche Gesellschaften spiegelt sich die Krise der islamischen Welt im Kleinformat. Hier kann nur gelten, Demokratie und Menschenrechte geduldig, aber auch beharrlich dagegen zu halten.
Die vorliegende Publikation fasst eine Reihe von Aufsätzen und Fachbeiträgen zusammen, die im Zeitraum von sieben Jahren, beginnend mit der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 und den nachfolgenden großen Migrationsbewegungen entstanden sind und vom Autor veröffentlicht wurden. Der Titel dieses Buches „Im Visier des Islam“ bildet eine Klammer für die einzeln publizierten Beiträge. Alle Beiträge wurden thematisch geordnet, in sechs Kapiteln zusammengestellt und redaktionell überarbeitet. Der Leser sei darauf hingewiesen, dass alle Kapitel und deren Abschnitte unabhängig voneinander gelesen werden können.
Das Kapitel 1 behandelt die politischen, gesellschaftlichen und sozialen Verwerfungen, wie sie durch die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 hervorgerufen worden sind. Mit grundlegenden Fragen der Religionen – Christentum, Judentum und Islam – beschäftigt sich das Kapitel 2.
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der westlichen und der islamischen „Kultur“ liegt in der unterschiedlichen Akzeptanz der Allgemeinen Menschenrechte begründet; diesem Thema widmet sich in ausführlicher Weise das Kapitel 3. Ein Überblick über die unverändert schwierige Lage des Mittleren- und Nahen-Ostens wird in Kapitel 4 gegeben.
In Kapitel 5 werden zwei Seiten einer Medaille betrachtet: zum einen die Bemühungen des liberalistischen Islam, sich mit seinen ureigenen Vorstellungen entweder in politischen Parteien der Gastländer zu engagieren oder auch eigene, muslimisch geprägte Parteien zu gründen. In diesem Zusammenhang bleiben die Bemühungen und Interessen muslimischer Verbände und Organisationen eine nicht zu vernachlässigende Komponente. Abschließend wird in Kapitel 6 ausführlich das zivilisatorische Versagen des Islam und das Scheitern muslimischer Gesellschaften dargelegt.3
1 Gülen, Fetullah (2004), Besitzt der Islam das Potenzial, sich mit Problemen jeder Art zu befassen?
2 Vgl. Gerloff, Eckhard (2021), Die Tragödie muslimischer Gesellschaften. Eine Religion am Abgrund.
3 Ein Hinweis zu den Fußnoten: sie beziehen sich auf wörtliche Zitate, auf Anlehnungen zu Argumenten, Thesen und Begründungen von Autoren aus Publikationen oder sie beinhalten vertiefende Erläuterungen zu Begriffen und Text. Zitate mit Bezug auf Autoren bzw. Publikationen sind verkürzt dargestellt, der Name, das Erscheinungsjahr und der Titel werden angegeben. Im angefügten Literaturverzeichnis sind alle Quellen ausführlich dargestellt.
1. 2015 – Das Jahr der Flüchtlingskrise
Allein im Jahre 2015 kamen knapp 1 Millionen Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland. Die Politik in Deutschland wie auch in den übrigen Ländern Europas zeigten sich überfordert, hilflos und ließen die Migrationswelle geschehen. Wesentliche Regelwerke Europas waren plötzlich kaum mehr etwas wert. Es herrschten Chaos und laissez faire. Die Bürger Europas wurden von einem spürbaren Unbehagen darüber beschlichen, dass mit den Flüchtlingen auch nicht nur traumatisierte Menschen in ihre Länder kamen, sondern mit ihnen auch die Probleme und kulturellreligiösen Prägungen der Ursprungsländer.
Politik und Medien versuchten, beschwichtigend zu wirken. Jedoch führten ausführliche Berichte von Medien und betroffenen Bürgern schnell zu Verunsicherung – und je genauer man hinschaute, desto größer wurde das Unbehagen. Immerhin war vielen Bürgern bewusst, dass die Integration von Arbeitsmigranten mehr oder weniger schiefgelaufen war, dass sich in „banlieus“ und großen Teilen der Ballungszentren Parallelgesellschaften entwickelten – mit all den befremdlichen Begleiterscheinungen. Das „Unbekannte“ äußerte sich schnell an kritischen Betrachtungen des Islam, derjenigen Religion, die die allermeisten Flüchtlinge aus ihren Heimatländern mitgebracht hatten. Es entwickelten sich Klischees und Vorurteile
In den westlichen Ländern wurden neue Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht, die negativ geprägte Haltungen und Denkweisen durchaus bestätigten und Vorurteile bestärkten. Gefühle und Befindlichkeiten von Menschen können eine starke Wirkung entfalten. Die Politik wie auch die Medien haben diesen Sachverhalt lange Zeit völlig unterschätzt. Auch der „aufgeklärte“ Bürger Europas neigt gelegentlich dazu, „Gefühle“ über die „Vernunft“ zu stellen.
Diese schwierige Gemengelage der im „Beobachtungsmodus“ befindlichen Bürger Europas steht im Mittelpunkt dieses einleitenden Kapitels. In Abschnitt 1.1 wird die durch die Migrationswelle eintretende gesellschaftliche Disruption beschrieben. Der Abschnitt 1.2 beschäftigt sich mit einem außergewöhnlich heftig geführten Diskurs deutscher Intellektueller, die auf die Migration, die Handlungen der Politik und der möglichen Folgen für das Land reagierten; auch ausländische Intellektuelle griffen in diesen Diskurs ein.
In Abschnitt 1.3 wird eine „Disruption“ anderer Art erörtert: Das Zusammentreffen der gesellschaftlich-kulturellen Prägungen der Migranten mit den europäischen Rechtsnormen. Der Abschnitt 1.4 beschreibt zum Ende dieses Kapitels den Stand der Integration vor dem Eintreten der Migrationswelle. Insbesondere in Deutschland wurde im Jahre 2015 der Status der bisherigen Integrationsbemühungen gesellschaftlich diskutiert. Dies wirkte ebenso wie ein Schock wie die Tatsache, dass sich die Zahl der Muslime als Folge der Migrationswelle in erheblicher Weise erhöhte.
1.1 Migration und gesellschaftliche Disruption
Die im Jahre 2015 erlebte Migration und die daraus erwachsenden künftigen Herausforderungen werden dieses Land und auch Europa als Ganzes verändern. Der CDU-Politiker Jens Spahn4 sprach in seinem 2016 vorgelegten Buch „In`s Offene“5 von „Disruption”, von tiefgreifenden „Verwerfungen“, die Staat und Gesellschaft an den Rand ihrer Möglichkeiten bringen würden. Gelegentlich wurde in der politischen Szene offen auch von Staatsversagen gesprochen, insbesondere als es um die mangelnde Sicherung der Staatsgrenzen oder die Registrierung von Flüchtlingen ging. Die „Ungeschicklichkeiten“ der Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, „selfies“ mit Flüchtlingen als quasi Aufforderung und Werbung nutzbar zu machen, dass sich weitere Menschen der Massenflucht anschließen, hatten fundamentale Fragen aufgeworfen: Die AfD hatte Klage gegen die Kanzlerin beim Verfassungsgericht eingereicht, es wurde sogar von einem „Putsch“ gesprochen – auf jeden Fall blieb festzustellen, dass die Bürger der Bundesrepublik weder befragt wurden noch im Wege einer allgemeinen, freien und geheimen Wahl über die Situation und damit über die weitere Zukunft des Landes abstimmen konnten. Diese Abstimmung wurde jedoch mit den folgenden Landtags- und Bundestagswahlen erwartet.
Durch die damalige Migrationswelle und die hastig eingeleiteten politischen Maßnahmen hat Europa in einer schwer zu reparierenden Art und Weise Schaden genommen. Die Abkommen von „Schengen” und „Dublin” waren faktisch außer Kraft gesetzt, die „alten nationalen Grenzen” wurden eilends wieder hergestellt. Die EU-Länder der „Balkanroute” (Ungarn, Kroatien) schlossen ihre Grenzen; auch Nicht-EU-Länder wie Mazedonien und Serbien fühlten sich überrannt und schlossen ihre Grenzen. In Europa herrschte gegenseitiges Misstrauen und nationalstaatliches Denken – Abschottung war Trumpf. Die europäische „Idee” schien (vorläufig) am Ende zu sein, es drohte ein erheblicher mittel- bis langfristiger Schaden, Europa begann zu zerbröseln.
War noch anfänglich von „Flüchtlingen“ die Rede, so nahmen die Bürger des Landes bereits wenige Wochen nach Einsetzen dieser sich unaufhaltsam bewegenden und zunehmenden Menschenmassen in und aus den Medien einen begrifflichen Wechsel wahr: Plötzlich wurden aus „Flüchtlinge” zu „Zuwanderer“. Als hätten Meinungsforschungsinstitute während der Wanderungsbewegungen offene und repräsentative Befragungen nach den Motiven der unterwegs befindlichen Menschen durchgeführt, deren Ergebnisse in unverdauter und noch nicht interpretierter Form der staunenden Öffentlichkeit preisgegeben wurden. Weiter wurde suggeriert: es sei der feste Wille dieser Menschen, nicht ein vorübergehendes „Asyl“ und Bleiberecht zu erwirken, nein, sie wollten hier in Deutschland und anderen europäischen Ländern ihr Leben verbringen. Und die in Europa bereits lebenden Bürger hatten darauf auch keinen Einfluss zu nehmen. Alles ist vom Schicksal so gewollt, die Bürger hatten keine Wahl. Fatum!
„Refugees welcome”! Mit solcherart Plakatierung wurden ankommende Flüchtlinge in Deutschland begrüßt: „Achtung, Sie betreten das Gelobte Land!” Wie freundlich! Was für eine humanistische Großtat! Der „Gutmensch” zeigte sich von einer neuen Seite, seine „Lichterketten” verbrauchten mittlerweile zu viele Ressourcen und Energie, jetzt wurde die „Willkommenskultur” eröffnet. Die in ihrer Tendenz bislang mehr oder weniger passiv ausgerichtete „Betroffenheitskultur” nahm eine neue und aktivische Variante ein. Während überall in der Welt der islamistische Terror wütete, sah man Menschen „Fähnchen schwenkend” an Straßen und Bahnhöfen stehend, um zu zeigen, wie freundlich gesinnt wir den „Neuen” gegenüber waren.
Bei allem „Gutmenschentum” stellte sich indes eine weit überwiegende Anzahl der Bürger in Deutschland und anderen europäischen Länder besorgte und berechtigte Fragen: „Wen holen wir uns in das Land..?” und „Was genau nehmen wir da eigentlich auf..?“ – faktisch, kulturell, inhaltlich. Und: es sollten Antworten finden – wie gehen wir klug mit den sich stellenden Fragen und Herausforderungen um. Und genau um den Kern dieser Fragen wird unser künftiger Umgang mit dem Islam stehen.
Da die Bundesrepublik Deutschland mit dem 3.12.2015 wieder zur Einzelfallprüfung im Asylverfahren zurückgekehrt ist, soll hier nicht weiter auf individuelle Motive der Migranten eingegangen werden; es ist Sache staatlicher Organe, diese Sachverhalte zu erfassen und zu bewerten.
Es waren die gleichen Medien, die von der „Fachkräftelüge” berichtet hatten, die nun die „Zuwanderer” als neue Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft erkannten. Was für eine Geschichte. Sicher sind die meisten der “Flüchtlinge” im ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Alter; es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die deutsche Wirtschaft hervorragend ausgebildete Facharbeiter / Spezialisten benötigt, was einen entsprechenden Ausbildungs-(Bildungs-)standard voraussetzt – und natürlich auch die Beherrschung der deutschen Sprache und auch die Gepflogenheiten an einem deutschen Arbeitsplatz. Hiervon sind wir mit Blick auf die „Flüchtlinge” weit entfernt. Erste Schätzungen (des DIHK) gingen davon aus, dass lediglich 5% der Flüchtlinge an deutschen Arbeitsplätzen einsatzfähig seien (wenn unterstellt wird, bei “Spezialisten” werden Zeugnisse und Arbeitsdokumente schnell und unkompliziert anerkannt).
Bei jungen Männern, die noch eine Ausbildung benötigen ist mittlerweile von einer Zeitstrecke von 4 bis 5 Jahren auszugehen, die bis zu einem endgültigen Einsatz in der deutschen Wirtschaft vergehen werden. Wir sollten also nicht davon erwarten, dass „Ingenieure und Ärzte” nach Deutschland kommen, sondern Menschen mit einem teilweise deutlich unter dem deutschen Bildungsniveau liegenden Ausbildungs- und beruflichen Erfahrungsstatus. Das mediale “appeasement” ist völlig aus der Luft gegriffen und führt in eine falsche Richtung.
Es knirschte in Europa – an allen Ecken und Kanten. Die gesamten supra-nationalen Ordnungen schienen aus den Fugen geraten: der Euro wackelte, die Abkommen von Schengen und Dublin waren faktisch außer Kraft gesetzt. Einerseits schot teten sich Länder durch das Ziehen neuer Zäune ab, andererseits nahmen „rechtspopulistische“ Strömungen zu. Das „Orban-Ungarn“, das „PiS-Polen“, das „Pegida-Dresden“ und das „Le Pen-Frankreich“ sind nur Blitz lichter die aber aufzeigen, das die europäischen Bürger nicht gewillt waren, die derzeitigen „toleranten“ Mainstream-Gedanken kommentarlos mitzutragen.
Die Zeichen standen auf Sturm. Und die Journaille tobte und hate die Ursache bereits ausgemacht: der dumme, unfähige Bürger, der nach jahrzehntelanger medialer Bevormundungspolitik langsam aus dem Ruder zu laufen scheint. Doch diese „bürgerliche Chuzpe“ wurde bekämpft, statt zu fragen, ob der Bogen nicht doch überspannt und eine „kritische Masse“ nicht überschritten wurde. Aber: es schien, dass diese Heuchelei ins Wanken geriet und abgelöst wurde durch (aufgeklärten, emanzipierten) Realismus und Pragmatismus – auch wenn es hier und da weh tut!
Leider vermischten sich in diesen Strömungen allgemeiner Unzufriedenheit mit den politischen „Klassen“, zunehmende ökonomische Unsicherheiten und weiteres, diffuses Unbehagen. Das verleitete dazu, die damalige Massenmigration als willkommenen Anlass zu nehmen, „um das Abendland“ zu retten.
1.2 Flüchtlingspolitik – ein „deutscher“ Diskurs
Es ist eine unbestrittene Tatsache: Menschen fliehen, wenn ihnen Gefahr für Leib und Leben droht und ihre Zukunft als auf Dauer zerstört erscheint. Bei näherer Betrachtung der Flüchtlingsströme des Jahres 2015 blieb festzuhalten, dass mindestens 90% der Menschen muslimischen Glaubens waren. Allein dieser Sachverhalt wirft tiefgreifende Fragen auf – auch wenn seit der Rede des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff und seinem nachhallenden Zitat „der Islam gehöre ja auch zu Deutschland“6; alles halb so schlimm und gleichsam völlig normal sei, wenn auch weiterhin Muslime in großer Zahl zu uns drängen. In diesem Zusammenhang erscheinen zwei Aspekte bemerkenswert:
Erstens verweist der unmittelbare Redekontext vor und nach dieser häufig zitierten Textstelle die Muslime eindeutig in den Zusammenhang des deutschen Verfassungsrechts, seiner Gesetze, seiner Kultur und Gesellschaft; diese Tatsache ist beinahe komplett unterschlagen worden. Medien verkürzen gerne, denn sie lieben „griffige“ Formulierungen.
Zweitens hat der auf Christian Wulff folgende Bundespräsident Gauck diese umstrittene und stark diskutierte Textstelle eindeutig korrigiert und spricht im Rahmen mehrerer Reden an, dass Muslime zu Deutschland gehören, der Islam wurde in diesen Zusammenhängen jedoch nicht erwähnt. Auf die christlich-jüdische Kultur wird bei seinen Ausführungen explizit Bezug genommen – für Deutschland und auch für Europa.
Es nimmt nicht Wunder, dass die Auswirkungen der Flüchtlingskrise 2015 auch unter deutschen Intellektuellen kontrovers diskutiert wurde. Ein im Februar 2016 veröffentlichtes Interview7 mit dem deutschen Philosophen Peter Sloterdijk8 entwickelt in fließender Folge eine Reihe von Themenbereichen, zu denen Sloterdijk Stellung bezieht. Sloterdijk äußert sich in der ihm eigenen Art insbesondere zur Islam und christlichen Religion, dem islamistischen Terrorismus, zu Migration, Integration und der „deutschen Willkommenskultur“. In der Folge brachte dieses Interview eine Reihe teilweise heftig vorgetragener Debattenbeiträge hervor.
So führte Sloterdijk beispielsweise aus: „Doch während die christliche Religion ihre phobokratische Dynamik verbraucht hat, revitalisiert sich der Islam heute dadurch, dass er seine phobokratischen Reserven auffüllt. Unter salafistischen Vorzeichen findet eine Rückkehr zur kriegerischen Interpretation des Dschihad statt, der zuvor als spirituelle Wachsamkeit gegen die Reste der Ungläubigkeit im Gläubigen selbst gedeutet worden war. Meines Erachtens gründet dieses Zurück zur Furcht darin, dass der Islam heute spürt, dass er von seiner inneren Gestalt her nicht wirklich staatsfähig ist, nicht einmal gesellschaftsfähig. Mit dem Islam lässt sich keine authentische Zivilgesellschaft füllen9” und weiter „Die Scharia steht dem zivilgesellschaftlichen „modus vivendi“ im Weg. Im Grunde ist der Islam ein juristisches Konstrukt, er kommt fast ohne Theologie aus. Er will die soziale Synthesis mit Gesetzeszwang erreichen…10”.
Zur EU und dem Phänomen des Nationalstaates räumte er mit Blick auf die Migrationswelle recht unterschiedliche Zukunftsaussichten ein: „als lockerer Bund hat die EU mehr Zukunft, als wenn sie auf Verdichtung setzt. Dem Nationalstaat darf man ein langes Leben prophezeien, weil er das einzige politische Großgebilde ist, das bis zur Stunde halbwegs funktioniert. Die überwölbenden Strukturen können nur in dem Maß bestehen, wie die Nationalstaaten ihnen den Rücken freihalten11” und weiter merkte Sloterdijk an, „nichtsdestoweniger werden die Dinge sich normalisieren, sobald die Zeit der Illusionen auf allen Seiten vorüber ist. Die Europäer werden früher oder später eine effiziente gemeinsame Grenzpolitik entwickeln. Auf die Dauer setzt der territoriale Imperativ sich durch. Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung12”.
Nach diesem Interview meldete sich Herfried Münkler13 in der ZEIT14 zu Wort. Nach einer Einordnung der Flüchtlingskrise als „humanistisches” bzw. als „logistisches” Problem stellt er kritisch fest, dass man die aktuelle Flüchtlingskrise „als eine politisch-strategische Herausforderung begreifen (kann), und (es) dann .. um die Frage (geht), ob es jenseits humanitärer Gesichtspunkte und rechtlicher Selbstbindungen Gründe dafür gab, die deutschen Grenzen für den Flüchtlingsstrom auf der Balkanroute zu öffnen”. Eine solche strategische Diskussion müsse man jedoch bislang vermissen – und das sei einer der Gründe dafür, dass nach der „Sylvester-Nacht 2015/2016” das Schließen der Grenze wiederum als Option in das Spiel gebracht wurde. Mit der Forderung nach einer notwendigen „strategischen Diskussion” des Themas „Flüchtlingskrise” wird es jedoch belassen, der Artikel enthält ansonsten kaum weitere sachliche und zielführende Beiträge. Anstatt substanzielle Beiträge für den Fortschritt der von ihm selbst angeregten Debatte zu liefern, wird Sloterdijk massiv angegriffen.
Münkler rechtfertigt das politische Handeln der deutschen Bundesregierung durch folgende drei Aspekte: zum ersten die Vermeidung des Schengener Grenzraumes durch die Einführung nationaler Grenzregime, zum zweiten die Verhinderung des Zusammenbruches von Staaten auf der Balkanroute durch Flüchtlings(rück)stau und drittens zu vermeiden, dass Deutschland als möglicher Verursacher der zu erstens und zweitens genannten Risiken in die Pflicht genommen würde. Die “deutsche Strategie” bestand nach Münkler darin,
Nachdem – auch neben Münkler – eine Reihe von “prominenten Denkern” die Aussagen des Sloterdijk`schen Interviews mit kritischen Äußerungen bedacht hatten, kam am 9. März 2016 in ZEIT-online15 eine intensive Erwiderung, die an Deutlichkeit und persönlicher Polemik nicht zu wünschen übrigließ. Sloterdijk: „Wir haben es seit einer Weile mit einem bedenklichen Zug zur Nuancenvernichtung zu tun – bedenklich vor allem deswegen, weil allgemeine Lebenserfahrung weiß, dass zwischen Gut und Böse gelegentlich nur haarfeine Unterschiede liegen”, weiter führt er aus: „…meine Äußerungen über deregulierte Migrationen und übers Ufer getretene Flüchtlings-"Ströme". Der Fall hat eine aparte Seite, da Münkler kein kleiner Kläffer ist, wie ein Philosophie-Journalist (gemeint ist Richard David Precht: (Anm. .d. Verf.) aus der Narren-Hochburg Köln, der offensichtlich immer noch nicht weiß, wer und wie viele er ist. Münkler jedoch hat sich als Autor von Statur erwiesen. Umso erstaunlicher bleibt seine Fehllektüre-Leistung, die er in einem Artikel dieser Zeitung von vor wenigen Wochen zum Besten gegeben hat.”
Aufgegriffen wird der von Münkler vorgetragene Vorwurf, die Flüchtlingskrise müsse vor dem Hintergrund einer politisch-strategischen Herausforderung eben auch „strategisch” behandelt werden. Hier erfolgt nun eine Betrachtung der Merkel`schen Politik-Strategie als das, was sie in Sloterdijks Augen eigentlich darstellt: „In der Zwischenzeit, denke ich, sollte Herr Münkler die Gelegenheit nutzen, seine okkasionellen Ungezogenheiten zu überdenken. Offenbar stammen seine polemischen Thesen (er war erregt genug, meine und Safranskis Sorgen-Thesen als unbedarftes "Dahergerede" zu bezeichnen) doch auch zum Teil aus der Sphäre der vorkulturellen Reflexe, nicht zuletzt aus dem Revierverhalten und dem Streben nach Deutungshoheit.”
Die Gegenrede des derart Gescholtenen ließ nicht lange auf sich warten; am 12. März 2016 wurde von „Merkels Kavaliers-Politologen” Münkler ein Artikel16 veröffentlicht, der versucht, in gleicher Münze zurückzuzahlen. Zunächst setzt er die Kritik an dem Vorwurf der Merkel`schen Politik-Improvisation ebenso wie der generellen Infragestellung von Strategie-Sinnhaftigkeit an: „Peter Sloterdijk hat einen ausgeprägten Affekt gegen strategisches Denken. Wer darauf verzichtet, politische Ratschläge zu geben, kann sich solch einen Affekt leisten. Dann ist es ihm unbenommen, in abschätzigem Ton von "Strategie-Versteherei" zu sprechen und sich überhaupt als jemanden zu outen, der von Politik nichts versteht und auch nichts verstehen will.”
Im weiteren Verlauf des Münkler-Artikels werden die politischen Positionen und Optionen im Zusammenhang mit der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik dargelegt – im Wesentlichen aber gegenüber seinem Artikel vom 20. März 2016 nicht verändert oder erweitert. Der zum Teil “bösartigen” Erwiderung von Sloterdijk entgegnet Münkler zum Ende seines Artikels mit einer qualitativ adäquaten Polemik: „Man muss Sloterdijks Essay aber nicht unbedingt als Dokument eines verkorksten Denkens lesen, sondern kann darin auch die Abdankungserklärung eines Typus öffentlicher Intellektualität sehen, der die Debattenkultur dieses Landes lange Zeit beherrscht hat. Dieser Typus hat sich nicht einer klaren und präzisen Begrifflichkeit bedient, sondern mit dunklen Metaphern Gedankenschwere simuliert. Ein Beispiel dafür ist die von Sloterdijk in dem jüngsten Essay wieder aufgenommene Entgegensetzung von „stark-wandigen Container-Gesellschaften", die für die Moderne typisch seien, und „postmodernen dünnwandigen Membran-Gesellschaften". Damit sollte auf den Bedeutungsverlust des Nationalstaates als autonomer Politikakteur angespielt werden. Aber das sprachliche An- und Umspielen hat seinen Preis, und der besteht in einem defizitären Begreifen von Konstellationen und Veränderungen.”
Am 11. März 2016 veröffentlichte Armin Nassehi17 einen Beitrag18, der sich auf das ursprüngliche Sloterdijk-Interview in der Zeitschrift Cicero bezog. Mit Blick auf die zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung und des damit erfolgten Eingriffs in die Debatte nimmt er sich die Kontrahenten Sloterdijk und Münkler vor und führt aus: „…dass Konflikte recht stabile Gebilde sind, in denen die Rollen so stark verteilt sind, dass auch der Versuch, aus dem Gebilde auszusteigen, die Antipoden noch stärker in sie hineinzieht.” Diese Äußerung trifft zwar „beide” geht indes mehr oder weniger stärker belastend an die Adresse von Sloterdijk: „Sloterdijks Hauptvorwurf besteht darin, seine Kritiker übten „intentionale Falschlektüre" insbesondere seines Interviews im Februarheft der Zeitschrift Cicero – ein Argument, das seiner Diagnose einer pawlowsch reflexhaften Form der Debatte ein wenig widerspricht, aber tatsächlich ist es ein schwerwiegender Vorwurf.”
Kritisch setzt sich Nassehi mit der Sloterdijk`schen Aussage, dass aktuell der Flüchtling über den Ausnahmezustand entscheide, also in die Rolle des “Souverän” schlüpfe, auseinander. Dies setze voraus, dass der eigentliche Souverän (in diesem Falle die Bürger der BRD) seine Souveränität längst verloren habe, was Nassehi indes in keiner Weise nachvollziehen kann. Besondere Kritik äußert Nassehi an den Sloterdijk`schen Einlassungen zur angestrebten “Integration”: „Der wirklich ärgerlichste Passus des Interviews beschäftigt sich nämlich mit dem Integrationsbegriff. Integration ist für Sloterdijk ein Ausdruck, der ein unerreichbares Ziel beschreibt. Er schreibt: „Wir wären ja schon mehr als zufrieden, wenn man es zur beruhigten Koexistenz brächte, zu einer freundlichen Gleichgültigkeit gegenüber der Tatsache, dass es zu viele Leute gibt, mit denen man fast nichts gemeinsam hat." Was für ein Satz! Er sagt: Es gibt ein konsistentes, identitäres Wir und ein differentes Ihr, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass man mit ihnen „fast nichts" gemeinsam hat. Das ist entweder unbedacht, oder es ist eine klare Absage an eine pluralistische Gesellschaft. Sloterdijk wird hier das Opfer einer insuffizienten Theorie des Gesellschaftlichen.”
Abschließend rückt Nassehi das Sloterdijk-Zitat „es gäbe keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung” in einen direkten Zusammenhang mit der Buchtitel-These von Sarrazin des “Deutschland schafft sich ab”. So endet denn auch der Beitrag mit den wenig schmeichelhaften Worten: „Am Ende besteht für mich ein wenig der Verdacht, dass er seinen Interviewern auf den Leim gegangen ist, denen es jedenfalls kunstvoll gelungen ist, Sloterdijk jene Sätze abzutrotzen, die sie gerne hätten. Wenn man weiß, um wen es sich bei den Interviewern handelt, wundert das nicht sehr – aber schmeichelhaft wäre diese Diagnose für den wortgewaltigen Philosophen nicht, würde sie zutreffen. Ich lasse das deshalb explizit offen.
Einen weiteren Aspekt des Sloterdijk-Interviews spricht Rafik Schami19 in einer Veröffentlichung vom 15. März 201620 an, nämlich die vermeintliche Islamophobie, die er in einigen Passagen des Interviews zweifelsfrei erkennen will. Ohnehin sieht er von diesen „Hassern” nur Feindseligkeit gegenüber dem Islam entgegenschlagen. Er sieht es als lächerlich an „…wenn diese Hasser ihre Sorge um die ’jüdischen Mitbürger’ als Grund ihrer Verachtung der Muslime in diesem Land“ angäben, so Schami. In seinem 40-jähigen Bemühen um die Aussöhnung zwischen Juden und Arabern sei „nie einer dieser Herren auch nur in Sichtweite anzutreffen“ gewesen.”
Zugleich formuliert Schami einen Katalog mit Erwartungen an Flüchtlinge. „Im Zentrum stehen Dankbarkeit, Achtung und Respekt vor dem „christlichen Abendland“ mit seinen Freiheiten, Werten und Gesetzen. Die Diskussionen darüber „müssen wir wieder an uns reißen und nicht den Populisten und Menschenhassern überlassen.“ Flüchtlinge müssten die Gleichheit von Mann und Frau ebenso achten wie die Rechte von Homosexuellen. Sie sollten aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und für die Beseitigung der Fluchtursachen in ihren Heimatländern kämpfen.”
Sloterdijk gilt als rhetorisch brillanter und wortgewaltiger Geist. Eine klare gedankliche Analyse paart sich mit semantischer Durchdringung, wobei gelegentliche Überspitzungen, Zuspitzungen und „sprachliche Karikaturen” von ihm gern als geeignete Hilfsmittel im Diskurs benutzt werden. Das „An-Treiben” gedanklicher Klärung findet bei Sloterdijk mitunter in der Form des “Über-Treibens” statt. Die Äußerungen von Sloterdijk zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen, zur Integration, zur Herauslobung des „Nationalstaates” sind naturgemäß ein gefundenes Fressen für seine “geistige Gegnerschaft”.
Die Debatte wird aktuell von einigen Journalisten dazu benutzt, entweder die eigene Position zu schärfen bzw. zu begründen oder aber dafür zu missbrauchen, moralisierend, dämpfend und schlichtend einzugreifen. So wird schnell mit dem Verweis darauf, die Debatte sei dafür angetan, den „Stammtisch salonfähig zu machen”21, gleichsam Sloterdijk & Co. in die Nähe des Rechtspopulismus, der AfD oder Pegida zu rücken. Das mag politisch korrekt sein, ein solcher Ansatz greift jedoch nicht und ist in diesem Zusammenhang auch wenig hilfreich.
Bei genauer Betrachtung der von Sloterdijk ausgelösten Debatte ist indes erschreckend, wie wenig konkreter argumentativer Gehalt geboten wird. Das bezieht sich nicht allein auf Sloterdijk, dessen überspitzende Aussagen streckenweise verschwörungs-theoretischen Wert genießen, sondern auch auf die teilweise unter die Gürtellinie gehenden Reflexe von Münkler und Schami, der aus seiner Sicht (vielleicht) verständlich die probate Islamophobie-Keule schwingt. Man gewinnt den Eindruck, „der Ort geistiger Auseinandersetzungen” habe mittlerweile bereits die Inhaltslosigkeit der politischen Klasse oder das qualitative Niveau politischer Talk-Shows erreicht. Gehaltvoller erscheint da der mäßigend wirkende Beitrag von Nassehi, der sich um eine Rückführung der Debatte auf eine argumentative, sachliche Ebene bemüht.
Wirklich erschreckend ist das Ausmaß gegenseitiger Verunglimpfung, wie sie bei Sloterdijk und Münkler gelesen und wahrgenommen werden kann. Man gelangt zu dem Eindruck, hier gehe es nicht mehr um den Austausch gut formulierter und rhetorisch brillanter Argumente, sondern nur darum, möglichst vernichtend auf den Anderen einzudreschen. Die Sache selbst tritt in den Hintergrund und man erlebt eine Art und Qualität der Beschimpfung, wie man sie lange Zeit nicht erlebt hat. Man folgt einem Diskurs, der deswegen aus dem Ruder zu laufen scheint, weil das Ruder als Waffe genutzt wird. Damit ist jedoch mit Blick auf die ernste Lage weder Richtung zu gewinnen noch Fahrt aufzunehmen. Der interessierte Leser verfolgt das Geschehen durch eine Flut von Verbalergüssen und wird hoffnungslos in den Untiefen der aktuellen Ereignisse zurückgelassen. In Krisenzeiten ist zweifelsfrei geistige Führerschaft gefragt. Man wäre dankbar, wenn die exekutive Politik auf einen intellektuellen Überbau zurückgreifen kann, der den Überblick behält, der Orientierung gibt und Untiefen auslotet. Die dargestellte Debatte gibt allerdings wenig Orientierung, sie selbst erzeugt Untiefen. Der Leser verirrt sich indes ungewollt in “Reflexzonen”.
Mitte Februar 2016 äußerte sich in einem Interview mit dem Deutschlandradio “Kultur” der Erziehungswissenschaftler und Publizist Micha Brumlik22 zu den Aussagen Sloterdijks und beklagte eine Verschärfung des Debattentones, die aktuell zu einer “geistigen Spaltung” führe; gewissermaßen werde der “Stammtisch” salonfähig. Brumlik hält Sloterdijk et. al. insbesondere absurde “verschwörungstheoretische” Bezüge vor (z.B. die Steuerung der Flüchtlingsströme durch die USA).
Diese Einnahme extremer Positionen führt nach Meinung von Brumlik zu einer politischen Spaltung der Gesellschaft, zumal eine Politik der Alternativlosigkeit bei der Bevölkerung ein erkennbares Maß an Ohnmacht, Wut und Entrüstung produziert, wie man es aktuell in den USA beobachten könne. Und es steht zu befürchten, dass sich nun Ähnliches auch in Deutschland zeigen könne. Und das polarisiert sich nun an der Flüchtlings- und Migrationsfrage. Menschen (wie Sloterdijk) glauben, zu harten Ausdrücken greifen zu müssen, weil die Medien wesentlich differenzierter und weicher argumentieren. Aber die Antwort darauf könne nicht sein, dass die Medien plötzlich genauso undifferenziert draufschlagen, das ist genau das Problem.23 Vieles sei in der aktuellen Debatte eben ein Thema von „schlechter Kinderstube” und von „Stammtischniveau”. Leider wird über die Klage eines als wenig geeigneten verbalen Diskussions-Stils kein konkret inhaltlicher Beitrag geliefert. Es geht Brumlik offenbar lediglich darum, mit seiner Ansprache von “wenig gelungener argumentativer Qualität” einige Debattenteilnehmer in eine “rechte Ecke zu stellen”.
Rafik Schami hatte sich u.a. gegen Sloterdijk mit der harschen Kritik gerichtet, die von ihm (Sloterdijk) in seinen Äußerungen vorgetragene und erkennbare Islamophobie sei der salonfähige Antisemitismus. Hier wurde eine insbesondere in Deutschland recht wirksame “Keule” geschwungen, denn mit dem Argument des Antisemitismus sind Gegner (in Deutschland) schnell mundtot zu machen. Da Schami sich u.a. auch gegen den Autor und Büchner-Preisträger Reinhard Jirgl wendet, wehrt sich dieser im Feuilleton der FAZ.24
Natürlich verwahrt sich Jirgl gegen die Anwürfe von Schami und führt aus, zu keiner Zeit irgendwelche negative Äußerungen zu Muslimen, dem Islam etc. gemacht zu haben. So führt Jirgl dann aus: “Irgendwie macht alles die Runde. Irgendwann wird jeder gelesen haben, Reinhard Jirgl hätte islamophobe oder antisemitische Sachen geschrieben. Und keiner wird wissen, wo. Und keiner wird wissen, dass es diese Texte nicht gibt. Wenn Autoren, was immer sie sonst zu verfassen pflegen und aus welchen Gründen auch immer, in der gegenwärtigen Debatte zu solchen Lügen greifen, dann kann ich nur eines sagen: Es widert mich an. Wenn einer mich als Wirrkopf bezeichnet, als Konservativen, Nationalkonservativen, durchgedrehten Poststrukturalisten oder was der naturgemäß sehr flachen Etiketten sonst noch sein mögen, interessiert mich all das nicht. Aber Rafik Schami hat die Grenze von der Debatte zur persönlichen Verleumdung überschritten, die keiner überschreiten darf, niemals. Wer das tut, verlässt den Kreis derjenigen, mit denen zu sprechen ist. Das stelle ich hier fest, und ich lehne es ab, noch ein weiteres Wort dem Verleumder zu erwidern.”25 Diese Äußerungen lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig.
Aus dem französischen Ausland meldete sich mit Pascal Bruckner26 einer der weltweit erfolgreichsten Autoren zu Wort. Aus der Frage nach der Schuld und den Ursachen der Kriegssituationen in Nahost sieht Bruckner in allererster Linie die Länder in der Verantwortung, „die den Krieg verursacht haben, auch diejenigen sein, die die Flüchtlinge aufnehmen, allen voran Saudi-Arabien”27. Europa und insbesondere Frankreich sieht er dagegen nicht in der Verantwortung – damit auch nicht primär für die Lösung der Flüchtlingsprobleme. Deutschland sieht er in der Haltung gegenüber der Flüchtlingsproblematik in Europa als völlig isoliert, sowohl innerhalb der Politik wie auch bei der Intelligenz. Warum fühlen sich die Deutschen so viel mehr als andere verantwortlich für das Böse in der Welt? Die deutsche Moral sucht das reine, unschuldige Opfer. Noch im vergangenen Juni war Bundeskanzlerin Angela Merkel unversöhnlich gegenüber den Griechen, aber schon im August war sie ausgesprochen wohlwollend gegenüber den Syrern. Was bewies, dass Deutschlands Humanität einer sehr eigenen Logik der Bevorzugung folgte: Griechen gelten als Schmarotzer, sie sind der deutschen Güte unwürdig. Dagegen entsprechen die kriegsgebeutelten Syrer schon eher der Vorstellung des makellosen Opfers, an dem man Wiedergutmachung für die eigenen Verbrechen betreiben kann”28.
Nach Meinung Bruckners ist die deutsche Haltung weitgehend interessengeleitet: „Man begegnete in Merkel einem Narzissmus des Mitgefühls. Wie jeder Narzissmus war auch dieser grenzenlos und ein Alleingang. Zudem konnte man die Interessen hinter ihrer vermeintlichen Selbstlosigkeit erkennen. Die Leute kamen umsonst, ob zu Fuß oder mit dem Zug: Techniker und Ingenieure, wie sie die deutschen Arbeitgeber gefordert hatten!”29 Auf den Hinweis, der deutsche Schriftsteller Martin Walser hätte die Willkommenskultur als „Geschenk Deutschlands an die Welt” betrachtet entgegnet Bruckner: “Die meisten Europäer würden auf dieses Geschenk gern verzichten. Deutschlands Verhalten ist bewundernswert und unverantwortlich zugleich. Es fördert einen naiven Liberalismus, der keine Grenzen kennt, der die Kulturen nicht mehr trennen kann, der Menschen wie Dosenerbsen betrachtet – egal aus welcher Dose, werden sie sich schon dem Arbeitsmarkt anpassen. Dabei deutet alles, was seit dem September mit den Flüchtlingen geschieht, auf einen Kulturschock hin: in Schweden, in Norwegen, auch in Deutschland. Die Ereignisse in Köln, selbst wenn die Täter keine Flüchtlinge im engen Sinne, sondern Nordafrikaner waren, weisen in die gleiche Richtung”30.
Perspektivisch sieht Bruckner in der deutschen Haltung ein langfristiges Problem, das die Einheit Europas gefährden könnte: „Merkels Versuch der letzten Monate, das gute Europa nur in Deutschland zu bauen, dieses Zurschaustellen der deutschen Beispielhaftigkeit, vor der sich die Nachbarn für ihre Stumpfheit zu schämen haben, das erinnert mich an die großen Kämpfe innerhalb der Kommunistischen Internationale, an Stalins Antwort auf Trotzki. Trotzki trat damals innerhalb der kommunistischen Bewegung für die permanente Revolution ein, Stalin für den Sozialismus in einem Land. Stalin gewann die Auseinandersetzung, aus vielen historischen Gründen, aber mit katastrophalen Folgen. Wenn wir anderen Europäer die Deutschen heute nicht von ihren Alleingängen abhalten, dann fürchte ich um Europa”31. Es ist nicht überraschend, dass gegenüber der deutschen Öffentlichkeit die französische „Intelligenz” sich tendenziell auf die Seite der von Max Weber32 formulierten Verantwortungsethik beruft, als die deutsche Willkommenskultur, die eher der Gesinnungsethik frönt. Eigene französische Erfahrungen aus einer schlecht gelungenen Integration muslimischer Migranten zeigen erkennbare Spuren. Mit den kritisch distanzierten Aussagen wird auch – ohne auf diese bewusst abzustellen – die Position Sloterdijks bestärkt.
Mit einem Interview in der Schweizer Zeitung „Der Tagesanzeiger”, geführt am 15.4.2016 legt Sloterdijk in der von ihm angestoßenen Debatte nach. Ohne auf seine Kritiker im Detail einzugehen (der einzige Hinweis und Seitenhieb: „die Deformationen haben Grenzen, wenn die Argumente ehrenrührig oder gar diffamierend werden“.) kommt er schnell zum Thema; seine Kritik: die bundesdeutsche Politik ist weniger durch Strategie als durch Improvisation geprägt, denn „das rückwirkende Vortäuschen von Strategien, die es nicht gab, ist eine bedenkliche Form des Regierens“33. Im Zuge ihres Zurückruderns – wie er es vorausgesagt hatte – geht sie (Frau Merkel) einen „Teufelspakt“ mit dem türkischen Staatspräsidenten ein, denn „offenbar findet man bei Männern dieses Typs die nötige Grobheit, um die europäischen Sensibilitäten zu schonen“34.
Sloterdijk plädiert für eine Politik im Sinne der oben bereits angesprochenen Verantwortungsethik, für eine Politik, die Souveränität hochhält und auch durchaus Hartherzigkeit zeigt; „Souveränität ist auch das Gegenteil von Hartherzigkeit, nämlich die Prämisse für die Fähigkeit zu helfen. Zur Politik gehört die Handhabung von Härten. Dass es den Schweizern besser geht als den Menschen in Somalia, ist auch eine himmelschreiende Härte, die nur deswegen nicht auffällt, weil nicht genug Somalier vor der Tür der Schweiz stehen. Wenn demnächst die Welle der schwarzafrikanischen Überpopulation an die Tore Europas brandet, wird das Problem der Härte-Verwaltung wieder auftauchen, heftiger als heute”35. Die Wahrung der Souveränität bezieht er nicht nur auf die Gestaltungsfähigkeit, das politische Handeln, sondern auch auf die Staatsgrenzen. „Wenn die Einwanderung eine Form annimmt, in der es keine Grenze mehr gibt, sondern nur ein wüstes offenes Feld, liegt Staatsversagen vor. Dann kann man Reaktionen wie jene der Pegida oder der Alternative für Deutschland (AfD) metaphorisch als allergische Reaktionen deuten“36.
Auf den Vorwurf seiner Kritiker, als quasi aus dem „nationalistischen“ Raum heraus gesprochen und „nationalstaatlich“ argumentiert zu haben, entgegnet Sloterdijk: „hier liegt wieder so ein ärgerliches Missverständnis vor: Spricht man das Wort Nationalstaat aus, heult eine Kaste pseudoprogressiver Soziologieprofessoren auf und behauptet, man sei aus Naivität für nationalkonservative Optionen“ und weiter „Das Ethnisch-Nationale innerhalb des Staates ist längst zur Diskussion gestellt, und das zu Recht, denn wir leben nicht mehr in der Ära kulturell homogener Staatsvölker – falls diese nicht ohnehin immer schon Fiktionen waren. Was nicht zur Diskussion steht, sind Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit. Und diese Größen sind nun mal bis auf weiteres ausschließlich im sogenannten Nationalstaat inkarniert, nirgendwo sonst. Der Akzent fällt auf „Staat“, nicht auf „national“. Es gibt vorerst keinen anderen Träger dieser unentbehrlichen Prinzipien politischer Zivilisation“37.
Dem Vorwurf, staatliches Handeln entspräche mehr der Improvisation als dem Folgen einer transparenten und logischen Strategie, fügt er hinzu: „Es ist zu befürchten, dass wir die längst erkannten Probleme noch ein Jahrhundert vor uns herschieben. Das passt zur Signatur unseres Zeitalters, in dem das Vertagen und Aufschieben von Problemen mit ihrer Lösung verwechselt wird. Man kauft sich Zeit, man tut so, als gewinne man Spielräume, aber man nutzt sie nicht – unterdessen türmen sich die Berge ungelöster Probleme am Horizont immer höher auf“38.
Mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Cicero, dem Verleger und Publizisten Wolfram Weimer, führte Sloterdijk im April 2016 ein Interview, das unmittelbar an das ursprünglich in der gleichen Zeitschrift erschienene Interview anknüpft. Das aktuell geführte Interview nimmt zwar klaren Bezug auf das ursprüngliche Interview, findet seinen Einstieg jedoch über das im Jahre 2006 erschienene Buch von Sloterdijk unter dem Titel „Zorn und Zeit”. In diesem Buch steht für Sloterdijk außer Frage, dass in Tausenden von Koranschulen, die überall dort aus dem Boden schießen, wo es Jungmännerüberschüsse gibt, weiterhin Märtyrer auf Heiligen Krieg getrimmt werden. Ein kleiner Teil werde zu terroristischen Zwecken eingesetzt, der größere in Bürgerkriege auf arabischem Territorium investiert werden - Kriege, von denen das iranisch-irakische Massaker von 1980 bis 1988 einen Vorgeschmack gegeben hat. Es steht für ihn auch außer Frage, dass Israel weitere Bewährungsproben vor sich hat, also ohne eine weitsichtige Politik der Abschottung gar nicht wird überstehen können. Selbst Kenner der Lage“, so lautet seine Diagnose, besitzen heute nicht die geringste Vorstellung davon, wie der machtvoll anrollende muslimische „youth bulge“, die umfangreichste Welle an genozid-schwangeren Jungmännerüberschüssen in der Geschichte der Menschheit, mit friedlichen Mitteln einzudämmen wäre. Vor diesem Hintergrund nimmt das aktuelle Interview den auch direkten Bezug zu den Gefahren des Islamismus und Terrorismus, Gefahren, die auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der „Flüchtlingskrise” stehen.
Sein Vorschlag hinsichtlich einer künftigen Positionierung gegenüber Gefahren und Herausforderungen lautet: „Denken Sie an Carl Schmitts berühmte Formulierung „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, ich transformiere ihn ein wenig, indem ich sage: „Souverän ist, wer in der Lage ist, glaubhaft zu drohen“, und zu drohen heißt in der Sprache der Strategiewissenschaft, einen bewaffneten Ratschlag übermitteln. Das Interessante am Terrorismus ist, dass dort eine Reinform der Drohung entwickelt wurde, die drohen ihre Drohung an, es wird nichts vorgeschlagen, es wird eine reine Drohung in den Raum gesetzt, deren Bedeutsamkeit noch nicht zu fassen ist, deswegen neige ich dazu, das Ganze eher in Ausdrücken der Medienkunst zu interpretieren und nicht so sehr in Ausdrücken der Politologie”39.
„Man muss die Stolzkomponente im Terror versuchen, in Reindarstellung zu fassen, der Terror ist eine Verhaltensweise, der diese Reindarstellung nicht duldet, da ist schmutzige, im wahrsten Wortsinne niederträchtige Energie drin, die sich selbst die Absolution erteilt und zwar unter unsportlichen, das heißt religiösen Verbrämungen, deswegen ist Religion so gefährlich, vor allem monotheistische Religion, weil sie eine kriecherische Metaphysik unterstützt, die Religionen sind Gefäße des metaphysischen Masochismus, das heißt, man bekommt die Form vorgegeben, in der man sich unterwerfen darf”40.
Zum Ende des Interviews wird Sloterdijk die Frage gestellt, was im Zeichen des islamistischen Terrorismus in die Humanität rettet. Seine Antwort: „Die Frauen. Sie sind der Schlüssel zur Zivilisierung. Der Islam hat sich vom Anfang des 20. Jahrhunderts, wo er zu einer marginalen Glaubensgruppe zählte, binnen eines Jahrhunderts verachtfacht, das heißt, hier ist Kampffortpflanzung in der Luft, und damit auch eine Form von zweiter Proletarisierung. In dem Augenblick, wo das weibliche Dabeisein – wir haben diese aufs Ganze wünschenswerte Entwicklung im Westen –, wo der weibliche Stolz gestärkt wird, stürzen auch die Geburtenraten auf vernünftige Werte herunter. Der Schlüssel liegt in der Ermächtigung der Frau. Der Terrorist ist in der Regel der dritte, vierte oder fünfte, das heißt, der überflüssige Sohn und damit der zornige junge Mann. Der beunruhigendste Gedanke, der zurzeit in der Welt herumgeistert, Gunnar Heinsohn hat ihn ausgesprochen, ist der Gedanke, dass es in der arabischen Welt in den nächsten dreißig Jahren auch bei einem massiven Abnutzungskrieg noch mehr als genug Söhne gäbe, und wir haben gesehen, was an diesen Fronten möglich ist, im Krieg zwischen dem Iran und Irak, der weitgehend unbeobachtet von den europäischen Medien einer der blutigsten Kriege des 20. Jahrhunderts war, mindestens eine Million Männer wurden verheizt – es war die pure Lebensverschwendung, von daher führt für den Westen kein Weg daran vorbei, den Konflikt der Zivilisationen zu suchen”41.
Es geht also im Sinne von Sloterdijk nicht um den „Clash of Cultures” im Sinne von Samuel Huntington, sondern um einen zu führenden “zivilisierenden Konflikt, wir müssen die Idee eines Lebens aus dem Können in unterwerfungslustige Kulturen einführen, damit sich auch die Religion wandelt, von einer Religion der Unterwerfung zu einer Religion des betreuten Könnens, also, europäisch gesprochen, Protestantismus, der Glaube des von Gott getragenen Könnens”42.
Die verleumderischen Versuche, Sloterdijk (hier durchaus stellvertretend für einige weitere Intellektuelle) in eine rechts-populistische Ecke zu stellen sind relativ unwirksam verpufft und als „links-populistische” Versuche einer politisch korrekten Sprach- und Gedankenregulierung entlarvt. Das „gedankliche Weltbild” ist zwar komplex und nicht ohne weiteres zu erschließen, gleichwohl aber in sich geschlossen und einer stringenten Logik folgend. Es ist unbequem und für aktuell politisch Handelnde und Verantwortliche sicher nicht die gewohnte Heimstatt. Düstere Konturen nehmen seine Aussagen zu Terrorismus und Islamismus an. In Quantität und Qualität ungeheuerliche freisetzbare Gewaltpotenziale werden von Sloterdijk angesprochen; diese sind größtenteils auf die gegebenen demografischen Strukturen („zornige junge Männer”) zurückzuführen wie auch auf den Islam als eine „Religion” ohne ein konkretes Maß an spirituellem Gehalt.
Die aktuelle Debatte um das Sloterdijk-Interview zeigt die funktionierenden Wirkungsmechanismen eines unkontrollierbaren Mainstream-Journalismus. Aussagen und deren personelle Träger werden dann, wenn sie nicht in ein akzeptables Schema passen, reflexartig in den extremen Bereich des “Rechts-Populismus” hinein gerückt. Eine detaillierte Prüfung von Aussage- und Meinungs-Inhalten findet nicht mehr statt – es reicht der Anfangsverdacht, die Inhalte könnten möglicherweise die Menschen, die sie erreichen, zum Nachdenken oder zu einer vom Mainstream abweichenden Meinung führen. Da ist dann auch jedes Mittel recht – vor allen Dingen die persönliche Verleumdung und Diskreditierung. Die bundesdeutsche Journaille stellt sich selbst ein schlechtes Zeugnis aus – ebenso diejenigen Intellektuellen, die „reflexartig” die Keule schwingen. Nach-Denken wäre vielfach besser gewesen – nicht Nach-Treten.
1.3 Muslime im europäischen Rechtsrahmen
Eine häufig vertretene Auffassung besagt, dass das Christentum erst durch die Aufklärung zur Trennung von Staat und Kirche gelangt sei. Richtig ist jedoch, dass das Prinzip der Trennung von staatlicher Gewalt und Religion bereits in den Evangelien niedergeschrieben ist. Man könnte dieses Prinzip als Herzensanliegen Jesu betrachten. Es sticht beim Lesen der Evangelien ins Auge, dass Jesus keinerlei Ambitionen auf irgendeine Form weltlicher Macht hegte, genauso wie er Sklaverei und Unterdrückung kategorisch ablehnte:
„Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten; und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du: Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt demKaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon.“43
Eine Schlacht vor den Toren Roms beendete die Zeit der „alten christlichen Kirche“ und ließ eine ganz andere Art von Christentum entstehen. Zwei Kaisersöhne standen sich im Jahr 312 nach Christus an der Milvischen Brücke mit ihren Heeren gegenüber: Maxentius als Vertreter des alten Rom und der alten Religion und Konstantin, der Sympathien für die immer stärker werdende Gruppe der Christen hatte und der versprochen hatte, sich im Falle eines Sieges taufen zu lassen, Christ zu werden. Als Konstantin siegte, löste er sein Versprechen ein, und von da an änderte sich alles für die Christen. Aus einer verfolgten Minderheit wurde eine Staatsreligion, eine Reichskirche, die Bischöfe wurden zu weltlichen Herrschern und der Papst zum geistlichen Gegenüber und häufig auch zum Gegenspieler des Kaisers. Der Sieg Konstantins über Maxentius führte zur sogenannten „Konstantinischen Wende“, das Christentum wurde Staatsreligion, Rom wurde zum Zentrum der Kirche mit dem Papst an der Spitze; aus dem antiken Römischen Reich wurde das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“. Für mehr als 12 Jahrhunderte blieben von da an Staat und Kirche eng miteinander verzahnt, jeder Bürger des Reiches war gleichzeitig Mitglied der einen Kirche, ungefragt gehörte man zur Kirche, so wie man ungefragt Bürger des Staates war.
Dann kam bekanntlich Luther und forderte die Trennung von Kirche und Staat, der beiden „Reiche“, wie er das nannte, wobei sich die weltliche Obrigkeit nicht in kirchliche Angelegenheiten mischen sollten und die Kirche nicht in die Politik einmischen. Allerdings hat er sich selbst nicht an diese Lehre gehalten. Schon kurze Zeit später machte er die evangelischen Fürsten zu Aufsehern über die Kirche in ihrem Land: das sogenannte „landesherrliche Kirchenregiment“, das bis in das 20.Jahrhundert andauerte44.
In Deutschland wurden jedoch erst mit der Weimarer Verfassung Kirche und Staat strikt voneinander getrennt: „Es besteht keine Staatskirche“, hieß es dort, und: „Die Kirchen regeln ihre Angelegenheiten selbständig“.45 Und so ist es bis heute. Die Trennung der „beiden Reiche“, wie Luther es nannte, Staat und Kirche, ist erst in unserer Zeit Wirklichkeit geworden. Wir haben einen säkularen, einen nichtreligiösen Staat, und von diesem Staat unabhängige Kirchen.
Begründet durch das „humanistische Weltbild“ konnten sich westliche Gesellschaften entwickeln, in denen sich auf der Grundlage von Rationalität und Säkularität Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte schaffen ließen. Rechtsstaatlichkeit führt zur Anerkennung von Grundgesetzen und Verfassungen, die von Menschen und nicht von Gott gemacht oder von „Gottesgnaden“ eingeleitet wurden. Ohne Rechtsstaatlichkeit gäbe es keine Basis für demokratische Prinzipien. Erst wenn säkulare, rechtsstaatliche Grundlagen im Denken akzeptiert werden können, können demokratische Prinzipien zugelassen, eingefordert und umgesetzt werden. Nur auf der Grundlage von säkularen Grundgesetzen und Verfassungen entstehen Demokratien. Und erst das Verständnis der Menschen für die Sinnhaftigkeit von Demokratie und der gesamtgesellschaftlichen Durchsetzung von zwischenmenschlichen Grundwerten machte die UNO-Menschenrechts-charta zu einem wünschenswerten Gut.
Kaum jemand würde in einer anderen Staatsform als in der Demokratie die universellen Menschenrechte verbindlich einhalten. Außerdem können nur Bürger, die in einer funktionierenden Demokratie leben, daran denken, die Umsetzung der universellen Menschenrechte zu fordern. Zu wenig beachtet wird oft auch der Umstand, dass die Achtung und der Schutz der Menschenrechte wechselseitig abhängig sind von funktionierenden demokratischen und effizienten rechtsstaatlichen Strukturen. Die demokratische Weltsicht gipfelt in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die für alle Menschen auf der Erde gelten sollen.
Im Islam hingegen existieren diese beiden „Reiche“ der christlichen Auffassung nicht – das geistige Reich Gottes und das „weltliche Reich“ sind vielmehr als eine „Einheit“ gefasst. Alle Verkündigungen, Verheißungen und Gebote werden direkt Allah zugeschrieben, sie sind Allahs Wille, sie haben einmaligen Charakter und sind unveränderbar und in alle Ewigkeit festgeschrieben. Auf dieser Auffassung fußend gibt es in islamischen Gesellschafen auch keine Trennung zwischen geistiger und weltlicher Sphäre und da der Islam nicht als „Kirche“ verfasst ist, gibt es nach islamischer Auffassung auch folgerichtig keine Trennung zwischen „Staat“ und „Kirche“. Im Gegenteil: im Islam sind „Staat“ und „Religion“ (denn der Islam kennt eine Kirche nicht!) eine untrennbare Einheit.
In der islamischen Theologie wird die Scharia (übersetzt: der Weg zur Quelle) als die einzige und vollkommene Ordnung betrachtet, die sowohl Frieden als auch Gerechtigkeit schafft. Sie gilt als Ordnung Gottes und darf daher prinzipiell nicht durch menschliche Gesetze ersetzt werden. Die Scharia ist die Gesamtheit des islamischen Gesetzes, wie es im Koran, in der islamischen Überlieferung und in den Auslegungen maßgeblicher Theologen und Juristen vor allem der frühislamischen Zeit niedergelegt wurde; sie umfasst einerseits die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen