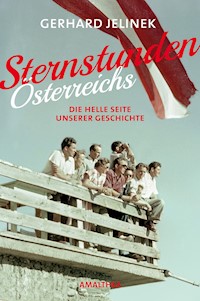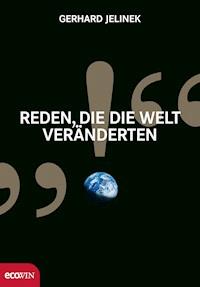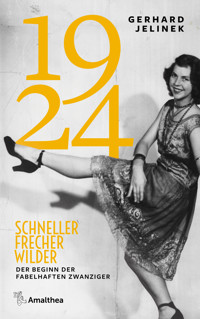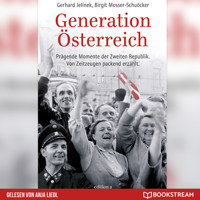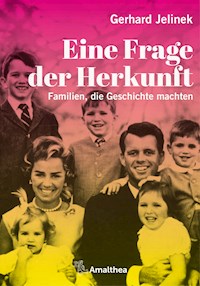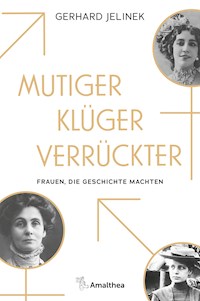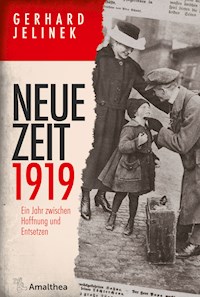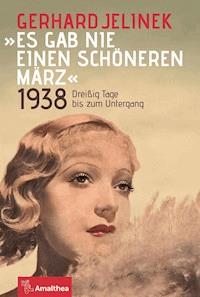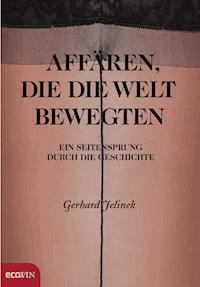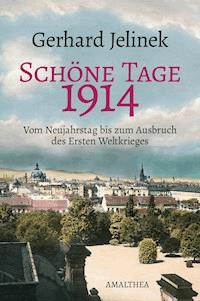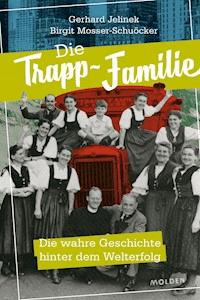
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Molden Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1,4 Milliarden Menschen haben den Hollywood- Erfolgsfilm »The Sound of Music« gesehen. Jahr für Jahr kommen Hunderttausende Touristen nach Salzburg, um auf den Spuren der singenden Familie Trapp die Schauplätze der Dreharbeiten zu besuchen. Kein Film, kein Buch, kein Lied hat das Bild Österreichs in der Welt so geprägt wie diese idealisierte Familiengeschichte. Das Lied »Edelweiß« wird weltweit als Hymne des Alpenlandes gesungen. Die wahre Geschichte der Familie des Georg Ritter von Trapp entspricht jedoch keineswegs den süßlichen Klischees: Das Schicksal der Trapps spiegelt vielmehr eindringlich Österreichs widersprüchliche Geschichte von der Habsburgermonarchie bis zur Auslöschung des Landes durch Adolf Hitler wider.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gerhard Jelinek · Birgit Mosser-Schuöcker
Die
Trapp-Familie
Die wahre Geschichte hinter dem Welterfolg
x_Inhalt
COVER
TITEL
VORWORT
1_ EIN KRIEGSHELD TAUCHT AUF
Georg von Trapp versenkt den französischen Panzerkreuzer „Léon Gambetta“
2_ TU FELIX AUSTRIA NUBE
Die Hochzeit mit der jungen Millionenerbin Agathe Whitehead
3_ EIN KAPITÄN VERLIERT SEIN MER
Mit dem Kriegsende geht 1918 die k. u. k. Marine unter
4_ DER FRÜHE TOD IM MARTINSCHLÖSSEL
Agathe von Trapp stirbt an Scharlach
5_ VOM SCHLÖSSEL ZUR VILLA
Witwer Georg von Trapp zieht es zu Kriegskameraden nach Salzburg
6_ WER IST FRÄULEIN KUTSCHERA?
Eine junge Lehrerin der Benediktinerinnen kommt ins Haus
7_ DIE PLEITE MIT LEONARDO DA VINCI
Durch den Konkurs der Lammer-Bank verliert die Familie ihr Geldvermögen
8_ SIEG IM GAUWETTSINGEN
Die Sangeskarriere des Trappchors beginnt im „Gasthaus zum elektrischen Aufzug“
9_ EINE ÖSTERREICHISCHE FAMILIE
Die Trapps werden Propagandisten des klerikalen „Ständestaats“
10_ BEGEGNUNG MIT ADOLF HITLER
Mit dem deutschen Reichskanzler in der Museumskantine
11_ FLUCHT ODER DER BEGINN EINER TOURNE
Im Herbst 1938 verlässt die Familie ihr Haus in Salzburg
12_ AUF DEM WEG ZUM WELTRUHM
Zwischen 1939 und 1956 singt der Familienchor für drei Millionen Menschen
13_ THE SOUND OF MUSIC
Ein Musical und drei Kinofilme begründen einen Mythos – größer als die Wirklichkeit
14_ DER IN DER HEIMAT IGNORIERTE HEIMATFILM
„The Sound of Music“ prägt seit fünf Jahrzehnten Österreichs Bild in der Welt
WAS WURDE AUS …
DANKE
RECHERCHE
VERWENDETE LITERATUR
BILD- UND QUELLENNACHWEIS
IMPRESSUM
„The Sound of Music“ vereinfacht alles. Vielleicht ist die Wirklichkeit weniger glamourös, aber sicher viel interessanter als der Mythos.
Johannes von Trapp, 1998
Vorwort
Es könnte das Skript eines Films sein: In der Hauptrolle eine junge Lehrerin, die in ein strenges Frauenkloster eintreten will. In der Nebenrolle, die aber eigentlich die zentrale Figur verkörpert, ein attraktiver Mittvierziger, der seinen Beruf als Kapitän mangels eines Meeres und der daher fehlenden Schiffe nicht mehr ausüben kann. Er gilt als Held des Ersten Weltkriegs, weil er zwei Torpedos, die der Großvater seiner englischen Frau erfunden und gebaut hat, gegen einen französischen Panzerkreuzer lenkt, der mit mehr als 600 Mann Besatzung im Mittelmeer untergeht. Der pensionierte Kriegsheld ist wohlhabend, eigentlich sogar reich. Er verwaltet die Erbschaft seiner verstorbenen jungen Frau, die ihm sieben Kinder geschenkt hat. Die kinderreiche Familie lebt mit einem Dutzend Dienstboten in einem Schlösschen im Schatten des mächtigen Stiftes Klosterneuburg bei Wien, ehe der Kapitän nach Salzburg übersiedelt und dort eine Villa im Ortsteil Aigen kauft. Der Marineoffizier beteiligt sich an einer Reederei, versucht sich im Holzhandel, übersteht die Inflationszeit, weil er sein Vermögen in England investiert hat. Mit einer 22-jährigen Wiener Lehrerin tritt eine resolute Person in das Leben seiner Kinder, die den Haushalt umkrempelt und die Kinder nach ihrer Fasson erzieht. Es wird gesungen und gewandert. Der gebürtige Triestiner, ein Ritter von, ehelicht die Junglehrerin alsbald, kaum aus großer Liebe, aber sicher aus praktischen Erwägungen. Eine falsche Investitionsentscheidung führt zum Verlust des Vermögens, eine Bankpleite verändert die Familiensituation, ein Gemälde des italienischen Renaissancemalers Leonardo da Vinci kann die Lage nicht retten. Die betont katholische Familie muss sich von zehn Dienstboten trennen und vermietet Zimmer in der Villa mit ihrem stattlichen Park an Theologiestudenten. Täglich wird die heilige Messe gelesen, die Familie singt dazu.
In Österreich regiert eine katholisch-konservative Regierung mit diktatorischen Methoden und versucht den Abwehrkampf gegen die in Deutschland seit 1933 an der Macht befindlichen Nationalsozialisten. Konservativ, monarchistisch, traditionell, kinderreich und aus religiösen Erwägungen gegen Hitler. So passt die Familie ins Rollenbild des österreichischen „Ständestaats“ und seiner Elite. Von einem Theologen musikalisch geformt, tritt die Familie bei diversen Sängerwettbewerben auf und wird über Auftritte in Radio Salzburg bis nach Wien bekannt. Dort singt der Familienchor für und vor Konzertagenten und wird vom Bundeskanzler der kleinen Alpenrepublik protegiert. In München treffen sie Adolf Hitler im „Haus der Deutschen Kunst“ und zeigen sich wenig beeindruckt. Nach dem militärisch erzwungenen „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland nützt die Familie eine Tournee-Einladung in die Vereinigten Staaten, um „Großdeutschland“ zu verlassen. Der Chor tourt durch Amerika, muss wieder ins kriegerische Europa zurück, bleibt aber im noch friedvollen Norwegen, ehe ein zweites Visum die Auswanderung nach New York ermöglicht. Bei einer großen amerikanischen Konzertagentur unter Vertrag zieht der „Family-Choir“ durch die amerikanische Provinz und wird so bekannt, dass das renommierte Life-Magazin auf die Emigrantenfamilie, die bei ihren Auftritten eher seltsame Tracht trägt, aufmerksam wird. Das Familienoberhaupt knüpft vorsichtige Kontakte zu monarchistischen Exilösterreichern, die Ehefrau organisiert nach Kriegsende eine Hilfsaktion für die Landsleute jenseits des Atlantiks. Am Höhepunkt der Gesangskarriere, die „Kinder“ sind längst erwachsen, kauft die Familie 1942 ein idyllisch gelegenes Gut in den Hügeln von Vermont, organisiert Chorwochen und betreibt eine Landwirtschaft und einen Hotelbetrieb. Die Ehefrau schreibt ihre Lebenserinnerungen, die in einem New Yorker Verlag erscheinen und ein Erfolg werden. Das Buch wird auch in Deutschland gedruckt und wird tatsächlich zu einem Drehbuch umgeschrieben. Der romantische Heimatfilm in bester Besetzung begründet einen Mythos, der bis nach New York an den Broadway reicht, wo das Erfolgsduo Rodger & Hammerstein aus dem Leben der Salzburger ein Musical machen, das mit großem Erfolg im Londoner Westend und in New York bejubelt wird. Es ist die Zeit der beginnenden Jugendrevolte in der westlichen Welt, im New Yorker Stadtteil Greenwich Village singt Robert Allen Zimmermann alias Bob Dylan zur Gitarre Blowin’ in the Wind und in Liverpool musizieren vier junge Kunststudenten, die sich „The Beatles“ nennen, im Cavern Club.
Das Fernsehen wird zum bestimmenden Medium, das Kino taumelt in eine schwere Krise, die Zuschauerzahlen halbieren sich innerhalb weniger Jahre. Selbst so große Hollywood-Studios wie „20th Century Fox“ sind de facto pleite und produzieren nur noch TV-Shows. Die Verfilmung eines altmodischen Broadway-Musicals gilt als eher absurde Idee, als Wagnis. Doch das Projekt wird mit vielen Pannen und Fehlschlägen umgesetzt. Die professionellen Kritiker sind vom mehr als dreistündigen Epos wenig begeistert. „Klebrig“ sei der Film, total verkitscht. Und er wird ein Erfolg. Beim Publikum, schließlich auch bei der Oscar-Jury. Bis heute haben fast zwei Milliarden Menschen diesen Musikfilm gesehen, nach Einspielergebnissen berechnet, ist es einer der zehn erfolgreichsten Filme der Geschichte. Als Basis dient ein Film-Skript: Es ist das Leben einer Familie, deren wahre Geschichte vor dem Weltruhm durch ebendiesen Ruhm überlagert, stellenweise ausgelöscht wird.
In diesem Buch wird die Geschichte der Familie Trapp neu erzählt. Eine Geschichte vom Leben einer aristokratischen Militärelite nach dem Untergang der Habsburgermonarchie im Schatten des Ersten Weltkriegs, der Wirtschaftskrise, der Hyperinflation, eine Geschichte der politischen Instrumentalisierung im „Ständestaat“ und der Emigration vor dem Nationalsozialismus. Es ist die Geschichte einer Frau, die eine Familie zu einem Wirtschaftsunternehmen formt, die in Amerika Erfolg hat, die ihre eigene Geschichte verfälscht und das Leben ihrer Kinder dominiert. Diese Geschichte wird durch drei Filme und ein Broadway-Musical auf Breitwandgröße ausgewalzt und hat längst über die Wahrheit triumphiert. Hunderttausende suchen Jahr für Jahr diesen Mythos in Salzburg. Sie wollen Teil eines Märchens sein. Österreichs wunderbare Landschaft wird zur Kulisse, Salzburg ist es heute noch. Die wahre Geschichte der Familie von Trapp: viel mehr als nur „The Sound of Music“.
Die Versenkung des französischen Panzerkreuzers „Léon Gambetta“ durch das k. u. k. U-Boot „SM U-5“. Von den 821 Mann an Bord sterben 684. Auch Admiral Victor-Baptistin Senès ertrinkt mit allen seinen Offizieren.
1_Ein Kriegsheld taucht auf
Georg von Trapp versenkt den französischen Panzerkreuzer „Léon Gambetta“
„Achtern, steuerbord Rauch!“ Die Meldung verbreitet sich in Windeseile durch das U-Boot. Wer kann, stürzt an Deck. Ein feindliches Schiff? „Volle Kraft voraus!“, lautet das Kommando. Dem feindlichen Kreuzer soll der Weg abgeschnitten werden. Das Kriegsschiff nähert sich schnell, zu schnell. Jeden Moment wird seine Brücke am Horizont auftauchen. Wer sieht, kann auch gesehen werden. Höchste Zeit auf Tauchposition zu gehen. Die Männer verschwinden in Windeseile im Inneren von U-5, der Kommandant schließt die Turmluke. Das laute Geräusch des Benzinmotors wird durch das leise Surren des Elektromotors ersetzt. Alle Mann sind auf Gefechtsstation, die Torpedos werden klargemacht. Danach herrscht absolute Stille. Nur hin und wieder wagt Georg von Trapp einen Blick durch das Sehrohr. Die See ist spiegelglatt. Die Bugwelle, die das Periskop durch die Fahrt erzeugt, kann den Jäger leicht verraten. Endlich hat sich U-5 nah genug an den feindlichen Kreuzer angeschlichen. Der Franzose wendet, das österreichische Boot zieht nach. Wieder ändert der Kreuzer den Kurs. Jetzt ist es klar: U-5 ist entdeckt. Bei Nacht müsste man angreifen, da fühlen sich die Kriegsschiffe sicher. Man müsste es wagen, denkt Kaptiän Georg von Trapp.
Und dann heißt es Geduld haben. Tatsächlich: In der nächsten Nacht taucht der französische Kreuzer wieder auf. Im Mondlicht ist er gut auszunehmen. U-5 ist schussbereit, da wendet der Franzose und läuft mit ganzer Kraft ab. Wieder nichts! Die Enttäuschung ist groß. Der nächste Tag bricht an und vergeht qualvoll langsam. Eine Chance hat U-5 noch, die folgende Nacht. Dann muss das U-Boot wieder in den Hafen zurück, länger reicht der Dieselvorrat nicht.
Der Alarm kommt um Mitternacht. Der Kommandant sieht den Schatten des Kreuzers im Fernglas. Das feindliche Schiff ist völlig dunkel. Lautlos verfolgt Georg von Trapp den Gegner, bis er mit freiem Auge erkennbar ist, dann gibt er Befehl zum Abtauchen. Seine Männer sind enttäuscht. Wieder nichts, auch in der letzten Nacht auf Feindfahrt. An einen nächtlichen Unterwasserangriff denkt niemand, das hat es noch nie gegeben. Georg von Trapp blickt stumm und verbissen durch das Sehrohr: Wo ist der Feind? Ein weiteres Mal darf er nicht entkommen. Da – der gegnerische Kreuzer ist ein winziger Punkt am Horizont. Georg von Trapp lässt seine Männer kurz durch das Periskop blicken. Jetzt begreifen sie: Der Alte will bei Nacht angreifen. Verflogen sind Enttäuschung und Lethargie. Diesmal kommt der Kreuzer auf seinen Verfolger zu, immer größer wird sein Bild im Sehrohr.
„Beide Torpedos fertig!“ Die letzte Sicherung des Projektils wird gelöst.
„Sind fertig!“
Georg von Trapp sieht die Kommandobrücke des feindlichen Schiffes im Periskop.
„Steuerbord-Torpedo — los!“
Schnell nachgedreht. „Backbord-Torpedo — los!“
Mit vierzig Knoten rasen die Geschosse auf ihr Ziel zu, für den Kreuzer gibt es kein Entkommen mehr. Ein harter, metallischer Ton, nach zehn Sekunden ein zweiter, dann eine Rauchwolke. Volltreffer. Die Männer sind nicht mehr zu halten.
„Hurra!“, tönt es durch das Boot. Die Anspannung der letzten Tage und Nächte muss sich entladen. Georg von Trapp beobachtet sein Opfer durch das Sehrohr: Der Kreuzer liegt auf der Backbordseite und versucht Rettungsboote klarzumachen. Die Panik muss entsetzlich sein. Kein Licht, Wassereinbruch, Schräglage. Alles geht sehr schnell. Die Silhouette des sinkenden Schiffes wird immer kleiner.
„Auftauchen!“, kommandiert Georg von Trapp. Fünf kleine Boote treiben im Wasser. Die Gedanken des Kommandanten rasen. Kann er die Schiffbrüchigen an Bord nehmen? Das kleine U-Boot verträgt keine zusätzliche Belastung, die Männer müssten an Deck stehen und bei einem Tauchmanöver ins Wasser springen. Unmöglich also. Georg von Trapp lässt abdrehen.
„Unsere Leute haben sie auch absaufen lassen!“, murmelt einer der Männer. Er hat recht, aber der Kommandant will dieses Gerede nicht hören. Er lehnt am Turm und starrt in die Ferne. Die Boote, denen er nicht helfen kann, sind nur noch kleine Punkte. Georg von Trapp ist übel.
Die erfolgreiche Feindfahrt des Unterseeboots Nummer 5 seiner Majestät des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn hat drei Tage zuvor wenig spektakulär begonnen: Das knapp über 32 Meter lange Unterwassergefährt „SM U-5“ dümpelt in der Straße von Otranto zwischen dem Absatz des italienischen Stiefels und der ionischen Insel Korfu dahin. Kein feindliches Schiff ist zu sehen. Es herrscht Krieg, doch die Flotten der Alliierten scheinen verschwunden. Italiens Marine wagt sich nicht aus den Adriahäfen, die Engländer überlassen das Mittelmeer den französischen Schiffen. Diese blockieren die Meeresstraße zwischen Griechenland und dem Süden Italiens. So soll die österreichisch-ungarische k. u. k. Marine in der Adria isoliert, Österreichs Handelswege und Nachschubrouten gesperrt werden. Die Franzosen nutzen die – eigentlich neutrale – griechische Bucht von Astakos als Stützpunkt.
Linienschiffsleutnant Georg Ritter von Trapp hat sich mit der „SM U-5“ weit nach Süden gewagt. Er liegt mit seinem Boot kaum zwanzig Kilometer von der italienischen Küste entfernt und orientiert sich an den Leuchtfeuern des Feindeslandes. Der Leuchtturm von Santa Maria di Leuca sendet in regelmäßigen Abständen einen hellen Lichtblitz über das dunkle Wasser. Die Unterseeboote der österreichisch-ungarischen Marine, gebaut auf der Whitehead-Werft in Fiume, sind langsam und haben nur eine geringe Reichweite. Nach drei Tagen „Feindfahrt“ müssen sie wieder in den Heimathafen zurück. Die alten Schiffsmotoren werden mit Benzin betrieben, die Leitungen sind undicht, können nur mühsam immer wieder geflickt werden. Abgase gelangen an Bord. Muss das Boot für eine Stunde unter Wasser tauchen, droht die Besatzung durch die Abgase ohnmächtig zu werden. Die Matrosen kennen diese Zustände, nennen sie „Benzinschwammer“ („Benzinrausch“). Und sie lachen darüber. Die österreichischen Schiffe haben einen gefährlichen Feind an Bord.
Kapitän von Trapp will südlich von Korfu einen französischen Kreuzer jagen, der die Straße von Otranto blockiert. Der Wind hat sich gelegt, die See ist spiegelglatt. Das erschwert die Tarnung eines U-Boots. Auch unter Wasser muss das Sehrohr ausgefahren werden. Es erzeugt eine kleine Bugwelle, macht so das Boot sichtbar und ermöglicht dem Gejagten die Flucht. U-5 wartet auf die Nacht, dann wird der französische Kreuzer seine Position beziehen und auf feindliche Schiffe lauern. Die Dunkelheit ist Verbündeter eines U-Boots. Tatsächlich entdeckt die Mannschaft mit ihren Nachtsichtgläsern Rauch. Langsam schleicht sich U-5 an sein Opfer heran, immer wieder muss von Trapp auftauchen lassen, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Schon ist der Schiffstyp erkennbar, bald befindet sich das österreichische U-Boot so nahe am feindlichen Kreuzer, dass seine Torpedos abgefeuert werden könnten. Doch der Franzose ist aufmerksam, er ändert den Kurs, läuft einen Kreis um das getauchte Boot und entkommt.
Kapitän Georg von Trapp am Turm von „SM U-5“ in der Bucht von Kotor (Cattaro).
Die Matrosen von U-5 fühlen sich um ihre Beute betrogen, wieder muss ein Tag gewartet werden. Kommt der französische Kreuzer in der kommenden Nacht wieder? Hat er den Befehl, die Seesperre zu überwachen, dann wird er kurz vor Mitternacht wieder am Horizont auftauchen. In der nächsten Nacht beginnt eine neue Jagd, die letzte Chance. Der Mond wird zum Verbündeten der Österreicher.
Ein Unterwasserangriff bei Nacht auf ein dunkles Schiff wird in der Marineschule nicht gelehrt. Bisher ist eine solche Attacke weder im Frieden ausprobiert, noch im Kriege versucht worden. Aber Kapitän Georg von Trapp will den Nachtangriff wagen. Er muss mit dem Boot selbst zielen, muss möglichst nah und möglichst unbemerkt an den feindlichen Kreuzer herankommen, um dann die Torpedos abfeuern zu können. Sind sie einmal aus den Abschussrohren, können sie nicht mehr gelenkt werden. Die Pressluft treibt die Geschosse mit fast vierzig Knoten pro Stunde auf ihr Ziel zu. Von Trapp hofft, dass ihm der Mond ausreichend Licht für die Sicht durchs Periskop spendet. Die Nacht ist klar.
Unter Wasser ist ein U-Boot blind. Vorsichtig durchstößt das Sehrohr die ruhige Wasseroberfläche. Kein Schiff zu sehen. Kapitän von Trapp ist enttäuscht. Hat er die Chance auf einen Seesieg verpasst? Dann entdeckt er das Schiff wieder. Die Matrosen erfassen intuitiv: „Wir fahren einen Angriff!“ Müdigkeit und Depression sind ein paar Minuten nach Mitternacht verflogen. Doch der französische Kreuzer beginnt zu wenden. Dreht er ab, haben die Österreicher keine Chance mehr. Aber diesmal schiebt sich das mächtige Kriegsschiff auf das winzige U-Boot zu. Von Trapp sieht seinen Gegner im Sehrohr größer werden. Er meint das Rauschen der Bugwelle zu hören. „Beide Torpedos fertig!“ Im Periskop sieht der Kommandant den Bug des Kreuzers durch den Visierfaden des Okulars laufen. Die Bahn der Torpedos ist an den aufsteigenden Luftblasen zu erkennen, sie laufen direkt auf ihr Ziel zu. Der Kreuzer hat keine Chance mehr. Auf kurze Distanz kann er nicht mehr ausweichen.
Kapitän Georg von Trapp schreibt im offiziellen „Kreuzungsbericht“ an das k. u. k. 5. Divisionskommando:
„Der Mond war voll, etwas umwölkt, die Kimm (= die Grenzlinie zwischen Himmel und Wasser) gegen Westen rein. Ich fuhr in Kriegstrimm ganze Kraft mit beiden Elektromotoren auf ihn zu, bis ich den Kreuzer mit freiem Auge erkennen konnte. Er zeigte mir seine Steuerbordseite im spitzen Winkel. Ich nahm Jagdkurs, den Feind 60 Grad backbord, tauchte und führte das Boot mittels Periskop zum Angriff. Im Kurs 180 Grad, bis auf 400–500 Meter nahegekommen, lancierte ich um 12 h 32 den Steuerbordtorpedo gegen die achter Schlottgruppe, 10 Sekunden später den Bachbordtorpedo gegen die vordere Schlottgruppe. Ich sah die Torpedobahnen ca. 150 Meter weit in guter Richtung, fiel nach Steuerbord ab und hörte nach 25 Sekunden die erste Detonation als kurzen dumpfen Knall. Kurz hierauf die zweite ebenso. Die Erschütterungen des Bootes waren unbedeutend. Die Mannschaft brachte ein spontanes ,Hurrah!‘ aus.“
Die Torpedos treffen den Panzerkreuzer unter der Wasserlinie. Zwei Explosionen in wenigen Sekunden Abstand lassen eine Wasserfontäne aufsteigen. Die Spannung löst sich. Routiniert werden die Ersatztorpedos in die Abschussvorrichtungen eingeführt. Sicher ist sicher.
An Bord des getroffenen Schiffes bleibt es finster. Die Maschinen müssen explodiert sein. Der U-Boot-Kapitän ist nur noch Beobachter der Katastrophe. Er notiert minutiös die letzten Minuten der „Léon Gambetta“ und ihrer Besatzung. „Der Kreuzer lag fünf Minuten nach den Lancierungen ca. 35 Grad auf seiner Backbordseite. Eine dunkle Rauchwolke bei der achternen (hinteren) Schlottgruppe hob sich bis auf die Höhe der Masten gegen den Horizont ab. Auf Deck sah ich ein Licht, sich rasch bewegen, sonst blieb das Schiff dunkel, kurz darauf auf achter des sinkenden Schiffs zwei Boote mit Lichtern im Wasser.“
Die „Léon Gambetta“ neigt sich rasch auf die Backbordseite. Innerhalb von nur neun Minuten sinkt das Schiff. „Um 12 h 41 Minuten nach den Lancierungen war der Kreuzer gesunken. An der Sinkstelle sah ich zu dieser Zeit fünf Boote im Wasser, von welchen zwei Lichter schwenkten. Ich tauchte auf, setzte mit beiden Maschinen Kurs gegen die Spitze Outro.“
Soll das kleine U-Boot seinen Opfern zu Hilfe kommen? Georg von Trapp überlässt die schiffbrüchigen Matrosen in den Booten ihrem Schicksal und rechtfertigt sich später: „An eine Rettung der Bemannung durfte ich nicht denken, da ich Zerstörer in der Nähe vermuten musste und mir das Mehrgewicht der aufgefischten Leute eine Unterwasserfahrt unmöglich gemacht hätte.“
Das U-Boot startet die Maschinen, dreht ab, fährt Nordkurs, zurück in den Golf von Cattaro.
Für Kapitän von Trapp und die k. u. k. Marine ist die Versenkung des Kreuzers „Léon Gambetta“ ein Triumph, für die Franzosen eine Tragödie: Von den 821 Mann an Bord sterben 684. Auch Admiral Victor Baptistin Sènès ertrinkt mit all seinen Offizieren. Nur 137 Matrosen überleben in den fünf kleinen Rettungsbooten die Katastrophe. Georg von Trapp stimmt nicht mit in den Jubel seiner kleinen Mannschaft ein. Er weiß, sein Angriff hat Hunderten Seeleuten das Leben gekostet. Es ist Krieg.
Georg von Trapp ist kein skrupelloser Kämpfer, sondern denkt durchaus differenziert über sein „Kriegshandwerk“. So legt er sich selbst in seinen Kriegsmemoiren Bis zum letzten Flaggenschuß folgende Worte in den Mund: „… es ist grauslich unser Handwerk! Wie ein Wegelagerer muss man sich an so ein ahnungsloses Schiff anschleichen, feig aus dem Hinterhalt! Wenn man wenigstens im Schützengraben wäre oder auf einem Torpedoboot, das wäre was anderes! Da hörst du schießen, neben dir fallen Kameraden, Verwundete stöhnen, da kommst du selbst in Wut, aus reiner Abwehr kannst du Leute tot schießen oder aus Angst … aber wir! Einfach kaltblütig aus dem Hinterhalt massenhaft Leute ersäufen!“
Im Buch widerspricht sein zweiter Offizier Hugo Freiherr von Seyffertitz (1885–1966) diesen Worten vehement. Sie selbst könnten ja auch jeden Moment auf eine Mine geraten oder von einem Torpedo getroffen werden. Sogar an „Horchapparaten“ gegen U-Boote werde schon gearbeitet – von Hinterlist könne also keine Rede sein.
Die Versenkung der „Léon Gambetta“ wird auch in der New York Times mit einer Meldung registriert. Das amerikanische Blatt berichtet am 1. Mai 1915 über den Erfolg des österreichischen U-Boot-Kommandanten und zitiert ihn: „Bedauerlicherweise konnte ich bei der Rettung der Schiffbrüchigen nicht helfen.“ Es ist Krieg. Helden fordern Opfer. Und Helden belobigen die eigene Mannschaft. „Die Haltung der Mannschaft, sowohl der Detailführer als auch der übrigen Unteroffiziere, war in jeder Hinsicht mustergültig und über jedes Lob erhaben. Der zweite Offizier Hugo Freiherr von Seyffertitz legte in allen Situationen große Kaltblütigkeit und besonnenes Wesen an den Tag.“
Im Kriegsjahr 1915 werden Helden gemacht: Die „Wiener Bilder“ und andere Blätter berichten ausführlich über den „Erfolg“ Kapitän Trapps. Er bewirbt sich später um den Maria-Theresien-Orden für diese außerordentliche Heldentat.
Zwei Jahre später wird Georg von Trapp Anerkennung für seine Tat verlangen. Er bewirbt sich um die Verleihung des Maria-Theresien-Ordens, die höchste Auszeichnung, die für außerordentliche Heldentaten im Krieg verliehen wird.
Schon am Tag der italienischen Kriegserklärung am 23. Mai 1915 greift die gesamte österreichisch-ungarische Marine italienische Adriahäfen an und beschießt Küstenstädte zwischen Venedig und Barletta. Das Feuer wird aus allen Rohren eröffnet. Hauptangriffsziel ist der Hafen von Ancona, aber auch die Häfen, Brücken und Eisenbahnanlagen in Rimini, Vieste, Manfredonia und Barletta gelten als militärische Ziele und werden von Seeseite aus angegriffen. In Venedig attackiert man nicht das historische Stadtzentrum, sondern das Arsenal, das mit Brandbomben aus der Luft angegriffen wird.
Italiens deutlich größere Kriegsflotte wird überrascht, die Schiffe bleiben in den Häfen. Es gibt so gut wie keine Gegenwehr. Der Einsatz der k. u. k. Marine hat vor allem etwas Symbolhaftes. Der Angriff wird als Strafaktion für den von den Österreichern und Deutschen als „Verrat“ empfundenen Kriegseintritt des einstigen Bundesgenossen auf Seiten der Alliierten erlebt. Das Königreich Italien hat sich dafür von Frankreich und England eine fette Kriegsbeute versprechen lassen. Das Trentino, Südtirol, der österreichische Hafen Triest und weite Teile der dalmatinischen Küste sollen nach dem Krieg an Italien fallen.
Österreichs Marine fehlt es zwischen Bug und Heck an der nötigen Finanzierung und so erfolgt nur zum Teil eine weitere Modernisierung der Flotte. Thronfolger Franz Ferdinand hat zwar eine Neigung zur militärischen Seefahrt und setzt mit dem Bau von Großkampfschiffen, den „Dreadnoughts“, auch beträchtliche Investitionen für die k. u. k. Flotte durch, im Vergleich zu den Rüstungsprogrammen Deutschlands oder Englands bleibt das jedoch bescheiden. Immerhin: Zu Kriegsbeginn verfügt man mit der „Viribus Unitis“, der „Tegetthoff“ und der „Prinz Eugen“ über drei dieser schwer bewaffneten Stahlkolosse, das vierte Schlachtschiff, die „Szent István“, befindet sich noch im Bau. Die habsburgische Marine ist daher keine quantité négligeable. Sie wird als fleet in being während der gesamten Kriegsdauer die lange adriatische Küste sichern und eine Landung der Alliierten verhindern. Aber nicht die gewaltigen Dreadnoughts, sondern die kleinen Unterseeboote beweisen in einer Zeit, in der Unterwasser- Sonare und Radar noch nicht erfunden sind, tödliche Effizienz. Sie stören die Handelsrouten und den Nachschub der viel größeren französischen und italienischen Flotte im Mittelmeer. Die österreichische U-Boot-Flotte operiert fast nur in der Adria, dort aber erfolgreich. Von den 79 gezählten Torpedoattacken auf feindliche Schiffe sind mehr als 90 Prozent erfolgreich. Keine andere Marine erreicht eine solche Trefferquote. Kriegsentscheidend sind diese Flottenerfolge jedoch nicht.
Der Kampf gegen feindliche Handelsschiffe wird im Ersten Weltkrieg noch streng nach einer internationalen „Prisenordnung“ geführt. Das feindliche Schiff muss zunächst durch einen „Schuss vor den Bug“ gestoppt werden. Danach kann das Schiff durchsucht und die Ladepapiere kontrolliert werden. Vorher darf die Besatzung ihr Schiff in den Rettungsbooten verlassen. Schiffe, die einer feindlichen Nation angehören, werden durch Sprengsätze oder Schüsse aus einem Geschütz auf die Wasserlinie versenkt. Torpedos sind sehr teuer und kommen daher relativ selten zum Einsatz. Mit der Versenkung von Handelsschiffen sollen die jeweiligen Nachschubrouten der kriegsführenden Nationen unterbrochen bzw. gestört werden. Handelsschiffe aus „neutralen“ Staaten müssen unbehelligt bleiben, obwohl sie sehr oft illegal kriegswichtige Materialien transportieren.
Georg von Trapp wird ein Leben lang mit Stolz an seine militärischen Erfolge denken. Seine Tochter Maria erinnert sich später in einem für das Fernsehen aufgezeichneten Gespräch an ein ganz besonderes Geschenk: eine silberne Zigarettendose, auf der die Adria dargestellt war. An jeder Stelle, an der der Kapitän einen feindlichen Kreuzer versenkt hatte, prangte ein Schiff.
Nach den ersten Erfolgen der österreichisch-ungarischen Marine versucht die italienische Flotte im Juli 1915 ihre angeknackste Ehre wiederherzustellen. Mit einem groß angelegten Landungsunternehmen wird die strategisch unbedeutende Insel Pelagosa (kroatisch: Palagruza) besetzt. Das Eiland liegt näher an der italienischen als an der dalmatinischen – heute kroatischen – Küste. Wenige Tage später versuchen die Italiener die Bahnanlagen bei Ragusa, dem heutigen Dubrovnik, zu erobern, aber die k. u. k. Küstenverteidiger sind wachsam. Sie attackieren die vier italienischen Panzerkreuzer. Das U-Boot „SM U-4“ versenkt die „Giuseppe Garibaldi“, die nach zwei Volltreffern binnen weniger Minuten untergeht, 53 Besatzungsmitglieder ertrinken, 525 können gerettet werden.
Sechs Wochen nach der italienischen Eroberung von Pelagosa greifen österreichische Marineinfanteristen das Eiland an. In heftigen Kämpfen werden die italienischen Insel-Besatzer vertrieben. Am 5. August 1915 kann auch Linienschiffsleutnant Georg von Trapp wieder einen Erfolg verzeichnen: Im direkten Duell wird von seinem U-5 das italienische U-Boot „Nereide“ versenkt. „5h 13 Position ‚unter Land‘. Italienisches Unterseeboot unter Land gesichtet, zwei Torpedos nacheinander lanciert, feindliches U-Boot versenkt. Rechter Tiefenindikator havariert in 14 Meter Tiefe, Kurs 135. Sechs Seemeilen südlich von Pelagosa aufgetaucht.“ „Keiner gerettet“, vermerkt lapidar der Heeresbericht.
Auch diesen „Seesieg“ reicht Georg von Trapp beim Ordenskapitel des Maria-Theresien-Ordens ein. Die Verleihung lässt auf sich warten. Auch ohne Ritterkreuz zählt der Korvettenkapitän zu den bekanntesten Marineoffizieren des Krieges. Seine Heldentaten werden in den Zeitungen des Landes gebührend gefeiert. Auch die evangelische Kirche schmückt sich mit Georg von Trapp. Und feiert einen Glaubensbruder: „Uns Evangelischen bereitete es eine besondere Freude zu vernehmen, dass der ausgezeichnete Führer von U-5, Linienschiffsleutnant Georg von Trapp, einer treuen protestantischen Familie entstammt, die seinerzeit um des Glaubens Willen ihre Tiroler Heimat verließ.“
Manchmal freilich gebietet es die Vernunft, einen aussichtslosen Kampf zu vermeiden. Tochter Maria erzählt von einer besonders geistesgegenwärtigen Reaktion ihres Vaters: Er ist mit seiner Besatzung auf einem erbeuteten U-Boot unterwegs, auf dem (noch) die französische Flagge aufgemalt ist. Der Kommandant lässt die Mannschaft ein Sonnenbad nehmen. Die Männer liegen mit nacktem Oberkörper an Deck, auch auf der feindlichen Fahne. Plötzlich nähert sich ein französisches Flugzeug. Was tun? Keine Zeit, um die Männer unter Deck zu bringen. Tauchen ist also ausgeschlossen. Wenn die Franzosen nahe genug sind, werden sie die österreichischen Uniformen erkennen und das Feuer eröffnen. Georg von Trapp scheucht die Männer von der feindlichen Flagge weg und lässt sie winken. Der Trick gelingt: Die Franzosen winken freundlich zurück und fliegen weiter. Hätte der Kommandant weniger geistesgegenwärtig reagiert, hätte es ein Blutbad gegeben.
Den Hang zur Seefahrt hat Georg von seinem Vater Johann August von Trapp (1836–1884) „geerbt“. Auch er diente in der österreichischen Kriegsflotte als Fregattenkapitän, ihm wurde 1874 das Kommando über die „SMS Saida“ übertragen. Der junge Kapitän geriet mit diesem Schiff im Mittelmeer in einen entsetzlichen Sturm und konnte die Mannschaft durch ein gewagtes Manöver auf eine Sandbank retten. Für diese Rettung wurde ihm das Eiserne Kreuz dritter Klasse verliehen. Außerdem wurde Johann August Trapp von Kaiser Franz Joseph 1876 in den erblichen Ritterstand erhoben und durfte sich fortan August Johann Ritter von Trapp nennen. Sein ältester Sohn Georg wird diesen Titel erben. Für einen tüchtigen Offizier der k. u. k. Marine war das anno dazumal eine übliche Auszeichnung. Ein höherer Sold war damit freilich nicht verbunden.
Georg wird vier Jahre nach der Adelserhebung seines Vaters am 4. April 1880 in der kroatischen Hafenstadt Zara, heute Zadar, geboren. Seine Mutter Hedwig stammt aus Luthers Geburtsstadt Eisenach und ist wie ihr Mann evangelisch. Georg ist der erstgeborene Sohn und wird – eher unüblich – erst Monate nach seiner Geburt im Oktober 1880 vom Pfarrer und Senior Medicus in der evangelischen Kirche zu Triest getauft. In seinem Geburtsort Zara, ehemals venezianische Provinzhauptstadt, ist wahrscheinlich kein evangelischer Pastor verfügbar. Zara war nach dem Fall der Dogenrepublik 1797 an die Habsburgermonarchie gelangt. Doch Österreich konnte sich nur acht Jahre in der dalmatinischen Stadt behaupten, denn Napoleons Truppen besetzten auch den Westbalkan, den der Kaiser der Franzosen nun zum „Königreich Illyrien“ machte. Ruhm und Erfolg des großen Korsen waren jedoch endlich: 1813 eroberten die Österreicher Zara/Zadar nach einer fünftägigen Beschießung zurück und machten es zur Hauptstadt eines Königreichs Dalmatien. Tatsächlich aber blieb Zadar eine eher bescheidene Garnisonstadt, malerisch an der dalmatinischen Küste gelegen und über regelmäßige Schiffsverbindungen nach Triest auch bequem zu erreichen. Der Kaiser im fernen Wien war fortan auch König von Dalmatien und blieb es bis zum Zerfall der Monarchie im November 1918.
Als Georg vier Jahre alt ist, stirbt sein Vater Johann August an Typhus und Mutter Hedwig zieht mit den drei Kindern Hede, Georg und Werner nach Pola. Sie erhält eine kleine Witwenpension, die ihr ermöglicht, die Kinder auf eine evangelische Volksschule zu schicken. Georgs ältere Schwester Hede wird später als Dichterin, Malerin und Grafikerin selbst zu einiger Berühmtheit gelangen. Sie heiratet einen Freund und Kommilitonen ihres Bruders Georg, der mit diesem die Marineschule besuchte. Die Ehe wird früh geschieden. Hede stirbt im selben Jahr wie ihr Bruder, aber auf einem anderen Kontinent, im niederösterreichischen Korneuburg.
Johann August von Trapp bestimmt posthum die schulische und damit auch gleich die berufliche Karriere seines ältesten Sohns. Georg wird mit vierzehn Jahren in die Marineakademie in Fiume aufgenommen und dort zum Seeoffizier ausgebildet. Neben dem Unterricht in vier Sprachen lernen die jungen Seekadetten all das, was man zu einer Karriere in der Marine braucht: Meteorologie, Ozeanographie, Schiffsbau, Seemanöver, Signalsprachen und weil ein Offizier dem Kaiser keine Schande machen soll, auch „Etiquette“. Die angehenden Seeleute sollen musisch gebildet sein. Zum Fächerkanon Georg von Trapps zählt auch das Erlernen eines Instruments. Georg spielt Geige. Vier Jahre später graduiert der Achtzehnjährige zum „Seekadetten 2. Klasse“ und darf seine erlernten seemännischen Fähigkeiten gleich auf einem alten Segelschiff beweisen. Das Schiff trägt den gleichen Namen wie jenes, das sein Vater einst befehligte und ihm die Erhebung in den Ritterstand einbrachte: Auf der „SMS Saida II“ befährt der Offiziersanwärter die Ozeane und umrundet einmal die Welt.
Georg von Trapp „erbt“ den Hang zur Seefahrt von seinem Vater Johann August von Trapp (1836–1884). Auch er diente in der österreichischen Marine als Fregattenkapitän.
In Kairo schnappt eine Wahrsagerin die Hand des jungen Ritters von Trapp, bevor er sie zurückziehen kann. Sie sagt ihm zwei Ehen und sieben Kinder voraus, womit sie fast richtig liegt. Es ist nicht überliefert, ob sich der junge Mann angesichts des bevorstehenden Kindersegens erfreut gezeigt hat.
Der Ausbruch des Boxeraufstands in China beendet die Weltreise der jungen Seekadetten. Mit Telegramm vom 9. Juni 1899 wird die „SMS Saida II“ heimbefohlen. Der junge Georg schreibt an seine Mutter: „Hurra! Gerade haben wir ein Telegramm erhalten, dass es nach Hause geht. An Bord sieht man nur glückliche Gesichter …“
Seekadett Georg von Trapp hat jedoch nicht viel Gelegenheit, in Pola seine Mutter zu sehen. Der erste militärische Einsatz kommt früher als gedacht. Er wird zum Dienst auf den Kleinen Kreuzer „Zenta“ kommandiert, der Richtung Asien dampft. Dort gerät die Besatzung des Panzerkreuzers in den Strudel des Boxeraufstands. Die Laibacher Zeitung informiert ihre Leser: „Der österreichisch-ungarische Kreuzer ,Zenta‘, der im verwichenen Herbste mit der Bestimmung zu einer 18 bis 20 monatlichen Expedition nach Ostasien aus unserem Kriegshafen Pola auslief, ist infolge der chinesischen Ereignisse bekanntlich ganz unerwartet in eine kriegerische Action gerathen.“
Dabei hatte die Seereise der „Zenta“, die knapp 300 Mann Besatzung an Bord hat, durchaus friedlich begonnen. In japanischen Häfen zeigte das k. u. k. Schiff Flagge und besiegte die Engländer, jedenfalls in einem freundschaftlichen Ruderwettbewerb. In Nagasaki hatten die dalmatinischen Matrosen bei einer internationalen Ruderboots-Regatta „zum ganz besonderem Verdrusse der Engländer mit ihren Booten sämtliche Preise davongetragen“.
Die friedlich begonnene Weltreise des Kreuzers wurde durch einen Hilferuf der internationalen Gesandtschaften in Peking unerwartet zum Kampfeinsatz. Die „Zenta“ sollte den belagerten Diplomaten in Peking zu Hilfe kommen. Die Habsburgermonarchie hatte – anders als die Kolonialmächte England, Frankreich, Russland und auch Deutschland – keine territorialen Ambitionen im Chinesischen Kaiserreich, Kolonien besaß Österreich-Ungarn ohnehin nicht. Die Österreicher sahen im Aufstand der „Boxer“ nur eine Bedrohung ihrer diplomatischen Vertretung und der eher bescheidenen Handelsbeziehungen mit dem großen „Reich der Mitte“. So konnten die Österreicher als quasi „Neutrale“ einschreiten, gerieten jedoch mitten in die Kampfhandlungen. Bei anderen Großmächten waren auch massive politische und wirtschaftliche Interessen bedroht.