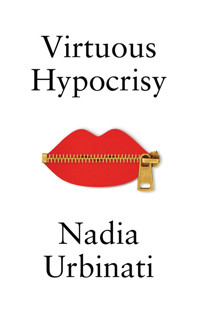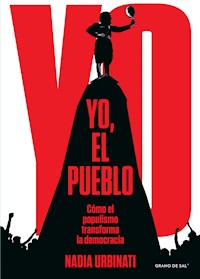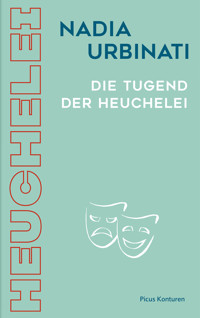
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Picus Konturen
- Sprache: Deutsch
Wer heuchelt, führt andere auf eine falsche Fährte, lässt sie Unwahrheiten glauben, will sie für eigene Zwecke missbrauchen, sagt man. Deswegen wird Heuchelei prinzipiell verurteilt. Weil Gedanken, Worte und Taten nicht übereinstimmen. Dabei ist Heuchelei für eine friedliche, demokratische Gesellschaft unentbehrlich, argumentiert Nadia Urbinati provokant. Denn: Sollen wir wirklich immer sagen, was wir denken? Wissen wir denn überhaupt immer so genau, was wir denken? Sollen wir wirklich andere vor den Kopf stoßen mit unseren momentanen Glaubenssätzen? Wäre es nicht viel besser, unsere Gedanken so zu formulieren, dass sie anderen eine Brücke bauen, das Verbindende vor das Trennende stellen? Wäre es nicht sinnvoll, Vertrauen aufzubauen, bevor wir andere in unsere ungeschminkte Welt einführen? Ohne ein gewisses Maß an freundlichem Entgegenkommen, also zivilisierter Heuchelei, sind, so Urbinatis Schlussfolgerung, weder vertrauensvolle Beziehungen noch Demokratie möglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Picus KonturenHerausgegeben von Georg Hauptfeld
© 2023 Società editrice il Mulino, BolognaTitel der italienischen Originalausgabe:L’ipocrisia virtuosa
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe:Picus Verlag Ges.m.b.H.Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 [email protected] Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Buntspecht, WienISBN 978-3-7117-3500-3eISBN 978-3-7117-5531-5
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
NADIA URBINATI
DIE TUGENDDER HEUCHELEI
Aus dem Italienischen vonFederica RomaniniundGeorg Hauptfeld
PICUS VERLAG WIEN
INHALT
EINLEITUNGSAGEN, WAS MAN DENKT – UND ZWAR IMMER?
1. WER IST HEUCHLERISCH UND WER IST ES NICHT?
2. LÜGE UND HEUCHELEI
3. EIGENINTERESSE UND VORURTEIL
4. HEUCHELEI VERSUS TOTALITARISMUS
1.ZWISCHEN ERDE, HIMMEL UND THEATER: EINE SEHR KURZE BEGRIFFSGESCHICHTE DER HEUCHELEI
1. THEATER UND RHETORIK
2. SÜNDE UND VERLOGENHEIT
3. DAS EVANGELIUM
4. IDENTITÄT UND KONFORMISMUS
5. DUALISMUS
6. NEUERE GESCHICHTE
2.PLURALISMUS UND TOLERANZ
1. WANN TRITT DIE MODERNE HEUCHELEI IN ERSCHEINUNG?
2. DIE EINTRACHT IN DER ANTIKE
3. DIE TOLERANZ VOR DER LIBERALEN TOLERANZ
4. MEINUNGSSTREIT ODER SPALTUNG?
5. DIALOG UND REDEKUNST
6. VON KENTAUREN UND CHIMÄREN
7. UMSICHT UND AUSGLEICH
8. KRIEG, WAFFENRUHE UND NEUE EINTRACHT
9. DER WEG ZUR LIBERALEN TOLERANZ
10. EINE SCHWIERIGE BEZIEHUNG
3.HEUCHLERISCHE HALTUNG
1. LICHT UND DUNKEL
2. PERSON, NICHT SCHAUSPIELER
3. DER STAAT HEUCHELT NICHT
4. DIE »ENGE DER BÜRGERSTUBE«
5. AUF DER SUCHE NACH DER TUGEND
6. DIE MÜHEN DES LIBERALISMUS
4.VERSPRECHEN, DIE (OFT) NICHT EINGEHALTEN WERDEN
1. LIBERALE, SOZIALISTEN UND KONSERVATIVE
2. ÖFFENTLICHKEIT UND ZWIELICHT
3. DAS LASTER DER POLITIKER:INNEN
4. ZWECKMÄSSIGE TUGENDHAFTIGKEIT
5.POLITISCHE KORREKTHEIT
1. WEM WIRD SCHADEN ZUGEFÜGT?
2. DIE NEUE ETIKETTE
3. MENSCHLICHE VERWUNDBARKEIT
4. DIE ERSTE STUFE: EIN SCHLUSS, DER EIN ANFANG IST
LITERATUR
DIE AUTORIN
Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
PAULUS VON TARSUS
Die Heuchelei ist die Huldigung, die das Laster der Tugend darbringt.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Ihr überschätzt die Heuchelei der Menschen. Die meisten denken zu wenig, um doppelsinnig zu denken.
MARGUERITE YOURCENAR
EINLEITUNGSAGEN, WAS MAN DENKT – UND ZWAR IMMER?
Sagen, was man denkt, und zwar immer. So lautet das Gebot der Authentizität, das die Heuchelei infrage stellt – als absichtlichen Widerspruch zwischen Gedanken und Äußerungen, und deshalb wird sie verurteilt. Heuchler:innen erscheinen demnach als stille (wenngleich nicht revolutionäre) Saboteur:innen der moralischen Ordnung, die heimlich die Grundlage gegenseitigen Vertrauens aushöhlen. In der Tat, wie soll man noch jemandem glauben, der andere der Heuchelei bezichtigt, wenn die Heuchelei zur Norm wird? Und wie kann man sichergehen, dass jemand, der vorgibt, ein:e Freund:in zu sein, auch eine:r ist?
1. WER IST HEUCHLERISCH UND WER IST ES NICHT?
Ohne Vertrauen gibt es keine Gesellschaft, keine Freundschaft und keine Liebe: »Heuchelei ist gefährlich (…), weil sie Vertrauen und Loyalität gegenüber den moralischen Werten (Freundschaft, Liebe und Glauben) in ihrer Gesamtheit untergräbt.«1 Gesellschaft, Freundschaft und Liebe kann es jedoch ohne ein gewisses Maß an tugendhafter Heuchelei nicht geben. Die Frage stellt sich daher nicht im Sinne einer Entweder-oder-Entscheidung: annehmen oder ablehnen, rechtfertigen oder verurteilen. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, in welchen Bereichen und innerhalb welcher Grenzen Heuchelei gerechtfertigt ist.
Eine uneingeschränkt authentische und eindimensionale Gesellschaft (ich nenne sie Uni-versum im ursprünglichen Sinn einer »lückenlosen Totalität«) würde die denkbar schlechtesten Lebensbedingungen bieten, weil ihre strikten Normen und Grundsätze unausweichlich mit Grausamkeit einhergehen würden. In einer solchen Gesellschaft wäre Heuchelei nicht länger das Ergebnis wohlüberlegter Entscheidungen, sondern eine systematisch angewandte Strategie des Selbstschutzes. Die Angst vor Verfolgung und davor, zum Ziel von Diskriminierung und Gewalt zu werden, würde dazu führen, dass Heuchelei einerseits zu einer allgegenwärtigen, unbeherrschbaren Erscheinung wird, und dass sie andererseits in Verlogenheit und Lüge umschlägt – zwei mit ihr zusammenhängende und doch eigenständige Phänomene. Die grausamsten Inquisitoren bezeichneten sich als Erzfeinde der Heuchelei und doch lebten sie geradezu von ihr (sofern sie überleben wollten). Galileo Galileis Widerruf der eigenen Lehre sollte nicht als Heuchelei, sondern als aus der Not geborene Doppelzüngigkeit ausgelegt werden – der Schrecken nimmt der Heuchelei die Spitze. Auch die politische Freiheit als »Ruhe des Gemüts« (die Montesquieu im Herzen einer gemäßigten Regierung verortete) und als rechtlich geschütztes Gut kann Anlass zur Heuchelei geben, diesmal jedoch als »Huldigung des Lasters an die Tugend«.
Gegenstand dieses Buches ist das »doppelsinnige Denken« als freie Wahl und nicht als erzwungene Handlung. Das Buch versteht sich keineswegs als Lob der Heuchelei (wäre das nicht heuchlerisch?), sondern als Versuch, alte und moderne Spielarten der Heuchelei aufzuzeigen, um folgende Hypothese zu überprüfen: In einer Gesellschaft, die auf gegenseitigem Respekt beruht, sollten Menschen in der Lage sein, ein gewisses Maß an Heuchelei an den Tag zu legen; sie sollten zugleich begreifen, dass das Streben nach Authentizität, sei es bei Prinzipien oder in Glaubenssachen, nicht immer der beste Verbündete jener ist, die Prinzipien haben und im Glauben leben. Die Heuchelei kann demnach ebenso Kontrollinstrument wie auch eine Art Schutzschild gegen die Kontrolle sein. In diesem Dualismus spiegelt sich die Verletzlichkeit des Menschen wider.
Im Unterschied zur Lüge geht es bei der Heuchelei nicht um die Frage nach der Übereinstimmung mit der Wahrheit, sondern um einen Stil des Diskurses, eine kontextbezogene Aufhebung der Entsprechung zwischen dem, was wir sagen, und dem, woran wir glauben oder was wir in dem Augenblick im Sinn haben. Die Heuchelei ist ein performativer Akt: Sie betrifft das Was und das Wie unserer Äußerung (Sprechen ist eine Handlung, die Gefühle und Emotionen, nicht nur den Verstand berührt) im Verhältnis zu dem, was wir sagen könnten oder gerne sagen würden. Die Entscheidung, lieber zu schweigen oder nicht genau zu sagen, was wir denken oder gerne sagen möchten, ist schwierig – vor allem für den Sprechenden selbst.
Ich möchte dies anhand von zwei Beispielen aus dem Alltag veranschaulichen.
Erstes Beispiel: Ich nehme an einem Abendessen bei Freund:innen teil. Unter den Gästen sind Personen, die ich bereits kenne, und andere, die ich zum ersten Mal sehe. Im Laufe des Abends entspinnt sich ein Gespräch über ein etwas polarisierendes Thema, das problemlos mit Kompromissbereitschaft und gegenseitiger Nachsicht abgehandelt werden könnte. Im Zuge des Gesprächs vertreten einige Gäste Meinungen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Während ich mich mehr und mehr in die Diskussion einbringe, vernehme ich eine Stimme in mir, die mir rät, es gut sein zu lassen und meine Meinung gar nicht oder – wenn es nicht anders geht – möglichst behutsam zu äußern. Doch mein polemisches Temperament lässt mich alle Vorsicht außer Acht lassen und ich sage schließlich genau das, was ich denke, und zwar so, wie es meinen starken Überzeugungen am besten entspricht. Es entsteht eine hitzige Diskussion, die niemanden unberührt lässt (schon gar nicht mich selbst).
Auf dem Heimweg mit einem Freund gestehe ich, ich hätte den Vorfall als unangenehm empfunden und würde es nun bereuen, die Kontrolle verloren zu haben. Ich hätte ja auch schweigen oder meinen Standpunkt umsichtiger formulieren können. Das Kippen der ausgelassenen Stimmung, die im weiteren Verlauf des Abends bis zum Abschied nicht wieder hergestellt werden konnte, hätte Gastgeber und Gäste in Verlegenheit gebracht. »Ich denke, dass du sehr gut daran getan hast, deine Meinung offen zu sagen«, erwidert der Freund. »Es lag nämlich an den anderen, ihre Position zu verteidigen, und nicht an dir, auf ihre Empfindlichkeit Rücksicht zu nehmen. Wärst du etwa lieber heuchlerisch gewesen?« Nun, diese Aussage enthält den Kern der Frage nach der Heuchelei, mit der ich mich auseinandersetzen möchte. Meine Frage fällt in den Bereich der civility (ich verwende diesen Begriff auf Englisch, da die deutsche Entsprechung – Zivilisiertheit – allzu prätentiös klingt – am nächsten kommt ihm der Begriff »Höflichkeit«). Es geht dabei auch um die individuelle Persönlichkeit, um Aspekte der Erziehung und der Bildung einer zweiten Natur (der mores).
Zweites Beispiel: Als ich ein junges Mädchen war, hielt mir meine Mutter vor, ich würde zu Unbekannten freundlicher sein als zu ihr selbst oder anderen Familienmitgliedern. War ihr Vorwurf eine Aufforderung dazu, ehrlich zu sein, oder meinte sie damit etwa, ich solle mich zu Hause benehmen wie auswärts? Diese Frage ist alles andere als rhetorisch, denn beim Vorwurf des Doppelstandards müsste man klarstellen, welchem der beiden Standards man denn nun zu folgen habe. Die guten Manieren, so viel konnte ich den Rügen meiner Mutter entnehmen, sollten nicht bloß »gute Manieren« sein, sondern der äußere Ausdruck einer inneren Absicht; meine Charakterstärke, so meinte meine Mutter, solle mir eine Stütze sein und mich keineswegs zum Kompromiss mit meinem Umfeld und den jeweiligen Umständen verleiten. Meine Mutter hielt mich also nicht dazu an, mich gegenüber Familienangehörigen so zu benehmen wie gegenüber Fremden, sondern strikt ich selbst zu sein. Sie verlangte mir geradezu Heldenhaftes ab. Aus ihrer Sicht sollte ich das Leben als ständigen Kampf begreifen, der keinen Raum ließ für Zweckmäßigkeitserwägungen.
Aus diesen beiden alltäglichen Beispielen ließe sich schließen, dass Authentizität im Grunde egoistisch ist und Heuchelei deren Korrektur darstellt – eine Art »wohlgemeinter Egoismus« also, um Alexis de Tocquevilles Definition der bürgerlichen Ethik zu bemühen.
Die Heuchelei erscheint in den angeführten Beispielen als so etwas wie eine Verletzung, die sowohl der individuellen Authentizität als auch der Gesellschaft zugefügt wird – dieser würden Leidenschaft und das Streben nach Perfektion genommen werden, die wichtige Bestandteile der Erziehung zur Authentizität sind.
Man selbst zu sein, auch auf die Gefahr hin, andere zu kränken, und die eigene Seele zu bewahren, selbst wenn das bedeutet, andere der Härte unserer Authentizität auszusetzen: Das sind die beiden moralischen Imperative all jener, die jede Art von Heuchelei bekämpfen. Die strenge Übereinstimmung von Sagen und Denken setzt voraus, dass man sich – bildlich gesprochen – nie »auf die Zunge beißen muss«, bevor man spricht.
Als ich einer Freundin und ausgezeichneten Historikerin mit Schwerpunkt Reformationsgeschichte von meinem Buchprojekt erzählte, meinte sie, das Bedürfnis, »sich auf die Zunge zu beißen«, sei durch nichts zu rechtfertigen. Anderen Menschen gebühre unser Respekt, so ihre Einstellung, jemand, der nicht anders könne, als »sich auf die Zunge zu beißen«, müsse moralisch verwerfliche Gedanken hegen. Heuchelei sei also nicht zu rechtfertigen und das Eingestehen von Schwäche. Und doch kann die Heuchelei, gerade indem sie das Bestehen einer Schwäche einräumt, eine erzieherische Wirkung entfalten und dem Zusammenleben einen guten Dienst erweisen.
Kinder werden dazu erzogen, »Bitte« und »Danke« zu sagen. Fragen die Kleinen, warum sie sich an diese Regel zu halten haben, antwortet man ihnen: »Weil es sich gehört.« Punkt. Der erste Schritt in der Erziehung zur Höflichkeit ist also einer zur Heuchelei: Benimmregeln zu beherzigen, sie von Kind auf einzuüben und gute Manieren zu entwickeln.
Andererseits ist nicht zu leugnen, dass jede Form von moralischer oder ideologischer Strenge der Entstehung ebenso wie der Verurteilung der Heuchelei vorangeht: Je mehr wir uns auf ein strenges, dogmatisches Regelwerk verlassen, umso schwieriger wird die Entscheidung darüber, welche Vorgaben wir als unantastbar zu betrachten haben und welche wir lockerer auslegen dürfen, um mit unserer Umwelt zurechtzukommen. Im Zuge einer solchen Abwägung (die fast immer vom Bedürfnis nach einem friedlichen Leben motiviert ist) macht die Strenge Platz für Heuchelei.
Hat also die Reinheit des Herzens Vorrang vor der civility?Würden wir behaupten, dass Unnachgiebigkeit wichtiger ist als gute zwischenmenschliche Beziehungen, die ihrerseits Grundlage für ein respektvolles Miteinander sind? Sollen wir unserer Nachbarin, die nicht nach unseren Vorstellungen lebt, den Krieg erklären oder vielmehr versuchen, einen höflichen Umgang mit ihr zu pflegen? Erfordert Höflichkeit, dass wir auch Dinge akzeptieren, mit denen wir nicht einverstanden sind? Kurzum, hat Heuchelei mit der Wahrheit zu tun oder stellt sie vielmehr eine Verhaltensweise dar, die auf ein friedvolles Miteinander abzielt? In diesem Buch werde ich die Heuchelei als Verhaltensweise, als Modus Operandi betrachten, der keinen Verzicht auf die eigene Meinung erfordert. Andere zu respektieren, ist nicht gleichbedeutend damit, ihr Weltbild zu teilen. »Respektvoll handeln und den eigenen Weg gehen«: So lautet die Maxime der tugendhaften Heuchelei. Gemeint ist die Einübung in die Kunst, bestimmte Lebensbereiche voneinander getrennt zu halten und dabei – in einem Balanceakt – weder sich selbst noch anderen Schaden zuzufügen. Es handelt sich um eine unvollkommene und doch anspruchsvolle Verhaltensweise, die durch die gelebte Praxis des Rechtswesens gefördert werden kann. Dieses bewahrt uns nämlich vor der Gefahr systemischer Heuchelei und lehrt uns zugleich, andere zu respektieren. Heuchelei allein reicht also nicht aus. Sie ist vielmehr ein erster, unerlässlicher Schritt, um von der Intoleranz zur Akzeptanz einer Pluralität von Weltanschauungen und Lebensweisen überzugehen – Akzeptanz, die ihrerseits Voraussetzung ist, um unser Verhalten nach dem Grundsatz des Respekts und der Anerkennung anderer Menschen auszurichten.
Das Rechtswesen unterstützt uns bei dieser Aufgabe, die durch Willensanstrengung allein kaum zu bewältigen wäre, denn das Ergebnis würde sich als ungewiss und unbeständig erweisen. Andere zu achten bedeutet, sowohl ihre als auch meine eigenen Rechte und daher die gemeinsame Freiheit anzuerkennen, nach eigenen Vorstellungen und in gegenseitigem Respekt zu leben. Gegenseitiger Respekt ist die Quelle der inneren Ruhe, die wir benötigen, um uns frei zu fühlen. Wir können nun einen Schritt weitergehen und festhalten, dass Rechte zwei Seiten haben: Eine zeigt auf die Adressaten unserer potenziellen Intoleranz, die andere auf uns selbst. Die Rechte prägen Beziehungen, die auf Geben und Nehmen, auf Kommunikation und Austausch beruhen.
Die vom Rechtssystem herbeigeführte soziale Befriedung ist weder vollständig noch schmerzlos und die Heuchelei bietet dabei einen verlässlichen Gradmesser für ihre Beständigkeit.
Es gibt Menschen, die großen Wert auf harmonische Beziehungen legen (besonders in einem sozial durchmischten Umfeld aus Freund:innen, Bekannten und Fremden, wobei auch freundschaftliche und familiäre Beziehungen Anlass zur Heuchelei geben können), und es gibt wiederum Menschen, denen Authentizität und Transparenz am wichtigsten sind. Die einen versuchen zu kontextualisieren, die anderen tun es nicht. Es gibt Themen und Situationen, die keine Diplomatie zulassen (etwa Fälle von Unterdrückung, Machtmissbrauch, ideologischer Intoleranz und Gewalt), und es gibt Umstände, in denen die Rücksicht auf fremde Gefühle und somit Höflichkeit Vorrang haben, sodass unser Streben nach Aufrichtigkeit uns selbst gegenüber und die Authentizität in den Hintergrund treten. Anders als man annehmen könnte, sind Menschen, die sich einer Situation anpassen, weniger egozentrisch als andere.
Man könnte einwenden, dass selbst eine kompromisslos handelnde Person sich nicht zu einer Ethik strenger Kohärenz bekennt – selbst jemand, der es für richtig hält, immer zu sagen, was er denkt, wird letztlich fremde Meinungen beachten. Parrhesie ist zwar freimütige Rede, aber nicht gleichbedeutend mit absoluter Aufrichtigkeit. Wer meint, man solle die eigene Meinung immer unumwunden äußern, gesteht jedem von uns das Recht zu, die eigene Meinung jederzeit und unter allen Umständen durchzusetzen. Es ist daher unrichtig, dass Gegner:innen der Heuchelei nur die Kohärenz mit sich selbst im Sinn hätten, denn selbst sie achten unvermeidlich auch auf fremde Meinungen – etwa wenn sie von anderen als Menschen »aus einem Guss« wahrgenommen werden möchten, die »sich nicht auf die Zunge beißen«.
Der Freund, der mein ehrliches Verhalten so geschätzt hatte, legte großen Wert auf sein eigenes Ansehen. Auch er trug eine Maske, die er bewahren und »inszenieren« wollte. Die eigene Reputation ist in der Tat auch für jene ein wichtiges Ziel, die sie der Authentizität gegenüberstellen.
In unserer Gesellschaft, in der die Sichtbarkeit des Einzelnen – nicht zuletzt aufgrund der neuen Technologien – zugenommen hat, hat auch das soziale Ansehen an Bedeutung gewonnen, sodass unsere Aufmerksamkeit stets zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung hin und her pendelt. Zwischen diesen beiden Impulsen spielen sich, im Sinne Jean-Jacques Rousseaus, die existenziellen und gesellschaftlichen Anstrengungen jedes Einzelnen von uns ab. Der soziale Ruf, der Wunsch nach Anerkennung, ist der wichtigste Ansporn des Homo comparativus (nach Gloria Origgis Definition). Er bildet den Rahmen, in dem unsere Erkenntnisse und Kompetenzen reifen und in dem Fragen des Geschmacks (ästhetische und kulturelle Werte) und des Konsumverhaltens (ökonomischer Wohlstand) verhandelt werden.
Wer ist also heuchlerisch und wer nicht? Genügt es zu sagen, heuchlerisch seien diejenigen, die nicht immer sagen, was sie denken? Sollte man nicht hinzufügen, dass sich Heuchelei auch dort einnisten kann, wo jemand die eigene Geradlinigkeit zur Schau stellt? Hier wird deutlich, dass unser Interesse nicht nur der Beziehung zwischen Sagen und Denken gilt, sondern auch dem eben angesprochenen »Zur-Schau-Stellen« der eigenen Person. Die Analogie mit dem Theater ist, wie wir im ersten Kapitel sehen werden, Kern und Ausgangspunkt meiner Untersuchung. Wenn das Fremdbild der Prüfstein ist, dann erscheint es nachvollziehbar, dass selbst die Behauptung der eigenen Authentizität im Dienst der Heuchelei stehen kann. Die Frage ist daher komplexer und spannender, als es den Anschein hat, wenn man sich auf die bloße Übereinstimmung von Sagen und Denken beschränkt.
Die Heuchelei gehört in den Bereich des öffentlichen Handelns, wobei die Art der Öffentlichkeit, die jeweilige Dosierung und die Rolle, die man dort einnimmt, unterschiedlich sein können. Gesellschaftliche Beziehungen sind zivilisiert, also durch civility geprägt, weil Menschen (wie Marguerite Yourcenar sagen würde) des »doppelsinnigen Denkens« fähig sind und weil sie das Sagen (das ein Handeln ist) an der Reaktion anderer Menschen messen – einer oft indirekten Reaktion aus Blicken und Gesichtsausdrücken, in denen sich die Wertschätzung des Gegenübers offenbart. Heuchelei zeugt in diesem Zusammenhang von Reife und Autonomie; sie zeigt unser Vermögen, mit Gegensätzen friedlich umzugehen. Heuchlerisches Verhalten ist im Grunde das, was uns zu einem guten Maß an Autonomie verhilft. Im Eifer, jede Form von Heuchelei zu verurteilen, übersehen oder unterschätzen wir oft diesen Vorzug. Wie wir im vierten Kapitel sehen werden, verurteilen wir gerne Politiker:innen, die »Wasser predigen und Wein trinken«, unterschätzen aber genauso oft, dass dieses Verhalten nicht selten davon herrührt, dass sie sich ständig dem Urteil der öffentlichen Meinung ausgesetzt sehen.
Die Heuchelei setzt eine reife Gesellschaft voraus und festigt sie. Sie trägt zu einem öffentlichen Leben bei, in dem Angst vor Willkür und körperlicher Gewalt weitgehend ausgemerzt und in dem starre ideologische und dogmatische Konstrukte (ob religiöser oder nicht religiöser Prägung) überwunden worden sind. Heuchelei im Sinne der civility ist eine liberale Tugend; wie wir im dritten Kapitel sehen werden, ist sie ein Beweis für das Vorhandensein von Grundfreiheiten; tugendhafte Heuchelei ist nämlich schlicht undenkbar in einer Gesellschaft, die nicht über rechtliche und ethisch-politische Grundfesten verfügt, die es Menschen erlauben, Authentizität und kontextbezogene Kompromissbereitschaft bewusst gegeneinander abzuwägen.