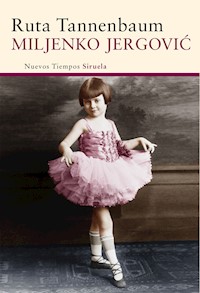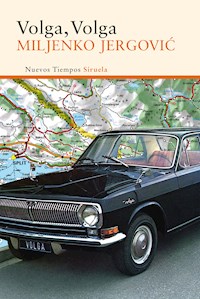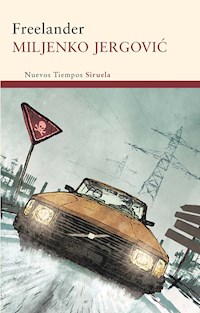16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Weil in jeder Familiengeschichte alles Wichtige der Weltgeschichte steckt", hat Miljenko Jergovic sich auf die Spuren seiner Familie begeben. Als seine Mutter, zu der er kein einfaches Verhältnis hat, im Sterben liegt, reist er nach Sarajevo und bringt sie zum Erzählen über die Vorfahren. Dort, wo jede Straße ihn in die Vergangenheit seiner traumatisierten Heimat führt, setzt er sich in einem schmerzlichen Prozess mit ihrem Erbe auseinander: Kinder des einstigen Habsburgerreichs, waren sie als Eisenbahner Zugereiste, und jeder Krieg stellte ihre Identitäten und Loyalitäten neu auf die Probe.Das Gefühl von Fremdheit ist dem großen europäischen Erzähler Miljenko Jergovic geblieben, auch wenn er sich an den Konflikten der Gegenwart auf seine Weise reibt. Fakten mit Fiktion vermischend und in konzentrischen Kreisen erzählend, zeigt er in diesem großen Weltentwurf, was das Leben in einem Vielvölkerstaat für den Einzelnen bedeutet, vor allem wenn er nicht zur Mehrheit gehört, sondern zu den "Anderen"."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1597
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Da, wo andere Menschen wohnen (Vortrag)
DIE STUBLERS (Roman)
Kennen Sie Regina Dragnev?
So sahen wir am ersten Kriegstag aus
Josip Sigmund möge euch auf der Seele liegen
Unter den Füßen leuchten sonnengelbe Dielen
Ivo Baškarad und der ewige Mujo
Omama Johannas Herzfehler
Iss, sonst versohl ich dir den Hintern
Der lange Brief des Michail Fleginski
Hast du über Boras nachgedacht?
Unsere geliebten Bienen
Maria Brana und Wassilj Nikolajewitsch
Pilzgebet oder Vom Nutzen des Wissens
Balijans Sommerhaus
Die Beichte vor dem Sakrament der Ehe
Deutsche in Sarajevo
Leben und Mieter der Frau Emilia Heim
Das ist rote Tanne
Das Grab in Donji Andrijevci
KUMPEL, SCHMIEDE, TRINKER UND DEREN FRAUEN (Quartette)
Tante Jela und Kljujić Šumonjas Nachfahren
Eine kurze Geschichte der Familie Karivan
Mutter, scher dich zum Teufel
Stric oder Amidža
Verräterische Erzählungen
Wir sind Gott sei Dank Katholiken
Schlachttag in der Kolonie
MAMA IONESCO (Reportage)
2. Dezember 2012, Pula, Forum
INVENTAR
Kakanien
Der Weg durch Verzweiflung und Wut
Weihnachten in Zenica
Olgas Zehra
Die Frančićs, Joža und Mutz
Erwin und Munevera
Die Kroatin
Hunger, bunte Steinchen
Mutter hilft Swjatoslaw Richter ins Boot nach Lokrum
Kofferkinder
Zuhause
Mejtaš, Ortsbeschreibung
Sepetarevac, bergan
Zatikuša, das vergessene Sträßchen
Der Große Park
Marschall-Tito-Straße, Traum und Erinnerung
Die Straße, in der Familie Focht wohnte, oder: Das Ende der Kunst
Christi-Verklärung-Kirche, Geschichte eines Albtraums
Zwei Friedhöfe
Im Frühling, wenn wir die Gräber lüften
Tante Finka auf Sankt Michael
188 Laternen
Über eins meiner Gedichte
KALENDER ALLTÄGLICHER VORFÄLLE (Fiction)
Weihnachten mit Koltschak
Zündholzjongleur, Furtwängler
Tagebuch der Bienen
Parker 51
Die Hunde von Sarajevo
DIE GESCHICHTE, FOTOGRAFIEN
Zitatnachweis
Autorenporträt
Übersetzerportrait
Über das Buch
Impressum
Da, wo andere Menschen wohnenVortrag
Vater, zwei Onkel und ich haben dasselbe Sarajever Gymnasium besucht.
Vor dem Zweiten Weltkrieg, in deren Schulzeit, hieß es umgangssprachlich Großes Gymnasium und offiziell Erstes Knaben-Real-Gymnasium, nach dem Krieg und der Abschaffung von Mädchen- und Knabenschulen schlicht Erstes Gymnasium. 1984, kurz vor meiner Matura, wurde es ein drittes Mal umbenannt und hieß fortan Helden und Revolutionäre des Ersten Gymnasiums. Während der Belagerung bekam es den alten Namen zurück, heißt seither wieder Erstes Gymnasium.
Der ältere meiner Onkel wechselte 1934, fast fünfzig Jahre vor mir, auf die weiterführende Schule, aber die Möbel blieben dieselben. Das fiel meiner Großmutter auf, die bei ihm wie bei mir die Elternabende besuchte. Der jüngere Onkel und mein Vater, die fünf, sechs Jahre später eingeschult wurden, hatten beim gleichen Lehrer Kunstgeschichte wie ich. Er starb, als ich in die sechste Klasse kam; wir drei waren gemeinsam bei der Beerdigung.
Gegründet wurde das Erste Gymnasium in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts als Eliteschule. Auch Ivo Andrić, der bosnische Schriftsteller und Nobelpreisträger, machte hier seinen Abschluss, allerdings mit großer Mühe und Pein, er selbst erzählt mit Abscheu und einem gewissen Ekel davon. Wahrscheinlich deswegen fiel sein Name nie bei feierlichen Anlässen, wenn der Direktor sämtliche berühmten Absolventen aufzählte. In meiner Schulzeit waren kommunistische Revolutionäre sowie die Attentäter auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger die größten Berühmtheiten. Gavrilo Princip, der die Kugeln auf Franz Ferdinand und dessen schwangere Frau abfeuerte, ging in Belgrad zur Schule, also nicht aufs Erste Gymnasium, wohl aber einige aus dem engsten Kreis um ihn herum.
Die Lehrer sagten oft, wir sollten uns an diesen leuchtenden Vorbildern ein Beispiel nehmen. In unserer sozialistischen Gesellschaft gab man viel auf leuchtende Vorbilder. Dazu zählten unter anderem opferbereite, heldenhafte Eltern, Onkel und Tanten.
Mein Vater zum Beispiel war ein ausgezeichneter Schüler, einer der besseren seines Jahrgangs, ebenso der jüngere Onkel mütterlicherseits, Repräsentant der jugoslawischen Metallbranche in der Sowjetunion, ein Mann von Welt. Beide wurden mir oft als Vorbilder genannt. Der Name des älteren Onkels fiel nie, er war trotz noch besserer Schulnoten kein leuchtendes Vorbild. Über solche wie ihn wurde nicht geredet, es gab sie in fast allen bürgerlichen Familien Jugoslawiens. Wie im Märchen: Einer von drei Söhnen ist kein leuchtendes Vorbild.
Der ältere Onkel hatte ausschließlich Einsen, korrespondierte mit ausländischen Freunden auf Lateinisch, löste unlösbare mathematische Aufgaben, spielte Gitarre und verfasste einen Essay über Paul Valéry. Blond und blauäugig, schlank und feingliedrig, sieht er auf Fotos wie ein junger Aristokrat in Thomas-Mann-Romanen aus, der kurz vor Ende des Buches stirbt, an Meningitis oder weil sich eine Kaverne in der Lunge öffnet, und dessen Tod für das Schicksal einer ganzen Familie oder Generation steht. Bitte sehr – so sah mein älterer Onkel mütterlicherseits aus, ansonsten hat er nichts mit einer Figur von Thomas Mann gemein, außer dass ich ihm gern auf den Stein seines vermutlich längst abgeräumten Grabes die Worte gravieren lassen würde, mit denen Serenus Zeitblom seinen Freund, den Tonsetzer Adrian Leverkühn, verabschiedet: Ein einsamer alter Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland.
Wobei ich nicht mit letzter Sicherheit wissen kann, was Vaterland meinem älteren Onkel bedeutete. Ich weiß nur, dass ich selbst kein Vaterland habe. Also letztlich weiß ich nicht recht, was der Spruch auf einem abgeräumten Grab soll.
Folgendes dürfte für seinen Begriff von Vaterland konstitutiv gewesen sein: Geboren in Usora, einer Kleinstadt in Zentralbosnien, wo sein Vater, mein Großvater, einige Jahre als Bahnhofsvorsteher arbeitete, aufgewachsen entlang österreichisch-ungarischer Gleise, mehrfach umgezogen, immer wieder neue Freunde; vom Vater, einem gebürtigen Slowenen, lernte er Slowenisch, von der Mutter Kroatisch, aber seine ersten Worte waren deutsch, denn sein Großvater, mein Urgroßvater, war ein Banater Schwabe aus einem Nest, das heute in Rumänien liegt. Auch er, ein hoher Eisenbahnbeamter, verbrachte nach Schule und Ausbildung in Vršac, Budapest und Wien sein gesamtes Berufsleben entlang bosnischer Gleise.
Damit dürfte eins klar geworden sein: Mein älterer Onkel mütterlicherseits – auch sein Name sei genannt: Mladen, denn wenn wir ohne Namen weitermachen, wird es konfus – lebte in einer schwer durchschaubaren und sprachlich vielschichtigen Umgebung. Wie verworren und schicksalhaft, wird sich noch zeigen. Mladens Großvater, Karlo, war ein nationalbewusster Deutscher, der bis zu seinem Tod mit seinen vier Kindern ausschließlich Deutsch redete. Niemals richtete er ein kroatisches Wort an sie. Mit den Schwiegersöhnen, zwei Kroaten sowie Mladens slowenischem Vater, die alle drei perfekt Deutsch konnten, sprach er Kroatisch, mit den Enkeln Kroatisch oder Deutsch, aber sie mussten ihn zunächst auf Deutsch anreden. Begrüßten sie ihn auf Kroatisch, stellte sich Opapa taub.
Den Erzählungen nach muten die sonntäglichen Mittagessen, bei denen die Großfamilie zusammenkam, seltsam an. Eine derart strenge Sprachregelung existiert heute vermutlich nur noch in den Gremien der Europäischen Union, aber damals hat sie keiner hinterfragt. Urgroßvater Karlo legte überaus großen Wert auf sein Deutschtum und seine Auserwähltheit als Deutscher, dem mussten sich alle fügen. Aber keiner, er am wenigsten, verbot ihnen zu sein, was sie waren, untereinander konnten sie reden, wie sie wollten. Urgroßvater liebte seine Schwiegersöhne, war, vornehmlich wegen ihrer Berufe, stolz auf sie und störte sich kein bisschen daran, dass sie keine Deutschen waren. Die Eisenbahnerzunft war wie ein Geheimbund oder eine Freimaurerloge, wer ihr angehörte, sah die Welt sowie die eigene Rolle in der Welt anders als gewöhnliche Zeitgenossen. Der deutsche Eisenbahner war dem kroatischen Eisenbahner brüderlich und damit enger als einem Landsmann verbunden. Urgroßvater Karlo stand politisch links, wurde Anfang der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts inhaftiert und außer Dienst gestellt, weil er einen Eisenbahnerstreik unterstützt hatte – was niemanden gestört hätte, wäre er nicht der deutsche Bahnhofsvorsteher unter den wilden Slawen gewesen. So aber bestrafte ihn die königliche Verwaltung hart: Er hatte seiner Volks- und Kastenzugehörigkeit zuwider gehandelt.
Zu Hause wurde nicht über ideologische Fragen geredet. Es sei denn, man würde das familiäre Erziehungsideal, dass alle Menschen unabhängig von Glauben und Vermögensstand gleiche Rechte haben, ideologisch nennen. Bosnien, in jenen zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein armes Land mit neunzig Prozent Analphabeten, in dem eine Typhus- oder Choleraepidemie die nächste jagte und die endemische Syphilis ohne Unterlass wütete, dieses Bosnien war für Urgroßvater Karlo und die Seinen ein guter Ort zum Leben. Nie äußerte er den Wunsch, zurück ins Banat zu ziehen, nach Wien oder Deutschland. Obwohl Deutscher, war ihm Deutschland fremd. Dort könne er nicht leben, sagte er: Die Leute sind anders. Ich persönlich wüsste keine genauere Definition von dem, was nicht Heimat ist.
Onkel Mladen hing an seinem Opa mehr als die anderen Enkel, obwohl er ihm nicht ähnlich sah. Der alte Karlo war ein kleiner, stämmiger Mann mit dunklem Haarschopf und langem grauen Bart, glich eher einem rumänischen Rabbiner als einem Deutschen. Mladen schlug mit seinen nordisch-blauen Augen, seiner hoch aufgeschossenen Statur nicht der deutschen, mütterlichen, sondern der väterlichen Linie nach, slowenische Bauern aus der Gegend um Tolmin. Ich betrachte Opa und Enkel auf vergilbten Schwarzweißfotos und versuche mir vorzustellen, wie ihr Leben verlaufen wäre, hätte sich Mladen mit dem Deutschlernen schwergetan, das großväterliche Geigenspiel abgelehnt oder während der sonntäglichen Mittagessen nicht direkt neben ihm gesessen. Was wäre gewesen, hätte der Alte den Enkel wenigstens ein bisschen als Slawen verachtet? Ich wüsste es zu gern.
Hinter dem Haus, in das wir Anfang der dreißiger Jahre einzogen, stand die aschkenasische Synagoge, die von allen, nicht nur von den Gemeindemitgliedern, Tempel genannt wurde. Dort beteten Juden, die unter Kaiser und König Franz Joseph nach Sarajevo versetzt wurden und sich in unserer Stadt dauerhaft niederließen. Früher, unter den Osmanen, lebten hier nur Sepharden, spanische Juden, die waren meistens bettelarm, trauten der neuen Besatzungsmacht nicht über den Weg und verweigerten den aschkenasischen Neuankömmlingen den Zutritt zu ihren Gebetsräumen. Das waren für sie keine richtigen Juden, sie warfen alle Deutschen in einen Topf und nannten sie unterschiedslos Schwaben. Und so blieb nichts anderes übrig, als eine zweite, aschkenasische oder deutsche Synagoge zu bauen, eben den Tempel.
Unmittelbar nach dem Einmarsch der Deutschen, ein paar Tage, bevor die Ustascha, die kroatischen Faschisten, Sarajevo erreichten, drang der Pöbel in die Synagoge ein und schlug alles kurz und klein. Die Randalierer trugen keine Uniformen, es waren ganz normale Bürger, ausschließlich Zivilisten: Stadtstreicher und feine Herren, Schlägertypen und kleine Angestellte, aber auch Roma, die ein paar Tage später zusammen mit den Sarajever Juden in die Konzentrationslager deportiert wurden.
Mein slowenischer Großvater – er hieß Franjo, ich sagte Nonno zu ihm – sah von der Küche aus zu, wie seine Mitbürger den Tempel zerstörten. Seine Frau Olga, meine Nonna, wollte ihn vom Fenster wegziehen, damit ihn keiner entdeckte, aber er blieb unerschrocken stehen. Das war das Maß seines Mutes. Er betrachtete die Menschen, unter denen er lebte, in den Stunden ihrer Wandlung: von der Sachbeschädigung zum Mord und zum Märtyrertum. Am Ende sahen sich alle als Opfer.
Als die Synagoge verwüstet wurde, ging Mladen, Franjos Sohn, in die siebte Gymnasialklasse. Vater und Großvater lehrten den Jungen, dass nicht in Ordnung war, was da vor sich ging, Pavelić sei ein Barbar, Hitler ein Verrückter, der den Krieg am Ende verlieren würde. Beide waren von dem überzeugt, was aus heutiger Sicht vernünftig und richtig ist. Aber natürlich bläuten sie dem Jungen auch ein, derlei auf keinen Fall laut zu sagen und sich mit niemandem einzulassen, der etwas gegen die Ustascha unternahm. Meine Großeltern und deren Eltern, die ganze Sippschaft lehnte sich grundsätzlich nicht gegen die Obrigkeit auf. Gegen den Staat ist man machtlos. Das ist nicht unser Bier, das bringt einen nur ins Gefängnis, sonst nichts.
Sie rieten Mladen von der Jugendorganisation der Ustascha ab, er sollte deren Veranstaltungen oder Versammlungen meiden und sich als Deutscher bezeichnen, nicht als Kroate. Wer weiß, ob er je zu diesem Mittel griff, um den Folgen zu entgehen, die Kroate zu sein mit sich brachte, aber natürlich, er sprach Deutsch, er beherrschte lauter schöne Fertigkeiten, mit denen die germanische Rasse gemeinhin glänzt, etwa Florettfechten und Geigenspiel, und das förderte sicher sein Empfinden, kein Kroate und insofern auch kein Ustascha zu sein.
Ein Jahr später hatte Mladen die Reifeprüfung bestanden und wollte in Zagreb oder Wien Forstwirtschaft studieren (mein Urgroßvater fand, Bosnien und Wald gehörten zusammen). In Wien hatten wir recht wohlhabende Verwandte, die ihn beherbergt hätten; in Zagreb wäre es etwas schwieriger geworden.
Stattdessen kam der Einberufungsbefehl, zweisprachig in Deutsch und Kroatisch, nach den Regeln eines vereinten Europa. Die Einheit, zu der Mladen im Frühsommer 1942 eingezogen wurde, war Teil von Hitlers Armee, nicht der Kroatischen Streitkräfte, eine Eliteeinheit für die besten jungen Männer aus deutschen und österreichischen Familien.
In dieser Situation gab es zwei Möglichkeiten: Mladen konnte sich bei der Einheit melden und in den Krieg ziehen oder zu den Partisanen überlaufen. Seine Eltern, Franjo und Olga, also mein Nonno und meine Nonna, hatten nicht die leisesten Zweifel, dass Hitler den Krieg verlieren und Pavelić am Galgen enden würde. Ich sagte es bereits, muss es aber noch dutzendfach wiederholen: Nicht eine Sekunde lang kam Franjo in den Sinn, die Seite, die den Tempel zerstört und unsere jüdischen Nachbarn abtransportiert hatte, könnte gewinnen. Auch wenn er nicht an Gott glaubte, es kam nicht infrage, dass am Ende das Böse triumphierte. Er selbst war kein Linker, wohl aber sein Schwiegervater, Urgroßvater Karlo, die Partisanen waren Kommunisten: Mladen hätte angesichts der deutschen Einberufung zu ihnen gehen sollen. Es wäre die in jeder Hinsicht richtige Seite gewesen.
Das war beiden klar, trotzdem schickten sie ihren Sohn und Enkel nicht zu den Partisanen, sondern zur SS, rechneten sich dort größere Überlebenschancen für ihn aus. Noch vor Ende der Grundausbildung hätte Hitler den Krieg verloren. Die Rechnung ging nicht auf, vierzehn Monate später fiel mein älterer Onkel mütterlicherseits im Kampf gegen die Partisanen. Es war der erste Kampfeinsatz seiner Einheit, und er war ihr erster und letzter Gefallener. Wenige Tage später lief sie geschlossen einschließlich ihres Kommandanten zu den Partisanen über. Im Sommer 1945, nach Kriegsende, besuchten vier von Mladens Kameraden seine Eltern. Sie gehörten zur Befreiungsarmee, Franjo und Olga waren Eltern eines Feindsoldaten. Nach dem Tod ihres Sohnes ging meine Großmutter nie mehr zur Messe, bekreuzigte sich nie mehr, feierte nie mehr Weihnachten und Ostern. Als ich sie mit fünf Jahren fragte, ob es einen Gott gibt, antwortete sie: Für die einen ja, für andere nicht.
Gibt es einen für dich?
Nein.
Gibt es einen für mich?
Das musst du selbst herausfinden.
Während sein Enkel für die Deutschen kämpfte, lebte Urgroßvater Karlo in seinem Haus in Ilidža, einem Vorort südlich von Sarajevo, in dem nachts häufig diverse, meist besoffene Truppenteile Razzien veranstalteten. Rückten Ustascha zu ihren nächtlichen Feldzügen aus, um in serbischen Häusern zu plündern und zu morden, versteckte Karlo seine Nachbarn bei sich. Das waren bis zu fünfzig Personen. Klopften die Ustascha dann bei ihm an und wollte das Haus durchsuchen, empfing er sie, grimmig und bärtig, wie er war, auf der Türschwelle und sagte auf Kroatisch: Das ist ein deutsches Haus, hier kommt ihr nicht herein!
Und wenn sie noch so besoffen waren, sie machten auf dem Absatz kehrt und trollten sich wortlos. Ihm stand der Hass ins Gesicht geschrieben, ein Blick, der seine Physiognomie völlig veränderte, so sehr, dass er wie ausgewechselt wirkte. Ein schrecklicher Mensch. Einer hat mal gesagt, diesen Blick hätte ich von ihm geerbt.
Im April 1945 wurde Sarajevo befreit. Ein oder zwei Monate danach wurde Urgroßvater Karlo abgeholt und sollte ins Lager kommen, von dem aus er wie alle seine Landsleute nach Deutschland deportiert werden sollte. Bis zum Bahnhof in Ilidža waren es ungefähr eineinhalb Kilometer Fußmarsch. Er ging zwischen zwei Partisanen, ein Dritter drückte ihm den ganzen Weg lang den Gewehrlauf in den Rücken. Der kannte ihn aus der Zeit vor dem Krieg und wusste sehr genau, wen er da vor sich hatte, es machte ihm Spaß, Urgroßvater Karlo ein bisschen zu misshandeln. So ist das eben. Du weißt nie, wer dich warum ins Konzentrationslager abführt; die meisten Leute denken lieber nicht darüber nach, dass sie selbst zu den Abgeführten gehören könnten.
Am Bahnhof versammelten sich unterdes Urgroßvaters serbische Nachbarn vor den Viehwaggons, mit denen die Partisanen ihre Opfer in die Lager schafften. Vier Jahre lang habe er sie vor den Ustascha gerettet, sagten sie, und wenn er hundert Mal Deutscher sei, sie würden Genossen Karlo niemals im Stich lassen, eher mit ihm dahin gehen, wo er hingebracht werden sollte. Die Partisanen wollten die Versammlung auflösen, schwangen Gewehrkolben, es gab blutige Köpfe, aber je härter sie zuschlugen, desto sturer wurden die Männer.
Sie brachten Opapa Karlo an diesem Tag zurück nach Hause, und er wurde kein zweites Mal abgeholt, obwohl er Deutscher und ihm eigentlich zugedacht war, wie die anderen Jugoslawiendeutschen nach Deutschland zu gehen. Es ist fraglich, ob er dort lebend angekommen wäre; man kann also davon ausgehen, dass ihm die, die er vor dem Tod bewahrt hatte, das Leben retteten. Damit war wie in einem pädagogisch wertvollen Märchen Gutes mit Gutem vergolten. Urgroßvater starb einige Jahre später, mehr als ein Jahrzehnt vor meiner Geburt.
Seine Töchter galten in Jugoslawien nicht als Deutsche, weil sie mit Slawen verheiratet waren, aber auch sein einziger Sohn, Rudolf, den alle Nano riefen, bis auf die Familie und seine Liebste, für die er der Rudi war, wurde weder als Deutscher betrachtet noch ins Lager abtransportiert. Welche Gesichtspunkte leiteten die jugoslawischen Kommunisten, als sie nach dem Krieg die Deutschen in Lager schickten, was war aus ihrer Sicht notwendig, damit jemand als Deutscher galt? Bis heute habe ich keine Antwort auf diese Frage gefunden. Unser Nano sah nämlich deutscher aus als sein Vater, er behielt dessen Nachnamen und kroatisierte ihn nicht, passte ihn nicht einmal der Gepflogenheit an, Namen so zu schreiben, wie sie gesprochen werden, er besaß Schränke voll deutscher Bücher, besuchte Konzerte für klassische Musik, sprach mit Freunden Deutsch, flanierte mit der Wiener Verwandtschaft und deren hübschen Freundinnen, allesamt Österreicherinnen, durch die Altstadt, und trotzdem war er für die Partisanen kein Deutscher. Warum? Wahrscheinlich haben sie mit ihrem siebten Polizeisinn gespürt, dass das Deutschtum unserer Familie bei Urgroßvater Karlo endete und Rudolf kein Verhältnis zu seiner Herkunft hatte. Ihnen genügte das, um einem Menschen das Lager zu ersparen, und in diesem Sinn sind die kommunistischen Konzentrationslager nicht mit den deutschen oder denen der Ustascha vergleichbar.
Der jüngere Onkel mütterlicherseits, Dragan, und mein Vater wurden zur Befreiung Sarajevos von den Partisanen mobilisiert und gegen Kriegsende bei Karlovac in einer der blutigsten Schlachten eingesetzt. Sie zogen als Gymnasiasten in den Krieg und legten das Abitur als demobilisierte Partisanen ab. Danach studierte der Onkel Metallurgie, Vater Medizin. Beide wurden in ihrem Fach erfolgreiche, angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Und beide waren in ihren Herzen und Köpfen und auch durch ihre Namen, in ihrer jeweiligen Polizeiakte, durch die Familie stigmatisiert. Der Onkel durch seinen Bruder, der als deutscher Soldat gefallen war, der Vater durch die Mutter, die wie zwei ihrer Schwestern in der Ustascha-Jugend aktiv war und nach dem Krieg zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, während ihre Schwestern nach Argentinien emigrierten.
Beide wurden Mitglieder des Bundes der Kommunisten und blieben es bis zum Zerfall Jugoslawiens. Auch meine Mutter, die gerade einmal ein Jahr alt war, als ihr Bruder fiel, trat der KPJ bei. Trotzdem konnte man sie bei Bedarf daran erinnern, dass ihr älterer Bruder im Krieg auf der falschen Seite gekämpft hatte – sie fühlte sich schuldig. Ebenso ihr jüngerer Bruder. Und ihr künftiger Mann, mein Vater, fühlte sich wegen seiner Mutter und deren Schwestern schuldig.
Schuld prägte ihr Leben und war wichtiger Bestandteil ihrer Identität. Schuld ist Bestandteil auch meiner Identität, obwohl ich sie nie fühlte, so wenig wie das Deutschtum meines Urgroßvaters, Opapa Karlo, oder das Slowenentum meines Großvaters Franjo. Mein Fall ist, wie ich heute weiß, etwas komplizierter, denn meine Identität setzt sich überwiegend aus dem zusammen, was ich nicht bin.
Als ich im Sommer 1993 Sarajevo verließ, und zwar, weil es damals von den Panzern und Granatwerfern der Verbrecher Mladić und Karadžić eingeschlossen war, in einem Transportflugzeug der US-Armee, das humanitäre Hilfe in die Stadt brachte und auf dem Rückweg einheimische wie ausländische Journalisten nach Split ausflog, traf mich der Gedanke ins Mark, dass ich vielleicht für immer ging. Meine nackte Haut hatte ich gerettet, nichts darüber hinaus. Mutter und Vater waren, jeder für sich, weil schon lange geschieden, noch in der Stadt, ich sah sie vielleicht nie wieder. Ich immerhin kam nach siebzehn Monaten Krieg und Belagerung mit dem Leben davon. Mir gelang, was meinem älteren Onkel mütterlicherseits nicht vergönnt war: die Flucht aus meinem Krieg.
Mein Ziel war klar, Zagreb, die Hauptstadt von Kroatien. Aber obwohl dort meine Sprache gesprochen wird, obwohl ich Kroate bin, erging es mir, wie es Opapa Karlo in Deutschland ergangen wäre. Das war mir damals nicht klar. Wenn man den Kopf aus der Schlinge zieht, denkt man nicht darüber nach, ob in Kroatien andere Leute wohnen, unter denen ich so fremd bin, wie es der Urgroßvater in Deutschland gewesen wäre. Sein Deutschtum war von der Art, dass es die, die keine Deutschen waren, als Spiegel brauchte, den täglichen Kontakt mit anderen, sein Deutschtum bestand in komischen Sprachritualen beim sonntäglichen Mittagessen, im arroganten Ton gegenüber kroatischen Faschisten, die sein Haus durchsuchen wollten. Mein Kroatentum war bosnisch, schlimmer noch, kuferaško. Kuferasche, Kofferkinder, nannte man die, die unter Franz Joseph aus anderen Teilen der Monarchie nach Bosnien kamen, Leute, die vermeintlich aus dem Koffer lebten. Sie schufen mit ihren Kulturen und Sprachen eine Identität jenseits der Nationalität, das kulturelle Substrat war stärker als die nationale Zugehörigkeit. In meinem Fall oder vielmehr dem meiner Familie bedeutet das, dass wir bosnische Kroaten sind, in deren Identität Slawen, Deutsche, Italiener und einige weitere Völker der Donaumonarchie Spuren hinterlassen haben. Ohne Österreich-Ungarn gäbe es mich nicht, weil meine Eltern nie geboren worden wären, weil deren Eltern nie geboren worden wären und sich die Eltern ihrer Eltern nie getroffen hätten … In diesem Sinn war meine Geburt ein politisches Projekt.
Nach einiger Zeit in Kroatien, im Land »der anderen Leute«, begriff ich, dass ich dort mein Leben leben und glücklich werden konnte, aber nie einer von ihnen sein würde. Wenn ich »wir« sage, ist das meist ein verlogenes Wir, ein Wir, für das man sich ein bisschen schämt. Deswegen werde ich häufiger als das Wir die Personalpronomen ich oder sie verwenden. Von mir werde ich hauptsächlich das erzählen, was die Leute nicht gern hören und ich selbst niemals erzählen würde, wenn ich mit meinem Umfeld eins wäre. Ob man sich im positiven oder negativen Sinn abhebt, ist gleichviel, allein dass man sich abhebt, von der Masse unterscheidet, provoziert Abwehr.
Als ich nach Kroatien kam, war es ein ethnisch weitgehend homogenes Land mit neunzig Prozent Kroaten, das heißt Katholiken, und die Mehrheit dieser Mehrheit war allen spinnefeind, die einer Minderheit angehörten. Die Feindseligkeit hatte überwiegend ideologische Gründe, war der Staatsraison, aber auch der Tatsache geschuldet, dass im Land Krieg herrschte und ein Drittel seines Territoriums besetzt war. Die Rolle des Besatzers spielte die ehemalige Jugoslawische Volksarmee, die Rolle des einheimischen Verräters übernahmen Angehörige der serbischen Minderheit. Auch die kroatischen Muslime wurden als Feinde wahrgenommen; im Herbst 1993 ordnete die kroatische Regierung Militäraktionen auf muslimischem Gebiet in Bosnien-Herzegowina an. Jenseits der nationalen Kodierung, auf gesellschaftlicher Ebene, wurden zudem Atheisten ausgegrenzt, erinnerten sie die Bürger doch an vierzig Jahre Kommunismus und vermutlich auch an die eigene Heuchelei. Solange der Atheismus die erwünschte gesellschaftliche Norm war, lehnten die meisten Religion strikt ab, nun hatte sich der Wind gedreht und die Leute rannten genauso eilfertig in die Kirche.
Und die Menschen schwelgten in ihrem Hass, genossen ihre Feindseligkeit. Das ist nichts Neues: Nur der Hass ist so umfassend und verdrängt derart gründlich alles andere, kein anderes Gefühl kann aus dem Privaten herausspringen und zur gesellschaftlichen Emotion mutieren. Kroatien war in den neunziger Jahren unter Präsident Franjo Tuđman das Land des Hasses. Der Hass richtete sich im Wesentlichen nicht nach außen, sondern nach innen, gegen Teile der eigenen Gesellschaft, der eigenen Kultur, Geschichte, Identität, Sprache … Der Hass richtete sich sogar gegen Worte, die nicht kroatisch genug klangen. Aber der Klang täuscht oft, vielleicht gab es auch nicht ausreichend viele Hassobjekte, jedenfalls behalfen sich die Leute mit dem Hass auf Dinge, die mit Minderheiten und fremden Identitäten nichts zu tun hatten.
Der Einzelne kann sich eine Reihe von Gründen zurechtlegen, warum er sich in solchen Zeiten an die Mehrheit hält. Schon gar, wenn er aus einer belagerten Stadt kommt, auf sich gestellt ist, materielle Sorgen hat, zur Untermiete wohnt, zum intellektuellen Proletariat zählt … Schließlich wurde Sarajevo von Angehörigen der Nationalität belagert und beschossen, die in Kroatien am hingebungsvollsten gehasst wurde. Spricht nicht alles dafür, sich einem solchen Hass anheimzugeben, sich zu assimilieren und gesellschaftlich einzugliedern, nach einer Übergangsphase den Vertriebenenstatus abzulegen und einen Platz in der neuen Gemeinschaft zu akzeptieren? Lassen wir einmal moralische Gegenargumente beiseite, die immer problematisch sind, wenn sich einer auf sie beruft, der gegen den Strom schwimmt, sehen wir weiterhin davon ab, dass auch der Hass eine gewisse intellektuelle und psychische Anstrengung voraussetzt (die manchen Menschen durchaus schwerfällt), dann bleibt wirklich kaum ein Grund übrig, warum sich einer, der 1993 aus Sarajevo floh, der herrschenden Stimmung in dem Land, das ihn aufnimmt, widersetzen sollte. Ich bin nicht so eitel, dass ich um jeden Preis aus dem Rahmen fallen muss. Und das Leben macht man sich mit solchen Widerständen auch nicht leichter.
Der Grund also, jedes meiner Wir auf ein Ich zu reduzieren, in der langen Zeit des Hasses die Ausnahme sein zu wollen, obwohl mir das überhaupt keinen Spaß machte, mir nicht einmal moralisch ein gutes Gefühl verschaffte, liegt in meiner Identität, die untrennbar auch das enthält, was ich nicht bin. Mein Urgroßvater war Banatschwabe, wohnhaft in Sarajevo, er sprach ein mit türkischen Wörtern durchsetztes Kroatisch, wie es für die bosnischen Muslime typisch ist. Er versteckte seine serbischen Nachbarn nicht deshalb vor der Ustascha, weil er so ein guter, aufopferungsbereiter Mensch war, wenigstens nicht in erster Linie deshalb, sondern weil sie ein wichtiger Teil seiner Welt waren, wie hätte er ohne Serben Deutscher sein können? Er konnte sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie man da, wo es keine Serben (Kroaten, Bosnier, Muslime, Juden …) gibt, Deutscher sein kann. Für ihn war jeder Hass in einem Vielvölkerland einfach nur Hass, und ich sehe es genauso. Deswegen unterschied sich mein Kroatentum substanziell von dem Kroatentum der Menschen, unter die ich mit meiner Ankunft in Zagreb geriet. Sogar von dem meiner Freunde und Bekannten. Denn diese lehnten den Hass aus intellektuellen und moralischen Gründen ab oder einfach weil sie zu Hause eine gute Erziehung genossen hatten, ich lehnte ihn ab, weil er mich bedrohte. Obwohl ich Kroate bin, bedrohte er den Serben und Bosniaken (Muslim) in mir.
Mein jüngerer Onkel mütterlicherseits, Dragan, später ein gefeierter Metallurg, der die bosnische Schwerindustrie in der Sowjetunion vertrat, wurde in Kakanj geboren, noch so einem Städtchen, in dem Großvater Franjo Bahnhofsvorsteher war. Dort stellten Muslime die Bevölkerungsmehrheit, als Dragan eingeschult wurde, war er der einzige Christ in der Klasse. In den dreißiger Jahren gehörte Religionsunterricht an allen Schulen des Königreichs Jugoslawien zu den Pflichtfächern; mein Onkel lernte den Stoff als kleiner Junge unter ungewöhnlichen Bedingungen. In der ersten Stunde gingen alle anderen Kinder in die nahe gelegene Moschee zum islamischen Geistlichen, und Dragan saß allein im Klassenzimmer, denn es gab keinen katholischen Religionslehrer, und der örtliche Pfarrer, der bei Bedarf dessen Rolle übernehmen sollte, wusste nicht, dass in der Schule ein getauftes Schäfchen auf ihn wartete. Ganz allein zwischen vier weißen Wänden, vor der Wandtafel und dem Bild von König Alexander Karađorđević, bekam mein Onkel die mörderische Einsamkeit zu spüren, an der man irre werden kann und die selbst Erwachsene fliehen, also aus Städten und Staaten, in denen sie zur Minderheit gehören, in Städte und Staaten ziehen, in denen sie zur Mehrheit gehören.
Doch statt mit der Familie umzuziehen oder darauf zu bestehen, dass der hiesige Pfarrer den Sohn unterrichtet, während seine Freunde den Glauben beim Hodscha lernen, erklärte Franjo, Dragans Vater, mein Großvater, dem Lehrer, er wünsche nicht, dass sein Kind von den anderen getrennt werde, es möge bitteschön zusammen mit den anderen zum islamischen Religionsunterricht gehen. Eine solche Forderung seitens der Eltern war ungewöhnlich, aber weder widerrechtlich, noch hatte irgendwer was dagegen.
So kam es, dass Dragan vier Jahre in der Mekteb die Grundlagen des islamischen Glaubens aus erster Hand lernte und, obwohl katholisch getauft, von Kindesbeinen an die Regeln des muslimischen Gebets kannte. Deswegen war er nicht weniger das, was er seiner religiösen und nationalen Herkunft nach war, aber es unterschied ihn natürlich von den meisten anderen mit seiner Religion und nationalen Herkunft. Das Entscheidende ist dabei nicht so sehr, dass er die islamische Grundschule beendete, wichtig ist, dass er in einer Familie aufwuchs, die bereit war, ihr Kind in die Mekteb zu geben, damit es nicht allein im Klassenzimmer hockt und um das gebracht wird, was an dieser Schule und in diesem Ort allen Schülern gemein war.
Der Unterschied ist aber nicht der einer gemischt-nationalen Gesellschaft zu einer national homogenen Gesellschaft. Der Unterschied liegt im Umgang mit Verschiedenheit. Wir können im Hass schwelgen und aus ihm unsere Identität ziehen, wir kommen aber auch ohne diese Schwelgerei aus. Wenn wir nicht hassen, spiegeln wir uns zwangsläufig im anderen, und dann wird der andere zwangsläufig Teil unserer Identität. Urgroßvater Karlo wusste das, deswegen zog es ihn nicht nach Deutschland, weil dort andere Deutsche lebten. Wie hätte er mit ihnen in Kontakt kommen können, wie sich mit ihnen verständigen, wie kann ein solcher Deutscher anders in Deutschland leben als gegen Widerstände und voller Konflikte?
Vom Urgroßvater, dem Banatschwaben, und seiner Familie, vom Onkel, der als Soldat der feindlichen Armee fiel, von Nonno und Nonna, die ihren Sohn in diese Armee schickten, von anderen Haupt- und Nebenfiguren, mit deren Schicksalen ich aufwuchs, handeln meine Romane und Erzählungen. Ich vermischte Wirklichkeit und Fiktion, versetzte sie in erfundene Lebenslagen, hauchte ihnen Leben ein und verlängerte es. Mehrfach und in verschiedenen Formen und Genres habe ich ihre Schicksale erzählt. Auch die Geschichte, die ich hier erzähle und in der sich Ausschmückungen und Veränderungen leider verbieten, habe ich schon mehrfach erzählt. Ich komme nicht von ihr los, ich kann meinen Onkel, dessen Grab auf einem Dorffriedhof irgendwo in Slawonien längst vom Gestrüpp überwuchert ist, nicht zwischen Millionen anderen Soldaten Hitlers ruhen lassen. Er ist Teil meiner Identität, der Gewissensbisse, die von Generation zu Generation weitergereicht wurden, der Implikationen, die sie für mein nationales Selbstverständnis haben. Denn ich bin nicht nur die und die Person, ich bin auch der und der Kroate. Oft umfasst die nominale Definition, der Name, nicht die ganze kollektive, nationale und religiöse Identität. Oft widerspricht das Katholischsein dem allgemein anerkannten Begriff und Selbstverständnis eines Katholiken.
Ich hatte gedacht, nach dem Tod von Franjo Tuđman und der Demontage der nationalistischen Oligarchie in Kroatien würden die Unterschiede zwischen uns mit der Zeit verblassen und mein schlechter Ruf bei der nationalen Elite irgendwann der Vergangenheit angehören, sich auflösen, so wie sich mit Kriegsende der Hass aufzulösen begann. Schließlich fing die Nation damals an, die Dissidenten der neunziger Jahre wieder an ihren mütterlichen Busen zu drücken, verlieh ihnen Nationalpreise und lobte ihre mustergültige patriotische Haltung. Das nationalistische Pathos wandelte sich zu einem Pathos der allgemeinen, kollektiven Europäisierung, das einem genauso auf die Nerven gehen kann, mit dem sich aber leichter leben lässt. Jetzt knattert neben der kroatischen Flagge die der Europäischen Union im Wind. Drückt sich darin nun koloniale Gefolgschaft einer zermürbten, schizophrenen Identität aus, oder bietet es sich einfach nur an, alle drei Fahnenmasten, die vor jedem öffentlichen Gebäude stehen, zu nutzen? Die Fahnenmasten stammen nämlich noch aus der Zeit, als in der Mitte die jugoslawische Fahne wehte, flankiert von der kroatischen und der der Partei. Heute hängt neben der kroatischen und europäischen meist eine Fantasieflagge für Stadt oder Gespanschaft …
Aber Flaggen entscheiden nicht über unser Leben. Was gestern noch Hassobjekt war, kann heute schon Symbol der Freiheit sein. Und umgekehrt. Man denke nur daran, wie radikal die Bush-Administration die Bedeutung des Sternenbanners veränderte. Auf einer Postkarte schrieb mein älterer Onkel der Tante in Sarajevo: Es ist Sonntag, ein freier Tag, das Feldlager liegt verlassen da, die deutsche Fahne flattert. Wir haben unsere verkauft. Wenn auch verklausuliert, ist es seine einzige politische Äußerung. Die Worte trösteten die überlebenden Familienmitglieder nach dem Krieg, aber im Grunde sagen sie nicht viel. Denn wir wissen eigentlich nicht, welche Fahne die unsere ist. Die es wussten, wussten auch, dass es sich mit einer Fahne gut hassen lässt. Daher ihre überragende Rolle bei Pokalspielen und während der Olympiade. Unsere Fahne demütigt eher die Verlierer, als dass sie den Sieger ehrt. Der bekannteste kroatische Fan-Song geht so: Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta! – Wen’s stört, mag leiden, Kroatien ist Weltmeister. Warum sollte jemand leiden, weil Kroatien Weltmeister ist? Wer so was fragt, ist wahrscheinlich kein echter Kroate.
Ein Jahr nach der Abwahl der nationalistischen Regierung, auf die eine Koalition unter Führung des Sozialdemokraten Ivica Račan folgte, dessen Europäertum ganz Europa und vor allem die unmittelbaren Nachbarn Kroatiens aufatmen ließ, war ich bei einem Filmfestival in einem uralten istrischen Städtchen auf einer Bergkuppe, wo früher überwiegend Italiener gelebt hatten. Als Istrien zu Jugoslawien kam, stellten die Kommunisten die Einwohner vor die Wahl, nach Italien zu gehen oder Jugoslawen zu werden, und die meisten schnürten ihr Bündel und zogen fort, lebten jahrelang in italienischen Flüchtlingslagern, und ihre Häuser wurden konfisziert. Ein Filmfestival in dem Städtchen war wegen dieser Vergangenheit in gewisser Weise die Manifestation eines neuen, antinationalistischen Kroatiens und als solches nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein politisch-gesellschaftliches Ereignis. Natürlich ließ es sich der neue Kulturminister nicht nehmen, auf dem Festival zu erscheinen; seine Anhänger und Unterstützer nannten ihn den kroatischen Malraux, was er sich gern gefallen ließ, zumal es in Kroatien wie auch im gesamten ehemaligen Jugoslawien und auf dem Balkan üblich und erwünscht ist, hervorragende Persönlichkeiten nach ausländischen Größen zu titulieren, ob nach Franz Beckenbauer, Kaiser Haile Selassie oder Shakespeare ist dann eigentlich egal. Dieser unser Minister, dieser kroatische Malraux, hatte sich davor mit Lexikografie beschäftigt, also im Wesentlichen auf der faulen Haut gelegen, also nach Durchsicht der zwei, drei Einträge, die ihm pro Arbeitstag auf den Schreibtisch flatterten, in Kneipen intellektuelle Debatten ausgefochten. Mir widerstrebte die Art, wie er das Ministerium leitete, und ich habe darüber einen im Vergleich zu meinen Philippiken gegen Tuđmans Nationalisten ziemlich zahmen Zeitungsartikel geschrieben.
Den hatte ich schon vergessen, aber als ich nachmittags an einer riesigen Linde, dem heiligen Baum der Slawen, vorbeikam, fiel er mir wieder ein. Im Schatten der Linde stand ein Wirtshaustisch, an dem saßen Regisseure, Produzenten und freischaffende Intellektuelle mit Minister Malraux beisammen. Ich kannte die Leute persönlich, natürlich auch den Minister, und wollte sie begrüßen.
Hau ab, du bosnisches Stück Scheiße, geh dahin zurück, woher du gekommen bist, sonst übernehmen wir das!, schrie Malraux.
Ich ärgerte mich nicht zu sehr, die vorangegangene Nacht war arbeitsreich und anstrengend gewesen, der Minister bis in den Nachmittag hinein verkatert. Aber ich blieb stehen und sah einen Regisseur an, der zu Tuđmans Zeiten auf der Schwarzen Liste stand und seine Filme nicht im Fernsehen zeigen durfte, ein aufrechter Dissident, fast so aufrecht wie Kundera, wenn nicht aufrechter. Er senkte den Blick und schwieg, nahm Rücksicht auf den ministeriellen Kater, er plante einen neuen Film, und das geht in Kroatien nicht ohne Staatsgelder. Auch der Produzent senkte den Blick, ein vielversprechender junger Mann, der jeden Nationalismus bekämpfte und internationale Liebe predigte, sämtliche aufrechten Dissidenten der Tuđman-Ära senkten einer nach dem anderen den Blick. Nachdem ich viel zu lange so gestanden und gewartet hatte, drehte ich mich um und ging unter dem Gekeife des kroatischen Malraux diesen istrischen Hügel hinunter.
Ich ging und gehe als glücklicher Mann, denn im Gegensatz zu Opapa Karlo werde ich nicht von zwei Kerlen abgeführt, während mir ein Dritter den Gewehrlauf in die Nieren stößt. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen unseren Identitäten, deretwegen wir dort leben, wo wir leben, obwohl wir nicht der Mehrheit angehören. Das Glück hält uns am Ort, das Glück, davon bin ich überzeugt, hat uns oft das Leben gekostet. Versöhnt mit dem, was wir sind, tragen wir in uns, was wir nicht sind, leben Identitäten, die sich nicht mit einem Wort, einem Pass, dem Personalausweis, einer Genehmigung belegen lassen. Der Mob weiß, welches Wappen, welche Fahne, welcher Name ihm gehört, und brüllt es frei heraus, wir hingegen sehen uns zu langen, umständlichen Erklärungen, Romanen, Filmen, fiktiven und wahren Geschichten gezwungen, haben das Bedürfnis, ein Dorf im rumänischen Banat zu besuchen, in dem keine Deutschen mehr sind, der Horizont aber ist noch wie zu Urgroßvaters Karlos Kindheit, uns bleiben öde Kleinstädte in Bulgarien, der Ukraine oder Polen, in denen Menschen lebten, die sich in Rauch auflösten, uns bleiben verschwommene Erinnerungen, das Gefühl, heute dies und morgen das zu sein, Hymnen und Staatsgrenzen kommen uns ständig abhanden, uns bleiben die Reue und lang anhaltende, schmerzliche Gewissensbisse, weil einer, mit dem wir verwandt sind, als Feindsoldat lebte und starb, wir sind gewissermaßen selbst der Feind, uns bleibt der Glaube an das, was wir unter der Zunge verstecken, unsere Heimat gibt es nicht mehr, gab es vielleicht nie, weil uns jede Handbreit Erde fremd ist.
DIE STUBLERS Roman
Kennen Sie Regina Dragnev?
Karlo Stubler, mein Urgroßvater, ließ bei seinem Umzug vom Banat nach Bosnien in Bosowitsch einen älteren Bruder zurück. Dessen Name ist dem familiären Gedächtnis entfallen, nicht aber der seiner Tochter: Regina. Karlo gab ihn einer seiner Töchter, der Zweitgeborenen, später hieß seine Urenkelin so, meine Cousine. Meine Mutter wurde auf die Namen Regina Javorka getauft, weil Javorka allein im Mai 1942 weder im Standesamt noch in der Kirche anerkannt wurde, und hieß so, bis ihr dasselbe Standesamt zwanzig Jahre später vorschrieb, sich für einen von beiden zu entscheiden, weil unsere sozialistische Gesellschaft Doppelnamen ebenso wenig dulde wie Doppeldeutigkeiten, und für sie mache man da keine Ausnahme. Sie entschied sich für Javorka, damit das Schicksal sie nicht mit einer der Reginas in der Verwandtschaft verwechselte.
Uns ist auch bekannt, nach welcher Regina sie alle benannt waren.
Nach der Mutter von Urgroßvater Karlo und seinem Bruder, dessen Namen keiner mehr weiß. Was diese Frau auszeichnete, ist nicht überliefert, nur, dass sie zwei Söhne gebar und ihr Name heute noch lebt. Dass wir nicht wissen, wodurch die erste Regina Stubler groß und bedeutend war, dieses Nichtwissen, das familiäre und historische Vergessen, trägt vermutlich zu ihrer Größe und Bedeutung bei.
Die Tochter von Urgroßvater Karlos Bruder wurde etliche Jahre vor ihren bosnischen Cousinen und Cousins geboren und war ihnen ein fernes Vorbild, das sie nie persönlich kennenlernten. Als Spross wohlhabender deutscher Bauern besuchte sie das Gymnasium in Temeswar und studierte danach während und trotz der Balkankriege – in denen das erwachende Jugoslawentum sein serbisches Blut vergoss und an Tuberkuloseschüben und der Schönheit seiner kroatischen Träume verreckte – in Sofia Medizin. Dass ein Mädchen vom Dorf in die ferne Stadt zog und Ärztin wurde, das war selbst bei den Banatschwaben selten, selbst in Rumänien, auch Französischer Balkan genannt.
Aber vielleicht war Sofia damals gar nicht so weit weg von Bosowitsch. In Bulgarien lebten viele Deutsche, gut möglich, dass die Stublers in der Hauptstadt Verwandte oder Freunde hatten, bei denen Regina unterschlüpfen konnte.
Kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs schloss sie die Ausbildung ab, fand Arbeit und heiratete einen Bulgaren, über den wir ebenfalls nichts wissen, nur den Nachnamen: Dragnev.
Karlo Stubler, mein Urgroßvater, wurde 1920 einschließlich Familie aus Dubrovnik gejagt, weil er als hoher Eisenbahnbeamter einen Streik unterstützt hatte. Er verlor seinen Posten und landete mit seiner Frau und dreien der vier Kinder in Sarajevo. In den Jahren danach sorgte die Gewerkschaft für ihr Überleben. Zwei oder drei Gewerkschafter, Eisenbahnarbeiter, Heizer oder Lokführer, gaben Karlo und den Seinen einen Teil ihres Lohns ab, bis Karlos Kinder die Ausbildung abgeschlossen hatten. So war es in frühkapitalistischen Zeiten auf dem Balkan Brauch, dafür waren Gewerkschaften da.
Dabei berücksichtigte man, dass Karlo Deutscher und ein gebildeter Mann war, dass seine Kinder musizierten und ihnen ein besseres Leben vorgezeichnet war als den Kindern der Heizer und Lokführer. Dass er sich für die Sache der Arbeiter einsetzte und dafür in Dubrovnik geschasst wurde, sollte seine Familie nicht in Armut stürzen, auch nicht um den Preis, dass das Kind eines Weichenwärters wegen der Fürsorgepflicht gegenüber meinem Urgroßvater die Schule abbrechen musste. Oder ist der Gedanke eine Übertreibung? Belassen wir es bei der Aussage, dass Glaube und Ideale damals etwas galten.
Eine von Karlos Töchtern, ebenjene Regina, heiratete Vilko Novak, den Sohn eines der für die Stublers sorgenden Gewerkschafters. Aus der Ehe ging meine Tante Nevenka hervor, die wiederum meine Cousine Regina zur Welt bringen sollte.
Vor dem Ersten Weltkrieg, als junger, fescher Eisenbahner, besuchte Karlo Stubler den Bruder in Bosowitsch noch. Nachdem er seine Stelle, und zwar, wie er befürchtete, bis ans Ende seiner Tage verloren hatte, fuhr er nie wieder in die Gegend, aus der er stammte. Die gesamte Kommunikation mit dem Bruder und den anderen Verwandten lief über einen teils sehr lebendigen, dynamischen und in gewisser Weise ergiebigen Briefwechsel. Wie die Juden von Amerika ihren Angehörigen in heute namenlosen galizischen Schtetl Briefe oder Päckchen mit Fotografien und anderen Memorabilien schickten, so hielten es auch Karlo und die Seinen mit den Verwandten im Banat. Der Briefwechsel zwischen Ilidža und Bosowitsch – wobei leider unklar bleibt, welcher der beiden Orte für Amerika und welcher für Galizien steht und ob die Ilidžer ins Banat oder die Banater nach Ilidža fahren wollten – war rege, über Jahrzehnte plante man Treffen, aber es kam nie dazu.
Regina Novak und ihr Bruder, Rudolf Stubler, der Nano meiner Kindheit, korrespondierten mit der Cousine in Sofia. Geschrieben in deutscher Sprache, wechselten Episteln alle zwei Wochen hin und her, zu Weihnachten und Ostern schickte man sich zusätzliche Grüße, und dieser Austausch zog sich durch die zwanziger und dreißiger bis in die vierziger Jahre, dann verstummte die Korrespondenz vor den Schrecken des Krieges.
Zwischen den Resten des familiären Briefarchivs in der Kasindolska, im Ilidžer Haus der Familie Novak-Cezner, wo der größte Teil des Stubler-Nachlasses liegt, gab und gibt es vielleicht immer noch, man sollte mal nachschauen, Bilder der Regina aus Sofia. Adrett und würdevoll lächelnd, wie es sich gehört, wenn man sich für die Verwandtschaft fotografieren lässt, schaut uns Frau Doktor Dragnev an.
Der familiäre Zusammenhalt, das, was uns als Familie konstituierte, gründete wie jede kulturelle, verwandtschaftliche oder häusliche Gemeinschaft auf einer Illusion. Unsere Cousine in Sofia, die uns eines Tages besuchen wird oder zu der wir auf Besuch fahren werden, war Teil dieser Illusion. Wir haben sie nie in die Arme geschlossen, mit Küsschen links und Küsschen rechts begrüßt oder ihr die Hand geschüttelt.
Keiner außer Karlo Stubler hatte je persönlich-unmittelbaren Kontakt zu Regina Dragnev. Als junger Eisenbahner spielte er mit dem kleinen Mädchen vor unserem Haus in Bosowitsch (ebenfalls eine Illusion, wir haben es nicht selbst gesehen), spielte Hoppe, hoppe Reiter mit ihr.
Seine Knie waren das Pferd, auf dem Regina fortritt.
Bald nach Kriegsende, Ende 1945, lebte das triste Herbeirufen von Menschen und Illusionen wieder auf, und so suchte Rudolf Stubler über das Rote Kreuz nach unserer Cousine Regina Dragnev, geborene Stubler, Ärztin in Sofia.
Zwanzig Jahre lang suchte er sie, über verschiedene Organisationen, unsere wie ausländische, nutzte jede Chance, sie aufzuspüren, ließ ihren Namen über jeden Radiosender verkünden, der sich an der Vermisstensuche mit wunderlichen Genre-Transformationen der Wünsch-dir-was- und Grußsendungen oder Matrosenabende beteiligte. Er fand sie nie, erfuhr nichts über ihr Schicksal. Regina Dragnev war wie vom Erdboden verschluckt, hatte sich in Schall und Rauch aufgelöst, und die Idee, dass die ganze Geschichte letztlich erfunden ist und weder die Gesuchte noch die Suchenden je existierten, drängt sich förmlich auf.
Derartige Suchen haben mindestens drei Schriftsteller thematisiert: Amos Oz, David Grossman und Ivan Lovrenović. Oz und Grossman schrieben über die Suche nach Verwandten, deren Schicksal vom Holocaust verfinstert wurde, Lovrenović über Väter und Onkel, die als Soldaten einer besiegten Armee parallel zu den Feiern der Sieger in Vergeltungsaktionen spurlos verschwanden. Etwas haben die Gesuchten von Oz, Grossman und Lovrenović gemein: Die Suchenden konnten den mit der Suche Beauftragten sagen, ob die Gesuchten Opfer waren oder, wie das früher bei uns hieß, dem Aggressor dienten.
Regina Dragnevs Cousin Rudi, mein lieber Nano, suchte mit einer doppelten Angst nach ihr. Die eine teilte er mit Millionen Europäern: Lebte sie, und wenn ja, wo? Wenn nein, wo lag sie begraben? Die andere gehörte ihm und uns allein, der Familie: Wie war Regina Dragnev aus Sicht der Sieger, Rechthaber und Antifaschisten einzuordnen? Denn so oft über zwei Jahrzehnte lang Briefe hin- und hergegangen waren, weder Rudi noch die Ilidžer Regina kannten Regina Dragnevs politische Einstellung. Unsere Cousine hatte einen Mann und zwei Kinder, arbeitete im Krankenhaus, sorgte für ihre Patienten, berichtete ihren fernen Verwandten manchmal von ihnen, ging ins Theater, las dieselben Bücher wie sie, erinnerte sich an Bosowitsch, erkundigte sich nach lebenden und toten Angehörigen, erwähnte aber mit keinem Wort Hitler und den deutschen Vormarsch im Osten, Kommunismus und Faschismus, und ihre Verwandten in Sarajevo hielten es genauso: Die Korrespondenz schweigt sich über Themen aus, die uns heute brennend interessieren würden.
Auf welcher Seite stand sie, was hat unsere Cousine Regina Dragnev 1941 bis 1945 gemacht? Hat die mit einem Bulgaren verheiratete Banatschwäbin mit dem Feind kollaboriert? Die Frage bereitete meinem Nano Bauchschmerzen, trotzdem suchte er nach ihr. Er war kein Held, hatte Fracksausen, es könnte eines Tages an seine Tür wummern und er verhört werden, warum er die Frau suche, ob er am Ende eine Konterrevolution anzetteln wolle?, aber er konnte nicht anders, die Suche war unverzichtbarer Teil seiner und unserer familiären Identität geworden. Er musste seine Cousine finden, und wir hätten gern erfahren, wer Regina Dragnev wirklich war. Die Ungewissheit bleibt uns bis ans Lebensende erhalten. Erst danach wird der Zweite Weltkrieg zu Ende sein.
Karlo Stubler, mein Urgroßvater, suchte seinen Bruder nicht. Der wurde 1945 aus Bosowitsch abgeführt und nicht mehr zurückgebracht. Karlo wurde in Ilidža von seinen serbischen Nachbarn gerettet, weil er sie vor der Ustascha gerettet hatte. Er versteckte sie in seinem Haus und schickte die kroatischen Soldaten von der Schwelle aus weg, Feiglinge, die sich nicht ins Haus eines Deutschen trauten, und sei der noch so klapprig.
Karlo fragte nicht nach den Bosowitscher Verwandten. Es war keiner mehr dort: Sie zerstreuten sich 1945, verwandelten sich in einen inhaltsleeren, wortlosen und verlassenen Gedanken, in etwas, worüber man zu Karlos Lebzeiten und noch lange danach nicht redete. Im Unterschied zu jüdischen Schicksalen sind deutsche unaussprechlich. Das ist so und durfte für meinen Urgroßvater auch gar nicht anders sein. Mit den Seinen sprach er Deutsch, über die Deutschen wurde geschwiegen. Aus Schweigen mauerte er ein Denkmal, einen kleinen Turm zu Babel.
Sein Sohn reiste viel durch Europa, fuhr aber nie nach Bosowitsch. Wo immer Rudolf Stubler hinkam, er trat in die nächstbeste Telefonzelle und blätterte die dicken, angeketteten Telefonbücher durch. Das mache ihm Spaß, sagten die einen. Der Nachname Stubler sei selten genug, deswegen sei es lustig, nach Stublers zu suchen. Sagten die andern.
Meiner Meinung nach suchte er in den Telefonbüchern von Wien, Paris, Berlin, Rom, Leningrad, Moskau, Budapest, Amsterdam oder Madrid nur Regina Dragnev. Aber das durfte er nicht zugeben: Keiner hätte den Sinn der nach so vielen Jahren fortgesetzten Suche noch verstanden.
So sahen wir am ersten Kriegstag aus
Als Karlo Stubler Dubrovnik 1920 verlassen musste, weigerte sich die älteste Tochter, mit der Familie ins Exil zu gehen. Sie war volljährig, hatte die Handelsschule abgeschlossen und sich gegen König und Königreich nichts zuschulden kommen lassen, warum also sollte sie nach Bosnien?, und so blieb sie, entschlossen, auf eigenen Füßen zu stehen und ihr Leben Eisenbahn und Gewerkschaft zum Trotz selbst in die Hand zu nehmen. Töchter handelten normalerweise nicht gegen den väterlichen Willen, Karlo blieb jedoch keine Wahl, er musste seine Älteste freigeben, die nach ihm Karla hieß, aber Lukre oder Lola gerufen wurde. Schon als kleines Mädchen lehnte sie den Männernamen ab, genauer, den Namen, der für sie ein Männer- und Papaname war, suchte sich stattdessen Lukrecija aus und behielt das ein Leben lang bei. Erst im Sommer 1974 kehrte sie zu ihrem Taufnamen zurück, als sie sich wie jeden Tag nach dem Mittagessen ein wenig hinlegte und nicht mehr aufstand, ruhig und regungslos im Schlaf starb. Ein Aneurysma, hieß es. Anderntags meldete die Tageszeitung den Tod von Karla Ćurlin, geborene Stubler.
Nach dem Wegzug der Familie war Lola, die unangepasste Tochter von Kuferaschen, in Dubrovnik auf sich gestellt, ohne Freunde, dickköpfig, mit allen über Kreuz. Sie wusste sich zu helfen, umgarnte einen achtzehn Jahre älteren, begüterten Finanzbeamten aus Pelješac, Andrija Ćurlin. Onkel Andrija, für uns Dundo Andrija, gehörte zu jenen altmodischen Männern, die reiflich überlegen, geeignete Heiratskandidatinnen in Augenschein nehmen, ihre Wahl treffen und sich wieder umentscheiden, und irgendwann merken sie, dass ihnen die Zeit davonläuft. Dann erfasst sie Torschlusspanik, als Hagestolz wollen sie nicht enden, und so freien sie eine Hals über Kopf, in der Regel die Falsche, eine wie unsere Tante Lola, die ihre eigene Familie durch Vertreibung, politische Umstürze oder Naturkatastrophen verlor.
Tante Lola war nicht berechnend, das wäre zu hart ausgedrückt. Sie suchte einen Anker, eine Schulter zum Anlehnen, war überzeugt, ihr Leben würde leichter, wenn ein Mann ihr die Entscheidungen abnahm. Aber schon am Tag nach der Hochzeit wollte sie doch lieber selber entscheiden und stieß ihren Mann weg, so wie sie schon den eigenen Vater weggestoßen hatte. Der arme Dundo Andrija war darauf nicht vorbereitet, bei ihm zu Hause in Kuna Pelješka oder unter Dubrovniker Patriziertöchtern gab es keine Frauen wie Karla, Lukrecija, Lukre …
Sie liebte ihn nicht. Weil man Liebe nicht lernen kann, weil sie von ihrem Mann enttäuscht oder zu selbstverliebt war, um lieben zu können? Die zuletzt genannte Option dürfte der Wahrheit am nächsten kommen.
Sie gebar zwei Kinder, erst Željko, fünf, sechs Jahre später dann Branka.
Das änderte nichts. Wie mütterlich eine Frau ist, sieht man, bevor sie niederkommt. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, eigene Kinder würden ein egoistisches Naturell erweichen, eine hartherzige Frau von Grund auf ändern. Tante Lola änderte sich nicht, sie wurde keine gute Mutter.
Wenn das Leben oder Dundo Andrija sie langweilten, ließ sie ihn mit den Kindern allein und verschwand, ohne ein Wort zu verlieren. Zehn, fünfzehn Tage später kam sie wieder nach Hause und giftete vom Eingang aus: Da bin ich!
Mehr nicht. Sie gab keine Erklärungen ab, und er fragte nicht nach. Niemand wusste, wo sich Tante Lola herumtrieb. Dubrovnik war damals ein Nest, jeder wurde durchgehechelt, man konnte nichts verstecken, höchstens wurde einem was angedichtet, falsche Gerüchte in die Welt gesetzt, aber Lukre Ćurlins Eskapaden machten nicht die Runde, wurden nicht an die große Glocke gehängt. Selbst die engere Familie, Schwestern, Nichten und Neffen, war ahnungslos, und bis zu ihrem Tod traute sich keiner zu fragen. Allen bekannt und wieder und wieder halb scherzhaft, halb verzweifelt kolportiert wurde nur dieses: Da bin ich!
Branka war zu klein, aber Željko dürften die mütterlichen Ausflüge heftig mitgenommen haben. Er wurde so schnell wie möglich erwachsen und verließ das Elternhaus früh. Nach der Matura lernte er bei der Luftwaffe fliegen und wurde Pilot der Nišer Fliegerstaffel, deren Mitglieder sich 1941 je nach familiärer Herkunft, nationaler Zugehörigkeit und vermutetem Kriegsverlauf auf die verschiedenen Armeen verteilten. Željko Ćurlin schlug sich zunächst zur Luftwaffe des Unabhängigen Staats Kroatien, diente unter Leutnant Franjo Džal, lief aber bald zu den Engländern über und flog bis Kriegsende für die Royal Air Force.
Unterdessen lebten Tante Lola und Onkel Andrija ihr ödes, unzeitgemäßes Eheleben weiter. Branka wuchs heran, der Onkel arbeitete fleißig, und Tante Lola amüsierte sich, obwohl schon über vierzig, wie eine junge Frau, führte ein Leben, wie es Ende des 20. Jahrhunderts für viele Frauen weltweit normal und üblich werden sollte. Tante Lola war gewissermaßen die Speerspitze des späteren Remmi-Demmi-Dubrovnik. Dass Željko hoch oben über den Wolken eine Uniform gegen die andere tauschte, bekümmerte sie nicht weiter. Überzeugte Atheistin, die zu keinem Zeitpunkt an Gott glaubte, sich von einem solchen auch nichts erhoffte, war der Tod für sie stets das endgültige Ende.
Am Sonntag, dem 6. April 1941, der Tag, an dem Jugoslawien in den Krieg hineingezogen wurde, spazierte Tante Lola euphorisch – ihre übliche Ausgehstimmung – mit einer Freundin durch Dubrovnik. Damals wie noch bis in die siebziger Jahre hinein lichteten Fotografen unaufgefordert Einheimische oder zahlungskräftig wirkende Ausländer ab und boten ihnen die Aufnahmen zum Kauf an. Waren die Kunden einverstanden, mussten sie sofort bezahlen und bekamen die entwickelten Bilder per Post geschickt. Erst Anfang der achtziger Jahre stand das Gewerbe vor dem Aus, weil jeder Tourist einen eigenen Apparat besaß und sich für ausreichend geschickt hielt, die Welt um sich herum einzufangen.
Am ersten Kriegstag also bannte ein Dubrovniker Fotograf (Foto Berner) Tante Lola und ihre Freundin auf Zelluloid. Wir können es nicht beweisen, nehmen aber stark an, dass er an jenem Tag keine weiteren Bilder verkaufte: Die ganze Stadt versammelte sich um Radioapparate und verfolgte die Meldungen von der Bombardierung Belgrads und der Mobilmachung. Lukre indes scherte sich einen feuchten Kehricht um die Logik des historischen Augenblicks, stur wie schon einundzwanzig Jahre zuvor, als sie sich dem Umzug ins Exil verweigerte.
Die Aufnahme gefiel ihr so gut, dass sie sie den Schwestern in Sarajevo schickte, mit der Erklärung auf der Rückseite: So wie wir am ersten Kriegstag aussahen, hat sich sogar ein Fotograf gefunden, um uns aufzunehmen. Noch empfanden die Schwestern Lolas Flausen als tröstlich, als könnte deren Verrücktheit sie vor dem Unglück schützen, das absehbar auf sie zurollte und ihren weiteren Lebensweg bestimmen würde.
Im Hause Ćurlin lebte man ruhig und sicher, auch in Kriegszeiten wohlhabend. Dundo Andrija, ein angesehener, unnahbarer Herr, ließ sich mit den Machthabern gerade so weit ein wie unbedingt erforderlich, also wenig bis gar nicht, denn er wurde wegen seines Sachverstandes in finanziellen und kaufmännischen Dingen hofiert. Sie waren eine der wenigen Familien, die zu Hause ein Telefon hatten. Der Name steht im Fernsprechverzeichnis für das Jahr 1942 auf S. 396, einer von nur sechs Anschlüssen in Dubrovnik unter den Anfangsbuchstaben Č/Ć: Ćurlin, Sekretär der Handelskammer, Bunićeva poljana 1. Die Adresse war bis zu Tante Lolas Tod eine der wenigen unverrückbaren Tatsachen in der Geschichte der Stublers. Alles andere hat sich mehrfach geändert, ging verloren, wurde getilgt oder verschwand. Andrija Ćurlins Telefonnummer lautete 640.
Wir wählten sie im Herbst 1943, meldeten, Mladen, der Sohn von Lolas jüngerer Schwester Olga, meiner Nonna, sei im Kampf gegen die Partisanen gefallen.
Eine schreckliche Nachricht. Lola ahnte, dass es damit nicht sein Bewenden haben würde, dass es nur der Anfang von etwas war, was selbst heute, nachdem sie alle tot sind, noch nicht zu Ende ist. Die letzten Stublers waren geboren, nun konnte man zusehen, wer wann starb und wer wegen wem Gewissensbisse hatte.
Im Frieden nach dem Krieg, beim Wiedersehen der drei Schwestern und des Bruders, sollte man zum ersten Mal Unterschiede in Aussprache, Betonung und Sprachmelodie hören. Lukre redete wie eine aus Dubrovnik, den anderen hörte man die Bosnier an. Nur das Deutsch klang bei allen gleich. Die Familiensprache, die Sprache des Vaters.
Der Krieg war schon aus, da wechselte Željko, das Fliegerass der Familie, noch einmal die Uniform: Aus dem Piloten der altehrwürdigen Royal Air Force wurde ein Mitglied von Titos junger Armee. Eines Tages besoff er sich sinnlos, startete vom Militärflughafen Borongaj in Zagreb und stürzte in den Tod. Warum ist das passiert? Hat sich Željko umgebracht?
Von seinem Schicksal und Charakter, davon, dass er im Frühjahr 1945 bei der Bombardierung Sarajevos dabei war und hinterher seinen Tanten Olga und Regina erzählte, er hätte ihre Häuser geschont, handelt mein Roman Gloria in excelsis. Darin ist praktisch alles erfunden, damit ich Željko so wahrhaftig wie möglich schildern konnte.
Zwischen zweien der Stubler-Schwestern und ihren Männern standen nach dem Krieg die toten Söhne.
Von der schleichenden Erosion, der Reue, den stummen, unausgesprochenen wechselseitigen Vorwürfen lässt sich kaum erzählen. Mein Nonno Franjo und Dundo Andrija haben ihre Söhne weder in den Tod geschickt noch Heldentaten von ihnen erwartet. Weder meine Nonna Olga noch Tante Lola haben getan, was ihre Männer von ihnen erwarteten, damit die Söhne am Leben blieben. Das blieb bis zuletzt spürbar. Beide Mütter waren zu ihrem eigenen und Željkos und Mladens Unglück stärker als die Väter. Sie haben die Entscheidungen getroffen, Druck gemacht, mal zum Wohl der Söhne, mal zum eigenen Vorteil, gemäß dem eigenen Temperament, der eigenen Hysterie; wenn sie schon die eigenen Ehemänner nie ganz akzeptieren und lieben konnten, wollten sie wenigstens gute Söhne haben. Und die sind dann umgekommen.
Tante Lola erschütterte Željkos Tod mehr als die mütterlichste Mutter. Sie tobte durch die Wohnung und durch Dubrovnik, sie tobt bis heute durch die Briefe der Familie und deren ewig unsichere Erinnerungen, inzwischen aus dritter Hand, überliefert von Personen, die Tante Lola nicht persönlich kannten.
Es war, als wäre Željkos Schatten auf ihre ungebärdige Freiheit gefallen. Was hat sie nicht unternommen, um ihm zu entgehen: Sie musste unbedingt mit Dundo Andrija nach Peru (wovon eine Erzählung in Mama Leone handelt) und wenig später zurück nach Dubrovnik ziehen – Lima sei einfach zu weit über Normalnull, war ihre Begründung. Dann adoptierten sie einen Jungen, Šiško; den brauchte sie, um Željko zu vergessen. Ihr neuer Sohn. Aber er erfüllte die Erwartungen nicht, er war eben nicht Željko, dessen Klugheit und Herzensgüte inzwischen unfassbare Dimensionen angenommen hatte.
Sobald er alt genug war, fuhr Šiško zur See, kam einmal pro Jahr nach Hause. Ich war drei Jahre alt, als ich ihn kennenlernte. Dundo Andrija war längst gestorben, wir besuchten Tante Lola in ihrer schönen großen Wohnung an der Piazza. Šiško nahm mich mit zum Hafen, zeigte mir Schiffe und fotografierte mich auf einem gewaltigen Metallpoller. Ich hatte wahnsinnige Angst, ins Wasser zu fallen.
In demselben Sommer zerstritt er sich mit der Pflegemutter. Ich weiß nicht, worum es ging oder was sie ihm an den Kopf warf; wir sahen ihn nie wieder. Richtig zur Familie gehörte er nie, so wenig wie Tante Lola, aber das lag an ihr. Wir wissen nicht, ob er noch lebt, wenn ja, besucht er Dubrovnik vielleicht immer noch, während von uns keiner mehr dort lebt, weder dort noch anderswo, einer nach dem anderen ist abgetreten. Falls Šiško lebt, möge er in Frieden leben.
Branka, meine Tante, Lolas Tochter, wuchs zu einer markanten, aufrechten Frau heran, studierte Medizin und wurde Anästhesistin. Vom Vater hatte sie das sanfte, reine Naturell geerbt, von der Mutter die Neigung zum ungebundenen Leben. Sie arbeitete in Zagreb, im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, und ehelichte den Schauspieler Jovan Ličin. Ihre große, ungetrübte Liebe versiegte, sie ließen sich scheiden, und Branka heiratete nach Deutschland, gebar mit weit über vierzig Tochter Katarina und starb bald darauf im Schlaf. Ein Aneurysma, hieß es. Sie wurde fünf Jahre älter als Tante Lola.
Karla, Lukrecija, Lukre, Lola Ćurlin, geborene Stubler, liegt in Boninovo begraben, zusammen mit Dundo Andrija, Željko und Branka. Ganz schön viele Särge für ein einziges Grab. Bei Brankas Beisetzung sah es so aus, als wäre für ihren kein Platz mehr. Dann schlug einer der Totengräber mit dem Spaten auf Tante Lolas Sarg, und der Sarg zerfiel zu Staub. Um uns die Strapaze zu ersparen, die die Suche nach einem neuen Grab mit sich gebracht hätte, schob er Lolas Gebeine zur Seite, so passte der vierte Sarg, aus Deutschland eingeflogen, noch hinein. Wer weiß, was wir ohne den Totengräber mit Brankas Leichnam gemacht hätten. So ist es gut. Sehr gut. In Dubrovnik haben wir keinen mehr, nur ein überfülltes Grab, das wir nie besuchen und zwischen den vielen fremden Gräbern bestimmt nicht wiederfinden.
Josip Sigmund möge euch auf der Seele liegen
Schade, dass unser Nano keine Kinder bekam. Seine Gene zerstoben im Wind, der Zweig verdorrte, der Nachname Stubler erlosch, weil Karlos einziger männlicher Nachfahre nicht heiratete und keinen rechtmäßigen Erben hinterließ.
Und das hatte äußerst sentimentale Gründe. Auch wenn Rudolf Stubler, oberflächlich betrachtet, ein fauler Hund gewesen zu sein scheint – erst mit über vierzig trat er seine erste Stelle an –, er hatte ein gebrochenes Herz.
Von klein auf ein Ass mit akkurat-schnörkeliger Handschrift, Matura mit Auszeichnung bestanden, belesen, begabt in sämtlichen schönen Künsten, der geborene Mathematiker (aus allen Ecken Bosniens und Dalmatiens pilgerten Schüler nach Dubrovnik, um den siebenjährigen Rudi zu sehen, wie er die kompliziertesten arithmetischen und geometrischen Aufgaben löste), als sei er mit dem ganzen Wissen bereits auf die Welt gekommen, verstand es sich von selbst, dass Rudi die Hochschule besuchte, natürlich in Wien. Fraglich war allein die Fachrichtung und in welchem Gebiet er unserer Epoche seinen Stempel aufdrücken würde.