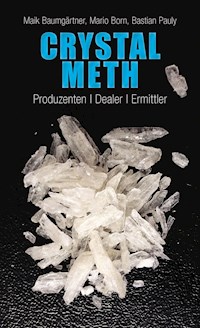9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frauen undercover: Der Einfluss von Geheimagentinnen in Deutschland
James Bond und Jason Bourne prägen unser Bild über die Arbeit von Geheimdiensten. Aber in der Realität sind nicht nur Männer als Agenten tätig. Schon seit dem Kaiserreich arbeiten viele Frauen für deutsche und internationale Nachrichtendienste. Sie stehlen militärische Dokumente, überwachen und sabotieren ihre Gegner, rekrutieren Informantinnen und enttarnen feindliche Spione. Doch obwohl Agentinnen ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen, wird ihr Einfluss auf die Geschichte bis heute unterschätzt. Maik Baumgärtner und Ann-Katrin Müller haben ihre geheimen Fälle der vergangenen hundert Jahre recherchiert, zahlreiche Akten ausgewertet und mit ehemaligen und aktiven Geheimagentinnen gesprochen, die für oder in Deutschland im Einsatz waren. In diesem Buch erzählen die beiden SPIEGEL-Journalisten ihre Geschichten und zeigen, wer die Frauen waren, die der heutigen Generation von Spioninnen den Weg ebneten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Frauen undercover: Der Einfluss von Geheimagentinnen in Deutschland
James Bond und Jason Bourne prägen unser Bild über die Arbeit von Geheimdiensten. Aber in der Realität sind nicht nur Männer als Agenten tätig. Schon seit dem Kaiserreich arbeiten viele Frauen für deutsche und internationale Nachrichtendienste. Sie stehlen militärische Dokumente, überwachen und sabotieren ihre Gegner, rekrutieren Informantinnen und enttarnen feindliche Spione. Doch obwohl Agentinnen ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen, wird ihr Einfluss auf die Geschichte bis heute unterschätzt. Maik Baumgärtner und Ann-Katrin Müller haben ihre geheimen Fälle der vergangenen hundert Jahre recherchiert, zahlreiche Akten ausgewertet und mit ehemaligen und aktiven Geheimagentinnen gesprochen, die für oder in Deutschland im Einsatz waren. In diesem Buch erzählen die beiden SPIEGEL-Journalisten ihre Geschichten und zeigen, wer die Frauen waren, die der heutigen Generation von Spioninnen den Weg ebneten.
Ann-Katrin Müller, geboren 1987, recherchiert seit 2013 für den SPIEGEL, häufig zur AfD und zu Innerer Sicherheit, aber auch zu Desinformation, sexualisierter Gewalt und Frauenfeindlichkeit. Zuvor studierte sie Politikwissenschaften und European Studies in Bonn und London und volontierte beim ARD-Polittalk »hart aber fair.« Sie ist Mitautorin des SPIEGEL/DVA-Buchs Lockdown. Wie Deutschland in der Coronakrise knapp der Katastrophe entkam (2021).
Maik Baumgärtner, geboren 1982, schreibt seit 2011 für den SPIEGEL, meist zu politischen Sicherheitsthemen und Geheimdienstarbeit. Seine Recherchen veröffentlichte er auch beim ARD-Politikmagazin Monitor und bei Deutschlandradio. Er ist Mitautor verschiedener Bücher und Broschüren über Rechtsextremismus und Drogenkriminalität. Im Bereich Investigation hat er den Deutschen Reporterpreis und den Nannen Preis gewonnen.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Maik Baumgärtner | Ann-Katrin Müller
Die Unsichtbaren
Wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München,
und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG,
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt
Coverabbildung: akg-images
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-328-11189-4
e-ISBN978-3-641-28838-9V003
www.dva.de
Für Ann-Katrins Oma,
»Uns wird niemand verdächtigen. Wir sind Frauen.«
KGB-Agentin Sonya in Geheimnis eines Lebens
Inhalt
VORWORT
1 Damenbinden, Geheimtinte, Tabakpfeifen
Spioninnen erobern das Kaiserreich
2 Schnaps, Tanzen, Decknamen
Die Feinde der Weimarer Republik im Visier der Frauen
3 Verschlüsseln, Funken, Lügen
Eine Doppelagentin im Kampf gegen Nazideutschland
4 Tratschen, Trinken, Abhören
Die Agentinnen der CIA in Ost-Berlin
5 Affären, Observationen, Wanzen
Wie mit Sekretärinnen die DDR infiltriert wird
6 Romeos, Entführungen, Kopierer
Die »Kundschafterinnen« der Stasi im Westen
7 YouTube, Schütteln, Kompromate
Alte Feindinnen im neuen Jahrtausend
8 Denkfabriken, Fake-Profile, Backkünste
Wie Nachrichtendienstlerinnen heute ihre Netze auswerfen
Nachwort
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Kontaktmöglichkeit
Vorwort
Sie will sich nur per Telefon verabreden, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen, auch nicht über einen verschlüsselten Messenger. Die Gespräche sind kurz. Erst möchte sie wissen, wann wir in der Stadt sind. Dann schlägt sie ein Restaurant vor, sagt, wir sollen nicht beim Kellner nach ihr fragen, sondern direkt auf die Terrasse gehen und uns einen freien Tisch suchen. Sie würde uns schon erkennen. Angebahnt hatte das Treffen ein ehemaliger Kollege von ihr, sonst hätte sie sich gar nicht drauf eingelassen. Es klappt, das Gespräch wird lang, ihre Erfahrungen sind in dieses Buch eingeflossen. Sie, das ist eine ehemalige Agentin, die zwar schon seit ein paar Jahren nicht mehr für einen deutschen Nachrichtendienst arbeitet, aber viel aus ihrer Zeit zu berichten hat. Und die noch weiß, wie man möglichst wenig Spuren hinterlässt.
Sie ist eine der Unsichtbaren.
Seit dem Kaiserreich werden Frauen professionell für die Arbeit in Nachrichtendiensten eingesetzt, für und gegen Deutschland – und doch weiß fast niemand etwas darüber, wer sie waren, was sie taten und was sie erreicht haben. Ihre Geschichten wurden bis heute kaum erzählt. Hinter feindlichen Linien und in laufenden Konflikten riskieren die Unsichtbaren alles, sterben auf gefährlichen Missionen, werden nach Entdeckung enthauptet oder verbüßen lange Gefängnisstrafen. Auf ihren Missionen bringen sie Menschen aller Gesellschaftsschichten dazu, Informationen und Dokumente aus Politik, Wirtschaft und Militär zu verraten. Und auch wenn es in der Natur ihrer Arbeit liegt, dass diese im Verborgenen geschieht, fällt auf, dass ihre Erlebnisse im Vergleich zu denen ihrer männlichen Kollegen schlecht aufgearbeitet sind. Es gibt nur wenige Bücher oder Dokumentationen über sie, nur in Ausnahmefällen kennt man ihre Namen oder die Operationen, denen sie zum Erfolg verholfen haben. Sie sind doppelt unsichtbar – bis heute.
Dieses Buch soll das ändern. Wir wollen die noch unbekannten Fälle aus historischen Akten ans Tageslicht holen und die wenigen bekannten detaillierter und wahrheitsgetreuer nachzeichnen. Denn die Unsichtbaren haben Historisches geleistet, stehen ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Gemeint sind nicht Frauen wie Mata Hari, jene Erotiktänzerin, die das falsche Bild von Agentinnen als sogenannte Honigfallen geprägt hat und deren Bedeutung fast immer überschätzt wird. Sondern etwa jene Frau, die Mata Hari ausbildete und wirklich Relevantes schaffte, indem sie ein erfolgreiches Netzwerk aus französischen Deserteuren aufbaute, ganz ohne die sprichwörtlichen Waffen einer Frau. Oder jene Doppelagentin, die mit dafür verantwortlich ist, dass der D-Day gelang und die Nationalsozialisten besiegt werden konnten. Oder jene Sekretärinnen, die mächtige Männer ausspionierten, darunter ein DDR-Ministerpräsident und ein Generalsekretär der CDU. Sie haben Geschichte verändert, mal zum Positiven, mal zum Negativen. So oder so, wir machen sie sichtbar.
Genau wie jene Frauen, die heute im Verfassungsschutz oder im Bundesnachrichtendienst arbeiten. Sie leisten mindestens ebenso gute – oder schlechte – Arbeit wie ihre Kollegen, doch bis heute hat es keine von ihnen in das Präsidentenamt der beiden Bundesbehörden geschafft. Nur der Militärische Abschirmdienst wird inzwischen von einer Frau geleitet. Auch bei den Landesämtern für Verfassungsschutz sieht es kaum besser aus, allein Baden-Württemberg hat aktuell eine Präsidentin. Alle deutschen Nachrichtendienste beschäftigen generell viel zu wenige Frauen, gerade im Operativen, was sie selbst bemängeln. Dabei geht es nicht nur um Gleichberechtigung, sondern um Sicherheit: Mitarbeiterinnen im Nachrichtendienst observieren und analysieren mit ihrem eigenen, aus ihrer Sozialisation gewachsenen Blick. So können sie entscheidend dazu beitragen, Terroristen oder Spioninnen von ausländischen Diensten zu enttarnen.
Um die Unsichtbaren sichtbar zu machen, haben wir mit aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Nachrichtendiensten gesprochen, die für oder in Deutschland im Einsatz waren. Sie sind auf unterschiedlichen Führungsebenen tätig, manche im operativen Einsatz, andere am Schreibtisch. Einige haben wir offiziell über die Pressestellen angefragt, andere auf zum Teil verschlungenen Wegen kontaktiert. Bei fast allen Gesprächen gab es einen Moment, in dem die Befragten nachdenklich wurden, manchmal schon bei der Anfrage, manchmal später. Sie wunderten sich, warum bislang so wenig über Frauen in Nachrichtendiensten gesprochen und geschrieben wurde. Oder sie räumten ein: »Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dabei ist es total relevant.« Zusätzlich haben wir aktuelle, geheime Dokumente aus den Behörden ausgewertet, die uns während der Recherche von Informantinnen und Informanten übergeben wurden.
Außerdem gingen wir in Berlin-Lichterfelde, Koblenz und Freiburg auf die Suche nach historischen Fällen – und kamen mit tausenden Dokumenten und zähen Rückenschmerzen zurück, den nicht-ergonomischen Stühlen sei Dank. An den drei Orten lagert das Bundesarchiv die Akten, die uns interessierten, vor allem in Lichterfelde. Die Recherche war aufwendig: Wir suchten nach Aktenbänden mit den Stichworten »Landesverrat« oder »Spionage« und blätterten sie Seite für Seite durch, in der Hoffnung, darin einen Frauennamen zu finden. Wenn wir einen entdeckten, fotografierten wir alle betreffenden Dokumente zu der Frau ab, wieder Seite für Seite. Wir fanden säuberlichst per Hand geschriebene Urteile und Briefe, die schon etwas muffig rochen, Dokumente mit verblassender Schreibmaschinenschrift, zerfledderte Durchschläge, schief aufgeklebte Telegramme, Wachs- und Papiersiegel mit verschiedensten Adlern und Wappen, »Geheim«- und »Streng Geheim!«-Stempel in Rot, Schwarz und Lila. Und Hakenkreuze, immer wieder Hakenkreuze.
Wir durchsuchten Landes–, Stadt- und Kirchenarchive und wühlten uns durch die Online-Datenbanken der Nationalarchive Großbritanniens, der USA, der Schweiz und Frankreichs, verbrachten viel Zeit im »Elektronischen Lesesaal« der CIA. Das Stasi-Unterlagen-Archiv lieferte auf unsere Anfrage hin Dokumente, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst de-klassifizierten Akten. Dazu lasen wir Bücher über Geheimdienstoperationen und über jene Agentinnen, deren Geschichten schon beschrieben wurden, meist Engländerinnen oder Amerikanerinnen. Die wenigen Autobiografien von Agentinnen, die es gibt, haben wir mit Vorsicht behandelt. Nicht nur, weil sich Menschen gerne klüger darstellen als sie sind und unkritisch auf ihr Leben blicken, sondern weil Agentinnen und Agenten gelernt haben, ihr wahres Ich gut zu verstecken und mit Lügen und Desinformation zu arbeiten, ebenso wie ihre Auftrag- oder Arbeitgeber.
Bei den historischen Fällen haben wir uns deswegen an Gerichtsurteilen orientiert, bei denen die Richter der Meinung waren, genügend Beweise für Landesverrat gefunden zu haben. Zusätzlich haben wir recherchiert, welche Rechte Frauen zu ihren jeweiligen Lebzeiten hatten und welche Spionagewerkzeuge spezifisch für sie entwickelt wurden, etwa Lippenstifte, die als Waffen dienten, oder Parfumflakons, in denen geheime Tinte geschmuggelt wurde. Die Aktenlage variiert stark, so zerstörten die Nationalsozialisten viele Dokumente, als sie merkten, dass sie den Zweiten Weltkrieg verlieren. Die Stasi tat dies rund um die Wende ebenso. Die Akten aus den Jahren nach 1945 bekamen wir häufig mit Schwärzungen von Namen und Adressen, der Inhalt war aber fast immer verständlich. Die Kapitel, die sich mit der jüngeren Vergangenheit befassen, haben wir über geheime Dokumente und Medienberichte rekonstruiert. Außerdem haben wir viele vertrauliche Gespräche geführt, zu denen wir aus Quellenschutzgründen keine genaueren Details angeben können. Insgesamt kamen so zehntausende Seiten zusammen, die wir ausgewertet haben.
Zwischendurch sahen wir zur Abwechslung KGB-Agentin Anna dabei zu, wie sie in einem Moskauer Fünf-Sterne-Restaurant dutzende Menschen tötet, bevor sie sich – zumindest auf den ersten Blick – von der CIA anwerben lässt. Der Film von 2019, der so heißt wie seine Hauptfigur, ist einer von wenigen, in denen eine Agentin erfolgreich und ohne einen Mann an ihrer Seite ihre Missionen erledigt. Denn während in der Weimarer Republik sowohl Greta Garbo als auch Marlene Dietrich Hauptrollen als Spioninnen besetzten, jagte seit der NS-Zeit über Jahrzehnte keine relevante Schauspielerin mehr Widersacher allein über die Leinwand. Statt weiblichen James Bonds oder Jason Bournes folgten Filme und Serien, in denen Frauen ganz nach Klischee spionieren: Sie machen ihre Gegner mithilfe ihres Aussehens und ihres Sex-Appeals gefügig oder spielen charmante Hausfrauen, die mit mehr Glück als Verstand einem amerikanischen Geheimdienst helfen, wie Amanda King, die Agentin mit Herz. Oder sie sind tough, werden aber wie Carrie Mathison in Homeland gleichzeitig extrem emotional dargestellt. Nur ab und an gibt es sichtbar starke Frauen wie Anna oder Elizabeth Jennings aus The Americans, die durch ihre eigenen Fähigkeiten überzeugen und deren Weg ähnlich wie der von »007« mit Leichen gepflastert ist.
Auch in Büchern und Medienberichten werden Geheimagentinnen dauernd sexualisiert, selbst 2010 noch wurde eine enttarnte russische Spionin »Null-Null-Sex« getauft. Bei diesem öffentlichen Bild verwundert es kaum, dass sich nicht genügend Frauen für die nachrichtendienstliche Arbeit interessieren. Hinzu kommen zahlreiche Skandale der deutschen Nachrichtendienste: Neben dem NSU-Skandal und der Überwachung von Journalistinnen und Journalisten haben die Äußerungen so manches ehemaligen Behördenchefs das Vertrauen in die Ämter zusätzlich massiv bröckeln lassen. Umso wichtiger wäre es, dass mehr Frauen bei den Diensten arbeiten. Unser Buch zeigt, dass sie häufig diejenigen waren und sind, die sich für mehr Transparenz und klare Regeln einsetzen. Und es belegt, dass das öffentliche Bild von Agentinnen nicht zu den Frauen passt, die die deutsche Geschichte geprägt haben – und es bis heute tun. Sie sollten nicht länger unsichtbar sein.
1
Damenbinden, Geheimtinte, Tabakpfeifen
Spioninnen erobern das Kaiserreich
Sie war nicht schnell genug. Plötzlich steht ihr Nachbar wieder in seinem Zimmer in der Berliner Pension in der Nähe vom Kurfürstendamm, wo sie beide wohnen – und wo sie sich gerade über die militärischen Dokumente auf seinem Schreibtisch beugt. Die 25-jährige Russin Zinaida Smoljaninow rettet die Situation, indem sie den Nachbarn lachend rügt: Er sei aber unvorsichtig, sie hätte ihm ja die Pläne klauen können. Auf seine Frage, was sie denn damit anstellen wolle, kontert sie, ob er denn nicht wisse, was man mit solch wichtigen Dokumenten machen könne. Sie wisse es jedenfalls, sagt sie. Dann schlägt sie vor, dass sie die Pläne von einem Militärattaché der Russen abfotografieren lassen könnte, gegen Geld.
Doch ihr Nachbar weigert sich, schimpft, welcher ungeheuren Gefahr sie ihn und sich selbst aussetzen würde und welche Verbrechen sie ihm zutraue. Kein deutscher Offizier würde sich darauf einlassen. Sie erwidert, dass sie schon geheimere Missionen ausgeführt habe. Er müsse sein Gewissen nicht belasten und ihr nicht aktiv helfen, solle einfach nur die Pläne auf dem Tisch oder sonst wie unverschlossen liegen lassen, um den Rest kümmere sie sich dann. Er lehnt ihr Angebot ab.
Smoljaninow lässt nicht locker, spricht ihn immer wieder darauf an, fragt ihn, ob er Schulden hat. Er gibt an, dass er welche hat, etwa 5000 Mark. Auch sie benötigt Geld – und sagt, man könne mit dem Verkauf wertvoller Papiere bis zu 60 000 Mark verdienen. Ob er nicht welche beschaffen könne? Wieder und wieder wiegelt der Nachbar ab, sagt, das gehe gegen seine Ehre und sein Gewissen, droht ihr sogar mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Als er ihr wieder etwas später erzählt, dass er bald in der Eisenbahnabteilung des Großen Generalstabes arbeiten werde, bittet sie ihn erneut. Einer von den Russen, die sie kenne, würde ihr Nachrichten über die Mobilmachung an der Südostgrenze des deutschen Kaiserreichs aus den Händen reißen. Der Mann heißt Oberst von Schebekow und ist Militärattaché an der russischen Botschaft in Berlin, er kennt den Kaiser persönlich.
Es ist der Frühsommer 1905 und die Russen sorgen sich, dass die Deutschen weiter aufrüsten. Im April hatte der Reichstag beschlossen, das deutsche Heer in den kommenden vier Jahren um 10 000 Mann aufzustocken. Fünf Jahre zuvor hatte der Reichstag bereits das neue Flottengesetz angenommen und massiv aufgerüstet. Die Jahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts stehen im Zeichen von machtpolitischen Rivalitäten: 1902 hatte das Deutsche Reich seinen Dreibund mit Österreich-Ungarn und Italien erneuert. Die Annäherung der einstigen Rivalen England und Frankreich sorgt mehr für Nervosität als für Stabilität, zumindest aus deutscher Sicht. Denn Kaiser Wilhelm II. will einen »Platz an der Sonne« für sein Reich, das inzwischen ein Industriegigant ist. Es ist allerdings auch äußerst reaktionär und militaristisch eingestellt. Wegen des aggressiven deutschen Machtstrebens schließen sich Russland, Frankreich und Großbritannien nur wenig später, 1907, zur Triple Entente zusammen.
Smoljaninow ist also sicher: Für Dokumente zur deutschen Mobilmachung würden die Russen Tausende Mark zahlen. Plötzlich lenkt der Nachbar ein, sagt, er werde sich um ein solches Dokument kümmern. Smoljaninow informiert den Oberst. Der Nachbar organisiert kurz darauf drei Schriftstücke. Die ersten beiden sind als »Geheim« markiert und tragen den Stempel der »Eisenbahn-Abteilung des Großen Generalstabes«, dazu eine Journalnummer und Unterschriften von Eisenbahn- und Militärbevollmächtigten.[1] Es geht darin um die Maßnahmen, die im Falle einer Mobilisierung im Eisenbahndirektionsbezirk Kattowitz ergriffen werden sollen. Das dritte ist ein Lageplan des Bahnhofs Vossowka.
Kurz vor der Übergabe hat der Nachbar jedoch wieder Gewissensbisse und will die Dokumente nicht mehr weitergeben. Stattdessen verschließt er sie in seinem Militärkoffer. In einem passenden Augenblick nimmt sich Smoljaninow heimlich den Schlüssel vom Schreibtisch und die Dokumente aus dem Koffer. Sie zeigt sie dem Oberst, der ihr rät, Abschriften anzufertigen und diese zu dem Militärattaché der russischen Botschaft in Brüssel zu bringen. Sie schmuggelt die Schriftstücke zurück in den Koffer – und bittet den Nachbarn, sie abschreiben zu dürfen. Wieder lehnt er ab.
Als er abends sein Zimmer verlässt, stiehlt sie die Dokumente erneut und schreibt sie ab. Wenig später beichtet sie ihrem Nachbarn, was sie getan hat, und bittet dabei um einen bestimmten Lageplan sowie um weitere Schriftstücke. Als er diese dann tatsächlich besorgt, wiederholt sie die Abschreiberei. Den Plan schmuggelt sie gar ins Haus eines ihr bekannten russischen Propstes, um ihn dort abzufotografieren. Die Aktion misslingt, weswegen sie ihn am Ende abpausen muss. Oberst von Schebekow meldet Smoljaninow derweil in Brüssel an, schreibt seinem Kollegen, dass sie 2500 Mark für die Dokumente bekommen soll. Am 18. Juni 1905 reist die junge Frau los – und kehrt sechs Tage später mit dem Geld zurück. Der Nachbar bekommt 1500 Mark, sie quittiert ihm das und unterschreibt als Frau »Engelhard«. Dann reist sie nach Baden-Baden zu einer Freundin. Dort wird sie am 26. Juni verhaftet.
Was Smoljaninow nicht wusste: Der nette Nachbar, Karl Bader, ist nicht aus Zufall in das Zimmer neben ihr gezogen. Er ist ein verdeckter Ermittler, den die Polizei auf sie angesetzt hat. Die Dokumente, die er besorgte, waren extra für sie gefälscht. Manche Details fehlen, andere wurden verändert. Aber Smoljaninow hat Glück im Unglück: Die Behörden haben nun zwar etwas gegen sie in der Hand und können Anklage erheben. Doch da die Dokumente nicht echt waren, ist ihr Strafmaß gering, schließlich hat sie das Deutsche Reich nicht wirklich gefährdet. Am 18. November 1905 wird sie wegen des Verrats militärischer Geheimnisse zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Mark verurteilt.
Tatsächlich hatte die Polizei Smoljaninow schon länger im Visier. Im Frühjahr 1904 war sie erkrankt, soll dann einem Arzt »alsbald von ihren Beziehungen zum auswärtigen Amte und zu Offizieren des Generalstabs«[2] berichtet haben. Der habe sie deswegen als verdächtig gemeldet. So steht es im Urteil, das im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde liegt, in schwarzer Tinte schnörkelig auf schon leicht gelbem Papier, die Blätter längs mittig geknickt. Auch ihrer Vermieterin soll sie angeblich »oft und mit Vorliebe« erzählt haben, dass »sie viel mit Offizieren verkehre und dass sie alles erfahren könne, was sie zu wissen wünsche«.[3] Außerdem war der Vermieterin aufgefallen, dass Smoljaninow »größere Geldsummen aus Rußland erhielt und ihre Briefe stets eigenhändig der Post zur Beförderung übergab«.[4]
Die Polizei ermittelt also, findet jedoch nur heraus, dass Smoljaninow gute Kontakte in die russische Botschaft hat. Mehr können sie ihr nicht nachweisen. Ein Kriminalkommissar greift daraufhin zu einem drastischeren Mittel: er rekrutiert den Fabrikanten Karl Bader, einen Offizier im »Beurlaubtenstand«, wie es damals hieß. Er soll Smoljaninow bespitzeln und herausfinden, ob sie spioniere. Einzige Einschränkung: Bader darf sie nicht provozieren. Das erklärt, warum er ihr die Dokumente nie freiwillig gibt, immer wieder einen Rückzieher macht. Die Polizei braucht einen Beweis dafür, dass Smoljaninow aktiv wird, ohne angestiftet worden zu sein.
Im April 1905 zieht Bader in der Pension ein und legt militärwissenschaftliche Bücher, Karten und Pläne in seinem Zimmer aus. Smoljaninow wohnt direkt nebenan, kann sogar durch eine Glastür zwischen den beiden Räumen zu ihm hineingucken. Die beiden kommen ins Gespräch, sie denkt, er sei Offizier in »verantwortungsvoller Stellung«, der sich mit geheimen Dingen beschäftigt. Die Falle ist zugeschnappt.
Ein gutes halbes Jahr später, am 28. November 1905, schreibt selbst die New York Times über »die schöne Autorin« Smoljaninow und ihren Gerichtsprozess. Und das, obwohl sowohl das Auswärtige Amt als auch der Reichskanzler das Reichsjustizamt mehrfach darum gebeten hatten, das Verfahren möglichst geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Das sei »im Interesse der inneren wie der äußeren Politik«[5]. Die Times weiß trotzdem zu berichten, dass Smoljaninow schnell in »offizielle, aristokratische und Finanzkreise« vorgedrungen ist, nachdem sie aus St. Petersburg nach Berlin gezogen war. Auffällig sei aber gewesen, dass ihr Jahresgehalt niemals ihre Ausgaben hätte decken können, dafür habe sie zu prunkvoll gelebt. Außerdem hätte sie verschiedene Namen für Korrespondenz benutzt. »Der Fall weckt große Neugierde wegen des Geheimnisses um ihre Persönlichkeit und der gegen sie erhobenen Vorwürfe«, so die Zeitung.
Zinaida Smoljaninow, die am 29. August 1880 bei Moskau geboren wurde, kam 1900 nach Berlin. Sie unterrichtete Russisch, meist Mitglieder deutscher Offiziersfamilien. Und sie übersetzte aus dem Deutschen, vor allem für eine in Moskau erscheinende Zeitung. Mit ihrem Ausweis als Zeitungskorrespondentin hatte sie Zutritt zur russischen Botschaft, lernte so etwa Oberst von Schebekow kennen. Die Richter attestieren ihr, dass sie »eine gewisse Bildung und Gewandtheit besitzt«[6]. Auch meinen sie, bei ihr »weibliche Eitelkeit« sowie eine »Neigung zur Ruhmredigkeit« zu entdecken.[7] Entscheidend ist für die Richter aber, dass Smoljaninow »einen überaus hartnäckigen verbrecherischen Willen an den Tag gelegt hat«[8]. Schließlich habe sie »einzig und allein aus Gewinnsucht gehandelt« und »keinen Augenblick gescheut«, als ihr Nachbar Bader gezögert habe.[9] Sie sei dabei »eifrig und ernstlich bestrebt gewesen«[10]. Milde lassen sie deswegen nicht walten.
Smoljaninow streitet alles ab. Sie habe versucht »auf das Bestehen guter Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und Rußland hinzuwirken«[11], sagt sie vor Gericht. Ihr Geld habe sie von ihrem Job bei der Zeitung, außerdem unterstütze ihre Mutter sie, wann immer sie das benötige. Und wenn demnächst 3000 Mark von einem russischen Militärattaché an sie geschickt würden, beweise dies gar nichts. Das bekäme sie nur, weil sie für ihn ein deutsches Militärbuch beschaffen und übersetzen solle. Die Notizen, die sie bei sich trage, seien ebenso harmlos. Sie schreibe sich einfach alle Briefadressen auf, mit denen sie jemals korrespondiert habe. Und den kleinen Taschenatlas trage sie lediglich bei sich, um sich »über die Vorgänge in der Manjurei auf dem laufenden zu halten«[12].
Die Richter glauben ihr nicht. Sie lassen auch nicht gelten, dass Smoljaninow sagt, ihr Nachbar habe sie zu der Tat verleitet. Denn der habe bezeugt, dass er den Auftrag nur »übernommen habe, um dem Vaterlande einen Dienst zu leisten«[13]. Bader habe sich »streng jeder provokatorischen Anreizung zu einer Straftat enthalten« und gegenüber Smoljaninow »kein unlauteres Mittel« angewendet.[14] Er habe beispielsweise nicht versucht, »sie durch Weingenuß zur Offenlegung ihres Treibens zu bewegen«[15]. Ein militärischer Sachverständiger habe zudem überzeugend dargelegt, dass die Schriftstücke die Sicherheit des Deutschen Reichs gefährdet hätten, wenn sie in echter Form an die Russen gelangt wären. Alles in allem habe es die Angeklagte verstanden, »ihre Kenntnisse und ihre Verbindungen geschickt zu benutzen, um den Verrat militärischer Geheimnisse zu betreiben, so daß sie als eine nicht ungefährliche Persönlichkeit zu bezeichnen ist«[16]. Da man ihr allerdings keine weitere, »vollendete« Spionage nachweisen kann, könne man sie nicht stärker bestrafen.
Ende August 1906, nicht ganz ein Jahr nach dem Urteil, versucht Smoljaninows Mutter ihre Tochter aus dem Gefängnis zu holen und richtet ein Gnadengesuch an den Kaiser. Der Oberreichsanwalt leitet die Bitte zwar an ihn weiter, empfiehlt aber, sie nicht zu erfüllen, schließlich müsse die Spionin nur noch zwei Monate im Gefängnis aushalten. Ende September meldet sich der Staatssekretär des Kaisers zurück – und lehnt das Gnadengesuch ab.
Smoljaninow ist eine von vielen Frauen, die während des Kaiserreichs als Geheimagentinnen arbeiten und gegen die Deutschen spitzeln. Es ist die Zeit, in der Spionage professionalisiert wird, auch der Einsatz von Frauen. Informationen über Aufrüstung und Truppenbewegungen sind viel wert, der Schutz vor feindlicher Bespitzelung ebenso. Die Angst vor ausländischen Nachrichtendiensten sowie ihren Zuträgerinnen und Zuträgern ist allgegenwärtig. Ein Spionageabwehr-Experte der Berliner Polizei schreibt 1917 in einer 13-seitigen Analyse: »Unsere Feinde wenden riesige Geldmittel für ihren Kundschaftsdienst auf.« Russland etwa habe schon zu Friedenszeiten 13 Millionen Rubel pro Jahr ausgegeben, das seien 30 Millionen Mark. Nun, während des Ersten Weltkriegs, sei es sicher noch mehr. England habe sogar 40 Millionen Mark, also 2 Millionen Pfund ausgegeben, Frankreich »ohne Zweifel mindestens ebensoviel«. Die Feinde hätten ihre Nachrichtendienste »überall großartig organisiert mit Nachrichtenoffizieren, Spionageschulen, seßhaften Residenzagenten, Reise- und Unteragenten, Gelegenheitsagenten, strategischen und taktischen Spionen, Handelsspionen, Vertrauensleuten, Kontrolleuren, Kurieren, Schleppern, Agents provocateurs usw.«. Sie würden zudem miteinander arbeiten – gegen Deutschland. Der Hauptmann ist alarmiert: »Wir haben es also, ich wiederhole es, mit einer gewaltigen, unheimlichen Macht zu tun.« Diese müsste man jetzt vor allem im Inland bekämpfen. Frauen bezieht der Hauptmann explizit in seine Warnungen mit ein, betont sogar: »Agentinnen haben mancherlei andere Wege, um Nachrichten zu erlangen.« Auf dieses »traurige Kapitel« brauche er wohl kaum näher einzugehen, schreibt er: »Erwähnt sei nur, daß sie leider viel Erfolg haben.«[17]
Wie viel zu der Zeit spioniert wird, zeigt eine Liste aus dem Jahr 1917. In nur einem halben Jahr, von August bis Dezember, werden 126 Personen von deutschen Gerichten rechtskräftig verurteilt wegen »Landes- und Kriegsverrates sowie wegen Verbrechen oder Vergehen gegen das Spionagegesetz«, zehn von ihnen gar zum Tode.[18] Die Mehrheit der Verurteilten hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, arbeitete aber für Russland, England, Frankreich, Belgien oder Italien. Unter ihnen befinden sich 17 Frauen. Und das sind nur diejenigen, die ertappt wurden, mit genügend Beweisen, um verurteilt zu werden.
Dass Frauen eine immer größere Rolle spielen, zeigen auch Akten des Reichsmarineamtes, die im Militärarchiv in Freiburg liegen: »Es sind Fälle bekannt geworden, in denen junge Damen (…) auf den Bahnhöfen und während der Eisenbahnfahrt die durchfahrenden Soldaten über Ziel und Zweck ihrer Reise sowie über sonstige militärische Nachrichten ausfragten und sich Notizen machten.« Es bestehe kein Zweifel, dass es sich um Agentinnen des französischen Nachrichtendienstes handele. »Durch liebenswürdiges Entgegenkommen verstehen sie es, sich die Soldaten sehr bald gefügig zu machen und aus ihnen alles Wissenswerte herauszuholen.«[19] Im selben Jahr meldet ein deutscher Nachrichtenoffizier, der in Belgien stationiert ist: »Am 21. sah ich in La Panne gegen 9 Uhr morgens, wie ein kleines Segelboot ankam, es wurde eine Frau an Land gebracht.«[20] Sie habe zu den Polizisten gesagt, sie käme aus Maastricht und hätte wichtige Informationen. Sie sei dann mit einem Auto nach Furnes gefahren worden. »Ausserdem wurde mir gesagt, dass Belgien Frauen zu[r] Spionage verwendet, die mit gutem Erfolg arbeiten sollen.«
Der Anteil der Frauen, die in den von Deutschland besetzten Gebieten in Belgien und Frankreich gegen das Kaiserreich spionierten, war in der Tat sehr hoch. Der Historiker Emmanuel Debruyne von der Université Catholique de Louvain ist Experte für Besatzungen während des Ersten Weltkriegs. Zuletzt hat er die Archive einer Nachkriegskommission ausgewertet, die sich mit dem Krieg der Geheimdienste in den besetzten Gebieten befasst hat. In den vier Jahren des Ersten Weltkriegs gab es laut seiner Analyse 224 Spionage-Netzwerke in Belgien und Frankreich. Nur 18 von ihnen bestanden ausschließlich aus Männern, 24 dagegen wurden von Frauen geleitet. Von den 6415 Agentinnen und Agenten, die Debruyne aus den Akten identifizieren konnte, waren 1772 Frauen, also fast 30 Prozent. Der Wissenschaftler erklärt sich den hohen Frauenanteil unter anderem so: »Nachrichtendienstliche Tätigkeiten eignen sich vielleicht besser als andere kriegerische, um Frauen die Möglichkeit zu geben, aus den ihnen traditionell vorgeschriebenen Aufgaben auszubrechen.« Zudem habe die Geheimniskrämerei der Spionage-Netzwerke dafür gesorgt, »dass das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern nicht öffentlich gestört wird, aber dennoch überschritten werden konnte«.[21]
Walthère Dewé, der damals eins der größten belgischen Geheimdienstnetzwerke namens »Die Weiße Dame« anführt, schreibt 1919: »Die Frauen haben eine beträchtliche Rolle in unserer Organisation gespielt. Ihre intellektuelle Unterstützung war für uns absolut unerlässlich.«[22] Sie seien an allem beteiligt gewesen, hätten »sowohl die höchsten als auch die elementarsten Funktionen inne« gehabt.[23] Das habe man absichtlich so verankert, indem »wir sie unterschiedslos auf alle Posten setzten … indem wir ihnen die heikelsten und gefährlichsten Aufgaben anvertrauten.«[24]
So ist es kein Wunder, dass die preußische Armee nur wenig später explizit auch vor »Spioninnen« warnt: »Soldaten! Laßt Euch nicht ausfragen! Seid vorsichtig bei Euren Unterhaltungen!«[25] Auf den Bahnhöfen, in Zügen und in Lokalen würden sich die Spioninnen herumtreiben, heißt es. »Sie knüpfen mit Euch, besonders mit Verwundeten Unterhaltungen an, bewirten Euch und suchen Truppenstellungen, Truppenverschiebungen, Neuformationen und militärische Einrichtungen und Maßnahmen zu erfahren.«[26] Wenn man Verdächtige beobachte, soll man sie von Wachen festnehmen lassen und darauf achten, dass sie nichts wegwerfen oder zerreißen können.
Um mehr über ihre Gegner zu erfahren, gründen die Deutschen im Mai 1915 zudem eine Nachrichtenstelle in Dresden. Deren Aufgabe ist es, »die zu jener Zeit einsetzenden Rückwanderungen deutscher Personen aus Russland für den Nachrichtendienst nutzbar zu machen«.[27] Offenbar mit Erfolg: »Täglich konnten absolut zuverlässige Augenzeugen über Russland und seine internen Verhältnisse befragt werden«[28], heißt es in einem Bericht aus der Zeit. Bis ins 21. Jahrhundert wird diese Methode in ähnlicher Form von Nachrichtendiensten genutzt, deutsche Behörden fragen etwa Flüchtlinge über ihre Herkunftsländer aus, teilweise ohne sich dabei korrekt zu identifizieren.
Auch die Deutschen setzen seit dem Kaiserreich vermehrt Frauen ein. In dem Buch Geheime Mächte von 1923 heißt es, dass der deutsche militärische Nachrichtendienst beim Großen Generalstab durch »Deutsche beiderlei Geschlechtes«[29] überlaufen worden sei. Nie zuvor hätten sich so viele Frauen und Männer für die Arbeit im Geheimen gemeldet. Das Buch hat einer verfasst, der sich auskennt: Walter Nicolai, der von 1913 bis 1918 Chef der Abteilung III b beim Nachrichtendienst war. Während des Ersten Weltkriegs sei die Türkei »der einzige Kampfplatz« gewesen, in dem »die Frau keine Rolle spielte«, schreibt er.[30]
Auch der sogenannte »Gempp-Bericht« befasst sich mit Spioninnen. Generalmajor Friedrich Gempp war in leitender Funktion in der Abteilung III b und später Leiter der Abteilung Abwehr in der Reichswehr. Sein Blick auf Frauen ist nicht gerade wertschätzend: Für das Jahr 1907 hält er mit Verweis auf einen Nachrichtenoffizier fest, dass Frauen nicht selbständig spionieren sollten, da sie nicht genügend militärisches Verständnis hätten. Lediglich Material heranschaffen könnten sie, ebenso wie Agenten vermitteln. Der Mann plane, »Frauen von russischen Grenz-Beamten und – Offizieren, die ihre Einkäufe auf deutschem Gebiet machen,«[31] für sich zu nutzen. Diese wüssten, wie sie etwas über die Grenze bekommen. Ausfindig machen will er sie mithilfe von Gastwirten und Gendarmen. Es werde aber nicht überlegt, »käufliche Weiblichkeiten«[32] gegen die Russen zu nutzen. Zudem seien Frauen im preußischen Grenzgebiet nur für kleinere Aufgaben einsetzbar, wenn sie denn zuverlässig schweigen könnten. In den Berichten für die Jahre 1910 und 1911 schreibt Gempp zur Arbeit der Abwehr in Straßburg, dass nur Frauen, die schon Beziehungen zu höheren Militärs hätten »und selbst intelligent sind oder der Halbwelt angehören«[33] einen Wert hätten als Agentinnen vor Ort.
An anderen Stellen lobt er den Einsatz von Frauen im Ausland jedoch sehr. Die Agentin »Süd 205« etwa, die sich in einer »schwierigen Situation dem Leiter der französischen Nachrichtenstelle Annemasse dienstbar«[34] macht, deckt eine militärische Desinformationskampagne der Franzosen auf. Sie überbringt von ihnen fingierte Briefe an internierte Offiziere – berichtet den Deutschen aber davon. Damit wussten diese, welche Falschmeldungen über einen Truppenabzug die Franzosen »in geschickter Weise«[35] verbreiten wollten. Eine andere, »noch unerprobte« Agentin, die in den Akten A.F. 92 heißt, unterhält »Beziehungen« zum Sekretär der russischen Botschaft in Rotterdam und macht 1916 »nützliche Angaben über die russischen Truppen in Frankreich und die Vorbereitungen für die Frühjahrsoffensive«.[36] Und die Agentin A.F. 3 beschafft 1915 über einen von ihr »angeworbenen belgischen Dolmetscher«[37] ein Telegramm über einen geplanten Durchbruchsversuch der Engländer.
Frauen werden auch als Doppelagentinnen eingesetzt. Zu ihnen gehört »Nord 16«, genannt Nordwind, die Gempp offenbar beeindruckt hat. Die junge Österreicherin studiert Naturwissenschaften und wird nach vier Erkundungsreisen für die Deutschen 1914 zur Gegenspionage nach Bordeaux geschickt. Ihr gelingt es, sich »an das 2. Büro des französischen Generalstabes heranzumachen«[38] und von den Franzosen einen Auftrag zu erhalten. Sie soll in Berlin herausfinden, ob und wie viele deutsche Truppentransporte von Westen nach Osten durchkommen und wohin sie ziehen. Die Deutschen notieren: »Hervorragende Kraft des Nachrichtendienstes zur Zeit.«[39] Die Franzosen hätten viel Vertrauen zu ihr. Sie arbeite, ohne sich um Gefahren zu scheren und sei unbedingt zuverlässig. Außerdem stamme sie aus einer guten Familie und arbeite nicht für Geld, spende sogar das, was sie nicht zum Leben brauche, ans Deutsche Rote Kreuz. »Von dieser sehr intelligenten Agentin sind weiterhin die wertvollsten Nachrichten bestimmt zu erwarten.«[40] Damit das klappe und die Franzosen weiter Vertrauen zu ihr behielten, müsse Nordwind aber auch echte Infos an sie weitergeben können. Und so muss der »mobile Nachrichtendienst III b« entscheiden, welche korrekten Angaben sie machen darf, etwa »solche, die nicht zu verbergen sind und deshalb den Franzosen und Russen doch nicht verborgen bleiben«.[41] Die Franzosen kommen Nordwind allerdings auf die Schliche, am 25. Oktober 1914 wird sie an der Grenze verhaftet. »Sie machte einen Selbstmordversuch, verletzte sich aber nur leicht an der Pulsader«[42], schreibt Gempp. Ein halbes Jahr später wird sie verurteilt. Was genau mit ihr passiert, weiß selbst Gempp nicht: »Da ein Todesurteil entgegen der sonstigen Gepflogenheiten in der französischen Presse nicht veröffentlicht wurde«[43], sei möglich, dass sie noch am Leben sei.
Die Rolle, die Frauen gesellschaftlich zugedacht ist, hindert sie offenkundig daran, gleichberechtigt als Agentinnen zu arbeiten. Zumindest zeigt ein Brief aus dem Juli 1917, dass mit so mancher nicht gerade fair umgegangen wird. Irma Frobenius hat ihn an den Staatssekretär des Reichsmarineamts geschrieben. Die Frau arbeitete demnach 12 Jahre im »deutschen und österreichischen Nachrichtendienst«[44] – zuletzt in der Nachrichtenstelle im rumänischen Bukarest. Nun habe sie einen neuen Chef bekommen, der ihr gekündigt habe, weil sie in »der letzten Zeit nicht mehr genug geleistet«[45] habe. Die Agentin hat jedoch einen anderen Grund identifiziert, beteuert, dass ein Vorgesetzter ihre Arbeit als die seine ausgegeben habe. Frobenius will zu der Sache angehört werden und schreibt: »Es ist doch ein tief schmerzliches Empfinden, wenn man unter den schwierigsten Verhältnissen seine Pflicht dem Vaterlande gegenüber in aufopferndster Weise erfüllt und dann, statt Dank und Anerkennung eine so schmachvolle Behandlung erdulden muss, ohne sich dagegen schützen zu können.«[46]
Tatsächlich ist es mit der Gleichberechtigung noch weit hin. Seit der Revolution von 1848/1849 hatten sich Frauen zwar in Vereinen organisiert, um für ihre Rechte zu kämpfen, sie nahmen zudem aktiv an Aufständen teil und veröffentlichten Schriftstücke. Doch der Gegenwind kam schnell: Schon kurz darauf wurde Frauen fast überall verboten, sich politisch in Vereinen zu engagieren. Trotz der Unterdrückung wuchs die Bewegung – und wurde lauter. Die Frauen machten aus der Not eine Tugend, gründeten neue Vereine, die offiziell vor allem in der Bildungs- und Sozialarbeit tätig waren, mit denen sie aber weiter gesellschaftspolitische und emanzipative Ziele verfolgten. Im Oktober 1865 wurde dann der »Allgemeine Deutsche Frauenverein« in Leipzig gegründet.
Im Kaiserreich nimmt die Bewegung an Fahrt auf. 1876 veröffentlicht die Schriftstellerin und Feministin Hedwig Dohm das Buch Der Frauen Natur und Recht, in dem sie das Wahlrecht für ihr Geschlecht fordert. Sie fragt: »Warum ist die Frau gleichgestellt Idioten und Verbrechern? Nein, nicht den Verbrechern. Der Verbrecher wird nur zeitweise seiner politischen Rechte beraubt, nur die Frau und der Idiot gehören in dieselbe politische Kategorie«. Es wird noch 43 Jahre dauern, bis Frauen das erste Mal national wählen dürfen – obwohl sich auch ein paar Männer öffentlich auf ihre Seite schlagen. August Bebel, einer der Begründer der deutschen Sozialdemokratie, schreibt 1879 das Buch Die Frau und der Sozialismus. Es wird ein Bestseller, Bebel gilt vielen seither als der »erste Feminist«.
Vierzehn Jahre später wird das erste Mädchengymnasium in Karlsruhe eröffnet, 1894 gründet sich der »Bund Deutscher Frauenvereine«, ein Dachverband, der bis 1913 von 35 auf 2200 Mitgliedsvereine anwächst. 1900 erlaubt das Großherzogtum Baden die Immatrikulation von Frauen an Universitäten – in den folgenden Jahren ziehen die anderen Länder nach. 1908 wird mit der Verabschiedung der Preußischen Mädchenschulreform eine zentrale Forderung der Frauenbewegung erfüllt. Doch die Erfolge sorgen wieder für Gegenwehr. 1900 tritt der sogenannte Gehorsamsparagraf in Kraft, in § 1354 des Bürgerlichen Gesetzbuches heißt es nun: »Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu; er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung.« Frauen sind nur dann nicht verpflichtet, den Entscheidungen ihrer Männer zu folgen, wenn diese ihr Recht missbrauchen.
1902 schreibt die Frauenrechtlerin Dohm das Buch Die Antifeministen. Sie reagiert damit unter anderem auf den Essay »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«, den der Neurologe Paul Julius Möbius 1900 veröffentlicht hatte. Dohm gibt sich einerseits versöhnlich: »Die von mir gewählten Vertreter des Antifeminismus kenne ich ja gar nicht. Es mögen charakter- und gemütvolle Persönlichkeiten, meinetwegen Menschen zum Verlieben sein, auch in ihren Schriften mag neben dem, was mich entrüstet, Gutes und Schönes stehen, das geht mich gar nichts an.« Sie wende sich nicht gegen Personen, dafür aber gegen ihre Ideen. »Meine Feder ist nur mein Schild zur Abwehr der tödlichen Streiche, die man gegen mich als Weib führt.« Es ist eine Kampfschrift. Die lesbische Aktivistin Johanna Elberskirchen reagiert 1903 ähnlich mit ihrem Buch Feminismus und Wissenschaft und schreibt: »Nein, Herr Möbius, das Weib ist nicht schwach, nicht inferior, nicht ›physiologisch schwachsinnig‹, aber das Weib ist krank – es leidet zu sehr unter der Herrschaft des männlichen Sexus«. Es gibt natürlich Frauen, die das anders sehen und damit großen Erfolg haben. So eifert die Autorin Kathinka von Rosen 1904 Möbius nach und veröffentlicht das Buch Über den moralischen Schwachsinn des Weibes. Es wird ein Bestseller. 1912 gründen die Antifeministen sogar den reaktionären »Deutschen Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation«, in dem ein Viertel der Mitglieder weiblich sind.[47] Ihr erklärtes Ziel: Sie wollen das Frauenwahlrecht verhindern.
Elisabeth Schragmüller, genannt Elsbeth, wollte die Ungleichbehandlung der Zeit nicht auf sich sitzen lassen. Sie wird eine der wichtigsten Frauen der Deutschen im Spionagekampf gegen die Franzosen – und ist offenkundig Feministin. Geboren am 7. August 1887 in Schlüsselburg in Nordrhein-Westfalen merkt sie schon in der Schule, dass Frauen anders behandelt werden. Ihr habe das »schöngeistige Wissen«[48], was ihr auf dem Mädcheninternat in Thüringen vermittelt wird, nicht gereicht, schreibt sie in dem 1929 veröffentlichten Sammelband Was wir vom Weltkrieg nicht wissen. »Das, was der weiblichen Jugend damals an Wissenswertem geboten wurde, erschien mir oberflächlich«[49]. Gegen den ursprünglichen Willen der Familie habe sie sich »ertrotzt«, dass sie das humanistische Abitur machen darf.
Schragmüller stammt väterlicherseits aus einer alten Ritterguts- und Offiziersfamilie, mütterlicherseits aus einem hannoveranischen Adelsgeschlecht. Ihre Großmutter nimmt sie mit auf Reisen, sodass sie früh mit anderen Kulturen in Berührung kommt. »Statt wie meine Altersgenossinnen Bälle und gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen«[50], habe sie die Zähne aufeinandergebissen und Griechisch und Latein fürs Abitur gelernt, schreibt sie weiter. Ab 1908 studiert Schragmüller Staatswissenschaften in Lausanne, Berlin und Freiburg im Breisgau, wo sie 1913 den Doktor macht. Sie gehört damit zu den ersten Frauen mit einem akademischen Titel.
Als der Erste Weltkrieg ausbricht, lehrt Schragmüller Staatsbürgerkunde in Berlin. »Wie in den Tagen des Kriegsausbruchs jeder Deutsche, ohne Unterschied des Geschlechts nur von dem einen Willen beseelt war, sich in den Dienst des bedrohten Vaterlandes zu stellen, so hatte auch ich nur ein Streben, nur einen Gedanken: ›helfen‹!«[51] Mit unzähligen anderen Berlinerinnen schleppt sie schwere Wassereimer zu den Zügen für die Soldaten. Aber es reicht ihr nicht, sie will aktiv am Krieg teilnehmen. Sie hadert mit ihrem »Schicksal«, als Frau geboren worden zu sein – und war mit sich selbst »erzürnt«, dass sie Staatswissenschaften und nicht Medizin studiert hat. Damit hätte sie leichter an die Front gekonnt.
Hartnäckig wie sie ist, bittet Schragmüller das Oberkommando um eine Genehmigung, dennoch an die Front reisen zu dürfen. Laut ihrer Erinnerung erhält sie diese am 20. August 1914: Sie dürfe sich »frei und ungehindert auf beide Kriegsschauplätze«[52] begeben. Da sie Englisch und Französisch spricht, zieht es sie nach Brüssel. Dort mietet sie sich in das Hotel ein, in dem der Generalgouverneur Generalfeldmarschall Colmar von der Goltz mit seinem Stab residiert. »Rasch entschlossen, äußerlich sicher, doch innerlich pochenden Herzens«[53] habe sie von der Goltz angesprochen und ihm gesagt, dass sie für ihn arbeiten möchte.
Mit Erfolg. Sie darf unter anderem bei der »Kriegsnachrichtenstelle Brüssel« die beschlagnahmte Feldpost auswerten. Diese kommt von Soldaten, die gegen das Kaiserreich kämpfen und an ihre Familien in der Heimat schreiben. Schragmüller sichtet Tausende Briefe und sucht Informationen von militärischem Wert, die sie in der »Form knapper, sachlich geordneter Berichte zusammenstellt«[54]. Der Leiter der Kriegsnachrichtenstelle bestellt sie eines Tages ein und berichtet ihr, dass ein hochrangiger Militär mehr über »Leutnant Schragmüller« wissen wollte. »Seine Berichte wären außerordentlich fachgemäß abgefaßt und bewiesen entschieden strategisches Verständnis«[55], habe er gesagt. Als er erfuhr, dass es sich um eine Frau handelt, habe er ein »recht verblüfftes Gesicht gemacht«, dann gefordert, sich diese »warmzuhalten«.[56] Schragmüller wechselt danach in das »weite interessante Feld der Spionage«, wie sie es nennt. Bis Anfang 1915 dauert ihre Einarbeitung, auf Besuchen an der Front und auf Dienstreisen in die besetzten Gebiete lernt sie das Handwerk von Kollegen. Dann wird sie vom Chef des militärischen Nachrichtendienstes mit der Leitung der Frankreich-Sektion der Kriegsnachrichtenstelle Antwerpen beauftragt.
Diese Stelle ist besonders erfolgreich. Hier arbeiten im März 1915 allein 11 Agentinnen und 42 Agenten, die gegen Frankreich und England spionieren. Darunter sind neben 24 Belgiern vor allem Deutsche, Franzosen, Holländer, ein paar Engländer, aber auch ein Amerikaner, ein Deutsch-Amerikaner, ein Grieche, ein Spanier, ein Luxemburger, ein Schweizer und sogar ein Argentinier, ein Brasilianer, ein Perser und ein Staatenloser. Die Mischung macht Eindruck: Die »Mannigfaltigkeit« an Nationalitäten zeuge davon, dass dort geschickt angeworben werde. Und: »Die Agenten stammen aus allen Gesellschaftsklassen«[57], heißt es im Gempp-Bericht. »Es gehörten zu ihnen u. a. der dritte Sekretär der persischen Botschaft in London und ein früherer Amerikanischer Vizekonsul in Lille.« Die »längere Zeit erfolgreiche Verwendung mehrerer Frauen in England« sei zudem auffällig, ebenso die Einstellung eines Doppelagenten. Auch würden Agenten und Agentinnen sorgfältig nach der Zuverlässigkeit ihrer Meldungen einsortiert.
Schragmüller fühlt sich dort offenkundig wohl. »Ein Täuschungsmanöver des englischen Nachrichtendienstes, das einer gewissen Komik nicht entbehrte, machte uns eine Zeit lang viel Vergnügen«[58], schreibt sie später. Man habe sicher gewusst, dass ein deutscher Agent in England erschossen worden war. Nach einiger Zeit habe der »tote Agent« allerdings um Übermittlung von Geld gebeten, er sitze »ganz und gar auf dem Trockenen«.[59] Nach einer Woche, in der die Deutschen nicht reagierten, habe er ihnen bittere Vorwürfe gemacht und gleichzeitig eine Meldung geschickt, die nichts Neues bot. »Die Schrift unseres Mannes war zwar recht gut nachgeahmt, aber wir schöpften natürlich doch gleich Verdacht, dass der englische Nachrichtendienst nun so freundlich sein wolle, uns mit eigenen Meldungen für den Verlust jenes armen Teufels, den sein Schicksal erreicht hatte, zu entschädigen.«[60] Zum Schein seien sie auf seinen Wunsch eingegangen, hätten ihm etwas Geld zukommen lassen. Sie hätten ihn dann angefeuert, mehr Informationen weiterzuleiten »und bekamen stets prompt Antworten, die ein recht gutes Bild über das boten, was die Engländer uns aufbinden wollten.«[61]
Schragmüller baut auch eine erfolgreiche »Deserteuragenten-Organisation«[62] auf. Sie startet ihr Netzwerk mit zwei französischen Deserteuren, stattet sie mit neuen militärischen Ausweispapieren aus. Die beiden Ex-Soldaten reisen damit zurück nach Frankreich und geben sich als Fronturlauber aus. In ihren Uniformen fragen sie andere Soldaten an Bahnhöfen über den Standort von Einheiten und andere militärische Informationen aus, so viel wie »ihr Gedächtnis klar zu behalten imstande war«[63], schreibt Schragmüller später. Die Methode ist erfolgreich, die Agentin rekrutiert weitere Deserteure. Für Schragmüller waren sie offenkundig einfach zu handhaben. Sie mussten nicht militärisch geschult werden und »auch die oft sehr langwierigen Instruktionen über Anwendung von Geheimtinten, Gebrauch von Codes u. s.w. fielen bei diesen und allen weiteren Deserteuragenten fort, denn für sie kam nur die mündliche Berichterstattung in Frage«[64], schreibt sie. Der Erfolg gibt Schragmüller Recht: Das Netzwerk wuchs »binnen kurzem zu Ausmassen, die alle meine Erwartungen weit übertraf«[65].
Der Erfolg verschafft ihr allerdings auch Feinde, sogar in den Reihen der eigenen Kollegen. Schon während des Kriegs kursierten zahlreiche Mythen über Schragmüller, die meist nur »Mademoiselle Docteur« genannt wird. Nachdem einige Medien dann noch behaupten, sie sei kokain- und morphiumabhängig, lebe in einer »Irrenanstalt« und habe Agenten mit einer Waffe gedroht, kommt sie 1929 in dem Buch Was wir vom Weltkrieg nicht wissen aus der Deckung, enthüllt ihre Identität. Es gebe beim »breiten Publikum« immer noch die »abenteuerlichsten Vorstellungen«, daher wundere es sie nicht, wenn solche »Sensationsberichte« wie über ihre Person gedruckt würden.[66] Diese würden ein schlechtes Licht auf den Nachrichtendienst werfen, deswegen wolle sie sich äußern. Nur eines sei wirklich richtig an den Artikeln und Beiträgen über sie, schreibt Schragmüller: »Eine Frau stand während des Krieges im deutschen Nachrichtendienst auf verantwortungsvollem Posten!«[67]
Sie beschäftigt sich zudem mit der Frage, wie es möglich war, dass »eine Frau im deutschen Nachrichtendienst Brauchbares zu leisten imstande war«[68]. Sie kommt zu dem Schluss, dass der Nachrichtendienst »auf psychologischen Kräften aufgebaut« sei, »auf Fähigkeiten, die nicht erlernbar und nicht Eigenschaften eines Berufes sind.«[69] Es brauche Menschenkenntnis und das Wissen, wie man mit Menschen umgeht. »Diesen hier nur kurz umrissenen psychologischen Anforderungen kann die Frau ebensowohl wie der Mann genügen.«[70] Mehr noch: Durch die »im allgemeinen stärker als beim Mann ausgebildeten gefühlsmäßigen Veranlagung«[71] seien Frauen sogar vielleicht diesbezüglich bevorzugt ausgestattet, was die starke Rolle von Frauen im Nachrichtendienst erklären könne.
Der Bericht löst auch Kritik aus, etwa von Generalmajor Gempp. Schragmüller habe »in unerwünschtem Ausmass ihre Erfahrungen an die Öffentlichkeit gebracht«[72]. Allerdings sei »gegen die Sachlichkeit ihrer Ausführungen« wenig einzuwenden. Sie hat laut Gempp nicht nur die Wahrheit geschrieben, sondern ist generell eine »ernst zu nehmende Persönlichkeit«. Außerdem attestiert er ihr in seinem Bericht zu den Erfolgen der Kriegsnachrichtenstelle »zweifellos viel beigetragen« zu haben.
Doch Schragmüller, die im Februar 1940 in München stirbt, ist heute fast vergessen. Und das, obwohl das Leben einer von ihr ausgebildeten Spionin eine Vielzahl von Büchern füllt: Mata Hari. Also jene Frau, die das oberflächliche Bild von Geheimagentinnen prägt wie keine andere. Und die vermutlich den meisten Menschen beim Thema Spioninnen einfällt, oft als einzige. Dabei ranken sich bis heute viele Legenden und Lügengeschichten um ihre Person. Mata Hari selbst befeuerte sie, indem sie es mit der Wahrheit oft nicht ganz so genau nahm.
Margaretha Geertruida Zelle wird am 7. August 1876 in den Niederlanden geboren. Mit Ende 20 nennt sie sich Mata Hari und tritt als Schleiertänzerin auf, zuerst in Paris, danach folgen Auftritte im Ausland. Mit ihrem Tanz, den sie orientalisch kostümiert beginnt und fast nackt beendet, erregt sie die von ihr gewünschte Aufmerksamkeit und befriedigt vor allem die kolonialen Fantasien weißer Männer. Einige ihrer Zuschauer, Gönner und Liebhaber gehören der Oberschicht der französischen Hauptstadt an, was ihr ein luxuriöses Leben ermöglicht. In Berlin tanzt sie sogar vor Kaiser Wilhelm II.
Der Kriegsbeginn lässt ihre knapp zehnjährige Karriere ins Stocken geraten, jüngere Nachahmerinnen haben ihr schon zuvor Aufträge und Männer weggenommen. Zelle braucht Geld. 1915 wird sie Agentin für die Deutschen und erhält den Decknamen »H 21«. Im Kölner Domhotel trifft sie den Chef des militärischen Nachrichtendienstes, Walter Nicolai. So steht es nach dem Krieg in einem Bericht eines Majors, der sie in Frankfurt am Main »politisch und militärpolitisch«[73] ausbildet. Elsbeth Schragmüller, die erfolgreiche Nachrichtendienstlerin, ist dafür zuständig, Zelle »Beobachten und Melden« beizubringen und »Instruktionen über ihr Verhalten« zu geben.[74] Sie lernt auch den Umgang mit »chemischen Tinten«.
Bis heute ist strittig, ob Zelle im Laufe ihrer Tätigkeit wichtige Informationen für die Deutschen lieferte. Der Major, der sie mit ausbildete, hält fest: »Was nun die Leistungen von H 21 anlangt, so gehen die Ansichten hierüber sehr auseinander.«[75] Offenbar auch bei ihm selbst. Er persönlich glaube, »dass sie bestimmt sehr gut beobachtet und gemeldet hat; denn sie war eine der klügsten Frauen, die ich je kennengelernt habe.«[76] Andererseits stellt er fest, dass die Geheimtinten-Briefe, die er von ihr bekommen habe, nur wenig wertvolle Informationen enthielten. Nicolai findet dagegen, sie sei ein »bedauernswerter, gerissener Mensch, ungebildet und dumm«.[77]
1916 wird Zelle wegen Spionageverdacht von den Franzosen verhaftet. Sie kann sich rausreden und willigt ein, für sie gegen Deutschland zu spionieren. Nur wenig später, im Februar 1917, verhaften die Franzosen sie erneut. Sie haben herausgefunden, dass Zelle weiterhin für die Deutschen arbeitet. Sie wird wegen Doppelspionage und Hochverrats zum Tode verurteilt und am 15. Oktober hingerichtet. Der deutsche Major, der sie ausbildete, hielt später schlicht fest: »Spionage zugunsten Deutschlands hat sie bestimmt getrieben und ich bin der Meinung, dass sie von den Franzosen – leider – zu Recht erschossen wurde«[78].
Während des Kaiserreichs werden auch die Spionagemethoden immer ausgefeilter. So gründen die Deutschen erstmals eine »Zeitungstelle«, die öffentlich zugängliche Quellen auswertet – wie es Nachrichtendienste bis heute tun. Für die Heeresleitung werden täglich die Informationen über die »militärischen, politischen und wirtschaftlichen Inhalte der Auslandspresse«[79] zusammengestellt. Von besonderer Bedeutung sind demnach operative Nachrichten über den Feind und dessen Verluste, Berichte über Gefechte und Schlachten, Aufsätze über die politische und wirtschaftliche Lage des feindlichen und neutralen Auslandes. Die Liste der beobachteten Länder und Medien ist lang. Auf ihr stehen etwa die amerikanische New York Times, die englische Daily Mail und der französische Figaro, zudem Zeitungen aus Russland, Dänemark und der Türkei.
Spannender ist aber, was im Verborgenen geschieht. Im Mai 1917 beispielsweise landet ein Brief in der Postüberwachungsstelle Frankfurt am Main, der nach Frankreich gehen soll, also ins Feindesland. In ihm findet sich ein unscheinbares Kommunionfoto eines kleinen Mädchens. Doch die Kontrolleure machen ihre Arbeit gründlich: »Als das Lichtbild von der Papierunterlage, auf die es aufgeklebt war, losgelöst wurde, stellte sich heraus, daß die Papierunterlage auf der Innenseite einen Teil des Lageplans der Firma Thyssen zeigte«.[80] Thyssen ist damals neben Krupp führend in der Eisen- und Stahlproduktion und produziert seit 1914 Rüstungsgüter wie Geschosshüllen, setzt dabei Frauen und Kriegsgefangene ein. Der Lageplan zeigt nicht irgendeinen Teil des großen Werkes, sondern den wichtigsten, heißt es in einem Gerichtsdokument: Würden die dortigen Anlagen zerstört werden, könnten mehrere Tage keine Wagen fahren, die Auslieferung wäre unterbrochen.
Die Postüberwachungsstellen, in denen auch damals schon Frauen arbeiten, haben keinen leichten Job. Auf Postkarten werden geheime Botschaften etwa gern zwischen den Bildern auf der Vorderseite oder zwischen der normalen Schrift auf der Rückseite versteckt. Briefmarken werden beidseitig analysiert, ebenso wie verschlossene Briefe. Dafür wird das Papier mit einer Flüssigkeit getränkt, die die geheime Tinte zum Vorschein bringt. Am 3. August 1917 warnt die Armee allerdings, dass die feindlichen Dienste etwas Neues entwickelt haben – was die »Postüberwachung und damit die Spionageabwehr (…) auf das Empfindlichste berührt«.[81] Gemeint ist, dass die Briefe nach dem Trocknen der unsichtbaren Tinte mit einer Masse überzogen werden, was das einfache und schnelle Testverfahren der Deutschen torpediert. Stattdessen müsse nun jedes Papier einzeln an einer Stelle »mit einem scharfen Messer radiert«[82] werden, bevor eine Jodlösung aufgetragen werden könne, so der Rat. »Wenn hierbei die radierte Stelle eine hellere Tönung erhält als die Umgebung, so ist auf eine Nachbehandlung des Papiers zu schliessen.«[83]
Wie aufwendig das Verfahren ist, zeigt eine vierseitige »Anweisung zur optisch-chemischen Postprüfung«[84]