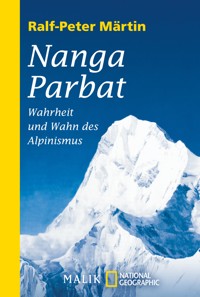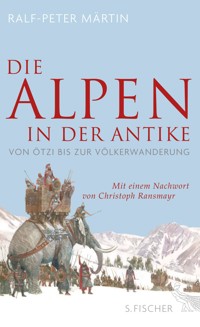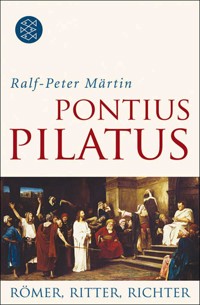9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Herbst des Jahres 9 n. Chr. wurden in den Wäldern Germaniens drei römische Legionen von den eigenen Hilfstruppen, den Cheruskern, überfallen und niedergemetzelt. Der Feldherr der Römer, Varus, stürzte sich in sein Schwert. Die Schlacht, eine der empfindlichsten Niederlagen, die das Römische Reich jemals erlitt, prägte die Entwicklung Mitteleuropas und verhinderte angeblich die Romanisierung des späteren Deutschland. Was aber wollten die Römer in Germanien? Und wie geschah es, dass die beste Armee der Welt von Barbaren geschlagen werden konnte? Wer überhaupt war Arminius, der Sieger? Jenseits vertrauter Klischees, in denen Regen und Sturm, Wälder und Sümpfe und die Unfähigkeit des Varus noch immer die Hauptrolle spielen, wagt Ralf-Peter Märtin eine faszinierende neue Deutung der Ereignisse. Sein brillant geschriebenes Werk ist gleichzeitig eine Mentalitätsgeschichte Roms und dessen imperialen Anspruchs. In einem abschließenden Teil, der von den Humanisten und Luther, über Befreiungskriege und Reichsgründung 1871 bis hin zum Nationalsozialismus reicht, erzählt er, wie aus dem römischen Ritter Arminius der deutsche Nationalheld Hermann der Cherusker wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dr. Ralf-Peter Märtin
Die Varusschlacht
Rom und die Germanen
Über dieses Buch
Im Herbst des Jahres 9 n. Chr. wurden in den Wäldern Germaniens drei römische Legionen von den eigenen Hilfstruppen, den Cheruskern, überfallen und niedergemetzelt. Der Feldherr der Römer, Varus, stürzte sich in sein Schwert. Die Schlacht, eine der empfindlichsten Niederlagen, die das Römische Reich jemals erlitt, prägte die Entwicklung Mitteleuropas und verhinderte angeblich die Romanisierung des späteren Deutschland. Was aber wollten die Römer in Germanien? Und wie konnte es geschehen, daß die beste Armee der Welt von Barbaren geschlagen werden konnte? Wer überhaupt war Arminius, der Sieger?
Jenseits vertrauter Klischees, in denen Regen und Sturm, Wälder und Sümpfe und die Unfähigkeit des Varus noch immer die Hauptrolle spielen, wagt Ralf-Peter Märtin, gestützt auf die Originalquellen und den aktuellen Forschungsstand der Historiker und Archäologen, eine faszinierende neue Erklärung der Ereignisse.
Sein brillant geschriebenes Werk ist gleichzeitig eine Mentalitätsgeschichte Roms und dessen imperialen Anspruchs. In einem abschließenden Teil, der von den Humanisten und Luther über Befreiungskriege und Reichsgründung 1871 bis hin zum Nationalsozialismus reicht, erzählt er, wie aus dem römischen Ritter Arminius der deutsche Nationalheld Hermann der Cherusker wurde.
»Seine […] Ausführungen gehören zum Besten, was über die faszinierende Rezeptionsgeschichte der Schlacht geschrieben worden ist.«
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ralf-Peter Märtin, (1951–2016), hat an der TU Berlin Geschichte und Germanistik studiert und promovierte 1982. Für »GEO«, »ZEIT« und »National Geographic« hat er historische Reportagen zu den Themen Geschichte und Archäologie, Entdeckungsreisen und Alpingeschichte geschrieben. Auf seinen Reisen hat er die Grenzen der römischen Welt, vom britannischen Hadrianswall bis zum Euphrat, vom marokkanischen Atlas-Gebirge bis zum obergermanischrätischen Limes, erkundet.
Seine Bücher über den historischen Dracula, den rumänischen Fürsten Vlad Ţepeş und seine Kulturgeschichte des Himalaya-Bergsteigens »Nanga Parbat. Wahrheit und Wahn des Alpinismus« gelten als Standardwerke. Sein Buch »Die Varusschlacht. Rom und die Germanen« stand 22 Wochen auf der Bestsellerliste des »Spiegel«.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
ISBN 978-3-10-490789-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Karten]
Prolog Hiobsbotschaft
Kapitel I Die Barbaren des Nordens
Skythen, Kelten und Germanen
Furor Teutonicus
Cäsar
Kapitel II Zweimal Germanien
Der römische Blick
Germanenleben
Kapitel III Die Römer
Kapitel IV Augustus
Kapitel V Rheinfront
Kapitel VI Germanien unterworfen
Kapitel VII Dynastie
Kapitel VIII Provinz Germanien
Status quo
Marbod
Kapitel IX Die Schule des Arminius
Kapitel X Varus
Kapitel XI Arminius
Kapitel XII Die Schlacht
Woher wissen wir, was wir wissen? Die schriftliche Überlieferung.
Aufbruch
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Tod und Triumph
Zusammenbruch
Varianten des Grauens
Kapitel XIII Die Rache Roms
Wacht am Rhein
Germanicus
Marsermord
Kapitel XIV Mehr durch Gewalt als durch Klugheit
Kapitel XV Die Sieger
Epilog Verzicht
Von Arminius zu Hermann – Wie ein abtrünniger römischer Auxiliaroffizier zum deutschen Helden wurde
Humanisten und Reformatoren
Germanen gegen Griechen
Befreiungskriege und Restauration
Hermannsdenkmal
Germanenwahn
Weltkrieg und Weimar
Hitler, Himmler und Hermann
Hermann heute
Zeittafel
Das Iulisch-Claudische Haus
Adelsgeschlechter der Cherusker
Bibliographie
Abbildungsnachweis
Register
Danksagung
Für Charlotte
[Karten]
Die römische Welt
PrologHiobsbotschaft
Vom Rhein brauchte der Kurier neun Tage. Quälte sich über den Reschenpaß, jagte im gestreckten Galopp durch die Poebene, querte den Apennin. Fünfmal so schnell wie der normale Reisende raste er dahin und wußte am Ziel nicht mehr, wie oft er die Pferde gewechselt, wie viele er zuschanden geritten hatte. Am 6. Oktober erreichte er Rom.[1] Die Prätorianer, zuständig für die Sicherheit der Hauptstadt, nahmen den Erschöpften als erste in Empfang. Dann die persönliche Leibwache des Kaisers: germanische Bataver vom Niederrhein, großgewachsene Krieger, Augustus unbedingt ergeben. Ihr Anführer geleitete ihn in den Palast. – Der Kurier, noch in Reisekleidern, verdreckt und abgehetzt, sah einen zierlichen, kaum mittelgroßen, immer noch gutaussehenden Mann um die Siebzig, der Schuhe mit dicken Sohlen trug, damit er größer erschien.[2] Er bemerkte es, als er das Knie beugte und die Papyrusrolle mit der Botschaft dem »Vater des Vaterlandes« und »Mehrer des Reiches« übergab.
Sie enthielt die Nachricht einer Katastrophe. Dem Bericht zufolge waren in den Wäldern und Sümpfen des nördlichen Germanien drei römische Legionen, sechs Kohorten Hilfstruppen und drei Alen Reiterei unter dem Befehl des Statthalters Publius Quinctilius Varus in einen Hinterhalt geraten und vollständig aufgerieben worden. Varus hatte die Schande nicht überleben wollen und sich in sein Schwert gestürzt. Haupt der Aufständischen war ein Cheruskerfürst in römischen Diensten, der Reiteroffizier Gaius Iulius Arminius. Das Massaker hatte sich im September[3] ereignet und mit ihrem Leben hatten die römischen Soldaten auch ihre Ehre durch den Verlust ihrer Feldzeichen, der drei goldenen Legionsadler, verloren.
Prätorianer
Draußen am Eingang seines aus Marmor errichteten repräsentativen Palasts,[4] »wert, daß ein Gott ihn bewohnt«, nach der Ansicht des Dichters Ovid,[5] standen zwei Lorbeerbäume und über ihnen hing ein Eichenkranz. Rühmende Auszeichnungen waren das, Augustus als Retter der Bürger vor Gewalt und Gefahr verliehen, Symbole seiner Sieghaftigkeit gegenüber inneren und äußeren Feinden.[6] Die war nun, im vierzigsten Jahr seiner Herrschaft (9 n.Chr.), zum erstenmal ernsthaft in Frage gestellt.
Der Kaiser war erschüttert. In der Geschichte des Römischen Reiches gab es wenige vergleichbar vernichtende Niederlagen. Die letzte war die Schlacht von Carrhae im fernen Mesopotamien gewesen, in der die Parther den römischen Feldherrn Marcus Licinius Crassus töteten. Aber das war 62 Jahre her und seit Augustus an der Spitze des Staates stand, waren die Siege zur Gewohnheit geworden, ja zur Notwendigkeit, denn durch sie legitimierte sich die neue politische Ordnung des Prinzipats.[7]
Rasch sprach sich die schlechte Neuigkeit in der Stadt herum. Der Verlust von 15000 Mann gutausgebildeter Kampftruppen schmerzte empfindlich, denn die römische Armee war knapp kalkuliert. Das Reichsterritorium von 3,5 Millionen Quadratkilometern, das sich vom Euphrat bis zum Atlantik, von der Nordsee bis in die Sahara erstreckte, verteidigten gerade einmal 28 Legionen, jede etwa 5500 Mann stark. Reserven waren nicht vorhanden und Verschiebungen nur im begrenzten Umfang möglich. Die Römer wußten, was die Vernichtung der drei Legionen bedeutete.[8] Neue Verbände mußten aufgestellt werden und nach Lage der Dinge würden die Bürger Roms die Zeche zahlen und die Mannschaften stellen. Schon marschierten die Prätorianer in den Stadtvierteln auf, um drohende Unruhen wegen der Rekrutierungen zu unterdrücken.
Die Öffentlichkeit erwartete von Augustus Zeichen der Trauer und des Mitgefühls und bekam sie. Er zerriß seine Kleider, stieß wieder und wieder mit dem Kopf gegen die Tür und rief: »Quinctilius Varus, gib mir die Legionen wieder«, berichtet der Augustus-Biograph Sueton. Monatelang schor er sich Bart und Haare nicht und entließ seine germanische Leibwache, obwohl der Stamm der Bataver seit Generationen Rom Truppen stellte und mit den Rebellen nichts zu schaffen hatte. Bis an sein Lebensende beging Augustus den Tag der Varusschlacht als Fastentag.[9]
Geschickt präsentierte er der beunruhigten Bevölkerung eine Begründung für die Niederlage, die weder die militärische Schlagkraft Roms noch die Führungsfähigkeit seiner politischen und militärischen Elite in Frage stellte. Nicht fehlbares menschliches Handeln war nach offizieller Lesart für die Niederlage verantwortlich, sondern der Wille der Götter. Ihn hatte man offensichtlich übersehen, dabei hatte es an Hinweisen nicht gefehlt. Den Tempel des Kriegsgottes Mars traf ein Blitz, von den Gipfeln der Alpen stiegen Feuersäulen auf und in Germanien hatte ein Standbild der Siegesgöttin Victoria ihr Antlitz nach Italien gedreht.[10] Zur Versöhnung und in schuldiger Demut vor dem Schicksal gelobte Augustus Jupiter, dem höchsten Gott, prachtvolle Spiele. Eine Geste, die schon deshalb für bessere Stimmung in der Stadt sorgte, weil sie aus ängstlichen Römern begeisterte Zuschauer machte.
Panzerstatue von Prima Porta, Augustus als Feldherr
Die Wirklichkeit sah trister aus. Fünf Tage bevor die Hiobsbotschaft aus Germanien eintraf, war auf dem Balkan einer der härtesten und blutigsten Kriege, den Rom je zu bestehen hatte, der pannonisch-dalmatische Aufstand, beendet worden. Den Sieg zu erringen, hatte es dreier Jahre, des Einsatzes aller militärischen Mittel und der Kunst des besten Feldherrn des Imperiums bedurft. Die Legionen waren erschöpft, die Ressourcen des Reiches überspannt. In Rom war es sogar zu einer Hungersnot gekommen. Was würde geschehen, wenn Arminius mit den Cheruskern und ihren Verbündeten über den Rhein vorstieß? Wartete nicht nördlich der Donau schon ein anderer Germanenfürst, der Markomannenkönig Marbod, auf die Gelegenheit zum Losschlagen? Kamen die Zeiten wieder als Rom selbst bedroht wurde, wie es in den Kimbern- und Teutonenkriegen, einhundertzwanzig Jahre vorher, geschehen war? Fiel nun alles was man in Jahrzehnten erobert und fest zu besitzen geglaubt hatte, die Länder westlich, nördlich und östlich des Alpenbogens, Gallien, Rätien, Noricum, Pannonien und Illyrien wie ein Kartenhaus in sich zusammen und von Rom ab? Wie war es zugegangen, daß dieses Germanien, in dem römische Truppen bis zum Elbfluß vorgedrungen waren, in dem es römische Stützpunkte, Straßen, Häfen, Märkte und Bergwerke gab, in dem erste römische Städte gegründet wurden, sich urplötzlich und unter der Führung eines römischen Offiziers erhob? Und wie war es möglich, daß die hochgerüstete römische Militärmaschine, die beste Armee der Welt, von undisziplinierten Barbarenhaufen geschlagen werden konnte? – Augustus war über den drohenden Verfall seines Ansehens und seiner Stellung so deprimiert, daß er sich, wenigstens eine Zeitlang, mit Selbstmordgedanken trug.[11]
Kapitel IDie Barbaren des Nordens
Skythen, Kelten und Germanen
Sich für den Norden Europas zu interessieren, dafür gab es keinen vernünftigen Grund. Die Welt teilte sich nach Aristoteles, dem berühmten griechischen Philosophen, in fünf Klimazonen und durch den Willen der Götter saßen Griechen und Römer in der Besten von allen, der gemäßigten, in der Völker und Staaten gediehen. Damit war auch gleich erklärt, warum es die Barbaren des Nordens zu keiner staatlichen Ordnung gebracht hatten, die Römer aber zu einem Imperium.[1]
Der Römer Vitruv ergänzte diese Klimatheorie um eine biologische Variante. Im hohen Norden hätten die Völker viel Blut und seien deshalb tapfer. Im tiefen Süden, womit er Nordafrika meinte, hätten die dort Lebenden zu wenig und seien deshalb feige. Nur die Römer besäßen genau die richtige Menge und könnten deshalb die Südvölker durch ihren größeren Mut besiegen, die Nordvölker durch ihre größere Begabung.[2]
Schon hinter den Bergen fing das Barbarenland an. Denn deswegen waren die Alpen und das Balkangebirge von den Göttern aufgetürmt worden: um die angenehmen Bereiche der Erde von den weniger schönen zu trennen. Kälte herrschte im Norden und eisiger Wind, Regen peitschte von einem trüben Himmel, der sich im Winter vollends verdunkelte. In undurchdringlichen Wäldern, schwer passierbaren Sümpfen, weglosen Gebirgen und Steppen hausten zahllose wilde Völker, die sich nach unbekannten Gesetzen in explosionsartigen Schüben über die zivilisierte Welt ergossen. Im Prinzip bildeten sie ein ideales Sklavenreservoir, waren aber schwer zu unterwerfen, da ihre Lebensumstände sie kriegstüchtig und entbehrungsfähig machten.[3]
Den Völkerbrei, der da von Norden gegen die von der Natur gezogenen Grenzen schwappte, genauer einzuteilen, gab sich die Antike keine Mühe. Östlich des Tanais (Don), in den grenzenlosen Steppen Asiens, lebten die Reiterkrieger der Skythen, westlich davon bis zum Atlantik die Kelten. Hinter ihnen, in der äußersten Randzone der bewohnten Welt, an den Ufern des nördlichen Ozeans, siedelten die Fabelvölker: Oinonen, die sich von Hafer und Sumpfvogeleiern ernährten, Hippopoden mit Pferdefüßen und Panotier, die sich ihrer übergroßen Ohren wie warmer Mäntel bedienten.[4]
Ein Stamm namens Germanen tauchte spät und erstmals bei dem griechischen Historiker Poseidonios von Apameia (135–51 v.Chr.) auf, der das keltische Gallien – das Land zwischen den Pyrenäen im Süden und dem Rhein im Osten, dazu noch Belgien und die Westschweiz – aus eigener Anschauung kannte. Die Germanen, schrieb er um 80 v.Chr. in seinen »Historien«, lebten östlich davon und seien eine spezielle »wilde« Form der Kelten. Als Beweis führte er schaudernd ihre halbtierische Lebensweise an, die sie eindeutig einer niederen Kulturstufe zuordnete. Sie äßen gebratenes Fleisch »gliedweise« schon zum Frühstück, tränken Milch dazu und ungemischten Wein.[5] Barbarischer konnte man den Tag nicht beginnen.
Als eine besondere Gruppe von Stämmen, die sich von der althergebrachten Einteilung in Kelten und Skythen unterschied, wurden die Germanen erst von Gaius Julius Cäsar (100–44 v.Chr.) identifiziert. Für die Römer galt er als der eigentliche Entdecker des Nordens, dafür gerühmt von seinem Zeitgenossen Cicero, denn »Gegenden und Völker, von denen uns bislang kein Buch, keine Erzählung, kein Gerücht Kunde gebracht hatte, hat unser Feldherr, unser Heer, haben die Waffen des römischen Volkes durchwandert.«[6]
Cäsar war allerdings nicht als Tourist unterwegs, sondern eroberte in den Jahren 58 bis 51 v.Chr. Gallien und stieß erstmals in der römischen Geschichte mit seinen Legionen bis zum Rhein (Rhenus) vor. Fortan galt dieser Fluß als Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation.[7] Dahinter lagen unermessliche Urwälder, Ödlandzonen und fern im Norden das Mare Germanicum (Nordsee). Im Winkel zwischen Rhein und Donau türmten sich die Berge des unergründlichen Hercynischen Waldes, Quellgebiet aller nordwärts fließenden Ströme, der größte Eichenwald Europas, von dem es hieß, er sei »mit der Welt zugleich entstanden«.[8] Er erstreckte sich vom Schwarzwald bis zu den Karpaten. Genau wußte man es nicht, denn an sein Ende war noch niemand gekommen.[9] In ihm lebten viele bislang unbekannte Tiere und das römische Publikum las mit Begeisterung Cäsars Berichte über ein Rind, das wie ein Rehbock aussehe, aber mit nur einem Horn auf der Stirn, das sich an der Spitze verzweigte (Rentier). Über den Riesenhirsch namens »alces« (Elch), der im Stehen schlafe, weswegen die Jäger seine Ruhebäume ansägten (eine Falschinformation, nur Pferde sind dazu fähig). Über Stiere, die etwas kleiner als Elefanten seien und deren Hörner man als Trinkgefäße benutze (Auerochsen).[10]
Auf besondere Aufmerksamkeit aber konnte rechnen, was Cäsar über die Völker der Germanen seinem Schreibsklaven diktierte. Denn diese, behauptete er, würden Rom bedrohen, wie es die Kimbern und Teutonen vor fünfzig Jahren, zwischen 113 und 101 v.Chr., getan hatten. Bisher glaubten die Römer, sich damals gegen Kelten gewehrt zu haben – die waren längst keine Gefahr mehr. Jetzt erfuhren sie von Cäsar, daß es Germanen waren, die in mehr als zehnjährigen Kämpfen den römischen Staat fast an den Rand des Abgrunds gebracht hatten.[11] Das Trauma war nicht vergessen, die Erinnerung immer noch präsent. Nun lebte es wieder auf und verband sich mit einem neuen Begriff: Germanen.
Furor Teutonicus
Was die Kimbern, Teutonen und Ambronen veranlaßt hatte, etwa um 115 v.Chr. ihre Wohnsitze in Jütland und auf den nordfriesischen Inseln (Amrum) aufzugeben, ist nicht ganz klar. Heutige Klimaforscher registrieren für diese Zeit eine feuchtkalte Abkühlungsphase, die mit Ernteeinbußen und Krankheiten einhergegangen sein könnte,[12] wohingegen der um Christi Geburt lebende griechische Geograph und Historiker Strabo kurz und bündig und überaus typisch für das antike Barbarenbild die Freude am Beutemachen und Herumschweifen als Grund annahm.[13]
Der Heereszug von geschätzten 300000 Menschen[14] wälzte sich mit Mann, Roß, Frauen, Kindern, Vieh und zahllosen Wagen durch Mitteleuropa und stieß in Noricum (Österreich) erstmals auf römische Truppen. Ein reichlich plumper Überrumpelungsangriff des kommandierenden Konsuls schlug unter großen Verlusten fehl und die Römer konnten froh sein, daß sich der Auswanderertreck nicht gen Süden nach Italien, sondern donauaufwärts nach Westen in Bewegung setzte. Der nächste Zusammenstoß erfolgte am 6. Oktober 105 v.Chr. in Südfrankreich bei Arausio (Orange). Diesmal hatte man sogar zwei römische Heere aufgeboten, doch da die beiden Befehlshaber in ihrer Arroganz sich über die einzuschlagende Strategie nicht einigen konnten, erlitten die Römer wiederum eine verheerende Niederlage. Die Zahl von 100000 Toten in den zeitgenössischen Quellen ist zwar nicht wörtlich zu nehmen, macht aber das Ausmaß der Verluste deutlich.
Nach ihrem Sieg gerieten die Kimbern und Teutonen in eine den Römern völlig unverständliche Raserei und zerstörten und töteten alles, was ihnen im Kampf in die Hände gefallen war. Die Krieger zerfetzten kostbare Kleider, warfen Silber und Gold in die Rhône, zerbrachen Waffen und Rüstungen, ertränkten die Pferde. Gefangenen wurde keine Gnade gewährt, sondern man erhängte sie in den Bäumen oder übergab sie Priesterinnen, die ihnen über riesigen Kesseln die Kehle durchschnitten, »um aus dem hervorströmenden Blut wahr zu sagen.«[15]
Erst später begriffen die Römer, daß es sich um ein germanisches Opferritual handelte, die Feinde ihre gesamte Beute, einschließlich Mensch und Tier, aus Dank den Göttern weihten.[16] Das machte ihnen den Vorgang nicht sympathischer, sondern unterstrich nur noch mehr das Abstoßende dieses Barbarentums, die »sinnlose Vergeudung von Menschen und Gütern.«[17]
Die Götter der Germanen schienen dennoch für die Römer etwas übrig zu haben. Obwohl ihnen der Weg offen stand, marschierten die Feinde zunächst nicht nach Italien, sondern teilten sich und griffen in zwei Heerhaufen Nordspanien und Nordgallien an. So blieben Rom drei Jahre, um eine durchgreifende Heeresreform durchzuführen, neue Truppen aufzustellen und sie ihrem besten Mann anzuvertrauen: Gaius Marius. Der machte mit hartem Training, einer neuen Befehlsstruktur und verbesserter Taktik aus den Legionen ein Instrument des Krieges, das all das in sich vereinigte, was den Germanen fehlte: die Fähigkeit zum Formationskampf, Eingreifreserven, Disziplin, Ausdauer und vorzügliche Bewaffnung. Marius ging kein Risiko ein und bereitete sein Heer sorgfältig auf die Entscheidung vor. Rom hatte nur noch dieses eine.
Als er im Jahre 102 v.Chr. nach Südfrankreich aufbrach, um den Gegner zu stellen, erwarteten ihn nur die Teutonen und Ambronen. Die Kimbern hatten sich von ihnen getrennt, waren wieder nach Norden an die Donau gezogen, um dann, die Alpen im weiten Bogen umgehend, vom Klagenfurter Becken nach Italien einzufallen.[18] Mit den Römern würden ihre Stammesgenossen leicht fertigwerden. Nach drei großen und etlichen kleinen Niederlagen nahmen sie die Legionen nicht mehr sonderlich ernst. Um so weniger, als Marius die ihm angebotene Schlacht verweigerte und sich, in den Augen der Germanen »feige«, in seinem Lager verschanzte. Also ließen die Teutonen ihn, wo er war, und zogen einfach in Richtung Seealpen weiter. So groß war ihr Heer, daß es sechs Tage brauchte, um die römischen Schanzen zu passieren. Die Germanen taten es provozierenderweise in Rufweite und fragten spöttisch, ob die Legionäre ihren Frauen in Rom etwas zu bestellen hätten. Ungerührt folgte Marius ihnen nach, bis er bei Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) das Schlachtfeld gefunden hatte, das ihm zusagte. Dann setzte er in zweitägiger blutiger Schlacht sein taktisches Konzept um. Hielt Truppen in Reserve, die den wankenden Verbänden zu Hilfe kamen oder sie ablösten. Besetzte die Höhen, um den Feind sich müde stürmen zu lassen, und krönte das Ganze mit einem Angriff aus dem Hinterhalt. Dem hatten die Germanen nur ihre Kampflust und ihre Masse entgegenzusetzen. Die eine erschöpfte sich, wie die andere sich verminderte. Der Sieg war so vollständig, die Zahl der getöteten Feinde so hoch, daß die Bewohner der nahe gelegenen Stadt Massilia (Marseille) ihre Weingärten mit den Knochen der Gefallenen einhegten. Später reiften auf dem Schlachtfeld »durch die Verwesung der Leichen Ernten von überreicher Fülle heran.«[19]
Kimbernschlacht, Reliefdarstellung auf einem römischen Sarkophag
Ein Jahr später traf das gleiche Schicksal bei Vercellae (Vercelli) in Oberitalien die Kimbern. Die Zehntausende, die überlebten, endeten auf den Sklavenmärkten, was, verglichen mit den germanischen Sitten, eindeutig die humanere Praxis darstellte. Was aber den Römern im Gedächtnis haftete, war die Bedrohung durch einen Menschentyp, dessen Wildheit und Aggressivität keine Grenzen kannte, der weder sich selbst noch seinen Gegner schonte und dessen unkontrollierte Kampfeswut eher an ein Raubtier als an ein menschliches Wesen erinnerte.
Das zeigte sich schon bei ihrem Anblick, wenn sie ohne Rüstung, mit nacktem Oberkörper und rotgefärbten Haaren in den Kampf zogen. Wenn sie die Schilde aneinander schlugen und im Takt ihren Stammesnamen schrien. Selbst wenn sie wehklagten, wie es die Ambronen in der Nacht nach der Niederlage taten, »klang es nicht wie menschliches Weinen und Stöhnen, sondern wie tierisches Heulen und Brüllen, untermischt mit Drohungen und schrillen Klagerufen.«[20] In der Schlacht waren sie undiszipliniert, unfähig, sich zurückzuhalten, tapfer, aber ohne Überblick. Mit Ketten verbanden sie sich, um nicht getrennt zu werden. Prahlsüchtig waren sie und überaus stolz auf ihre Kraft und ihren Mut. Die Römer verachteten sie als Weichlinge, schützten sie sich doch mit Rüstungen und verschanzten sich hinter Wällen. Die Kimbern entblößten sich lieber, wenn es schneite, damit ihre Kleider nicht naß wurden, und machten sich einen Spaß daraus, »durch Eis und Schnee auf die Bergeshöhen zu klettern, sich auf ihre breiten Schilde zu setzen, und – unbekümmert um die schroffen Wände und klaffenden Schründe – in die Tiefe hinunter zu sausen.«[21] Wie die schrecklichen Giganten der Vorzeit wirkten sie, wenn sie nicht mit Werkzeug, sondern mit roher Kraft Bäume samt der Wurzel ausrissen, ohne Katapulte Felsbrocken schleuderten und Hügel nicht mit Ingenieurskunst, sondern mit bloßen Händen abtrugen. Doch kaum wurde es heiß, wie am 30. Juli bei Vercellae, und die Sonne blendete, war es um sie geschehen: »Frost und Kälte zu ertragen, war den Kimbern ein Leichtes, die Hitze aber lähmte sie völlig, sie keuchten, der Schweiß strömte ihnen herab und sie mußten sich zum Schutz vor der Sonne die Schilde vors Gesicht halten.«[22]
Fürchterlicher in ihrer Todesverachtung als die germanischen Männer waren nur ihre Frauen. Bei Aquae Sextiae stürzten sich die Teutoninnen mit Äxten und Schwertern gleichermaßen auf ihre flüchtenden Stammesgenossen wie auf die angreifenden Legionäre: »Sie warfen sich mitten ins Kampfgetümmel, rissen den Römern mit bloßen Händen die Schilde weg und packten ihre Schwerter, ließen sich verwunden und in Stücke hauen, bis zum Tode unbesiegt in ihrem Mut.« Noch radikaler wehrten sich die kimbrischen Frauen gegen die drohende Gefangenschaft: »In schwarzen Gewändern standen sie auf den Wagen und töteten die Fliehenden, mochte es auch der Gatte, der Bruder oder der Vater sein. Mit eigenen Händen erwürgten sie ihre kleinen Kinder, schleuderten sie unter die Räder und die Hufe der Zugtiere und brachten sich dann selber um.«[23] Dies taten schließlich auch die Frauen, die Marius darum baten, er möge sie den Priesterinnen der Göttin Vesta schenken, die ewige Jungfräulichkeit geschworen hatten und darum ein Leben in Keuschheit führten. Als der Feldherr ablehnte, begingen sie gemeinsam Selbstmord und erhängten sich.[24]
Konnte es mit solchen Völkern jemals Frieden geben? Waren sie in ihrer Primitivität überhaupt in der Lage, den Wert von Verträgen zu erkennen, geschweige denn sie einzuhalten? Waren sie – modern ausgedrückt – überhaupt integrationsfähig in die Welt der Mittelmeervölker oder war ihre Vernichtung und Versklavung die einzige Alternative?
Es gab Zeichen der Hoffnung. Die »humanitas«, die zivilisatorische Verfeinerung des Lebens, ging offenbar selbst an den harten Kimbernkriegern nicht spurlos vorbei. Ein Beobachter schrieb: »Wenn die Cimbern einmal Halt machten, büßten sie viel von ihrem Kampfgeist ein und wurden dadurch schlaffer und träger an Leib und Seele. Das kam davon, daß sie anstelle ihres bisherigen Lebens unter freiem Himmel in festen Häusern wohnten und statt der früheren Kalt- nun Warmbäder nahmen. Vorher gewohnt, rohes Fleisch zu verzehren, sättigten sie sich jetzt an Leckerbissen und einheimischen Gewürzen und übernahmen sich an Wein und schwerem Getränk, ganz gegen ihre bisherige Sitte. Diese Lebensweise raubte ihnen ihren wilden Mut und schwächte ihre Körper, so daß sie weder Mühen noch Strapazen, noch Hitze oder Kälte oder Mangel an Schlaf mehr ertragen konnten.«[25]
Cäsar
Hätte es die Germanen nicht gegeben, Cäsar hätte sie erfinden müssen. Denn ohne sie existierte für ihn kein hinreichender Grund, Gallien mit Krieg zu überziehen und schließlich vollständig für das Römische Reich zu erobern. Ursprünglich war das nicht vorgesehen. Aufgabe Cäsars hätte sein sollen, die seit 150 Jahren von Rom kontrollierte Provinz »Gallia Narbonensis« als Statthalter zu verwalten. Ein Gebiet, das die französische Mittelmeerküste und ihr Hinterland umfasste sowie das Rhônetal bis zum Genfer See hinaufreichte. Im übrigen, den Löwenanteil ausmachenden Gallien lebten unabhängige keltische Stämme auf einem hohen kulturellen Niveau, allerdings ohne eine einheitliche politische Führung.
Es war ein reiches und blühendes Land. Der vollentwickelte Ackerbau produzierte regelmäßig Getreideüberschüsse, das Fleisch der gallischen Rinder und Schweine, die Wolle der Schafe waren gesuchte Exportartikel, berühmt war die Pferdezucht, das Handwerk von höchster Kunstfertigkeit. Im Boden fanden sich Gold und Eisen. Ein gutausgebautes Straßen- und Flußwegenetz verband die etwa 200 »Oppida«, wie die Römer die befestigten Keltenstädte, meist verteidigungsgünstig auf Berghöhen gelegen, nannten. Für antike Verhältnisse war Gallien dicht bevölkert. Mutmaßliche Schätzungen liegen zwischen fünf und zwölf Millionen Einwohnern.[26]
Doch kein Paradies ohne Schlange. Im Falle Galliens bestand die Versuchung im fast ununterbrochenen Streit der führenden Keltenstämme um die Vorherrschaft. Die hießen Averner, Remer, Treverer, Häduer und Sequaner und letztere waren gerade dabei, den kürzeren zu ziehen. Deswegen holten sie sich Hilfe von außerhalb.
Östlich des Rheins, im heutigen Baden-Württemberg, in Thüringen und im Elbtal siedelte die Stammeskonföderation der Sueben. Cäsar charakterisierte sie »als größten und streitbarsten Stamm der Germanen«,[27] gegliedert in hundert Gaue, aus denen sie 100000 Krieger aufbieten könnten. Die eine Hälfte bleibe zu Hause, um die Felder zu bebauen, die andere führe Krieg. Im nächsten Jahr würde dann gewechselt, damit niemand aus der Übung käme. Laut Cäsar lebten die Sueben vor allem von Milch und Fleisch und jagten leidenschaftlich gern. Sie waren kälteresistent, trugen selbst im Winter nur kurze Fellkleider und badeten zur Abhärtung in Flüssen. Sättel verachteten sie als für Weichlinge geschaffen. Diese Lebensweise machte sie stark, ungeheuer groß und unglaublich tapfer. Ihr höchster Ruhm bestand darin, so furchterregend auf ihre Nachbarn zu wirken, daß niemand wagte, sich in ihrer Nachbarschaft niederzulassen. Deshalb war ihr Gebiet von weiten Einöden umgeben.
Die Sueben, deren Gefährlichkeit Cäsar bewußt betonte und dabei alle bekannten Barbaren-Klischees bemühte, überschritten unter ihrem Anführer Ariovist den Rhein, um als Söldner der Sequaner gegen die Häduer zu kämpfen. Darin waren sie so erfolgreich, daß sie sich als Belohnung erst ein Drittel, dann sogar zwei Drittel des Sequanerlandes aneigneten und sich ihnen immer mehr Krieger anschlossen. Cäsar läßt einen Gallier klagen: »Als diese rohen und unkultivierten Menschen Felder, Kultur und Wohlstand Galliens schätzen gelernt hatten, folgten immer mehr und derzeit sind es schon 120000.« Da der germanische Ackerboden schlechter, die gallische Lebensweise attraktiver sei, kämen in wenigen Jahren alle Germanen über den Rhein. Cäsar glaubte zu wissen, was das bedeutete: Hätten sie erst ganz Gallien besetzt, würden sie wie ihre Vorfahren, die Kimbern und Teutonen, gegen Rom ziehen.[28]
Büste Cäsars
Angesichts dieser Lage konnten die Römer nur dankbar sein, daß Cäsar den Galliern mit seinen Legionen zu Hilfe eilte und gegen Ariovist, den »König der Germanen«, präventiv zu Felde zog. Der stellte erstaunt die Frage, was Cäsar in seinem Gebiet zu schaffen habe, das ihm durch Tapferkeit und Kriegsglück zugefallen sei, schließlich marschiere er auch nicht in der römischen Provinz herum. Die Antwort auf diese Impertinenz eines Barbaren gab Cäsar mit dem Schwert. Bei Mühlhausen verlor Ariovist die Schlacht (58 v.Chr.) und floh mit seinen Scharen zurück über den Rhein. Die Anhänger Cäsars feierten den Sieger als einen zweiten Marius, der wie dieser Rom vor den Germanen gerettet habe.[29] Das lag in der Familie, denn die Gattin des Marius war Cäsars Tante.
Tatsächlich war die Lage weit weniger dramatisch. Sein mehr als zehnjähriger Aufenthalt in Gallien hatte aus Ariovist einen halben Kelten gemacht. Er trug einen keltischen Namen, hatte eine Keltenprinzessin geheiratet und sprach keltisch.[30] »König der Germanen« hatte ihn nur Cäsar genannt, bei Strabo, dem griechischen Historiker, heißt Ariovist dagegen »König der Kelten«. Sein Heer setzte sich aus allen möglichen Stämmen zusammen. In seinen Reihen standen genauso keltische wie germanische Krieger, in ihrer Bewaffnung und Kampfesweise nicht voneinander zu unterscheiden. Daß Cäsar in seinem Buch über die Gallischen Kriege Ariovist prahlen läßt, seine »sieggewohnten und waffengeübten Germanen« seien »seit vierzehn Jahren unter kein Dach gekommen«,[31] hatte nichts mit der Realität, aber sehr viel mit Cäsars Absicht zu tun, Ariovist als einen aggressiven, gefährlichen Barbaren zu beschreiben.
Denn Ariovist war kein nomadischer Reiterkrieger. Was er suchte, war nicht Beute, sondern Land, um es zu bebauen und sich darauf anzusiedeln – und über nichts anderes beklagten sich ja die Sequaner. Von Cäsar in Ruhe gelassen, wären seine Scharen mit Sicherheit genauso keltisiert worden wie Dutzende anderer germanischer Stämme rechts und links des Rheins. Ein Marsch auf Rom lag völlig außerhalb seines Horizonts. Wie die gallischen Fürsten wollte er sein: ein Territorium besitzen und für seine Herrschaft Anerkennung. Diese hatte ihm der Senat, das oberste politische Gremium der römischen Republik, sogar gewährt, als es ihm den Ehrentitel »König und Freund des römischen Volkes« verlieh – wie noch im Vorjahr geschehen.[32]
Aber ein Ariovist, der sich mit Rom arrangieren, seine neuaufgerichtete Herrschaft konsolidieren wollte, war keine Gefahr. Als Vorwand, Gallien zu erobern, taugte er nicht. Also machte ihn Cäsar zum gefährlichen, unberechenbaren, herumschweifenden Germanenkönig und seine Gefolgschaften zum germanischen Großverband, der östlich des Rheins lauerte und jederzeit mit gewaltigen Kriegermassen über die zivilisierte Welt hereinbrechen konnte.
Erst diese Drohkulisse lieferte die Begründung, warum Rom eingreifen, Gallien besetzen mußte. Cäsar verkaufte seine Okkupation, die ihm das Geld, die Legionen und den Ruhm verschaffte, um in Rom seinen Anspruch auf die Führung des Staates durchzusetzen, als Verteidigungskrieg gegen die Germanen. Nur er könne ihn erfolgreich führen, da die Kelten dazu nicht in der Lage seien.
Cäsars Rheinübergang, Rekonstruktion
Dies sahen die Gallier anders. Sie verteidigten erbittert ihre angestammte Freiheit und wollten auf den Schutz Roms lieber verzichten, als sich unterwerfen. Sechs Jahre benötigte Cäsar, um ihren Widerstand zu brechen. Am Ende waren ein Viertel der Einwohner tot, ein weiteres Viertel in die Sklaverei gewandert, aber das Römische Reich war um eine halbe Million Quadratkilometer größer und reichte nun bis zum Atlantik und zum Rhein.
Der große Strom bot sich aus praktisch-militärischen Erwägungen an. Er war keine Völkergrenze, wie Cäsar behauptete, denn es gab sowohl linksrheinische Germanen als auch rechtsrheinische Kelten.[33] Während des langen gallischen Krieges, in dem die Legionen mehrmals in schwere Bedrängnis gerieten, griffen die als so gefährlich erachteten Germanen nicht etwa auf gallischer Seite in die Kämpfe ein, sondern ließen sich von Cäsar als Söldner anwerben. Nur mit ihrer Hilfe war es ihm möglich, die vorzügliche keltische Reiterei zu schlagen, was entscheidend zu seinem Sieg beitrug.[34] Wo Cäsar die eigentliche Bedrohung der Macht Roms sah, zeigte sich an den Stationierungsorten der Legionen. Ihre Lager wurden nicht am Rhein, sondern im Innern Galliens errichtet.
Die rechtsrheinischen Germanen einzuschüchtern und von Plünderungszügen abzuhalten, genügten zwei Brückenschläge, die Cäsar 55 und 53 v.Chr. ausführen ließ, da er es unter seiner und der Würde des römischen Volkes fand, per Schiff überzusetzen. Es waren technische Meisterleistungen, die ersten Brücken über den Rhein, von den Germanen bewundert und bestaunt.[35] Zugleich demonstrierten sie, daß die Macht Roms nicht an seinem Westufer endete.[36] Sechzehn Tage blieb Cäsar auf der östlichen Seite, dann kehrte er zurück und befahl, die Brücke abzubrechen. Er hatte erfahren, was er wissen wollte: Dieses Land, Germanien, zu erobern, lohnte sich nicht.
Kapitel IIZweimal Germanien
Der römische Blick
Mit den Worten des römischen Historikers Tacitus beschrieben, bot Germanien »einen traurigen Anblick«. Es war »ein gestaltloses Land« voller »schauriger Wälder, grässlicher Sümpfe« und rauer Gebirge.[1] Es lag so abseits, so am Rand der Kulturwelt, daß die Götter des Acker- und Weinbaus, Ceres und Bacchus, vergessen hatten, es zu besuchen, und so »führen die Einwohner von allen Menschen das erbärmlichste Leben. Sie pflanzen keine Ölbäume und erzeugen keinen Wein«,[2] wie ein römischer Beamter beim Anblick dieses Notstandsgebiets nüchtern feststellte.
Wie weit Germanien vom Rhein nach Osten reichte, wußte man nicht genau. Cäsar vertrat die Ansicht, es erstrecke sich bis zu den Skythen, also bis zum Don. Zwei Jahrzehnte danach, etwa 30 v.Chr., grenzte es der römische Feldherr Agrippa mit der Weichsel ein, berechnete aber den Abstand zwischen diesem Fluß und dem Rhein mit 600 Kilometern als zu gering. Da ihm der gleiche Fehler in der Nord-Süd-Ausdehnung unterlief, wo Germanien vom Meer bis zur Donau reichte, wurde das Land für sehr viel kleiner als Gallien gehalten.[3] Wiederum fünfzig Jahre später wußte der griechische Geograph Strabo, »daß der Fluß Elbe Germanien in zwei Teile schneidet«, schätzte aber den Abstand zwischen Rhein und Elbe mit 3000 Stadien (555 km) viel zu groß. Was jenseits der Elbe lag, war ihm völlig unbekannt, wohingegen der römische Forscher Plinius 70 n.Chr. in seiner Naturgeschichte die Weichsel als Grenze wieder erwähnte.[4] Die in den Rhein fließenden Flüsse waren bekannt, ebenso Nord- (Mare Germanicum) und Ostsee (Mare Suebicum), aus denen das einzige germanische Handelsgut kam, das im Mittelmeerraum nicht vorhanden und dort wirklich begehrt war: Bernstein.[5]
Die zahlreichen Stämme, die Germanien bewohnten (s. Karte auf S. 28), Friesen und Chauken, Brukterer und Marser, Chatten und Cherusker, Ampsivarier und Sugambrer, Usipeter und Tenkterer, Sueben und Markomannen, Langobarden und Semnonen, um nur die wichtigsten zu nennen, kannten die Bezeichnung »Germanen« nicht. Daß sie von Cäsar so genannt wurden, ahnten sie so wenig, wie die Comanchen, Apachen, Sioux oder Assiniboins Nordamerikas den Namen »Indianer« auf sich bezogen. Es gab auch kein einheitliches »Germanenbewußtsein«. Jeder Stamm empfand sich als autonom. Auch die untereinander verwandten Sprachen schufen keine gemeinsame Identität, sowenig wie die ähnlichen Formen der Religion. Die Vorstellung eines »Volks der Germanen« stammt aus dem 19. Jahrhundert und entspricht nicht der historischen Realität. Möglich wäre, daß der Germanenbegriff des Poseidonios (s. Kap. I, S. 14) aktuell wurde, als die gallischen Kelten die von Osten einbrechenden wilden Scharen des Ariovist erblickten, ebenfalls denkbar, daß der Begriff schon für linksrheinische Germanen, die sich unter den Kelten angesiedelt hatten, in Gebrauch war; Cäsar hätte ihn dann für seine Zwecke instrumentalisiert und als Sammelbegriff für die rechtsrheinischen Stämme popularisiert.[6]
In seinem ethnographischen Werk über Land und Leute, der »Germania«, die um das Jahr 100 n.Chr. entstand, versuchte Tacitus eine Unterteilung der Germanen. Er hatte herausgefunden, daß sie sich von einem gemeinsamen Stammvater ableiteten, Tuisto, dessen drei Abkömmlinge den drei Hauptgruppen ihre Namen gaben: Ingävonen, Istävonen, Herminonen.[7] Sie entsprechen unserer modernen geographischen Einteilung in Nordsee-, Rhein-Weser- und Elbgermanen. Was auf der Karte überzeugend wirkt, läßt sich im Gelände nicht nachweisen. Wo immer die Archäologen zwischen Flandern und der norddeutschen Tiefebene ihren Spaten ansetzen: Die ausgegrabenen Siedlungen können in der Zeit um Christi Geburt nicht eindeutig Kelten oder Germanen zugewiesen werden. Die Übernahme bestimmter Schmuckformen, Waffen oder anderer Gegenstände des Alltagsgebrauchs war ja nicht verboten. Ein »keltisierter« Germanenstamm folglich von einem keltischen kaum zu unterscheiden. Cäsars Völkergrenze Rhein war ein absichtsvolles, jedoch höchst wirkungsvolles Konstrukt, daß ein für allemal die Germanen jenseits der Zivilisation ansiedelte. Eben deswegen glaubten die römischen Geographen und Historiker, es träfe auf sie zu, was man schon immer von den Barbaren des Nordens zu wissen behauptete.
Stammesgebiete der Germanen im 1. Jh.n.Chr
Um den turmhohen Unterschied zwischen Römern und Germanen zu verdeutlichen, greift man am besten auf die Kolonialgeschichte zurück. Der amerikanische Kavallerieoffizier in den Indianergebieten, der englische oder deutsche Missionar in Afrika, empfanden gegenüber den »Wilden« genau das gleiche Überlegenheitsgefühl, die Gewissheit, auf einer höheren Stufe der Kultur zu stehen, wie die Römer gegenüber den Germanen. Und ebenso wie diese waren sie zutiefst davon überzeugt, daß es nur eine richtige Art zu leben, einen besten »way of life« gab: den eigenen.
Bestimmte Tatsachen in puncto Germanen standen für die Römer unverbrüchlich fest. Beispielsweise, daß der Germane viel redete, wenn der Tag lang war, aber nichts zuwege brachte. Denn er war faul und zu disziplinierter Arbeit unfähig. Er war jähzornig, grausam und neigte zu alkoholischen Exzessen: »Tag und Nacht durchzuzechen, ist für keinen eine Schande.«[8] Er war unzuverlässig bis zur Treulosigkeit und kannte zur Durchsetzung seiner Interessen nur Willkür und Gewalt. Er liebte die Freiheit, was aber nur bedeutete, daß er den Wechsel von Befehl und Gehorsam nicht verstand, der die Voraussetzung war für jegliche Ordnung, sei es im Staat, sei es in der Armee. So gesehen, konnte er froh sein, wenn er unter römische Herrschaft geriet, vertraut wurde mit Gesetz und Recht und damit langsam in den Status eines Vernunftmenschen aufstieg.[9]
Recht hatte Cäsar, diesseits des Rheins zu bleiben. Um so mehr, als man davon überzeugt war, daß die Charaktereigenschaften der Germanen sich verschlechterten, immer extremer wurden, immer wilder, je weiter man nach Osten kam. Dort gab es Stämme, die nur in der Nacht kämpften, schwarz bemalt die Gesichter, Leiber und Schilde, »grauenvoll und schattenhaft wie das Totenheer«. Andere wurden von einer Frau regiert, was der römische Geschichtsschreiber so unglaublich fand, daß er diesen Zustand schlimmer beurteilte als Sklaverei.[10]
In den Augen der Römer fehlte den Germanen jeder zivilisatorische Schliff. Das zeigte sich vor allem im Alltag. Kultivierte Menschen tranken keine Milch. Beim griechischen Dichter Homer war es die Nahrung der ungeschlachten einäugigen Kyklopen. Große Fleischmengen verzehrten sie, weil es ihnen an Brot fehlte, sie also zu wenig Getreide anbauten. Ebenso war das bei ihnen verbreitete Getränk, das ohne Hopfen hergestellte und deswegen wenig haltbare Bier, ein Zeichen des Mangels. Denn die Germanen verstanden sich nicht aufs Pflanzen von Reben und das Keltern der Trauben. Nicht einmal richtig genießen, konnten sie den Wein. Während man ihn in Italien mindestens im Verhältnis 1:3 mit Wasser mischte, ließ der trinkfreudige Bewohner der nördlichen Wälder jedes Maß vermissen und schüttete ihn pur in sich hinein. Völlig anders verfuhr man auch bei der Körperreinigung. Die Römer rieben ihre Körper mit Öl ab, entfernten dann den Schmutz mit Schabern und badeten anschließend in warmem Wasser. Der Germane bereitete aus Ziegentalg oder Wollfett, Buchenasche und Pflanzensäften eine Masse, die er Seife nannte, und sprang damit in Fluß oder See.[11a] Unterschiedlich war schließlich das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit. Die bei Kelten und Germanen übliche Kleidung, die Hose, hatte beim Rom-Besuch einer gallischen Delegation zu einem Auflauf geführt, wobei die Tunika und Toga tragenden Römer ihr Erstaunen über den lächerlichen Anblick kaum unterdrücken konnten. Gleiches galt für die germanentypischen Langhaarschöpfe und die wuchernden Vollbärte,[11] denen man einen militärisch-kurzen, kantigen, über der Stirn gerade abgeschnittenen Haarschnitt und ein glattrasiertes Kinn entgegensetzte.
Es gab freilich etwas, was die Römer an den Germanen bewunderten und fürchteten: ihre Kampfkraft. Sie stützte sich auf Tapferkeit bis zur Tollkühnheit, Gewandtheit, körperliche Stärke und Größe, Ausdauer und Gefolgschaftstreue bis in den Tod – was sie zu begehrten Söldnern und Leibwächtern machte. Aber worauf beruhte diese militärische Leistungsfähigkeit?
Sie mußte, darin stimmen die antiken Autoren überein, mit der kriegerischen Lebensweise der Germanen zusammenhängen. Statt die Felder zu bestellen, jagten sie lieber oder überfielen ihre Nachbarn. Ihre Häuser bauten sie mit Absicht schlampig und zugig, um sich abzuhärten. An den Baumaterialien Holz und Stroh (für die Dächer) und der rohen, hässlichen Art der Verarbeitung ließ sich der niedrige Grad ihrer Zivilisation ablesen.[12] Sie betrieben keine richtige Landwirtschaft, sondern nur eine Art Wanderfeldbau, damit sie jederzeit weiterziehen konnten. Die tapfersten Germanen, die Sueben, taten selbst das nicht: »Sie betreiben weder Ackerbau noch Vorratswirtschaft, sammeln keine Schätze, sondern wohnen in Hütten. Ihre meisten Nahrungsmittel nehmen sie vom Zuchtvieh, und so können sie es den Nomaden gleichtun, indem sie Hab und Gut auf Karren laden und mit ihren Herden dorthin ziehen, wo es ihnen beliebt.«[13]
Daraus ergaben sich zwei Folgerungen. Jederzeit war mit einem Angriff wilder Stämme aus der germanischen Wald- und Sumpffestung zu rechnen. Umgekehrt hatten die Römer im Fall einer Okkupation nichts zu gewinnen als mageres Vieh und nichts zu erwarten als Schwierigkeiten.
Germanenleben
Über die Germanen existieren nur römische und griechische Berichte. Sie selbst haben uns nichts hinterlassen, denn sie kannten keine Schrift, und auch diejenigen, die später im Dienst des Imperiums standen, Latein sprechen, schreiben und lesen lernten, sahen keine Veranlassung, etwas über ihre Vorfahren und ihre Lebensweise zu überliefern. Zweihundert Jahre Forschung in den Bereichen der Vergleichenden Sprachwissenschaft, vor allem aber die Ergebnisse der Archäologie, versetzen uns heute in die Lage, die Aussagen der antiken Quellen zu überprüfen – und in vielen Punkten richtigzustellen.
Das Leben in Germanien war hart. Die Bewohner fristeten ihr Dasein als Bauern, die mit ihren Sklaven, tagein, tagaus die Äcker bestellten. Mit primitiven hölzernen Hakenpflügen, von Rindern gezogen, kratzten sie über die Ackerkrume und bauten Gerste und Hirse, Dinkel und Emmer, Nacktweizen und Einkorn, Roggen und Hafer an.[14] Dabei war der Wanderfeldbau bei schlechteren Böden keine freiwillige Entscheidung für ein ungebundenes Nomadentum, sondern schiere Notwendigkeit, da die ungedüngten Böden rasch auslaugten. Er vollzog sich aber nicht jährlich, sondern in größeren zeitlichen Abständen. Sorgte man dann noch fürs Vieh (Rinder, Schafe, Ziegen) und die hochbeinigen Weideschweine, die man zur Mast in die Wälder trieb, blieb für die von den Römern so gerühmte »Schule des Krieges«, die Jagd, keine Zeit. Abgesehen davon, daß für bäuerliche Gemeinschaften, in denen die Arbeitskräfte knapp sind, die Pirsch auf Wolf, Bär oder Auerochse ein viel zu hohes Lebens- und Verletzungsrisiko darstellt.
Sowohl die Ausgrabungen germanischer Siedlungsplätze als auch Haar- und Mageninhaltsuntersuchungen von Moorleichen haben ergeben, daß sich die Germanen überwiegend vegetarisch ernährten. Fleisch und Fisch kamen höchst selten auf den Tisch. Der Wildtieranteil betrug nicht einmal fünf Prozent.[15] Tägliche Hauptspeise bildete ein grob geschroteter Brei aus Hirse, Hafer oder Gerste, dem englischen Porridge vergleichbar, dem als Nahrungsergänzung Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohrrüben oder geröstete Eicheln hinzugefügt wurden. Brot gab es nur an Festtagen. Auch die Vorstellung, daß der Germane auf der Suche nach Wildfrüchten durch die Wälder streifte, muß ins Reich der Fabel verwiesen werden. Selten finden sich Beeren, Pflaumen, Wildkirschen oder Haselnüsse im Fundgut. Obstbau war unbekannt. Äpfel, Zwetschgen und Birnen, die diesen Namen verdienten, gab es erst, als die Römer diese und andere Sorten in Germanien kultivierten. In der auf bloße Selbstversorgung angelegten Landwirtschaft kam es offenbar immer wieder zu Nahrungsengpässen. Dies belegen »Harris-Linien«, die man bei Knochenuntersuchungen entdeckte. Sie deuten auf Wachstumsstörungen hin und sind Anzeichen von Ernährungsmängeln. Germanische Volkskrankheit Nummer eins, gleich gefolgt von der Arthrose, die an fast allen Skeletten der über 30jährigen nachzuweisen ist, war Karies. Zwar gab es kein Zuckerproblem – Honig war das einzig bekannte Süßungsmittel –, doch das mit Steinmühlen erzeugte Mehl war derart mit sandigem Abrieb versetzt, daß es wie Schmirgelpapier auf den Zahnschmelz wirkte.[16]
Städte gab es nicht. Die einst von Kelten in Germanien gegründeten »Oppida« waren seit der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts verlassen und aufgegeben. Die Germanen lebten vorzugsweise in Einzelgehöften inmitten ihrer Äcker oder in Dörfern, die höchstens zehn bis dreißig Gehöfte mit etwa 100-200 Bewohnern umfassten.[17] Die Bauernhöfe glichen heutigen im Alpenvorland. Es waren Wohnstallhäuser von etwa 12 bis 25 Meter Länge, etwa 4 bis 6 Meter breit, wobei der Stallteil drei Viertel des Hauses einnahm. Das dort gehaltene »Großvieh« war verglichen mit römischem ausgesprochen klein. So wiesen die Pferde nur eine Widerristhöhe von 1,20 Meter auf (etwa mit heutigen Islandponys zu vergleichen), die Rinder brachten es auf bescheidene 1,10 Meter.[18] Es kam den Germanen allerdings mehr auf die Zahl als auf die Größe ihrer Tiere an. Rund um das Hauptgebäude lagen kleinere Häuser, in denen Schmiedewerkstatt, Backhaus, Töpferei, Webhaus und Speicher untergebracht waren. Damit deckte der einzelne Hof alle Bedürfnisse des bäuerlichen Lebens ab. Während die Töpferei nur von Hand ausgeführt wurde, da die Töpferscheibe unbekannt war, konnte die Webtechnik durchaus mit der römischen konkurrieren. Die Schmiede litten unter dem in ganz Germanien zu spürenden Eisenmangel, der sich nicht nur in der Herstellung von Ackergeräten, sondern vor allem bei der Bewaffnung auswirkte. Umschlossen wurden Siedlung und Hof meist von einer Palisade.
Germanisches Gehöft und Wohnstallhaus
Die Häuser selbst waren in einer Holz-Ständer-Konstruktion erbaut, meist »dreischiffig« mit zwei Balkenreihen. Die Wände aus Flechtwerk verschmierte man mit Lehm, das Dach war mit Schilf gedeckt. Fenster,[19] Kamine oder Schornsteine existierten nicht. Es gab nur ein Windauge für den Rauchabzug. Wie archäologische Untersuchungen an Balken erwiesen, glich der einzige Wohn-, Schlaf-, Eßraum, in dem bis zu drei Feuerstellen brannten, ab einer Höhe von 1,20 Meter einer verqualmten Räucherkammer, die nach unseren Maßstäben extrem ungesund gewesen sein muß. Stall und Wohnbereich gingen ineinander über. Um die Körperwärme der Tiere auszunutzen, nahm man den Geruch in Kauf.[20]
Die adlige Oberschicht lebte nicht viel besser. Ihre Höfe waren größer, die Stallungen immerhin vom Haupthaus getrennt,[21] Kleidung und Waffen prächtiger und zahlreicher, die Palisaden höher, aber eigentliche Fürstensitze in Form von Burgen oder befestigten Plätzen sucht man vergeblich.[22] Denn die einzelnen Stämme hatten kein Zentrum und keinen Stammesführer oder König, dessen Befehle für alle galten. Man muß sich diese »Völker«, die etwa 50000 bis 150000 Angehörige umfassten und deren Grenzen und Siedlungsgebiete sich beständig veränderten, als eine Ansammlung von Familienclans vorstellen, deren ureigenstes Interesse sich zunächst darauf richtete, die eigene Machtposition zu verbessern. Gemeinsam waren ihnen nur die heiligen Haine und die Opferplätze, an denen sie die Götter verehrten. Ein- oder zweimal im Jahr traf sich dort die Vollversammlung des Stammes zum »Thing«, auf dem Gericht gehalten und Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung erörtert wurden. Aber die hier getroffenen Entscheidungen waren nicht in unserem Sinne »verbindlich«. Recht zu bekommen, etwa als Geschädigter, dem eine Ausgleichszahlung (Wergeld) zugesprochen wurde, bedeutete zunächst nur, einen moralischen Sieg erfochten zu haben. Seinen Anspruch durchsetzen mußte das Opfer selber. Polizei, Gerichtsvollzieher und all das, was wir unter staatlicher Exekutive verstehen, gab es nicht. Übrigens auch keinen Staatsanwalt, der von sich aus bei Rechtsverletzungen tätig wurde. »Wo kein Kläger, da auch kein Richter«, lautete die Maxime.[23] War das Thing nicht in der Lage, Konflikte beizulegen, entstanden endlose Kleinfehden zwischen den Sippen bis hin zur Blutrache, die sich über Generationen hinzog.
Germanische Krieger mit charakteristischer Haartracht, dem Suebenknoten
Rolle des Adels war es, im Frieden zu vermitteln und Recht zu sprechen, im Krieg die Männer in den Kampf zu führen. Er tat es kraft seiner Abstammung, die in der Tiefe der Zeiten wurzelte, und weil er sich auf Vorfahren berief, die sich in der Vergangenheit durch Weisheit und Tapferkeit ausgezeichnet hatten. Die Germanen waren überzeugt – hierin unterschieden sie sich nicht von den Römern, – daß spezifische Eigenschaften an bestimmte adlige Geschlechter gebunden waren und diese Familien im besonderen Maße von den Göttern bevorzugt würden.
In Krieg und Frieden konkurrierten die adligen Familien um das höchste Ansehen im Stamm. Gewonnen hatte derjenige Anführer, der die meisten Gefolgsleute um sich scharen konnte:
»Das bedeutet Ansehen, das Macht, stets von einer großen Schar auserlesener junger Männer umgeben zu sein, im Frieden eine Zierde, im Krieg ein Schutz. Nicht nur beim eigenen Stamm, sondern auch bei den benachbarten Völkern erwirbt sich ein jeder Namen und Ruhm, wenn er durch die Anzahl und Tapferkeit seiner Gefolgsleute hervorragt«,[24] beschrieb Tacitus das Phänomen.
Einem charismatischen Anführer strömten von allen Stämmen Gefolgsleute zu. Entscheidend war, daß er »Heil« besaß, die Götter auf seiner Seite wußte. Man sah es an seinen kriegerischen Erfolgen, wenn er Waffen und andere Kostbarkeiten erbeutete, Gold, auch Land und Sklaven verteilte. Im Frieden war die Gefolgschaft ein teures Vergnügen. Im Gegenzug für ihre Treue bis in den Tod – so galt es als Schande, wenn die Gefolgsleute den Tod ihres Anführers in der Schlacht überlebten – erwarteten sie Unterhalt und Geschenke für ihre Dienste: »Sie verlangen nämlich«, fährt Tacitus fort, »von der Freigebigkeit ihres Herrn das ihnen zustehende Streitroß, die ihnen zustehende blutige siegbringende Frame (Wurfspeer, Anm.d.Verf.) und festliche Gelage. Wenn sie nicht in den Krieg ziehen, verbringen sie nicht viel Zeit mit der Jagd, mehr mit Nichtstun, dem Schlafen und Essen ergeben. Gerade die tapfersten und größten Krieger tun gar nichts. Sie sind träge aus einem sonderbaren Widerspruch in ihrem Wesen heraus, da dieselben Menschen so sehr das Nichtstun lieben und die Ruhe des Friedens hassen.«[25] Dementsprechend mußte der Anführer seiner Gefolgschaft etwas bieten. Tatenlosigkeit führte unweigerlich zur »Kündigung« der Krieger, die nach dorthin abwanderten, wo mehr Ruhm, Ehre und Beute winkten. Wie diese auszusehen hatte, zeigt uns der Inhalt der germanischen Fürstengräber, in denen sich als Zeichen von Reichtum und Prestige vor allem römische Stücke (Waffen, Helme, Kessel, Schmuck) finden.[26]
Es gab zwei Strategien, um in ihren Besitz zu kommen. Die eine hatte Ariovist gewählt, als er den Rhein überquerte und sich mit Gewalt holte, was er wollte. Die andere bestand darin, römische Waffendienste zu nehmen, wie die germanischen Reiter im gallischen Krieg Cäsars. Seit das Imperium zum Nachbarn der Germanen geworden war, gab es für beide Alternativen Befürworter und Gegner in den Stämmen und Gefolgschaften: Romfeinde und -freunde. Abgesehen von der Varusschlacht hat nichts die Römer so aus dem Konzept gebracht wie die Unmöglichkeit, von einem germanischen Stammesführer eine verlässliche und alle seine Krieger bindende Zusage für Frieden oder Waffenstillstand zu erhalten.
Im Vergleich zu Gallien war Germanien dünnbesiedelt. Geschätzt werden zwei bis sechs Einwohner auf den Quadratkilometer, was ungefähr einer Bevölkerung von anderthalb bis drei Millionen Menschen entspricht.[27] Die Unzugänglichkeit des Landes und die mangelhaften Verkehrsverhältnisse wurden von den römischen Schriftstellern allerdings reichlich übertrieben dargestellt. Ähnlich wie heute von den Abenteurern und »Grenzgängern« packende Schilderungen ihrer überstandenen Gefahren gefordert werden, erwartete das römische Publikum in den Berichten über die nördlichen Länder und ihre Barbaren dramatische Bilder von Sumpf, Urwald und wilden Stämmen.
Die römischen Militärs an der Rheingrenze wußten es besser. Händler, Späher oder befreundete Stämme lieferten die Informationen, die ihnen vielleicht einmal nützlich sein würden. Germanien verfügte nicht über befestigte Straßen, wie sie die Römer überall in ihrem Herrschaftsgebiet bauten, aber es war nicht weglos. Alte Handelswege, beispielsweise die »Bernsteinstraße« von der Ostsee zur Adria oder der »Hellweg« vom Niederrhein zur Elbe, verliefen auf natürlichen Trassen, auf Höhenwegen in den Mittelgebirgen, auf Geestrücken in Norddeutschland. Durch die Moore führten Knüppeldämme und Bohlenwege.[28] Die zahlreichen Flüsse wurden als Transportwege genutzt. Daneben existierten Wirtschaftswege von Dorf zu Dorf und eine Vielzahl anderer Verbindungen, die abkürzten oder den Marsch bei schlechtem Wetter erleichterten. Sie zu begehen, war man freilich auf einheimische Führer angewiesen.[29]
Als literarische Fiktion erwies sich auch die Vorstellung eines flächendeckenden, unpassierbaren Urwalds. Natürlich war Germanien vor allem ein Waldland. Überließe man die Vegetation sich selbst, wären neunzig Prozent Mitteleuropas mit Wald bedeckt. Aber seit Jahrtausenden wurde gerodet und aufgelichtet, um Acker- und Weideflächen zu erhalten. Es wurde Holz für den Hausbau geschlagen, und das Vieh sorgte mit seinem Verbiß für das Niederhalten der Austriebe. In den Lößebenen der Wetterau und der norddeutschen Mittelgebirgsschwelle (Börden) sowie in den Flußtälern lagen kleinere und größere Siedlungsinseln inmitten von Wiesen und Feldern, allmählich von lichterem Bewuchs (Waldweide) in Urwald übergehend.[30]
Dieser Wald hatte in seinem Aussehen wenig mit unseren Forsten und Holzplantagen zu tun. Der Naturforscher Plinius, der als römischer Offizier an der Germanengrenze diente und ihn mit eigenen Augen sah, schwärmte: »Die ungeheure Größe der Eichen, seit Jahrhunderten unberührt, übertrifft alle Wunder. Ihre Wurzeln wölben sich gleich weiten Toren auf, so daß sie ganzen Reitergeschwadern Durchgang gewähren.«[31] Im Flachland wie im Mittelgebirge dominierten Buchenwälder. In niederen Lagen traten Eichen, in höheren Lagen der Bergahorn hinzu. Undurchdringlich waren diese Wälder nicht, denn ein Buchen-Hochwald ist am Boden durch Baumschatten wachstumsarm und keinesfalls mit einem tropischen Regenwald zu vergleichen. Natürlich existierten weglose, schwer passierbare Wälder. »Refugien«, in die man Flüchtlinge, die sich auskannten, möglichst nicht verfolgte. Doch im Bereich der Norddeutschen Tiefebene gab es durch feuchte Niederungen, Moore und Heiden, die ungefähr ein Viertel ihrer Fläche bedeckten, sogar offene Landschaften. Die Vorstellung eines Landes, daß »durch zahlreiche Flüsse unwegsam und wegen der Wälder und Sümpfe über weite Teile unzugänglich« sei, wie wir sie beim römischen Geographen Pomponius Mela und bei Tacitus[32] lesen, der Germanien nie besuchte, trifft genausowenig zu wie ein moderner Vergleich mit den hunderttausend Quadratkilometer umfassenden, russischen Pripjet-Sümpfen.[33] Höchstens in einem Punkt: Wie dort und in den vergleichbaren Landschaften Skandinaviens müssen im Sommer Myriaden von Mücken und Fliegen herumgeschwirrt sein, eine Plage für Mensch und Vieh.
Kapitel IIIDie Römer
Schon die Zeitgenossen fragten sich, wie eine kleine Stadt am Tiber, umgeben von mächtigen Nachbarn, sich hatte aufschwingen können zur Herrin der Welt. Sich langsam vortastete in Mittelitalien, dann die Griechen Süditaliens besiegte und die Kelten der Poebene, die Flotten und Heere der Karthager in Nordafrika und Spanien und ihren berühmten Feldherrn Hannibal, bis sie schließlich die Könige des Ostens und ihre Reiche, Perseus von Makedonien, Mithridates in Kleinasien, Antiochos in Syrien und Palästina und zuletzt das uralte Ägypten, das reichste Land der Mittelmeerwelt, unterwarf.
Was besaßen die Römer, was andere Völker, die doch genauso tapfer waren, genauso eifrig und fromm in der Verehrung der Götter, nicht hatten? Der griechische Historiker Polybios, im zweiten Jahrhundert v.Chr. als Kriegsgefangener nach Rom gebracht, versuchte eine Antwort in seinen »Historien«, einer vierzig Bücher umfassenden Geschichte der Eroberung der Weltherrschaft durch Rom.
Polybios kannte die griechischen Stadtstaaten und ihre Verfassungen. Athens Demokratie, in der alle Ämter durch Wahlen der Bürger besetzt wurden, oder Sparta, das von einer adligen Elite regiert wurde, einer Aristokratie. Und natürlich kannte er die Herrschaft von Königen, die Monarchie. All diese Verfassungen unterlagen der Gefahr der Entartung. Die Demokratie konnte zur zügellosen Pöbelherrschaft werden, die Aristokratie sich von der Herrschaft der Besten zur Herrschaft der Reichen entwickeln, die Monarchie zur Tyrannis, zur willkürlichen Herrschaft eines Mannes, degenerieren.
Die Römer jedoch hatten es verstanden, die Vorteile der drei in einer Mischverfassung zu kombinieren. Ihr Staat verfügte über eine Volksversammlung, die jährlich die Beamten wählte, besaß einen Senat, das eigentliche Regierungsorgan, in dem die großen aristokratischen Familien vertreten waren, und mit den beiden Konsuln, den höchsten Staatsbeamten, zwei kleine »Könige«. Denn ihre Amtsgewalt in Krieg und Frieden war fast Monarchen gleich. Die Gefahr eines Machtmissbrauchs war jedoch gebannt. Die Konsuln kontrollierten sich gegenseitig, wurden nur für ein Jahr gewählt und durften erst nach einem Intervall von zwei Jahren erneut kandidieren. Nur in Notzeiten wählte man, befristet auf sechs Monate, einen Diktator. Die ganze Energie des Staates erschöpfte sich deswegen nicht in inneren Parteikämpfen, sondern verlagerte sich nach außen, in Eroberungen anderer Länder und Völker.[1]
Hundert Jahre später pries der römische Staatsmann Cicero aus den gleichen Gründen die Verfassung der »Res publica«, der römischen Republik, als die Beste aller möglichen.[2] Aber der ehemalige Konsul und gefeierte Schriftsteller, der in seinen Werken die »humanitas« (Menschlichkeit) als philosophisches Lebensprogramm propagierte, wurde auf Veranlassung seiner politischen Gegner am 7. Dez. 43 v.Chr. auf der Flucht erschlagen; seine rechte Hand, mit der er seine Reden verfasste, und sein Kopf, mit dem er sie erdachte, als abschreckendes Beispiel auf dem Forum in Rom auf der Rednertribüne angenagelt.[3] Statt gegen äußere Feinde kämpften in einem zwanzigjährigen blutigen Bürgerkrieg Römer gegen Römer – und keine Verfassung, auch nicht die vorgeblich beste, gebot ihnen Einhalt.
Tatsächlich war es so, daß die Römer den Krieg für das Funktionieren ihres Staates brauchten. Der Bürgerkrieg, der in den Jahren 49–30 v.Chr. das Römische Reich erschütterte und aus dem Augustus als alleiniger Sieger hervorging, war nur die letzte Steigerung, die äußerste Konsequenz dieses Gesetzes.
Der römische Adel, die Nobiles, bildete eine Leistungselite. Kraft der Taten ihrer Vorfahren und ihrer eigenen traten sie in einem harten Konkurrenzkampf um Ämter, Statthalterposten, Militärkommandos gegeneinander an. Von Anbeginn waren sie darauf konditioniert, in der staatlichen Ämterlaufbahn (cursus honorum) und nirgendwo sonst, Karriere zu machen. Darauf wurden sie gründlich vorbereitet.
Schon im Alter von zehn Jahren begann die Ausbildung in Rhetorik. Vorzugsweise pflegte man griechische Lehrer damit zu betrauen, die als die besten galten. Sich präzise auszudrücken, schwungvoll und mitreißend zu reden, war unbedingte Notwendigkeit. Immer und überall das Wort zu ergreifen, witzig und treffend zu formulieren, erwartete das Volk ganz selbstverständlich von einem Aristokraten: vor dem Heer, um es zur Schlacht zu begeistern oder zur Disziplin zu mahnen, vor Gericht oder im Senat und in der Volksversammlung.
Körperliche Ertüchtigung war genauso wichtig. Wer später Legionen kommandieren wollte, mußte reiten, schwimmen und mit den Waffen umgehen können. Was man sonst noch zu wissen brauchte, lernten die jungen Adligen beim Heer. Als Militärtribunen begleiteten sie erfahrene Kommandeure ins Feld, dienten mehrere Jahre im Stab oder als Befehlshaber kleinerer Einheiten.
Im Winter, wenn der Krieg ruhte und sie nach Rom zurückkehrten, lernten sie als Zuschauer und Helfer ihrer Väter und Verwandten den Umgang mit Recht und Gesetz. Jede der großen Familien hatte zahllose Klienten. Bürger, die ihnen verpflichtet waren und die umgekehrt bei Streitigkeiten und Prozessen von ihnen Hilfe erwarteten. Die Gerichtsverhandlungen fanden öffentlich statt. Manche zogen mehr Publikum an als eine Vorstellung im Amphitheater. Sowohl als Verteidiger wie als Ankläger konnte man sich einen Namen machen.
Erst nach dieser gründlichen Ausbildung unter den kritischen Augen ihrer Standesgenossen und der Bürgerschaft und nachdem sie zehn Jahre im Heer und in der Stadtverwaltung Erfahrungen gesammelt hatten, durften sie sich im Alter von 31 Jahren für die Quästur, die erste Stufe der Ämterlaufbahn, bewerben[4a]. Gelang ihnen der Sprung und bewährten sie sich, konnten sie sich Hoffnungen machen, weiter aufzusteigen, zum Ädilen, später zum Prätor, der ein Lebensalter von vierzig Jahren voraussetzte. Die Krönung einer solchen Karriere bildete das Konsulat, das frühestens mit 43 Jahren bekleidet werden durfte. Die Chance, ein Amt zu erhalten, erhöhte sich dadurch, daß die Ämter jährlich neu besetzt wurden, andererseits war ihre Zahl um so geringer, je höher man aufstieg. Den zwanzig Quästorenstellen standen zehn für die Prätoren und nur zwei Konsuln gegenüber. Irgendwann das Konsulat oder zumindest die Prätur zu erlangen, war das erklärte Ziel der ehrgeizigen Adligen. Nach Ablauf der Amtszeit winkten dann ein lukrativer Statthalterposten in den Provinzen oder ein militärisches Kommando. Es machte auch einen Unterschied, ob die Laufbahn schon nach der Quästur endete oder ihre Fortsetzung in höheren Ämtern fand. Zwar stieg man schon als ehemaliger Quästor in den Senat auf und bestimmte dort die Geschicke des Staates mit, doch zeigte sich die Bedeutung seiner Mitglieder bei den Abstimmungen. Die Reihe war zunächst an den ehemaligen Konsuln, dann folgten die Prätoren, schließlich die übrigen Rangklassen.
Um sich für die höchsten Ämter zu qualifizieren, gab es keine bessere Möglichkeit als den Krieg. Männer wie die Scipionen, Marius, Sulla, Pompeius, Crassus, Cäsar lieferten die Beispiele, daß »der Ruhm militärischen Erfolgs alle anderen überragt«,[4] daß nur er »die Ewigkeit der Zeiten«[5] überdauerte. Die Geschichte Roms war die Geschichte militärischer Heldentaten seiner Feldherrn, denen man Statuen mit der ehrenden Inschrift aufstellte: »Er hat das Gebiet des Reiches gemehrt«.[6] Krieg bedeutete Beute für die Soldaten, er füllte die Staatskasse und erlaubte den Bau repräsentativer Tempel und Foren, die Abhaltung aller Arten von öffentlichen Spielen. Vom Krieg profitierten alle, sei es durch die den römischen Bürgern gewährte Steuerfreiheit, das kostenlose »Grundeinkommen« für die in Rom lebenden Bürger in Form von Getreide-, Öl- und Geldspenden oder die Anlage von römischen »Kolonien«, Stadtgründungen auf dem besten Land der Unterworfenen.[7]
Rom war auf Krieg programmiert und nirgendwo zeigte sich dies deutlicher als im alle Bürger erhebenden und mitreißenden Schauspiel des Triumphs, der höchsten Ehrung, die einem Römer widerfahren konnte. An diesem Tag, wenn der siegreiche Feldherr auf prachtvoll geschmücktem Wagen mit seinen Soldaten in Rom einzog, galt er Jupiter, dem höchsten Staatsgott gleich. Kriege zu vermeiden, galt nicht als Tugend. Besser war es, der Gefahr mannhaft entgegenzutreten, sie schon im Keim zu ersticken, ehe sie sich wirklich zur Bedrohung auswuchs. Skrupel kannten die Römer nicht, da sie grundsätzlich »gerechte Kriege« führten. Immer gab es Bundesgenossen und befreundete Stämme, die verteidigt werden mußten, galt es, den Frieden der Welt wiederherzustellen, den nur Rom garantieren konnte, und unruhige Stämme vor sich selbst zu schützen wie beispielsweise in Gallien: »Wenn, was die Götter verhüten mögen, die Römer vertrieben werden, was hättet ihr zu erwarten als ewige Kriege unter euch selber?«[8]
Das Gefühl der Überlegenheit über andere Völker verließ den Römer nie. Es basierte auf der sicheren Gewissheit, die Götter auf seiner Seite zu haben, und auf den römischen Tugenden, deren Pflege die Grundlage für die Erfolge im Kriege waren. Die römischen Geschichtsbücher rühmten den Konsul Titus Manlius, der den eigenen Sohn hinrichten ließ, weil er zwar mit Erfolg, aber gegen den ausdrücklichen Befehl mit den Feinden gekämpft hatte. Denn nicht Tapferkeit allein gewann Kriege, sondern unbedingter Gehorsam (disciplina), der jedem verbot, seinen Platz in der Gefechtsordnung zu verlassen. Vorbilder waren Marcus Curtius, der sich mit Pferd und voller Rüstung in eine klaffende Spalte stürzte, die sich mitten auf dem Forum öffnete. Wenn Rom ewig bestehen wolle, hatten die Seher verkündet, müsse es in dieser Spalte begraben, wodurch die Stadt groß und mächtig sei. »Waffen und der Mut (virtus) eines Mannes!«, hatte Curtius ausgerufen, bevor er sich opferte.[9]