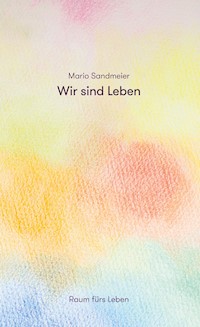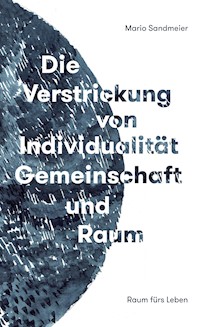
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist Individualität? Was ist Gemeinschaft? Und was bindet beide Formen des Menschsein, das individuelle Sein und das gemeinsame Sein, an den Lebensraum, in dem sich die Menschen aufhalten, und an die Wohnkultur, die sie pflegen? Nicht weniger bedeutsamen Fragen stellt sich dieses Buch. Mit Sanftmut und ruhiger Weitsicht, wendet es sich der Architektur des Menschen zu, um aufzudecken, was uns von Natur aus zum Individuum macht und wie diese Kräfte in Verbindung zu Gemeinschaft und Raum stehen - und wird so zu einem Wegweiser für menschenbasierte Lebensgestaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der achtsame Beobachter Mario Sandmeier hat sich auf den Weg gemacht, die Verbindung von Mensch, Raum und Gemeinschaft besser zu verstehen. Er will wissen, wie wir die innere Natur des Menschen mit den Einflüssen der äußeren Natur des Raumes in Einklang bringen können.
Im Laufe seiner Recherchen hat sich sein Ausgangspunkt bei der Betrachtung von Lebensräumen schrittweise verschoben. Immer mehr sieht er Architektur und Gemeinschaftsformen als lebendige Organismen, die sich gegenseitig beeinflussen, Teil der Umwelt sind und es, eingebunden in die Gesetze der Natur, auch immer bleiben werden. Bestehend aus vielschichtigen Strukturen und erbaut aus den Ressourcen der Natur, sieht er Lebensräume als bespielbare Bühnen, deren Kernaufgabe darin besteht, dem Organismus Mensch unterstützenden Raum für die individuelle und gemeinschaftliche Entfaltung zu bieten.
Mario Sandmeier, geboren 1985, ist Autor, Architekturpsychologe, Forscher, und philosophischer Beobachter des natürlichen Lebens. Er lebt in Baden, Schweiz.
Ich bin nicht nur Ich.
Inhalt
Die Herausforderung eines Widerspruchs
Die Quelle eines Widerspruchs
Die Prägung eines Widerspruchs
Die Poesie eines Widerspruchs
Das Potenzial einer Herausforderung
Anmerkungen
Die Herausforderung eines Widerspruchs
Die Fragen, die das widersprüchliche Bedürfnis nach Individualität und Gemeinschaft mit sich bringen und denen wir an manchen Tagen kaum gewachsen sind, prägen die Welt, in der wir leben.
Individualität und Gemeinschaft sind miteinander verbunden. Gemeinsam bilden die beiden scheinbaren Gegensätze einen lebendigen Organismus voller Widersprüche, die sich bei genauer Betrachtung in ihrem Kern gegenseitig bedingen. Denn nur aus der Gemeinschaft, kann sich eine menschliche Individualität formen. Und auch nur aus der Summe einzelner Individuen, kann sich eine Gemeinschaft bilden. Das eine braucht das andere. Und das andere braucht das eine. Obwohl auf den ersten Blick vollkommen gegensätzlich, sind paradoxerweise beide Formen des Menschseins, das individuelle Sein und das gemeinsame Sein, voneinander abhängig. Und gerade das Paradoxe von Widerspruch und Abhängigkeit, ist mit ein Grund dafür, dass die menschliche Lebensweise eine große emotionale Herausforderung ist, der wir uns täglich stellen dürfen.
Sich der Herausforderung bewusst zu stellen braucht Mut. Und genau darum geht es in diesem Text. Es geht um den Mut zur Achtsamkeit und darum, sich der Herausforderung, die das Bedürfnis nach Individualität und Gemeinschaft mit sich bringt, anzunähern. Gemeinsam wollen wir versuchen, dem Widerspruch bedacht in die Augen zu blicken, indem wir versuchen die Naturgesetze, welche Individuum und Gemeinschaft miteinander verbinden, aufzudecken. Wir werden versuchen die Grenzen unserer Selbstwahrnehmung ein Stück weit zu verschieben. Soweit, dass wir eine erweiterte Sichtweise auf uns selbst erhalten und mit einem neuen Blickwinkel von unserer wahren Natur lernen können.
Gelingt es uns, den Horizont unseres Bewusstseins wohlwollend zu erweitern, können wir anschließend das Gelernte in unseren Bemühungen bei der Gestaltung von Lebensräumen integrieren. Das wird uns guttun. Denn verborgen in den Verstrickungen von Individualität und Gemeinschaft, liegt eine befreiende Poesie, die das Potenzial in sich trägt, aus dem selbstbezogenen Drang zu «Überleben», langfristig einen achtsamen Dialog zwischen Individuum, Gemeinschaft und Raum zu formen, der ein gegenseitig befruchtendes «Füreinander» fördern wird.
∞
Dass das Zusammenspiel von Individualität und Gemeinschaft eine der prägendsten Fragen des Menschseins ist, begann ich zu spüren, als ich nach meinem Studium anfing als Architekt zu arbeiten. Die tägliche Auseinandersetzung mit den Lebensräumen, in denen sich die Menschen als Individuen in Gemeinschaften begegnen, öffnete in mir ein Bewusstsein für die überwältigende Größe der emotionalen Herausforderung, die sich darin verbirgt. In regelmäßigen Abständen begegnete ich in Gesprächen mit Kunden oder Planern, einer inneren Zerrissenheit, die in einzelnen Menschen zum Vorschein kommt, sobald es darum geht Individualität und Gemeinschaft, bei der Gestaltung von Lebensräumen und Wohnformen, in ein passendes Gleichgewicht zu bringen. In manchen Fällen konnte ich beobachten, wie sich die zwei scheinbaren Gegensätze im Bewusstsein meines Gegenübers um die geistige Vorherrschaft duellierten. Widersprüchliche Aussagen wie: «Wir wollen unbedingt ein gemeinschaftliches und befruchtendes Miteinander gestalten!» und: «Ich will mich aber vollkommen losgelöst von den anderen bewegen können und nur für mich sein!» sind keine Seltenheit. Aussagen, die zumeist nicht von unterschiedlichen Parteien gemacht werden, sondern von ein und derselben Person. Ohne jemandem einen Vorwurf zu machen, irritiert mich der emotionale Zwist – den ich ja auch in mir selbst immer wieder beobachten kann – jedes Mal aufs Neue. In meiner Irritation fand ich bisweilen nie wirklich die richtigen Worte, um bedacht darauf zu reagieren. Es machte mich ratlos. Stets blieb mir einzig die Frage: Woher kommt das?
In welchem Maß sich die emotionale Zerrissenheit, als Ausdruck von scheinbar gegensätzlichen Bedürfnissen, auf die räumliche Umwelt auswirkt, zeigt der Blick auf die Wohnkultur, die sich in den westlichen Kulturen entwickelt hat. Auf der einen Seite sehen wir großflächige Quartiere, in denen auf knapp bemessenen, rechteckigen Grundstücksflächen, sehr zentriert, wie auf einem Silbertablett, sich kleine Häuschen mit umlaufendem schmalen Grünstreifen präsentieren. Oft eingerahmt von Gartenzäunen oder grünen Hecken, die klar signalisieren, dass der Nachbar möglichst ausgeschlossen und das eigene individuelle Reich schützend eingeschlossen werden soll.
Auf der anderen Seite sehen wir große Wohnblöcke in dichteren und städtischen Siedlungsstrukturen, mit unterirdischen Tiefgaragen und den Lifttürmen aus Beton, die eine individuell eingerichtete Wohnung auf dem direktesten Weg mit dem parkierten Auto verbinden. Sodass die Bewohner, auf den kurzen Wegen außerhalb der eigenen vier Wänden, möglichst wenigen Nachbarn begegnen müssen. Wodurch diese Form des Wohnens, obwohl verdichtet und städtisch, auf der Ebene der sozialen Interaktion im privaten Umfeld, den Einfamilienhäusern beinahe gleichzusetzen ist. Ob nun vom Zaun eingerahmtes Einfamilienhaus oder anonyme Wohnung im Mehrfamilienhaus, beide Umstände führen dazu, dass die Individualität ein hohes Gewicht in der Lebensweise der Bewohner erhält. Nicht in wenigen Fällen kommt ergänzend dazu, dass die wirtschaftlichen und funktionalen Rahmenbedingungen, die damit einhergehen, zur seelischen Belastung werden. Die Bewohner der kleinen Haushalte sind dazu gezwungen, alles was sie fürs Wohnen benötigen, sich eigenständig anzueignen. Auch dann, wenn sie die Dinge nur wenige Tage im Jahr wirklich benutzen. So müssen sie darum besorgt sein, ein monatliches Einkommen zu generieren, mit welchem alle Auslagen gedeckt werden können.
Dass sich in einem durchschnittlichen Haushalt von zwei bis vier Personen, der Grad der Gemeinschaft im privaten Wohnumfeld auch noch auf ein absolutes Minimum reduziert, macht es nicht einfacher. Die Menschen eines kleinen Haushaltes kommen nicht darum herum, ihr Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Anerkennung, nebst privaten Treffen im engeren Freundeskreis, entweder in ihrem beruflichen Umfeld oder im anonymen, kommerzialisierten Kulturangebot zu suchen. Um sich an kulturellen Ereignissen zu beteiligen, besuchen sie Museen und Konzerte, Theatervorstellungen oder Sportveranstaltungen. Sie gehen ins Kino und in Restaurants, genießen die lebendige Atmosphäre der örtlichen Bar oder werden Teil eines Sportvereins. Ohne Absicht verdrängen sie das natürliche Bedürfnis nach Gemeinschaft relativ konsequent aus dem persönlichen Wohnalltag und verschieben es in die Anonymität der Privatwirtschaft. Was wiederum eine zusätzliche Belastung mit sich bringt, in Form von finanziellem Druck, da jegliches kulturelle Angebot außerhalb der privaten Wohnkultur mit höheren Kosten verbunden ist.
∞
Über die eigenen Worte nachdenkend, beobachte ich für einen Moment das einfallende Sonnenlicht, das einen hellen Abdruck, auf den sonst von Schatten bedeckten Eichenparkett in meinem Arbeitszimmer projiziert. Das unscheinbare Naturereignis erinnert mich daran, dass sich selbst in den dunkelsten Raum ein Streifen Licht verirren kann. Und auf einmal muss ich schmunzelnd an meine eigene Kindheit denken, die ich in einer der beschriebenen Wohnformen verbracht habe. Interessant wird es nämlich genau dann, wenn selbst in einem Einfamilienhausquartier, mit eingezäunten Gärten, geprägt von gebauter Individualität, eine Gruppe von Menschen zueinander finden, die sich gut miteinander verstehen, oder zumindest auf mehreren sozialen Ebenen unerwartete Verbindungen entdecken. Wie es der Zufall wollte, zog meine Familie in ein Quartier, in dem eine große Anzahl von Familien wohnten, dessen Kinder im selben Alter waren, wie mein älterer Bruder und ich. Beinahe bei jedem Wetter wimmelte es in den Straßen und Gärten nur so von Freunden und Klassenkameraden. Was dazu führte, dass Gartenzäune und Hecken ihre angedachten Aufgaben verloren, teilweise sogar durchbrochen oder zumindest einfach nicht mehr beachtet wurden. Private Wiesenflächen, Quartierstraßen und Garagenvorplätze wurden zu erweiterten Wohnräumen und Spielzimmern.
Wenige Jahre nach unserem Umzug, kam es dazu, dass ein Lehrerpaar der örtlichen Schule, die Idee hatte, ein Skilager zu organisieren, das nicht nur die Schüler, sondern die ganze Familie der Viert- und Fünftklässler besuchen durften. Die Eltern der Kinder wurden als Aufsichtspersonen und Skilehrer in die Lagerstruktur eingebunden und auch die kleinen Brüder und Schwestern waren herzlich willkommen. Unter den Eltern entstanden neue Freundschaften oder bestehende wurden vertieft. Fast noch bedeutsamer war der Umstand, dass wir Kinder, nebst den eigenen Eltern, auf ein Mal zusätzliche Bezugspersonen hatten, zu denen wir ebenfalls eine emotionale Bindung aufbauten. Nicht eine gleich starke wie zu den Eltern, aber doch eine, die genug gefestigt war, dass wir uns ohne Scham getrauten, auch die Eltern eines Kameraden anzusprechen, wenn wir Hilfe benötigten und die eigenen Eltern gerade nicht in Reichweite waren. Das erweiterte Feld von Vertrauenspersonen und neuen Freundschaften übertrug sich nachhaltig aufs gemeinschaftliche Dorfleben. Wir Kinder trafen uns wöchentlich zum Straßenhockey und im Sommer gab es in regelmäßigen Abständen Straßenfeste, an denen sich beinahe das ganze Quartier beteiligte.
Nicht immer lief alles rund. Es gab Streitigkeiten, kleine oder größere Neckereien und manchmal auch Kämpfe zwischen uns Jungen, die auch mal mit blutigen Nasen oder einer Beule an der Stirn endeten. Doch über einige Jahre hinweg, herrschte durchaus eine wohltuende Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft, auch wenn die Siedlungsstruktur nicht darauf ausgerichtet war. Der Umstand, dass wir letztendlich doch in einer gebauten Raumstruktur lebten, die eher auf Individualität ausgelegt ist, war dann wohl mitunter ein entscheidender Grund dafür, dass sich das Gefühl des Verbundenseins im Quartier schnell verzog, sobald mein älterer Bruder und ich, wie auch alle unsere Klassenkameraden, der örtlichen Primarschule entwachsen waren und ab diesem Zeitpunkt, unterschiedliche Wege gingen. Gartenzäune und Hecken gewannen schrittweise wieder an Bedeutung, private Gärten waren wieder privat und Quartierstraßen, sowie Garagenvorplätze dienten mehrheitlich wieder dem Individualverkehr und auch Straßenfeste gab es keine mehr. So traurig es klingen mag, waren die Kinder unserer Generation, die einzige treibende Kraft, der es für kurze Zeit gelang, in einer Siedlungsstruktur voller gebauter Individualität, eine Atmosphäre der Gemeinschaft zu gestalten.
Erfreulicherweise tauchen immer wieder Bewegungen auf, gerade auch in den letzten Jahren, die quasi als Gegenthese zu den eingeschlossenen Einfamilienhäusern und den anonymen Wohnungen, versuchen das Miteinander ganz bewusst in die private Wohnkultur zu integrieren. Experimentierfreudige Kommunen organisieren sich in Genossenschaften oder privaten Großfamilien und entwickeln ihre eigene Vorstellung vom gemeinschaftlichen Wohnen. In eigenständigen Ansätzen versuchen sie die Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft neu auszuloten.
Die Schicksale einiger gemeinschaftlichen Kleinhaussiedlungen und kommunenartigen Gartenstädten aus dem letzten Jahrhundert zeigen, dass ihre größte Herausforderung darin bestehen könnte, ihre Ansätze nicht zu radikal in Richtung eines dominierenden Gemeinschaftsgedankens auszurichten. Wie die ausgeprägte Individualität in Einfamilienhausquartieren oder anonymen Mehrfamilienhäusern, kann auch ein stark ausgeprägter Gemeinschaftsgedanke ein emotionales Ungleichgewicht fördern, einfach in die gegensätzliche Richtung. Nicht wenige Wohnsiedlungen von bekannten oder unbekannten Architekten, die auf ein einfaches, gemeinschaftliches Wohnen ausgerichtet waren, fielen dem großen Drang nach Individualität zum «Opfer», der sich gegen Ende des letzten Jahrhunderts verstärkte. In Wohnhöfen, welche als soziales Zentrum oder Gemeinschaftsplatz konzipiert wurden, stehen heute dichtgedrängt, Stoßstange an Stoßstange, die Personenwagen der Bewohner, die den Charme der Häuser zwar schätzen, sich dem Gemeinschaftsgedanken aber grundsätzlich entziehen.