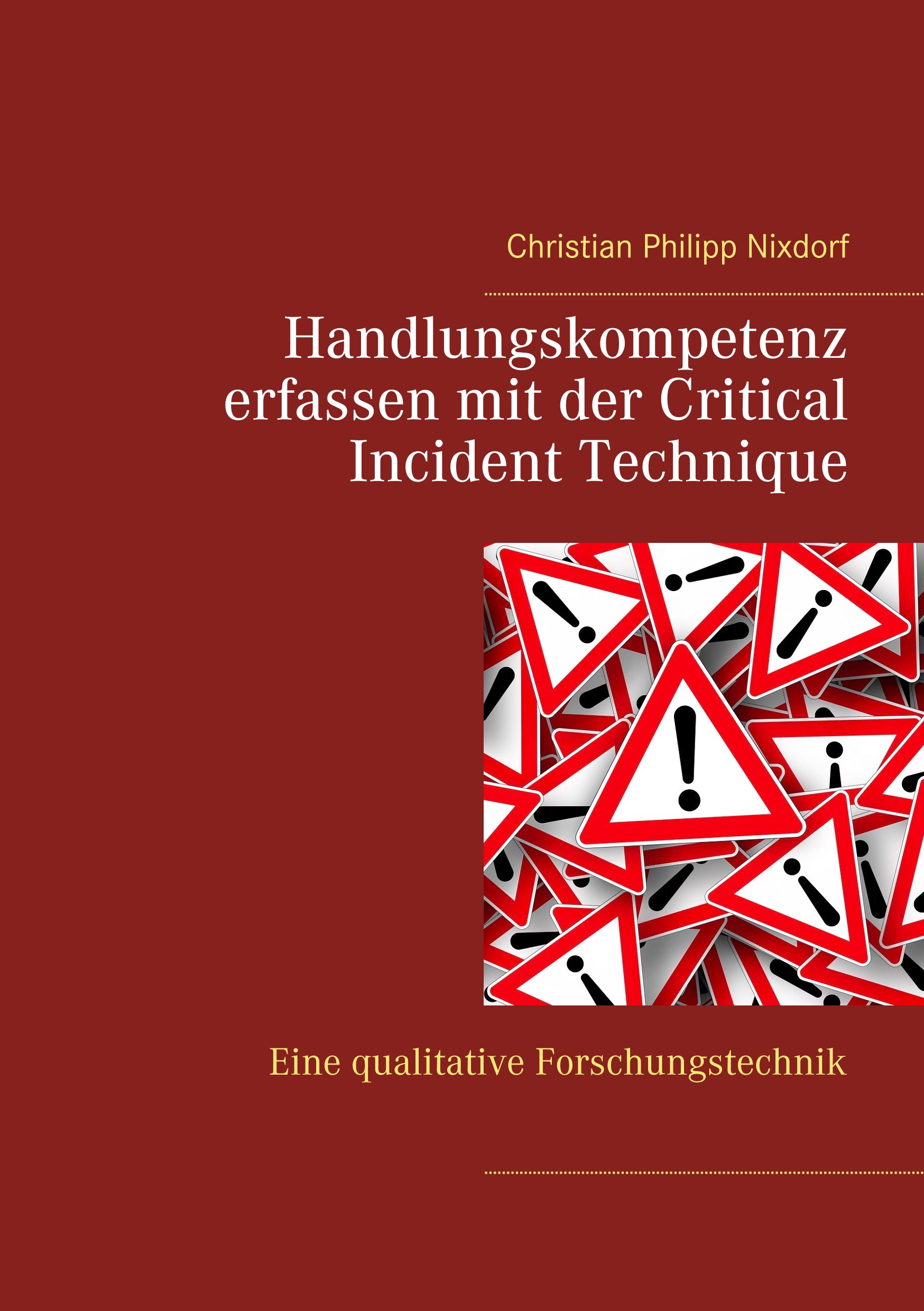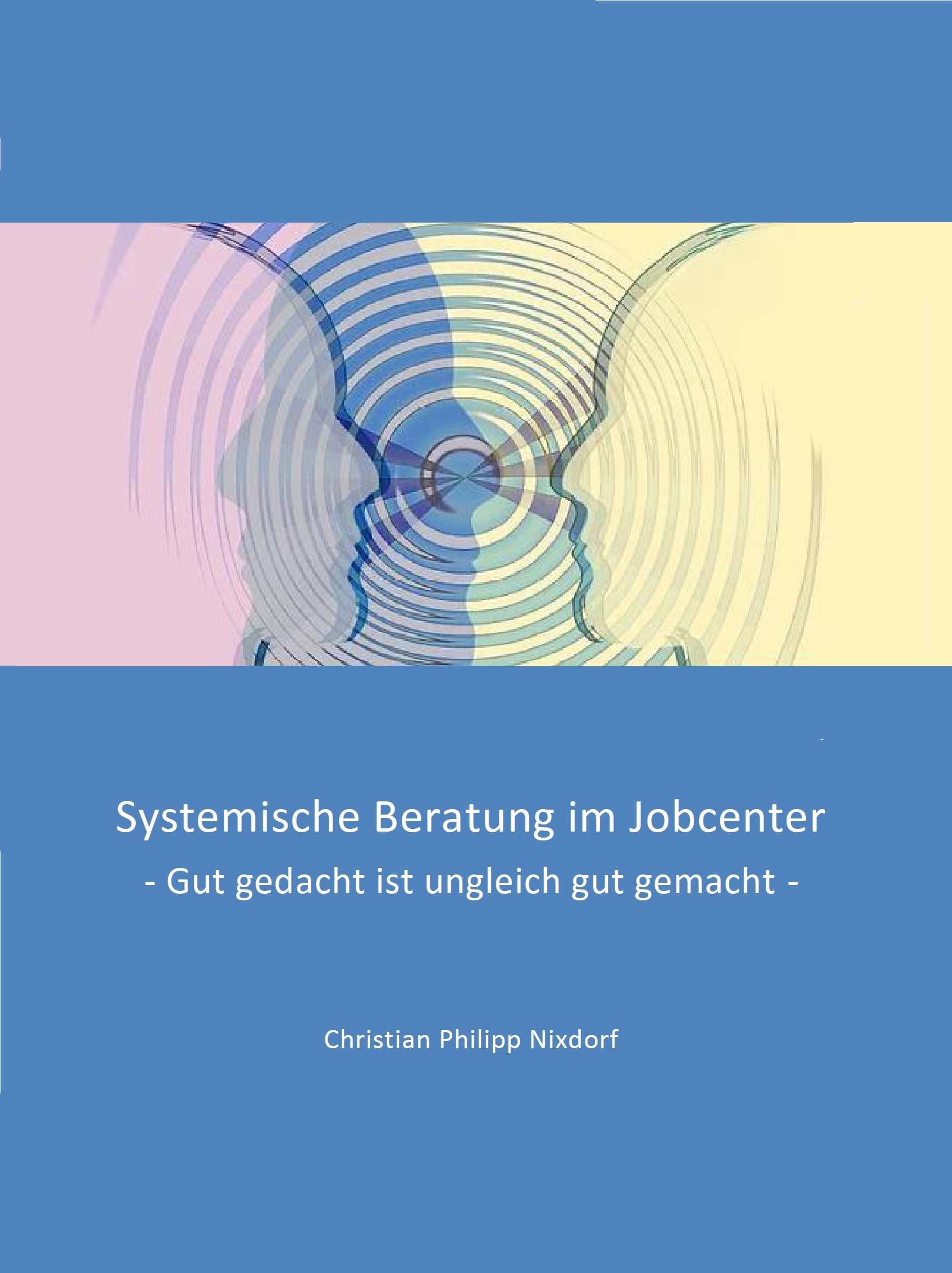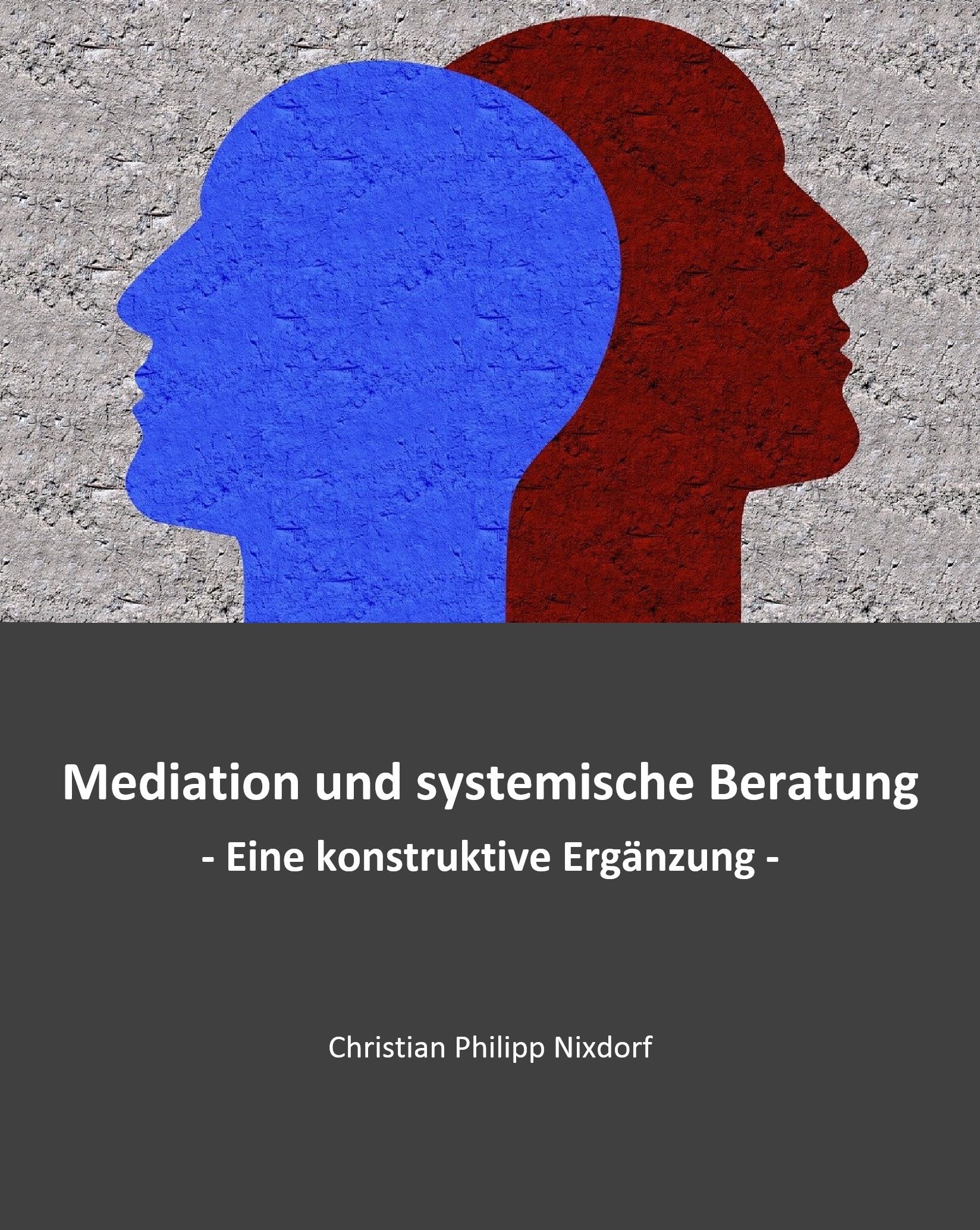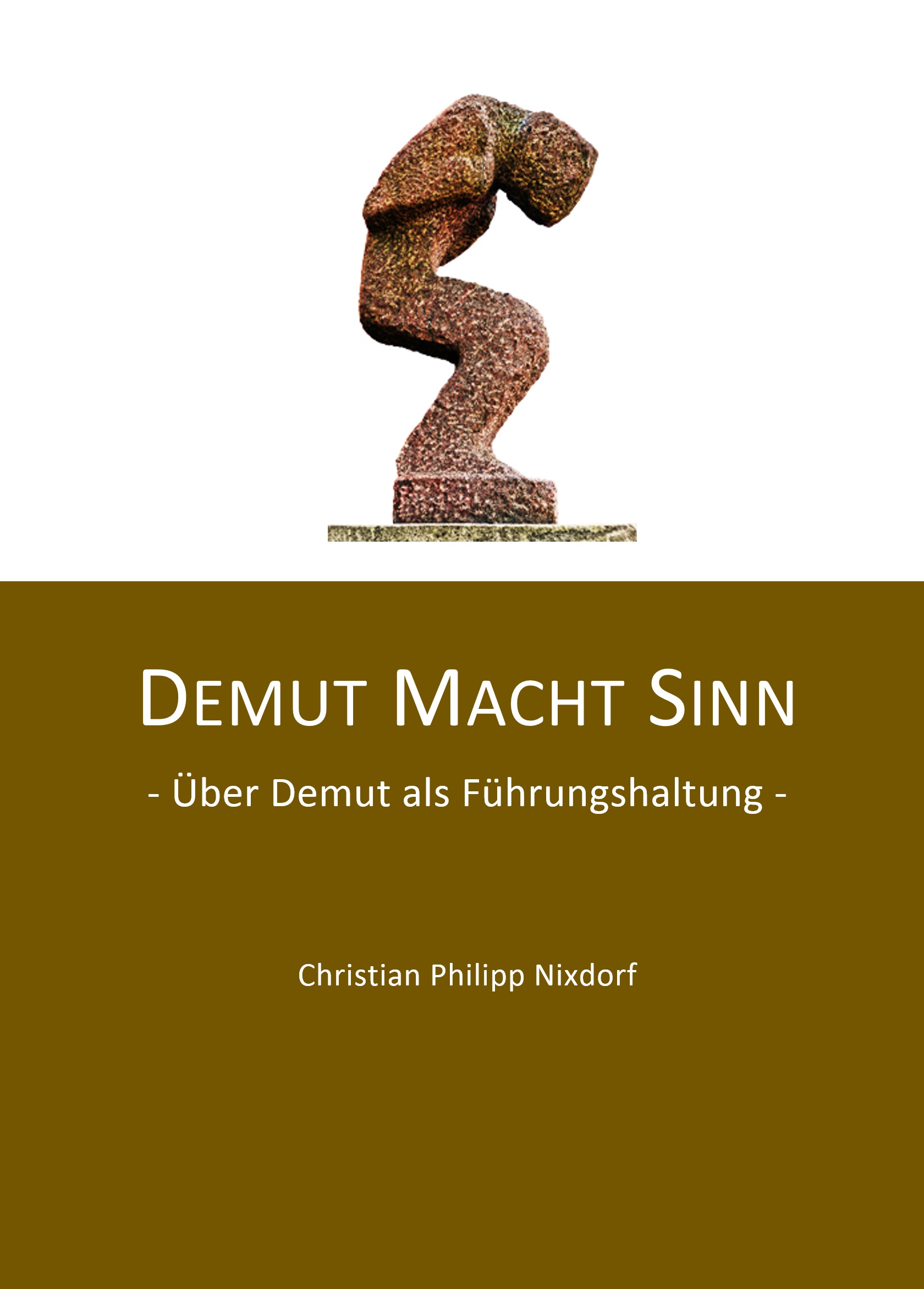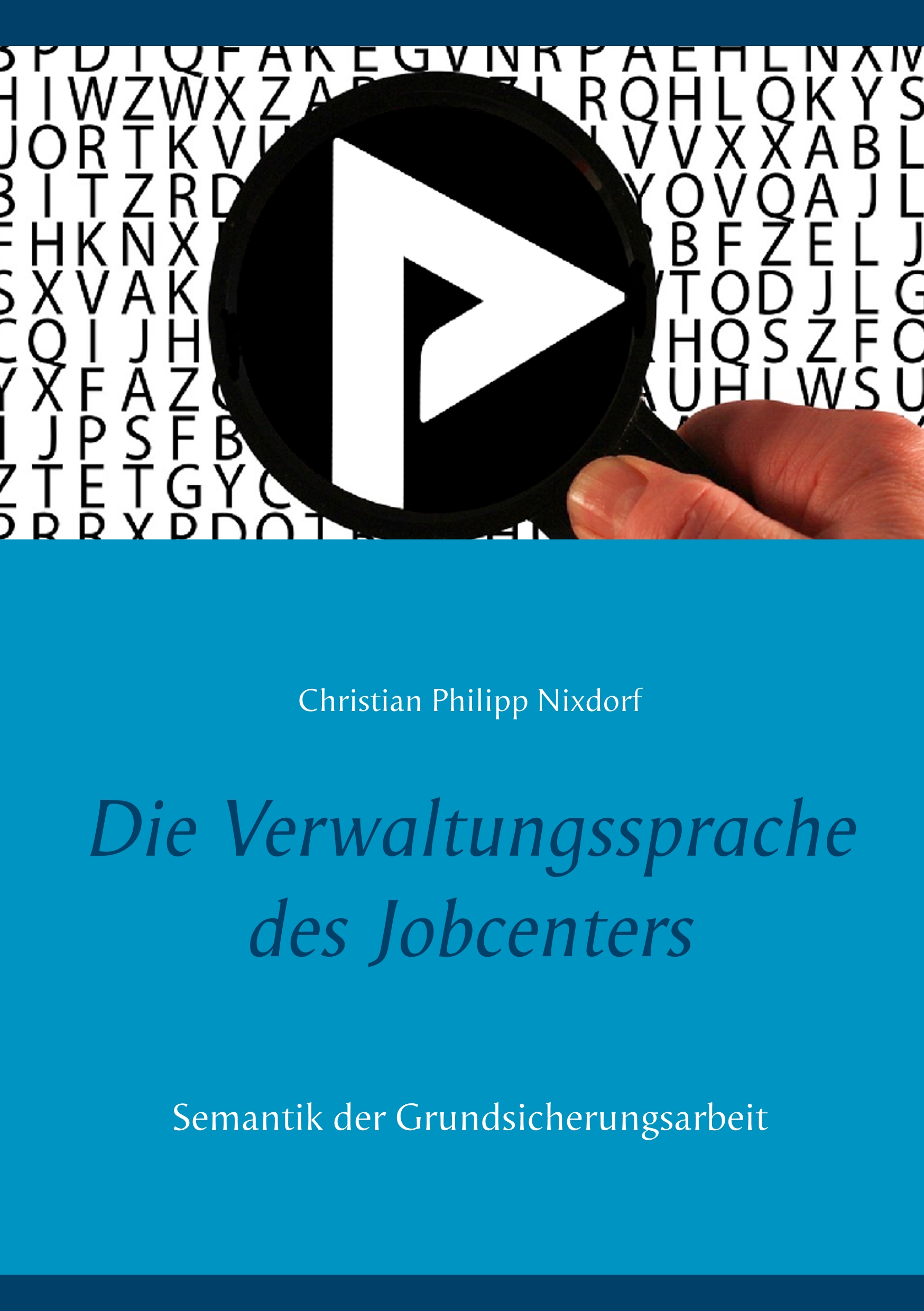
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Bedeutung eines Wortes lässt sich aus seiner Nutzung im Alltag erschließen. Im Jobcenter ist das insofern herausfordernd, als manche Wörter hier eine andere Bedeutung haben, als das im Alltagsverständnis üblich ist. Die Leistungsbeziehenden werden im Jobcenter Kunden genannt. Sie können sich aber nicht wie solche verhalten, da sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Jobcenter stehen. Die Kunden werde betreut und aktiviert. Das legt Unselbstständigkeit nahe und empört manche Erwerbslose, die längst nicht alle arbeitslos sind. Kurzum wirkt sich die Sprache auf die Interaktion der Arbeitsvermittler und Kunden aus. Das wird im Buch anhand mehrerer Begrifflichkeiten dargelegt, denen im Jobcenter besondere Bedeutung zukommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Wer auf andere Leute wirken will,
der muss erst einmal in ihrer
Sprache mit ihnen reden
- Kurt Tucholsky -
In aller Kürze – Worum es geht
Die Bedeutung eines Wortes lässt sich aus seiner Nutzung im Alltag erschließen. Im Jobcenter ist das allerdings herausfordernd, weil diverse Wörter hier konträr zum Alltagsverständnis vieler Menschen genutzt und mit Bedeutung aufgeladen werden. Der Rekurs auf Angebote, Einladungen, Kunden und Eingliederungsvereinbarungen impliziert Freiwilligkeit. Diese ist im Jobcenter aber nur bedingt gegeben, da Beratung hier faktisch in einem Zwangskontext stattfindet. Die Menschen, die im Jobcenter Kunden genannt werden, können sich nicht wie echte Kunden verhalten. Sie stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Jobcenter. Hier werden sie betreut und aktiviert. Beides legt Unselbstständigkeit nahe, was nicht wenige Erwerbslose echauffiert, die längst nicht immer arbeitslos sind. Auch geschieht es im Jobcenter nicht selten, dass persönliche Ansprechpartner gerade nicht persönlich ansprechbar sind. Deren Aufgabe ist u. a., Kunden, die sich nicht wie Kunden fühlen, in Bildungsmaßnahmen zuzuweisen, die selten der Weiterbildung dienen. Im Jobcenter wird, das impliziert schon die Institutionsbezeichnung, auch selten in Arbeit vermittelt. Vermittelt werden Jobs. Zu jobben ist aber etwas Anderes als zu arbeiten. Und wenn Kunden sich im Jobcenter nicht regelkonform verhalten, werden sie nicht etwa sanktioniert, sondern die Sanktion wird festgestellt. Inwieweit diese Semantik Einfluss nimmt auf die Interaktion von Arbeitsvermittlern und ihren Kunden, wird hier anhand der Schilderung von 11 Begrifflichkeiten dargelegt, die im Jobcenter eine andere Bedeutung haben als in der Vorstellung vieler Kunden.
Anmerkungen zu diesem Text: Mehrere der hier reflektierten Aspekte bzgl. der Kommunikationsformen und -hürden im Jobcenter finden sich in ausführlicherer Form und mit anderer Schwerpunktlegung auch im Buch (Bildungs-)Beratung im Jobcenter, das der Autor 2019 im Hamburger Wissenschaftsverlag Dr. Kovač veröffentlicht hat.
Kontakt zum Autor: Bei Anmerkungen, Fragen oder auch Kritik ist der Autor erreichbar über seine Homepage www.serene-success.de
Abkürzungsverzeichnis
AA / AfA
Agentur für Arbeit
AGS
Arbeitgeberservice
ALG II
Arbeitslosengeld II
ALO/ASU
arbeitslos/arbeitsuchend (Statusangabe im ⇒ VerBIS)
AVGS
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein
BA
Bundesagentur für Arbeit
BeKo
Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit
BewA
Bewerberangebot
BMAS
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
EinV
Eingliederungsvereinbarung
eLb
erwerbsfähige Leistungsberechtigte
elW
Ermessenslenkende Weisung
FbW
Förderung beruflicher Weiterbildung
FM
Fallmanager/Fallmanagement
gE
gemeinsame Einrichtung
Hartz IV
4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
IFK
Integrationsfachkraft
JC
Jobcenter
KKD
Kundenkontaktdichte
MAbE
Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
MAG
Maßnahme bei einem Arbeitgeber
MAT
Maßnahme bei einem Träger
OK
Optionskommune
pAp
persönlicher Ansprechpartner
SGB II
Sozialgesetzbuch II
SteA
Stellenangebot
SteSu
Stellensuchlauf
VerBIS
Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem
VA
Verwaltungsakt
VV
Vermittlungsvorschlag
Inhalt
Sprache schafft Realität(en)
Arbeit und Arbeitslosigkeit
Aktivieren
Anbieten, einladen, vorschlagen
Eingliederungsvereinbarung
Betreute Kunden
Persönlicher Ansprechpartner
Job(center)
Beraten
Bildungsmaßnahmen
Coaching
Sanktionen feststellen
Fazit
Literatur
Sprache schafft Realität(en)
Sprache formt das Bewusstsein. Sie beeinflusst das Denken über Dimensionen wie Zeit, Raum, Mengen und Geschlechter. Einer der einflussreichsten Vertreter der Sprachphilosophie, Ludwig Wittgenstein (2003, PU 43), erklärte, dass sich die Bedeutung eines Wortes aus dessen Gebrauch in der Sprache ergibt. Worte bedeuten das, was diejenigen, die sie nutzen, ihnen an Bedeutung zuschreiben. Ein Stuhl ist ein Stuhl, weil es Menschen gibt, die ihn als solchen bezeichnen. Er wird zum Sitzobjekt, weil Menschen über eine Vorstellung dessen verfügen, dass ein Stuhl als Sitzmöbel fungieren kann. Freilich kann man mit einem Stuhl aber noch viel mehr anstellen. Man kann ihn zu Feuerholz verarbeiten, wenn er aus Holz ist. Man kann ihn jemandem über den Kopf schlagen, ihn zum Wäscheständer umfunktionieren und vieles mehr. Davon abgesehen steht das Wort Stuhl auch für Ausscheidungen von Stoffwechselendprodukten. Je nach Kontext und Berufshintergrund haben Menschen unter Umständen ganz unterschiedliche Bilder im Kopf, wenn sie an „Stuhl“ denken. Der Gastronom wird vielleicht an Sitzmöbel für sein Restaurant denken, der Linksextremist bei einer Straßenschlacht vielleicht an das Überkopfschlag-Möbel, die Gastroenterologin vielleicht ans Stoffwechselendprodukt.1
Was für den Stuhl gilt, gilt auch für jedes andere Wort. Wenn Menschen in der gleichen Sprache miteinander sprechen, haben sie ein grundlegend ähnliches Verständnis davon, was bestimmte Worte bedeuten (sollen). Wäre die weitgehende Deckungsgleichheit der Assoziationen nicht gegeben, könnten die Menschen kaum kommunizieren. Sie würden ständig aneinander vorbei reden. Das jeweilige Verständnis eines Wortes durch mehrere Personen ist aber kaum je völlig deckungsgleich. In Nuancen ist es verschieden. Im vorliegenden Text interessieren die diversen Wortbedeutungen, die in der Grundsicherungsarbeit im Jobcenter seitens der Mitarbeitenden geäußert, in der EDV hinterlegt und in Schriftstücken zu Papier gebracht werden. Es geht hier kurzum um die Besonderheiten der Verwaltungssprache. Dies nicht aus juristischer Perspektive, sondern aus einer sozialwissenschaftlichen. Kurt Tucholsky meinte, dass der, der auf andere Leute wirken will, erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden müsse. Dass das im Jobcenter nicht immer geschieht, wurde dem Autor dieses Textes in den 5 ½ Jahren, in denen er als sogenannter persönlicher Ansprechpartner (pAp) in 3 Jobcentern tätig war, deutlich.
Im Rahmen von Orientierungs-, Vermittlungs-, Beratungs-, Sanktions- und Streitgesprächen, in Folge von Reaktionen auf Einladungen und Anhörungsschreiben, in Telefonaten, in der E-Mail-Korrespondenz wie auch in Teamsitzungen und Schulungsseminaren bei der Bundesagentur für Arbeit wurde dem Autor bewusst, wie konträr zum Alltagsverständnis bestimmte Worte im Jobcenter genutzt und mit Bedeutung aufgeladen werden. Der Autor sprach darüber mit Beziehenden von Arbeitslosengeld II, mit Kolleginnen, Vorgesetzten und Dozentinnen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Er sichtete BA-interne Dokumente, Forschungsberichte sowie Korrespondenzschreiben von Leistungsbeziehenden. Dabei stieß er auf sprachliche Besonderheiten, welche die Interaktion von Integrationsfachkräften und Kunden im Jobcenter prägen. Zugespitzt ließe sich sagen, dass Sprache im Jobcenter systematisch (de)formiert wird. In kaum einem anderen Arbeitsfeld besteht ein ähnlicher Bedarf daran, sich Anführungszeichen bedienen zu müssen, wie das der Fall ist, wenn Schreiben des Jobcenters betrachtet werden.
Es ist zu vermuten, dass ein Viktor Klemperer seine Freude an der Analyse der Lingua Jobcenter gehabt hätte. Für die Beziehenden von Arbeitslosengeld II, die im Jobcenter euphemistisch als „Kunden“ 2 bezeichnet werden und sich mit dieser Sprache auseinanderzusetzen haben, ist es allerdings oftmals keine Freude. Für sie kann es eine Quelle von Verunsicherung und Verärgerung sein, dass das Jobcenter unter Einladungen, Vorschlägen und Angeboten etwas anderes versteht als das, was gemeinhin darunter verstanden wird. Das wird auf den nächsten Seiten anhand der folgenden Ausdrücke beschrieben, die hinsichtlich ihrer Verwendung im Jobcenter-Kontext kommentiert werden:
Arbeit und Arbeitslosigkeit
Aktivieren
Anbieten, einladen, vorschlagen
Eingliederungsvereinbarung
Betreute Kunden
Persönlicher Ansprechpartner
Job(center)
Beraten
Bildungsmaßnahmen
Coaching
Sanktionen Feststellen
1 Der Autor weiß um die diskriminierende Wirkung von Sprache. Ihm ist bewusst, dass es insbesondere in einem Text, in dem Sensibilität in Bezug auf Sprachverwendung das zentrale Thema ist, probat ist, Leser/ innen korrekt anzusprechen. Gleichwohl hält der Autor wenig davon, der Diversität geschlechtlicher Selbstbeschreibungen durch die Nutzung von Konstruktionen wie dem Gender_Gap, Binnen-I oder Gender*Sternchen gerecht zu werden. Stattdessen kommt im Text das Zufallsprinzip zur Anwendung. Es wird manchmal die weibliche und manchmal die männliche Form genutzt, statt ständig in Paarform zu schreiben. Das erfolgt zwecks Sicherstellung des guten Leseflusses. Es sind dabei immer Menschen jedes Geschlechts gemeint.
2 Darauf, warum das Wort „Kunden“ in diesem Text durchgehend in Anführungszeichen gesetzt ist, wird später ausführlich eingegangen.
Arbeit und Arbeitslosigkeit
„Menschen und Arbeit zusammenbringen“ – so lautet ein Slogan der Bundesagentur für Arbeit (BA), der das Selbstverständnis der Organisation auf den Punkt bringt. Menschen, die vermeintlich keiner Arbeit nachgehen, geraten nicht nur schnell in den Fokus der Arbeitsvermittler in der BA und im Jobcenter (Motto: Die müssen aktiviert werden), sie erleben auch Diskriminierung und Abwertung.3 Insbesondere im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit wird den Menschen häufig „der Missbrauch von Sozialleistungen, Faulheit sowie mangelnde Ambitionen und Motivation, etwas gegen ihre Arbeitslosigkeit zu tun, vorgeworfen“ (Zick et al. 2016, S. 41). Gerade Langzeitarbeitslosigkeit, definiert als Arbeitslosigkeit von über 12 Monaten Dauer, gelte es daher, so der im Jobcenter und in breiten Teilen der Öffentlichkeit vorherrschende Tenor, schnellstmöglich zu überwinden – und zwar im Bedarfsfall auch mittels der Bestrafung arbeitsloser Menschen. Arbeit kommt, so lässt sich mit Fug und Recht sagen, in dieser Gesellschaft eine zentrale Bedeutung zu. Die westliche Zivilisation habe, so schreibt Kerber (2002, S. 69), „die Gesellschaft allein auf Arbeit aufgebaut. Arbeit ist es, die Sinn stiftet und Identität. Wer ohne Arbeit ist, fühlt sich wert- und nutzlos. Es ist das Ethos unserer Arbeitsgesellschaft, dass sich die Menschen so sehr an ihre Erwerbsarbeit klammern lässt.“ Die Macht des modernen Arbeitsglauben lebe, so meint der Soziologe Wolfgang Engler in Bürger, ohne Arbeit (2005, S. 41) „von der Angst, ihn zu verlieren.“ Arbeit bedeutet Sinn und Sicherheit. Der Gedanke daran, sie zu verlieren, erzeugt Angst. Den Grund dafür, der als exemplarisch für diese Überzeugung gelten kann, fasst auch der Namensgeber der als Hartz-Gesetzgebung bekannt gewordenen Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Peter Hartz, zusammen mit Hilarion Petzold (2014, S. 35), zusammen. Sie schreiben:
„Wir dürfen nie vergessen: Arbeit bedeutet ja nicht allein Beschäftigung und Lohn. Sie bedeutet auch Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Kreativität, Selbstverwirklichung, gesellschaftliche Teilhabe und letztlich Sinnerleben, die Anerkennung von Integrität und Würde. ‚Ich glaube, es ist gottgewollt, dass wir arbeiten‘, hat Oswald von Nell-Breuning, der große Denker und Nestor der katholischen Soziallehre einmal gesagt, und damit auf einen tieferen Sinn der Arbeit verwiesen. Darf es uns gleichgültig lassen, dass Millionen erwachsener Menschen die sinnstiftende Qualität von Arbeit vorenthalten bleibt?“ Was Hartz und Petzold schreibe, steht exemplarisch für die vorherrschenden Wertvorstellungen bezüglich der Arbeit in unserer Gesellschaft. Die Vorstellungen des Gros der Menschen in diesem Land, die sich auch in der Gesetzgebung widerspiegeln, sind dabei entscheidend geprägt von der protestantisch-calvinistischen Arbeitsethik. Sie haben sich durch über 200 Jahren Kapitalismus so in den Köpfen der Menschen verfestigt, dass sie als naturgegeben angesehen werden. Doch das sind sie keineswegs. Vielmehr ist es so, dass die Arbeit im Laufe der letzten Jahrhunderte eine komplette Bedeutungsumkehr erfuhr.
Für Menschen im Mittelalter war Arbeit so gut wie nie mit Sinn-Erfüllung assoziiert. Sie war reines Mittel zum Überlebenszweck. Auch in der Antike wurde Arbeit mitnichten als Mittel der Selbstverwirklichung und Lebenssinn betrachtet. In seiner Nikomachischen Ethik äußert Aristoteles deutlich seine geringe Wertschätzung für die Arbeit. Sie sei Domäne der Unfreien, der Sklaven und Handwerker. Wirkliche Freiheit hingegen „erfüllt sich im Engagement fürs Allgemeine, ist Leben im Geist der praktischen oder der theoretischen Vernunft. [...] Arbeit [in vormodernen Zeiten] ist minderwertig in erster Linie nicht, weil Sklaven sie versehen, sondern weil ihr Vollzug als minderwertig, als versklavend gilt, wird sie zur Domäne der Recht- und Stimmlosen“ (Aristoteles zitiert nach Engler 2005, S. 31-32). Moral und Werte sind immer wandelbar, sie sind eine gesellschaftliche Konstruktion. Die unseren fasste Max Weber bereits im Jahr 1904 in seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus zusammen. Die Religion hat im Laufe der Jahrhunderte immer mehr von ihrer Prägekraft verloren. Der Kapitalismus ist allerdings auch heute noch geprägt vom gleichen Wertmaßstab wie vor 100 Jahren: Wert schafft nur jener Mensch, der arbeitet, der wirtschaftliche Erfolge erzielt. „Unglücklicherweise ist genau diese Gleichsetzung das kulturelle Dogma unserer Zeit schlechthin. Einzig der arbeitende Mensch gilt als aktiv handelnde Person, als vollwertiges soziales Wesen, das zu Stolz und Selbstachtung berechtigt ist“ (Engler 2005, S. 144). Dass dem Arbeitsprimat, das in § 2 des Sozialgesetzbuches 2 kodifiziert ist, nicht nur eine rechtliche, sondern gar eine moralische Komponente inhärent ist, hat laut Berlit (2013, S. 200) bereits das Bundesverfassungsgericht (67, 1 [5] vom 10.2.1983) folgendermaßen hervorgehoben:
„Arbeiten als solches ist - ganz gleich, auf welchem Wege hierzu Gelegenheit geboten wird - ein Mittel, einen Hilfesuchenden (Hilfeempfänger) in seinem Selbsthilfestreben zu unterstützen und ihm Gelegenheit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zu geben, ein wesentliches Kriterium für ein Leben, das der Würde des Menschen entspricht.“ Zu arbeiten gilt als Quelle der Selbstachtung. Zu fragen ist nur: Was ist Arbeit? Die Frage mutet banal an, ist es aber mitnichten, zumal diverse Definitionen von Arbeit sich mitunter erheblich unterscheiden. In der Bundesagentur für Arbeit und in den Jobcentern herrscht in der Regel das Verständnis vor, dass Arbeit eine finanziell vergütete, vertraglich geregelte und rechtlich normierte Tätigkeit sei. Diese Vorstellung ist es auch, die in vielen Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (MAT) seitens der dortigen Dozenten vermittelt wird. Menschen, die keiner bezahlten Arbeit nachgehen, werden im Jobcenter sowie in Aktivierungsmaßnahmen als arbeitslos bezeichnet. Diese Bezeichnung geht allerdings insofern fehl, als viele Menschen, die Arbeitslosengeld (ALG) II erhalten, zwar keiner Erwerbsarbeit nachgehen, aber sehr wohl arbeiten. Sie verrichten oftmals diverse Dinge und sind gesellschaftlich aktiv, werden dafür aber nicht bezahlt.
Da das SGB II nur Erwerbsarbeit als Arbeit klassifiziert, wird jene nicht finanziell vergütete Arbeit, die von Menschen im Ehrenamt, im privaten und im familiären Kontext geleistet wird, nicht als Arbeit anerkannt. Man kann sich, wenn man ALG II erhält, nicht darauf berufen, dass man durchaus arbeite, wenn man z. B. Kinder erzieht und einem Ehrenamt nachgeht. Doch eben diese Tätigkeiten sind es, die regelmäßige und kontinuierliche Erwerbsarbeit überhaupt erst ermöglichen. Würden von einem Tag auf den anderen nur noch jene Arbeit verrichten, die finanziell entlohnt wird, würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass täglich nicht vergütete Arbeit verrichtet wird. Gewürdigt wird diese aber kaum. Das zeigt sich beispielhaft daran, dass erziehende Menschen, die ALG II erhalten, bereits ab dem dritten Geburtstag ihres Kindes dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen. Auch wird das Elterngeld voll auf die ALG-II-Leistungen angerechnet. Dass man sich in den ersten 4-5 Lebensjahren des Kindes primär um dieses kümmern und keiner Erwerbsarbeit nachgehen wolle, wird nicht als wichtiger Grund der Ablehnung einer Beschäftigung akzeptiert. Arbeit wird nur dann anerkannt, wenn sie normiert und entlohnt erfolgt. Gorz (2000, S. 91) bemerkt: