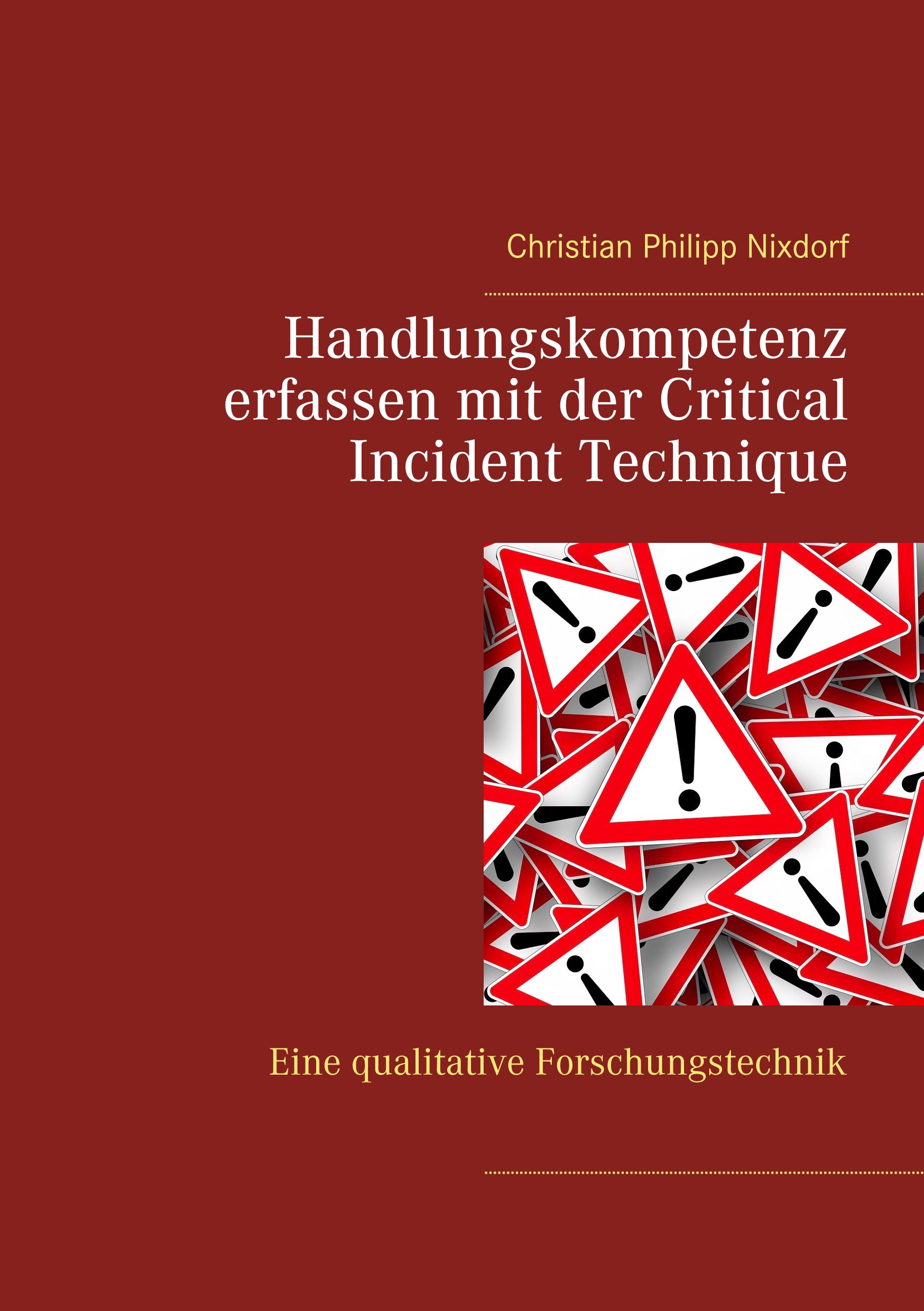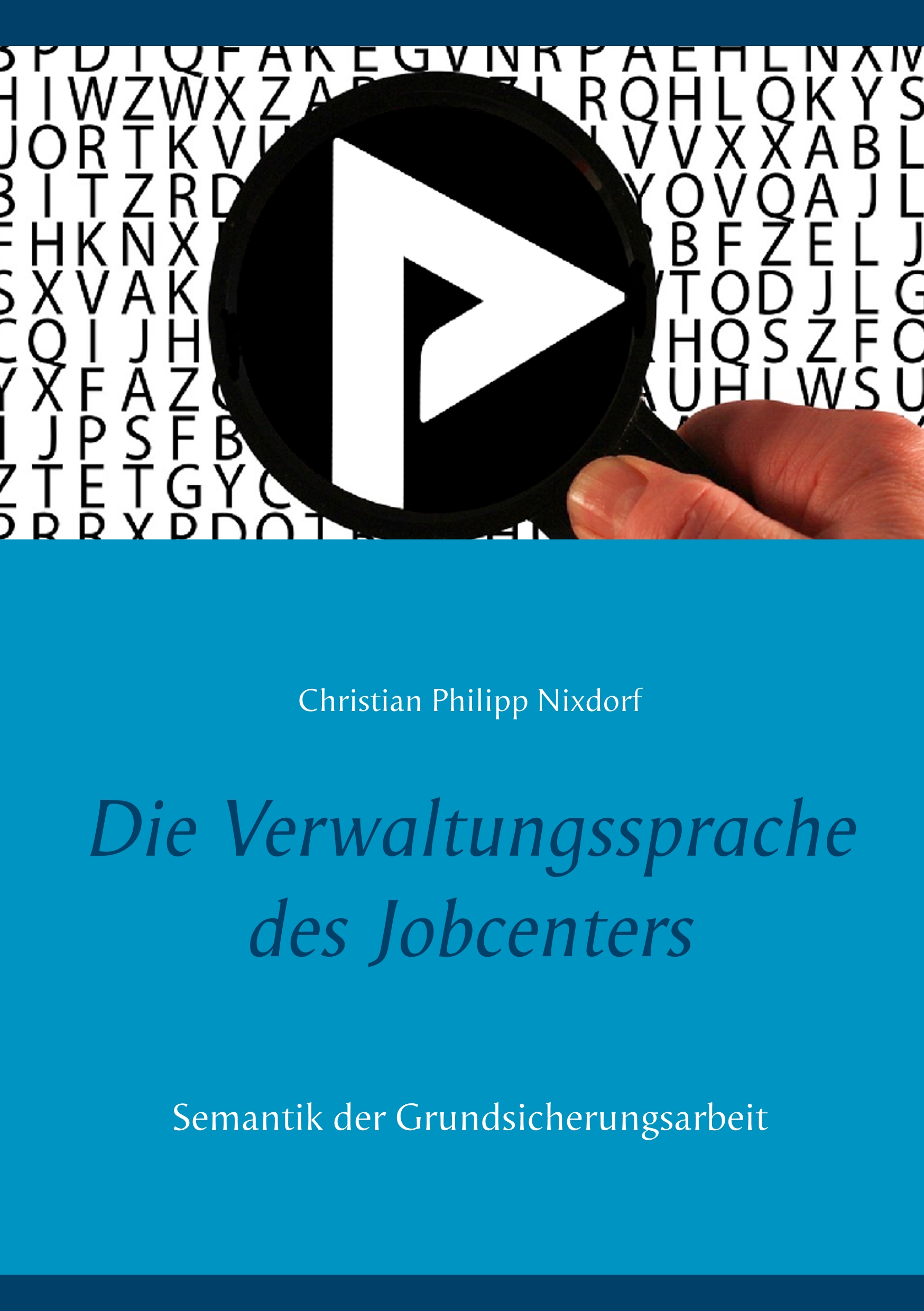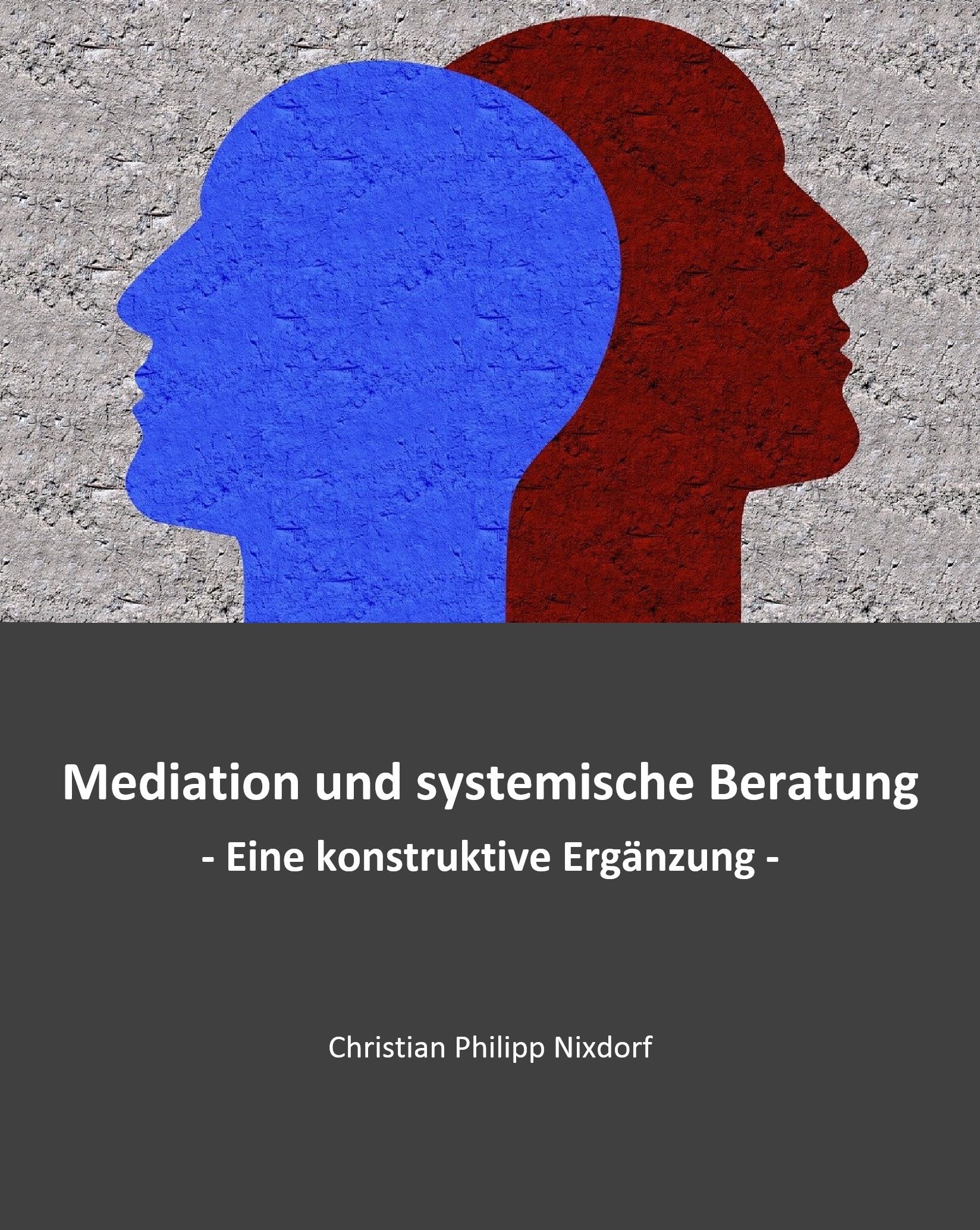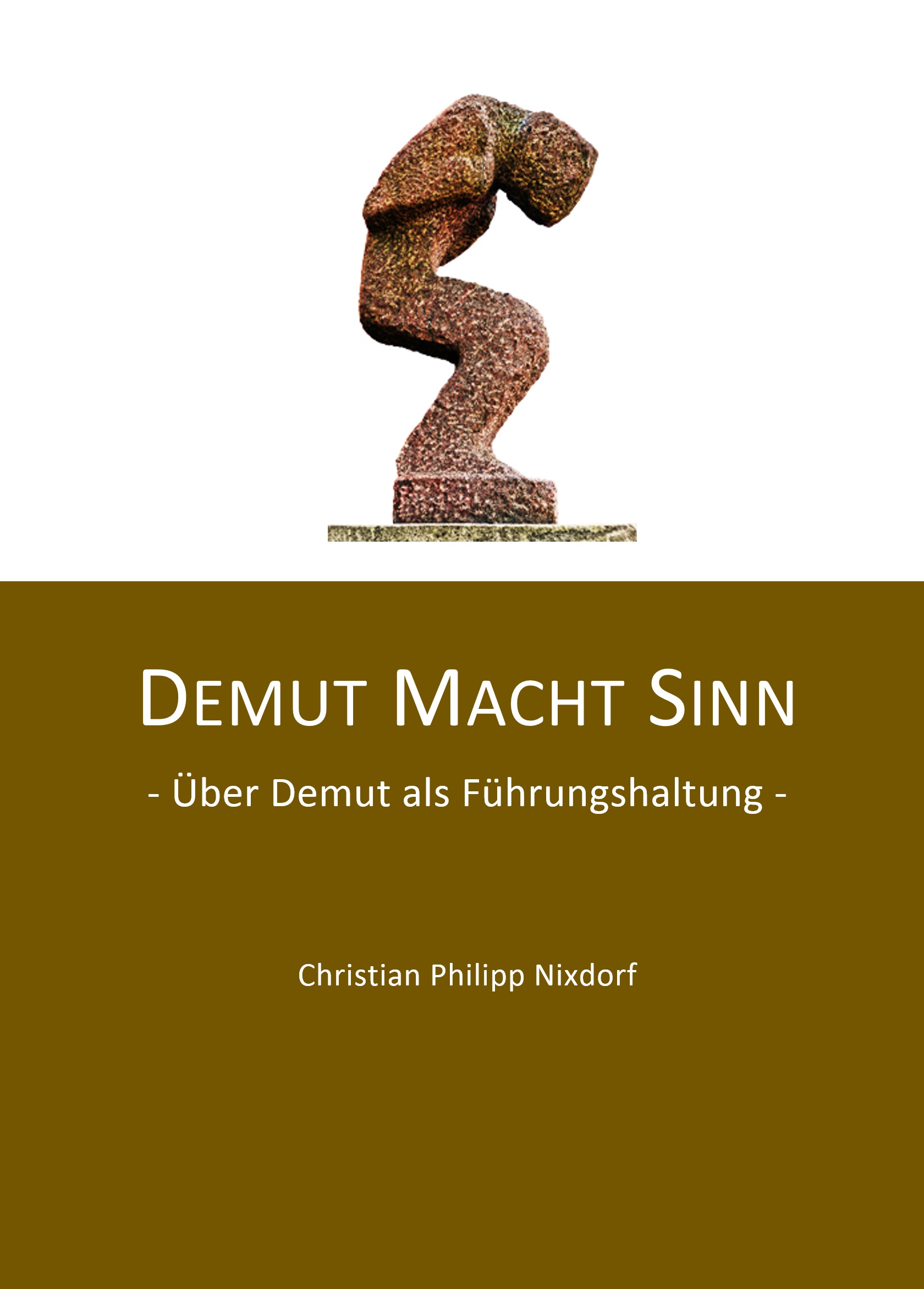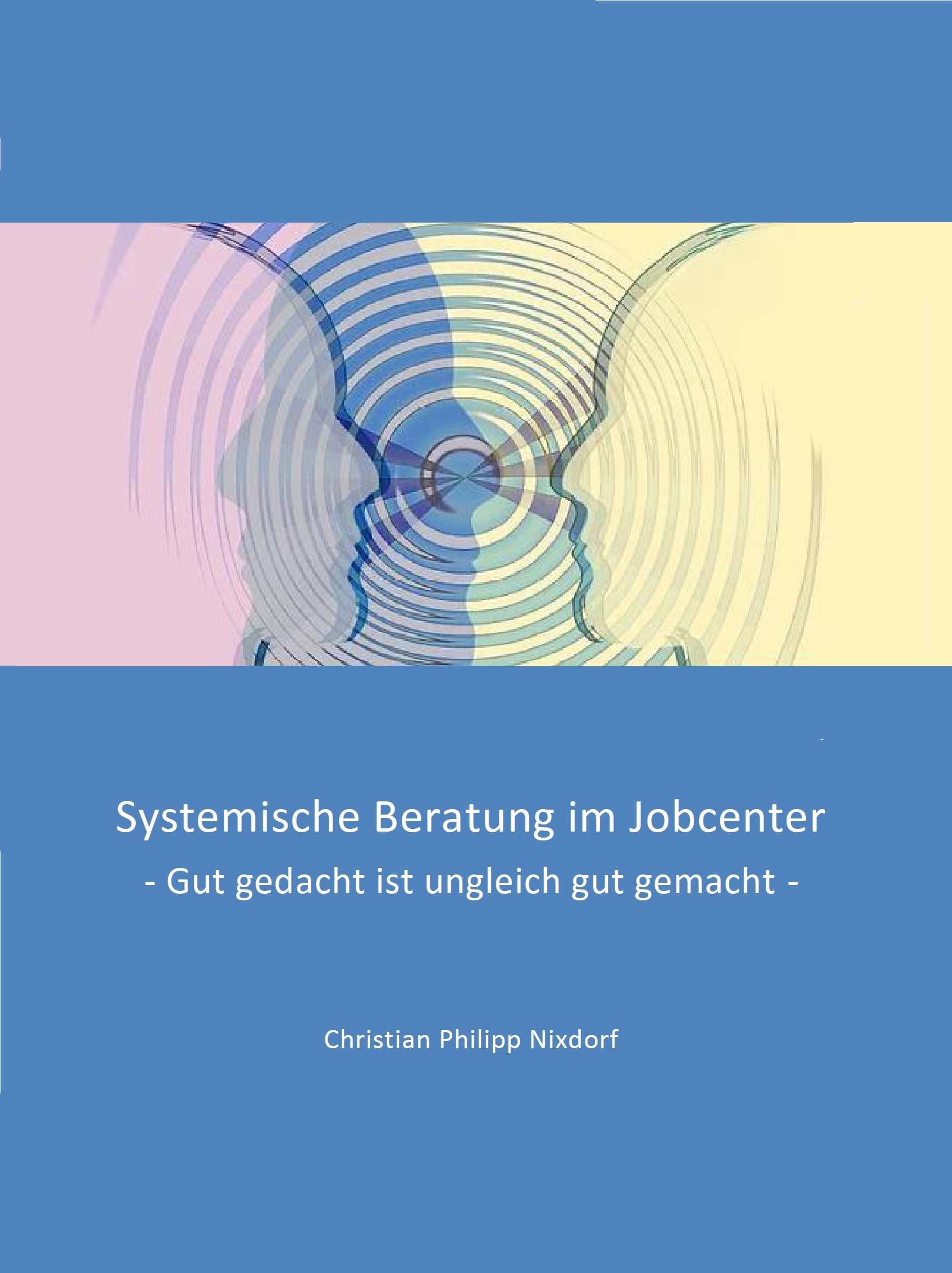
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer mehr Jobcenter schulen ihre Beratungsfachkräfte systemisch. Dem zugrunde liegt die Vorstellung, dass die Integration in Arbeit schneller und nachhaltiger gelinge, wenn Beratungsfachkräfte nicht nur ihre jeweiligen Kunden mit ihren Stärken und Schwächen fokussierten, sondern auch deren Familien, Bezugssysteme und Netzwerke mit in den Blick nähmen. Das ist im Jobcenter aufgrund organisationaler und rechtlicher Hürden allerdings oft schwer zu bewerkstelligen. Widersprüchliche Zielvorgaben, eine fehlende Exit-Option für Kunden und die konzeptionelle Schließung der Beratung leisten im Rechtskreis des SGB II der Vorstellung des Wir-steuern-die-Kunden Vorschub, statt ein wirklich ergebnisoffenes Wir-unterstützen-Kunden-beim-Selbststeuern zu ermöglichen. Das kann seitens der Kunden als übergriffig erlebt werden. Systemisch zu beraten kann im Jobcenter gelingen, es zu leisten ist institutionsbedingt aber herausfordernd. Warum genau das so ist, wird im vorliegenden Text geschildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Systemische Beratung im Jobcenter
In aller Kürze – Worum es gehtBilder im KopfDie Überlegung, im Jobcenter systemisch zu handelnGut gedacht ist ungleich gut gemachtSystemische Beratung stößt an institutionelle GrenzenEmployability wird gegenüber Empowerment priorisiertBeratung ist konzeptionell geschlossenMenschen werden defizitorientiert betrachtetRollenambiguität erschwert eine systemische HaltungEin systemischer Blick auf Arbeitslosigkeit kann helfenLiteraturÜber den AutorImpressumIn aller Kürze – Worum es geht
Immer mehr Jobcenter schulen ihre Beratungsfachkräfte systemisch. Dem zugrunde liegt die Vorstellung, dass die Integration in Arbeit schneller und nachhaltiger gelinge, wenn Beratungsfachkräfte nicht nur ihre jeweiligen „Kunden“ mit ihren Stärken und Schwächen fokussierten, sondern auch deren Familien, Bezugssysteme und Netzwerke mit in den Blick nähmen. Das ist im Jobcenter aufgrund organisationaler und rechtlicher Hürden allerdings oft schwer zu bewerkstelligen. Widersprüchliche Zielvorgaben, eine fehlende Exit-Option für „Kunden“ und die konzeptionelle Schließung der Beratung leisten im Rechtskreis des SGB II der Vorstellung des Wir-steuern-die-„Kunden“ Vorschub, statt ein wirklich ergebnisoffenes Wir-unterstützen-„Kunden“-beim-Selbststeuern zu ermöglichen. Das kann seitens der „Kunden“ als übergriffig erlebt werden. Systemisch zu beraten kann im Jobcenter gelingen, es zu leisten ist institutionsbedingt aber herausfordernd. Warum genau das so ist, wird im vorliegenden Text geschildert.
Bilder im Kopf
Bild dir deine Meinung – so der Werbeslogan der auflagenstärksten deutschen Tageszeitung, die das geschickte Bebildern von Texten perfekt beherrscht. Bei BILD weiß man eben: Bilder helfen, Meinungen auszubilden. Dass die BILD-Zeitung trotz der seit Jahren sinkenden Auflage noch immer eine große Leserschaft findet, hat viele Gründe. Einer ist, dass Menschen unabhängig von ihrem Bildungsstand durch Bilder gut erreichbar sind. Bilder sagen mehr als Worte – lautet ein geflügeltes Wort. So pauschal ist das sicher falsch, denn auch mit Worten können ausdrucksstarke Bilder „gemalt“ werden. Richtig ist aber, dass Bilder insbesondere in Kombination mit Worten Emotionen hervorrufen können. Sie sind imstande, etwas zu bewirken, was mit Worten allein schwerer fällt. Auch dienen Bilder der Emotionalisierung und Mobilisierung. Bilder begrenzen den Fokus, sie pointieren und reduzieren Komplexität. Das kann hilfreich sein, aber ebenso negative Folgen haben. Dass Bilder Meinungen prägen, dass sie Stimmungen erzeugen und diese verstärken können, hat Edward Bernays, der Vordenker der Public Relations (und Neffe Sigmund Freuds) schon vor 90 Jahren in seinem Referenzwerk Propaganda (1928) dargelegt. Wie Recht er damit hatte, haben die Nationalsozialisten wenig später auf erschreckende Weise bewiesen. Bilder können Leid verursachen, es aber auch lindern. Im therapeutischen Bereich etwa werden Bilder gemalt, wo Worte fehlen, um dem Erlebten Ausdruck zu verleihen. Werner Kraus beschreibt das in Die Heilkraft des Malens (2007).
Dass Bilder Orientierung stiften und Sprachbarrieren transzendieren können, belegen steinzeitliche Höhlenmalereien ebenso wie moderne Piktogramme, die fast weltweit verstanden werden. Auch das, was wir über Organisationen denken, mit denen wir interagieren, ist bestimmt von Bildern, die wir im Kopf haben. Nicht von ungefähr hat Gareth Morgan mit Images of Organization (2006) ein Buch dazu geschrieben, wie wir uns über Bilder ein Bild von Organisationen machen. Kurzum lässt sich mit Bildern auch deshalb gut arbeiten, weil sie erregen. Statistiken können das nicht, denn sie liefern nur Daten. Kalte, technokratische Fakten. Die Nachricht, dass 2018 laut Statistischem Bundesamt knapp 19 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in Armut lebte, erregt weniger die Gemüter als eine bebilderte SPIEGEL-Reportage, die den Alltag eines der 4,4 Millionen Kinder zeigt, die in Deutschland von Armut betroffen sind. Wenn Armut in meinungsprägenden Medien zum Thema wird, werden oft Bilder vermittelt, die Gedankenkonstruktionen wie den folgenden Vorschub leisten: Hartz IV und Unterschicht, Arbeitslosigkeit und Bildungsarmut, Bier und Kippen, Bild und Glotze, Verrohung und Gewalt, Schmarotzertum und Sozialhilfeadel. Das zeigt, dass pejorative Assoziationen der medialen Darstellung von Armut nicht selten zu eigen sind (vgl. Kaufmann 2013, S. 297; Dörre 2014, S. 42 und Borchert 2013, S. 206 f.). Behauptungen wie die, dass das Gros der „Unterschichtler“, die despektierlich auch „Hartzer“ genannt werden, weitgehend an Bildung desinteressiert sei, finden sich zuhauf, wie Chassé (2017), Dörfler & Fritzsche (2016), Baron & Steinwachs (2012) und Steinwachs (2015) schildern. Geradezu bezeichnend ist auch, dass ein Report vom Arbeitsmarkt, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im August 2005 herausgegeben hat, den Titel Vorrang für die Anständigen. Gegen Missbrauch, ›Abzocke‹ und Selbstbedienung im Sozialstaat trägt. In ihm (2005, S. 10) werden, wenngleich es sprachlich verneint wird, Arbeitslose implizit in die Nähe parasitärer Organismen gerückt. Auch das Jobcenter wird medial häufig thematisiert, wenn von Armut die Rede ist. Welche Bilder dabei entstehen, können eine jede Leserin und ein jeder Leser sich selbst fragen. Es sind meist keine Positiven. So ist ein Artikel von Antonia Baum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus 2014 betitelt mit Ein Tag im Jobcenter: Es brennt lichterloh! Eine Reportage in der ZEIT von Julia Friedrichs aus 2013 ist überschrieben mit den Worten Arbeitskrampf: Zwischen Engagement und Frustration. Und ein Artikel von Marie Rövekamp im Tagesspiegel aus 2017 trägt den Titel Wie verheerend die Arbeitsbedingungen in Jobcentern sind. Das vermittelt kein positives Bild des Ortes, an dem der Autor dieses Textes 5 ½ Jahre lang Menschen beraten hat. Das Jobcenter wird aufgrund der medialen Berichterstattung allzu oft assoziiert mit Tristesse, Chancenlosigkeit und Bildungsdesinteresse. Es ist, so die Wahrnehmung vieler Menschen, ein Un-Ort, wo Leute prozessiert werden, die an der von Vester (2001, S. 26) so titulierten „Grenze der Respektabilität“ leben.