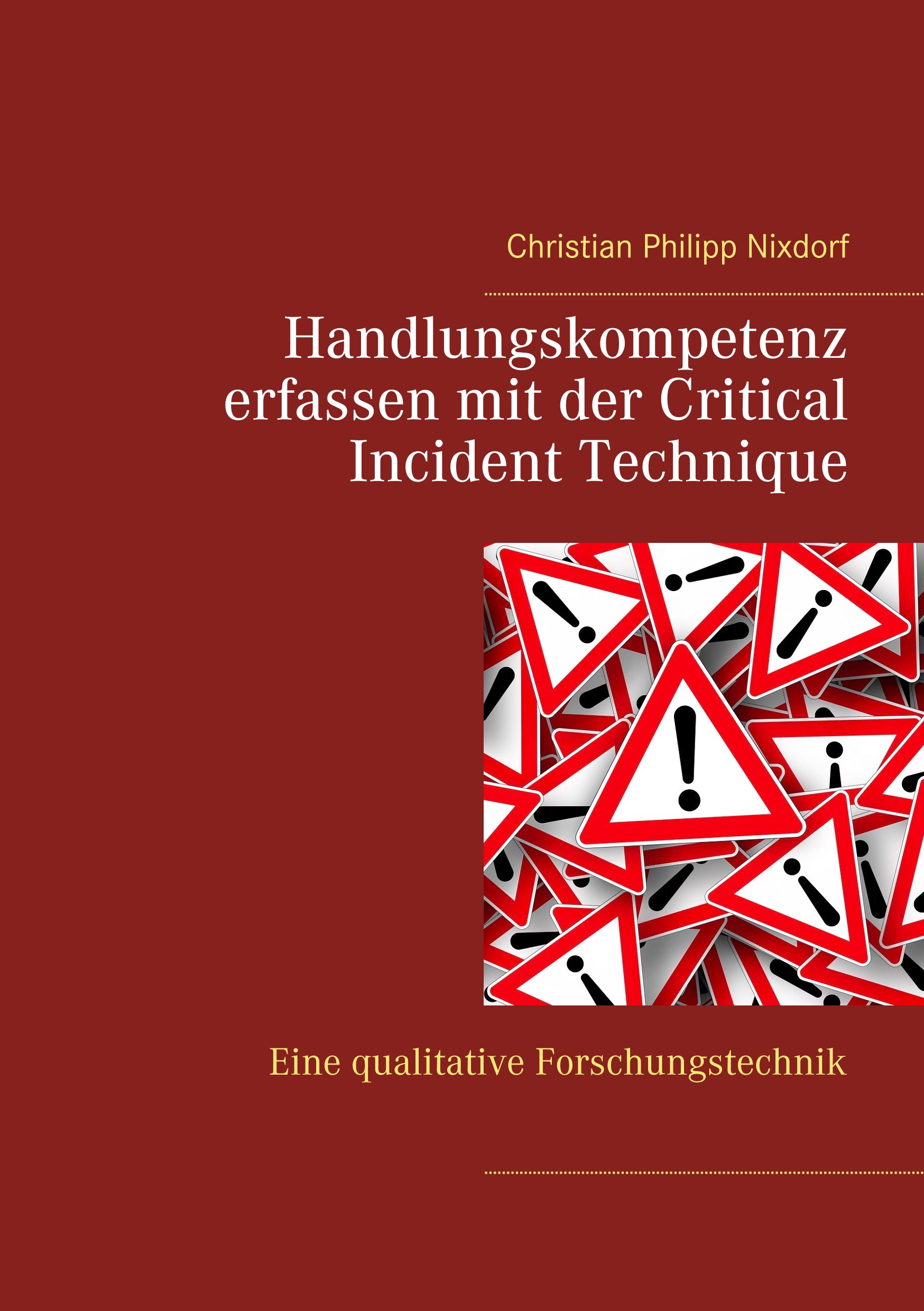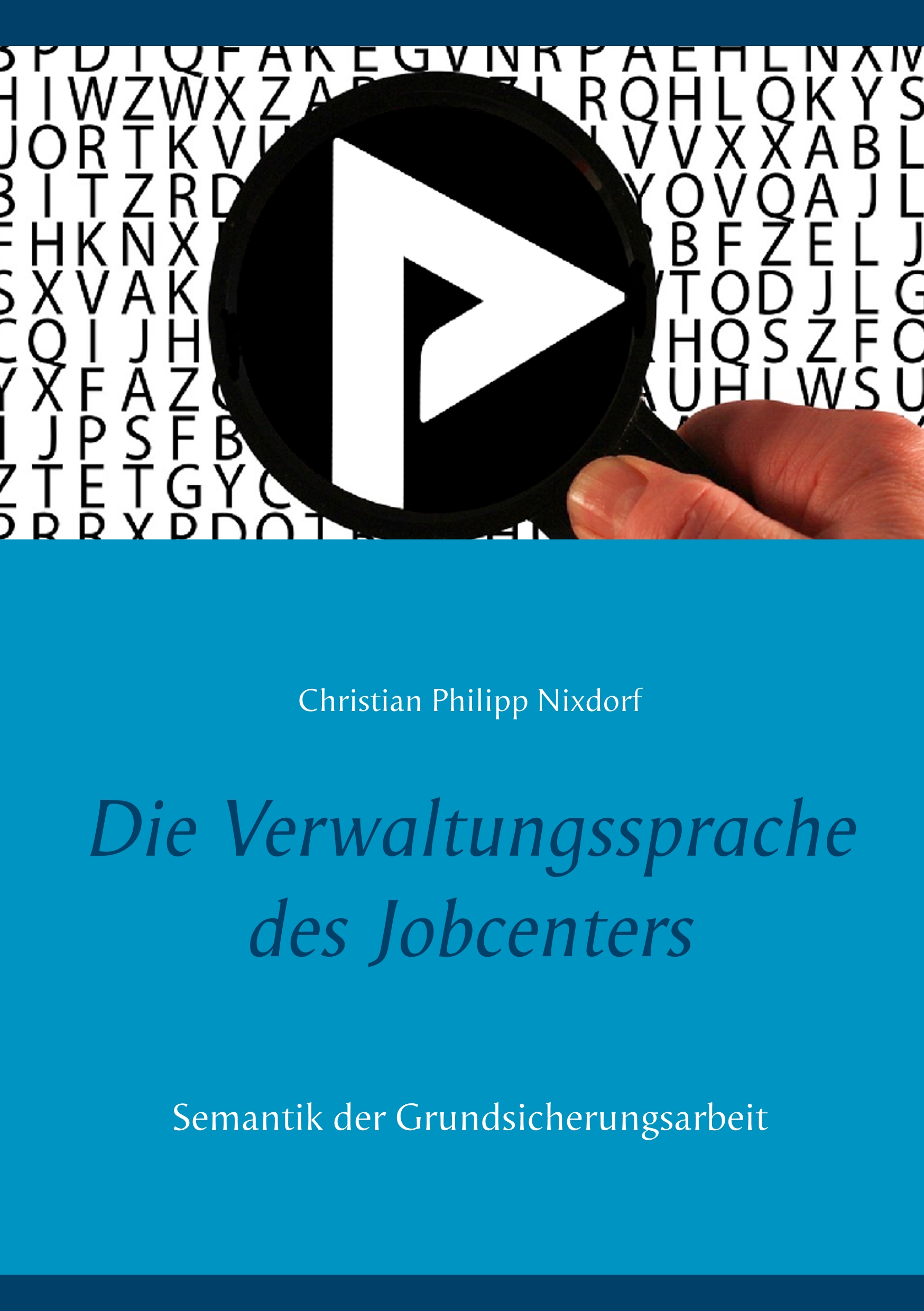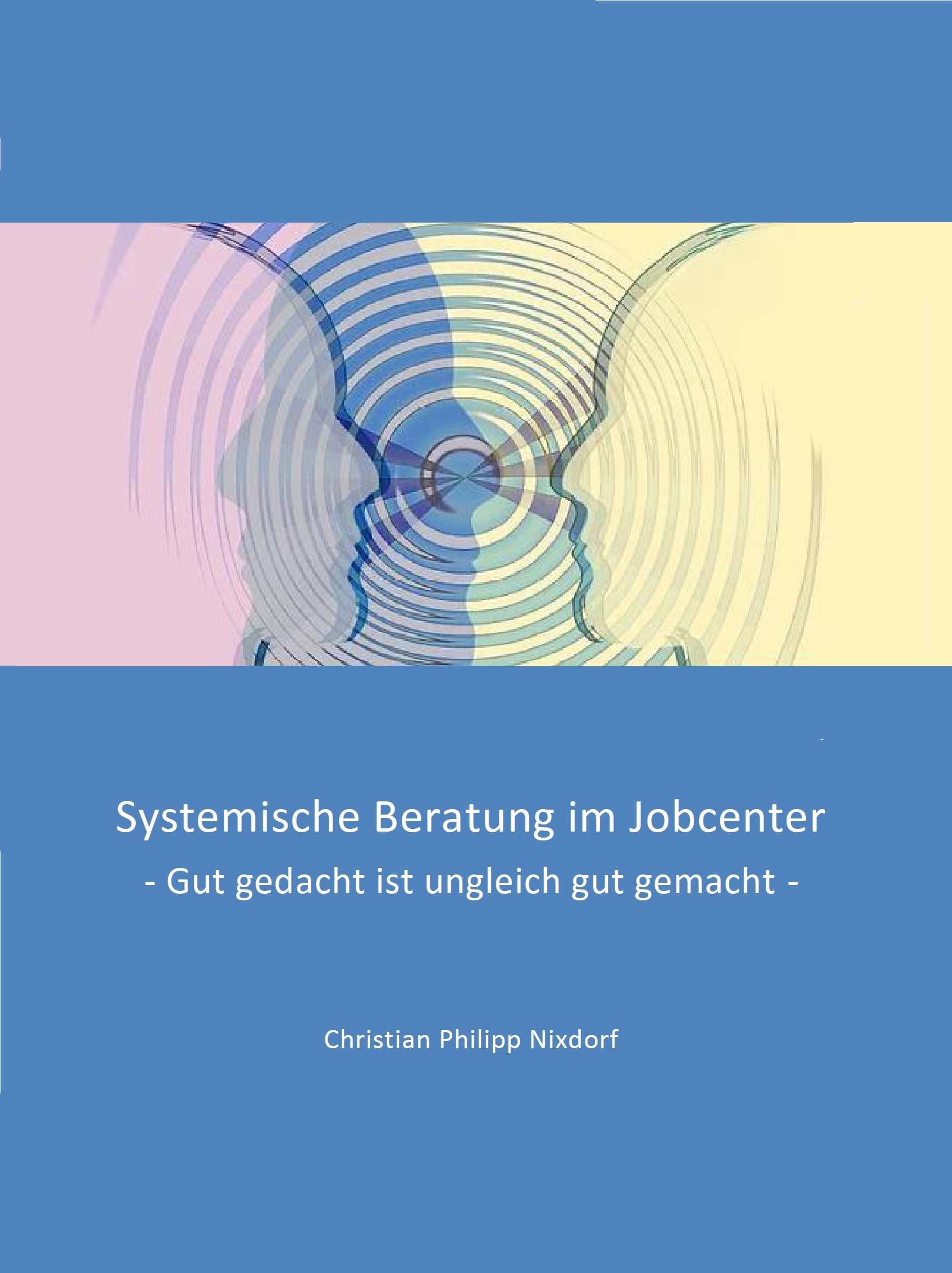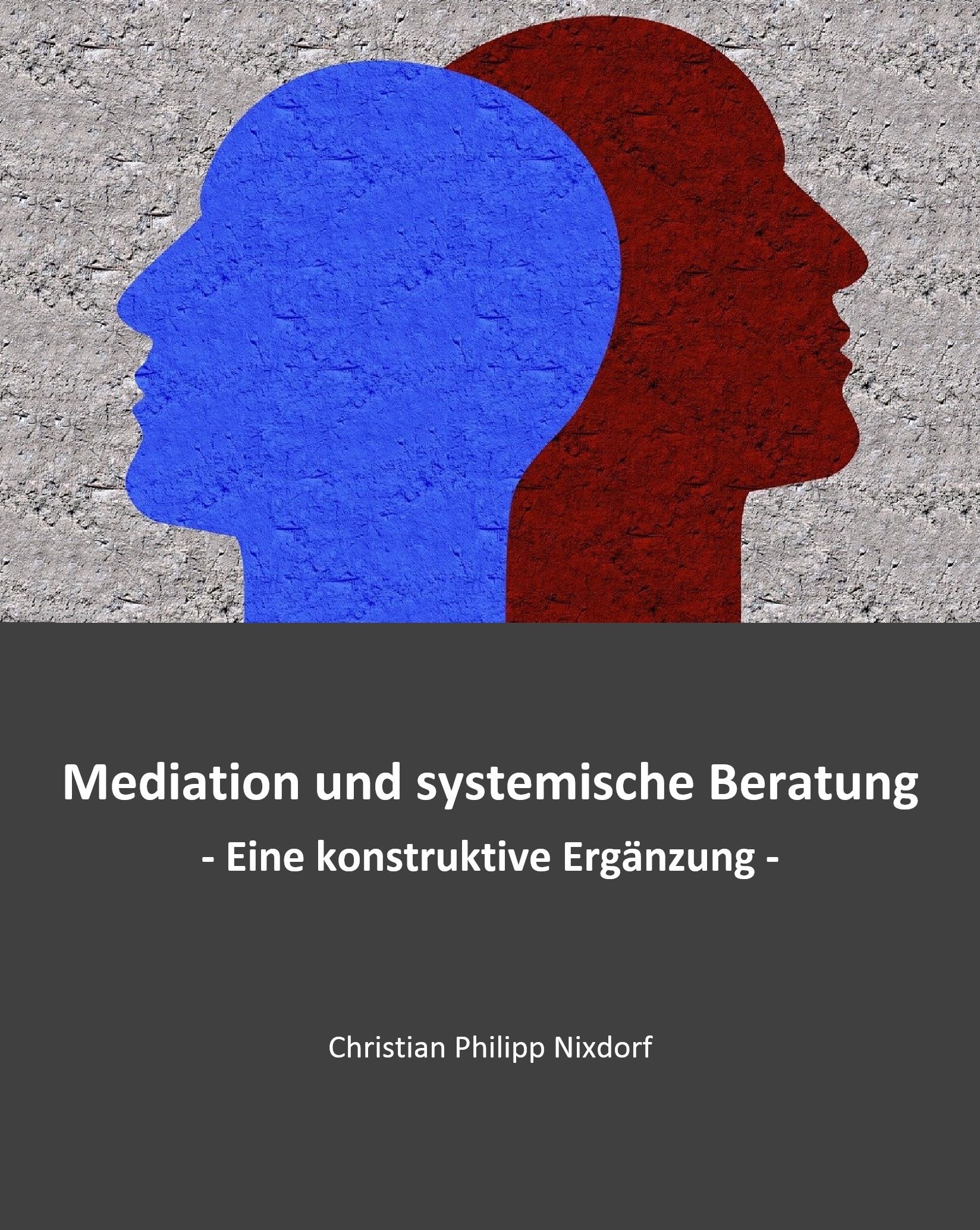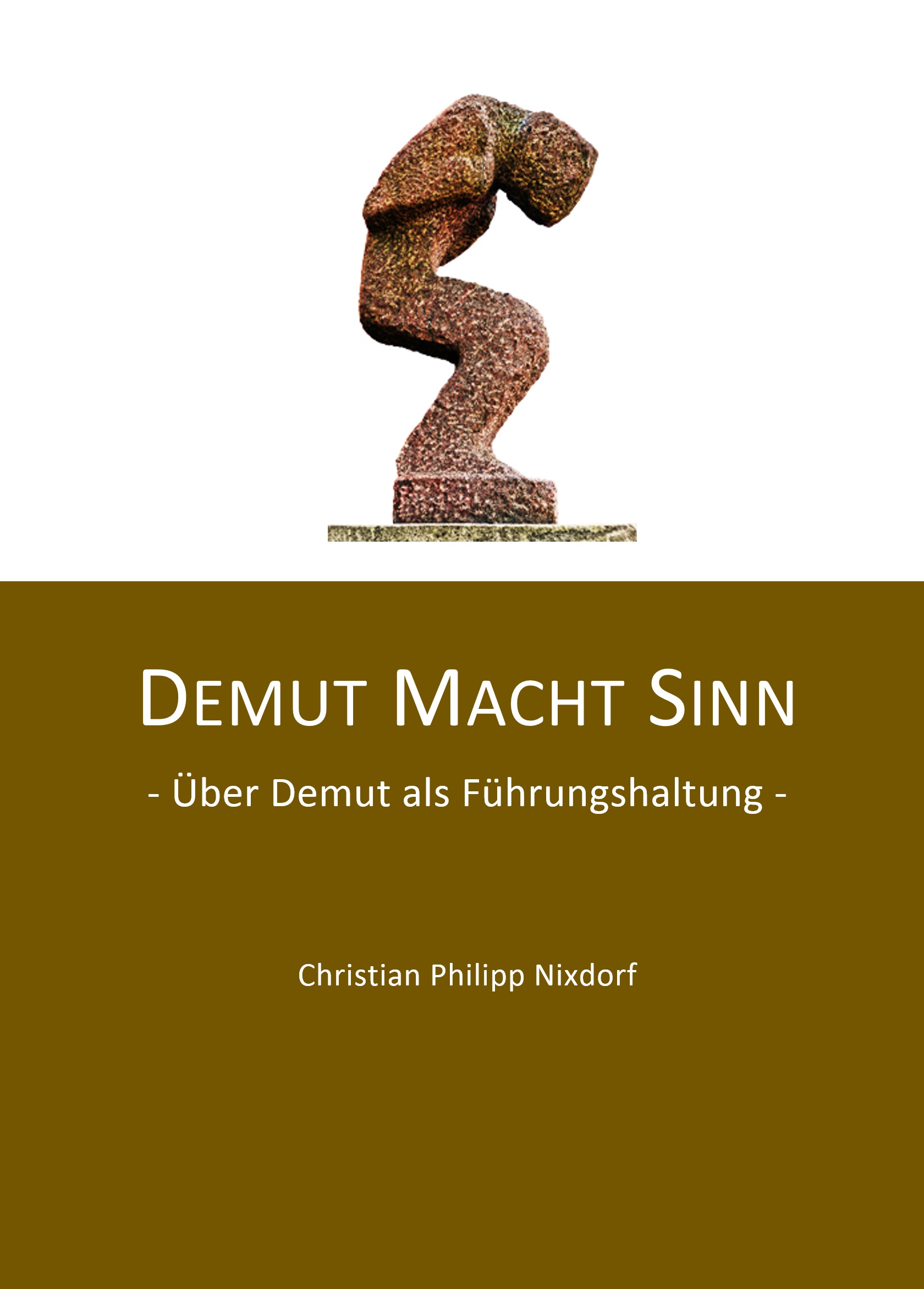
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Demut ist ein Zeitgeist-Phänomen. Längst nicht mehr nur Theologen und religiöse Menschen setzen sich mit dem Wert der Demut auseinander. Manager, Unternehmensberater und Coaches tun es genauso. Galt plakativ zur Schau gestelltes Gewinnstreben in den 1980er Jahren in Managementkreisen noch als sozial akzeptiert, kann man heute eher mit proklamierter Demut punkten. Demut ist, so liest man in diversen Management-Ratgebern, heute eine jener Voraussetzungen, derer es bedarf, um eine Kultur der Menschenwürde in Organisationen zu etablieren und zu leben. Demut schützt eine Führungskraft davor, übermütig zu wer-den und sich deutlich zu überschätzen. Demut erdet, was einem Unternehmen dienlich sein kann. Wer demütig ist, wird auch eher geneigt sein, seinen Mitmenschen mit Respekt zu begegnen und deren Expertise anzunehmen. Wer demütig führt, gesteht sich Fehler ein. Er trägt so entscheiden dazu bei, dass eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit gelebt wird. Wenn Mitarbeiter ihre Führungskraft als demütig und fehlertolerant erleben, werden sie eher geneigt sein, ebenfalls Fehler einzuräumen. In einer globalisierten Welt, in der Unternehmen weltweit konkurrieren, ist das essenziell, da es Innovationen befördert. Kurzum kann es von Vorteil zu sein, mehr Demut zu zeigen. Aber es gibt auch manche Nachteile. Dass man es auch mit Hochmut sehr weit bringen kann, beweist Donald Trump schließlich tagtäglich. Und noch etwas stimmt im Hinblick auf die Demut nachdenklich: Wie echt ist Demut, so ließe sich fragen, wenn Unternehmen sich ihrer im Kontext von Corporate-Social-Responsibility-Bekundungen primär deshalb bedienen, weil es dem eigenen Image dienlich ist. Ist das dann wirklich Demut, oder ist es nur Legitimationskitsch, mithin also Heuchelei? Und wenn Letzteres zutrifft, ist das schlimm? Und warum eigentlich? Darum geht es im vorliegenden Text.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
In aller Kürze – Worum es geht
Demut ist ein Zeitgeist-Phänomen. Längst nicht mehr nur Theologen und religiöse Menschen setzen sich mit dem Wert der Demut auseinander. Manager, Unternehmensberater und Coaches tun es genauso. Galt plakativ zur Schau gestelltes Gewinnstreben in den 1980er Jahren in Managementkreisen noch als sozial akzeptiert, kann man heute eher mit proklamierter Demut punkten. Demut ist, so liest man in diversen Management-Ratgebern, heute eine jener Voraussetzungen, derer es bedarf, um eine Kultur der Menschenwürde in Organisationen zu etablieren und zu leben. Demut schützt eine Führungskraft davor, übermütig zu werden und sich deutlich zu überschätzen. Demut erdet, was einem Unternehmen dienlich sein kann. Wer demütig ist, wird auch eher geneigt sein, seinen Mitmenschen mit Respekt zu begegnen und deren Expertise anzunehmen. Wer demütig führt, gesteht sich Fehler ein. Er trägt so entscheiden dazu bei, dass eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit gelebt wird. Wenn Mitarbeiter ihre Führungskraft als demütig und fehlertolerant erleben, werden sie eher geneigt sein, ebenfalls Fehler einzuräumen. In einer globalisierten Welt, in der Unternehmen weltweit konkurrieren, ist das essenziell, da es Innovationen befördert. Kurzum kann es von Vorteil zu sein, mehr Demut zu zeigen. Aber es gibt auch manche Nachteile. Dass man es auch mit Hochmut sehr weit bringen kann, beweist Donald Trump schließlich tagtäglich. Und noch etwas stimmt im Hinblick auf die Demut nachdenklich: Wie echt ist Demut, so ließe sich fragen, wenn Unternehmen sich ihrer im Kontext von Corporate-Social-Responsibility-Bekundungen primär deshalb bedienen, weil es dem eigenen Image dienlich ist. Ist das dann wirklich Demut, oder ist es nur Legitimationskitsch, mithin also Heuchelei? Und wenn Letzteres zutrifft, ist das schlimm? Und warum eigentlich? Darum geht es im Text.
Ein Zeitgeist-Phänomen im Management
Der Papst hat in seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate mehr Präsenz von ihr in der Wirtschaft gefordert. Ebenso tun es Bundespräsidenten in Weihnachtsansprachen. Der Dalai-Lama ist ein steter Verfechter von ihr, Nelson Mandela war es auch – Mahatma Gandhi sowieso. US-Präsidenten betonen, Donald Trump ausgenommen, in ihren Reden zum State of the Union regelmäßig, sie übten ihr Amt in ihr aus. Und immer wieder findet sich in Artikeln in Wirtschaftsmagazinen ein selbsternannter oder tatsächlicher Management-Experte, der sie als zentrale Führungshaltung rühmt: Demut. Dass die Demut wieder absolut „in“ ist, belegen unzählige Publikationen. Hier einige Beispiele: Understatement – Der Stil des Erfolgs lautet der Titel eines Buches von Rainer Wälde (2008), in dem wir einiges über die Vorteile eines demütigen Führungsstils erfahren. Im selben Jahr erschien Kristian Furchs Demut macht stark (2008). Über die Demut – so lautet der Titel eines Kapitels in Baldur Kirchners (2012) Benedikt für Manager. Ein Kapitel im Management-Fachbuch Das Zukunfts-Mindset von Jörg Hawlitzeck (2018, S. 212) ist ähnlich betitelt: Mit Leistungsbereitschaft und Demut zum Erfolg. Paul Romer, Wirtschaftsnobelpreis-Träger von 2018, sagte auf dem 12. Institutional Money Kongress: „Mehr Demut täte uns gut.“ Der Ex-Benediktiner Anselm Bilgri hielt beim HAYS Forum 2012 einen Vortrag über werteorientierte Führung, in dem er auf den Sinn der Demut für Führungskräfte einging. Ein anderer Benediktiner, Anselm Grün, schrieb ein Jahr später im Handelsblatt einen Artikel über Den Mut, hinabzusteigen. Er erklärt der Leserschaft darin, die Demut sei „in der Wirtschaft eine Haltung, die uns mitten in dem Streben, immer höher zu steigen, Halt gibt. Sie bewahrt uns davor, uns über andere zu stellen und in unserem Höhenflug dann jäh abzustürzen.“ Susanne Thielecke beschrieb das, was heute als guter Führungsstil gilt, im Magazin Unsere Wirtschaft (2018) mit folgenden Worten:
„Moderne Führungskräfte brauchen neben Klarheit, Entscheidungsfreude und Mut auch Demut, Empathie und Offenheit.“ Alexander Groth erklärt in seinem BuchBest of Führungslehre (2019, S. 27) in ähnlichem Tenor: „Eine demütige Führungskraft erhebt sich im Geist nicht über ihre Mitarbeiter, sie stellt sich nicht auf eine Ego-Säule, von der aus sie auf sie herabschaut.“ Im Artikel Mehr Mut zur Demut in der Führung auf WELT-Online (2019) postuliert Anke Houben dem ähnlich: „Führen heißt dienen. Die Autorität einer Führungskraft ist nichts anderes als zugestandene Macht im Austausch für eine Dienstleistung. […] Wenn es um Bescheidenheit und Ambition geht, wird schwarz-weiß gedacht. Beides zusammen geht einfach nicht. Und genau das ist der Trugschluss: Wirklich starke Führungskräfte verzichten auf Dominanz. Sie geben nicht vor, alle Antworten in einer immer komplexeren Welt zu kennen.“ Ähnliche Äußerungen finden sich in Wirtschaftsmagazinen, in Reden von Keynote-Speakern und in Ratgebern zum Management zuhauf. Dass die Demut im letzten Jahrzehnt als Tugend auch in elitären Investment-Banker-Kreisen (vordergründig) wiederentdeckt wurde, die mit ihr - so die Wahrnehmung vieler Menschen - sonst eher wenig am sprichwörtlichen Hut haben, ist vor allem auf die weltweiten Finanzkrise zurückzuführen, die sich ab 2007 abzeichnete und ihren Höhepunkt 2009 fand. Die Finanzkrise gilt als Paradebeispiel dafür, was Arroganz, Ignoranz, Gier und Hochmut anrichten können. Sie offenbarte, was passieren kann, wenn sich Manager allein dem Gewinnstreben verpflichtet fühlen, wenn sie hochrisikoreiche Entscheidungen treffen, für die sie persönlich nicht haftbar gemacht werden und bei denen sie im Falle des Scheiterns meist noch Millionen-Abfindungen erhalten, während Kleinsparer und Angestellte unter den Entscheidungen enorm leiden.
Rakesh Khurana, Professor für Führungsentwicklung in der Organisationstheorie an der Wirtschaftskader-Schmiede Harvard Business School, forderte daher bereits 2009 eine Art hippokratischen Eid für Manager. Die MBA-Absolventen sollten sich verpflichten, so seine Idee, der Gesellschaft zu dienen und ihr Unternehmen rentabel, sozial sowie auch umweltverträglich zu führen (vgl. Buchhorn & Werle 2009). Professor Khurana war sich der Tatsache, dass eine solcher Eid nicht mehr sei als eine unverbindliche Willenserklärung - ähnlich des Giving Pledge - freilich bewusst.1 Ein anderer bedeutsamer Management-Denker, Professor Henry Mintzberg von der McGill-University in Montreal, geht auf den Grund für den Hochmut vieler Harvard-MBAs in seinem Buch Managers, Not MBAs (2004, S. 74 ff.) ein. Er erklärt, dass die Kombination aus Kompetenz, Erfolgsverallgemeinerung und Arroganz vieler Studierender in Ivy-League-MBA-Programmen zu Selbstüberschätzung der Studierenden führen könne. Sein wenig schmeichelhaftes Resümee (ebd., S. 75) war schon vor 15 Jahren: „If the business schools were really doing their job, were truly creating leaders, their graduates would be known für their humility, not their arrogance. Certainly they would graduate with an acute appreciation of what they don’t know. Instead, we hear from a recent graduate of Harvard Business School about a professor who told her class that, in the future we would be among those who set the rules and have the conversations about what should and shouldn’t be done in the way business is conducted.‘ She and her classmates gave him a standing ovation.‘ No doubt!“ Dass Professor Khurana trotz - oder aufgrund - Mintzbergs Kritik am elitären MBA-Gehabe und der fragwürdigen Performance von Harvard-MBAs ein symbolisches Zeichen für mehr Demut im Business setzen wollte, entspricht dem Zeitgeist. Man könnte auch sagen: Der Professor erkannte einen Trend, der seit über 10 Jahren anhält. Birger Menke bringt ihn im Artikel Wiederkehr der Demut im SPIEGEL (2012) auf den Punkt. Er schreibt: „Nach der erfolgreichen Selbstermächtigung steigt der Wunsch nach einer neuen Selbstverpflichtung gegenüber Werten wie Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit. Der Wunsch nach einer neuen Form von Demut. Alexander Dibelius, Deutschlandchef und mächtiger Manager der Investmentbank Goldman Sachs, rief seine Branche zu ‚kollektiver Demut‘ auf. Medienmogul Rupert Murdoch sagte, als er vor dem britischen Unterhaus zu den menschenverachtenden Abhörmethoden seiner ‚News of the World‘ Stellung nehmen musste, es handle sich für ihn um den Tag ‚größter Demut‘. Karl-Theodor zu Guttenberg entschuldigte sich ‚in Demut‘ nach der Plagiatsaffäre, der damalige FDP-Generalsekretär Christian Lindner empfahl seiner Partei nach der Berlin-Wahl, das Ergebnis ‚in Demut aufzunehmen‘. Es gibt unzählige weitere Beispiele, eines zeigen sie alle: Demut mag verstaubt sein, an Wirkung hat sie nicht verloren.“ Die Liste von mehr oder weniger bedeutsamen Persönlichkeiten, die sich zum hohen Wert der Demut (bzw. zu ihrem jeweiligen Verständnis davon) geäußert haben, ließe sich fortsetzen. Und zwar lang. Das Internet ist voller Zitate von Menschen, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen und bekunden, ihre jeweilige Führungsaufgabe in Demut auszuüben. 44 Millionen Treffer liefert allein das Stichwort »Humble Leadership« bei einer Google-Suche im September 2019. Die Begriffskombination »demütig führen« brachte es auf 1,6 Millionen Treffer.
Das ist insofern interessant, als es noch gut 1/3 weniger Treffer waren, als der Autor dieses Aufsatzes vor gut 10 Jahren bereits einmal einen Artikel überDemut als Management-Hype (Nixdorf 2010; unveröffentlichtes Working Paper) schrieb. Daran zeigt sich, dass Demut als Führungshaltung weiter an Resonanz gewonnen hat. Oder provokativ gesagt: Das Reden von und über Demut als Führungshaltung. Aus wohlfeilen Texten und Lobpreisungen auf Demut kann schließlich keineswegs gefolgert werden, dass Manager das, was sie im Manager Magazin, in der OrganisationsEntwicklung oder im Harvard Business Manager so von sich geben, in der Praxis tatsächlich auch tun. Zu reden und zu handeln sind eben unterschiedliche Paar Schuhe. „Die Deutsche Bank übt Demut“ – so schreibt Hans-Jürgen Jakobs im Handelsblatt (2019). Dass dieselbe Deutsche Bank in Sachen Demut indes mitnichten eine Vorzeige-Organisation ist, hat nicht nur Josef Ackermanns mittlerweile zur Ikone der Kapitalismuskritik gewordenes Victory-Zeichen 2004 beim Mannesmann-Prozesses bewiesen. Es zeigte sich auch unlängst wieder, als die Bank bekanntgab, weltweit 18.000 Stellen streichen zu wollen. Am selben Tag, an dem das verkündet wurde, besuchten Schneidermeister von Fielding & Nicholson die Deutsche Bank in London, um deren Top-Manager zu vermessen zwecks Anfertigung maßgeschneiderter Anzüge, von denen die günstigsten mindestens 1800 Euro kosten (vgl. Farrell 2019). Das wirkte eher ignorant als demütig. Die Panama Papers und der VW Skandal zeugen ebenso davon, dass von wahrlich gelebter Demut vieler Wirtschaftseliten in real wenig zu sehen ist. Dass dies auch für so manche Eliten in der Politik gilt, belegt der Skandal um dreistellige Millionenbeträge, die ohne Ausschreibungen für Beratungsdienstleistungen seitens des Verteidigungsministeriums an die großen Consulting-Firmen Accenture und McKinsey flossen (vgl. Löhe 2019, siehe speziell zum Agieren von Eliten auch Hartmann 2019). Die damalige Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen, die mittlerweile Präsidentin der EU ist, sagte bei einer Rede im EU-Parlament übrigens: „The task ahead of us humbles me.“ Sich öffentlichkeitswirksam in Demut zu üben gehört mittlerweile zum guten Ton. Das alles verwundert nicht. Die Organisationswissenschaftler Nils Brunsson (1989) und Stefan Kühl (2007) haben umfassend dargelegt, dass Heuchelei im Sinne eines A sagen und B tun eine gesellschaftlich zwar vordergründig verpönte, indes doch weit verbreitete, ja gar überlebenswichtige Eigenschaft von Managern ist. Ob im Jahr 2020 wirklich demütiger geführt, gemanagt und mit Bürgern, Kunden sowie Mitarbeitenden kommuniziert wird als vor 10, 20 oder 30 Jahren, ist allerdings ungewiss. Vielleicht wird heute auch nur besser geheuchelt.
Klar ist, dass die Kommunikation über das Ideal der Demut als Führungstugend zugenommen hat. Das jedenfalls indiziert die Tatsache, dass laut Statistischem Bundesamt 27 % der betrieblichen und außerbetrieblichen Lehrveranstaltungen mit den meisten Stunden im Jahr 2015 Kundenorientierung zum Inhalt hatten. Explizit Führungskompetenz hatten 18 % der Veranstaltungen zum Ziel. Der Trendmonitor Weiterbildung (2018, S. 17) der Leipzig Graduate School of Management u. a. verweist ebenfalls auf die hohe Bedeutung von Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit in Unternehmen. Darin heißt es bezugnehmend auf eine Stichprobe von 157 Unternehmen, die 2016/2017 analysiert wurde: „In den befragten Unternehmen wird eine Vielzahl von Lerninhalten durch entsprechende Weiterbildungsangebote unterstützt […]. Besonders häufig werden in der betrieblichen Weiterbildung Soft Skills (75 Prozent) sowie Management Skills (74 Prozent) vermittelt.“ Forderungen nach mehr Demut fallen heute - insbesondere in Kombination mit den Worten »Wirtschaft«, »Politik« und »Finanzmarkt« - oft. Und das sicher nicht völlig grundlos, denn in letzter Zeit, so jedenfalls das Empfinden vieler Menschen, scheinen sich gerade in der Wirtschaft doch die Fälle zu häufen, in denen durch Hochmut, Egoismus und kurzsichtiges Gewinnstreben gigantische Wertvernichtung betrieben wird. Das neoliberale2 Credo, dass an jeden gedacht sei, wenn jeder an sich denke (medial bestens verkörpert durch die Figur des Gordon Gekko im Film Wallstreet), ist heute in vielen Milieus verpönt – und das nicht nur bei der politischen Linken. In weiteren Teilen der Gesellschaft gilt heute, dass demonstrativ zur Schau gestellte Bescheidenheit etwas ist, mit dem man punkten kann. Zumindest in Deutschland.3 Sich demütig zu geben, ist gutes Impression-Management