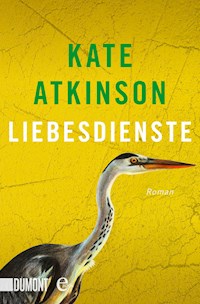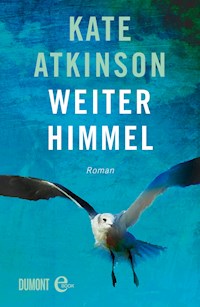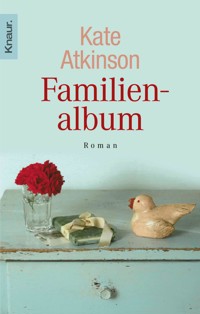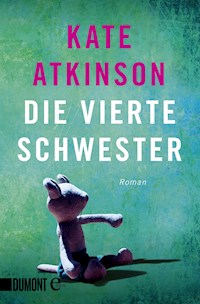
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jackson-Brodie-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Ein Roman mit einem Sog, der eines Thrillers würdig ist.« BRIGITTE In einer heißen Sommernacht verschwindet die kleine Olivia spurlos. Die Familie, deren absoluter Liebling sie war, zerbricht an diesem Unglück. Vor allem für die drei älteren Schwestern dreht sich fortan alles um diesen Verlust und die Beantwortung der Frage nach dem Warum. Dreißig Jahre später taucht Olivias Lieblingsspielzeug wieder auf. Sie beauftragen den Privatdetektiv Jackson Brodie, der jedoch kaum Hoffnung hat, den Fall nach all den Jahren lösen zu können. Für die drei Schwestern ist Olivias Verschwinden das Drama ihres Lebens. All ihre Träume und Sehnsüchte haben sich verflüchtigt, die kleine Schwester dagegen ist allgegenwärtig. Brodie rührt es zu sehen, wie die Frauen um ein normales Leben für sich kämpfen. Er kennt dies nur allzu gut, denn auch er hat seine Schwester auf schreckliche Weise verloren. Pflichtbewusst trägt er seine mageren Ermittlungsergebnisse zusammen – und stößt auf einen Hinweis, der das ganze Ausmaß der Tragödie sichtbar werden lässt. Jackson-Brodie-Reihe: Band 1: Die vierte Schwester (Case Histories) Band 2: Liebesdienste (One Good Turn) Band 3: Lebenslügen (When Will There Be Good News?) Band 4: Das vergessene Kind (Started Early, Took My Dog) Band 5: Weiter Himmel (Big Sky) Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jackson Brodie nimmt den Auftrag an, auch wenn er keine Hoffnung hat, den Fall nach all den Jahren lösen zu können. Für die drei Schwestern ist Olivias Verschwinden das Drama ihres Lebens. All ihre Träume und Sehnsüchte haben sich verflüchtigt, die kleine Schwester dagegen ist allgegenwärtig. Brodie rührt es zu sehen, wie die Frauen um ein normales Leben für sich kämpfen. Er kennt dies nur allzu gut, denn auch er hat seine Schwester auf schreckliche Weise verloren. Pflichtbewusst trägt er seine mageren Ermittlungsergebnisse zusammen – bis er auf einen Hinweis stößt, der das ganze Ausmaß der Tragödie sichtbar werden lässt.
© Helen Clyne
Kate Atkinson, geboren 1951, wurde bereits für ihren ersten Roman ›Familienalbum‹ mit dem renommierten Costa Book of the Year Award ausgezeichnet. Mittlerweile stehen ihre Bücher regelmäßig auf den internationalen Bestsellerlisten. Für ›Das vergessene Kind‹, den vierten Band in der Reihe um den Privatermittler Jackson Brodie, erhielt sie den Deutschen Krimipreis 2012 und für ihren Roman ›Die Unvollendete‹ den Costa Novel Award 2013. Kate Atkinson lebt in Edinburgh und gilt als eine der wichtigsten britischen Autorinnen der Gegenwart.
Kate Atkinson
DIE VIERTE SCHWESTER
Roman
Aus dem Englischen von Anette Grube
Von Kate Atkinson ist bei DuMont außerdem erschienen:
Weiter Himmel
eBook 2021
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2004 by Kate Atkinson
Die englische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel ›Case Histories‹ bei Doubleday, London.
›Case Histories‹ erschien auf Deutsch erstmals 2005 unter dem Titel ›Die vierte Schwester‹ bei Droemer, München.
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Anette Grube
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Foto: Stefanie Naumann
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8321-7078-3
www.dumont-buchverlag.de
Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
1
FALL NR.1, 1970 (VORGESCHICHTE)
Familiengrab
Mussten sie sich nicht glücklich schätzen? Eine Hitzewelle mitten in den Schulferien, genau dort, wo sie hingehört. Jeden Morgen stand die Sonne am Himmel, lange bevor sie aus den Federn waren, verhöhnte die dünnen Vorhänge, die schlaff in den Schlafzimmerfenstern hingen, eine Sonne, die bereits brannte und troff vor Versprechungen, bevor auch nur Olivia die Augen aufschlug. Olivia, so zuverlässig wie ein Hahn, wachte stets als Erste auf, so dass niemand im Haus sich seit ihrer Geburt vor drei Jahren die Mühe machte, einen Wecker zu stellen.
Olivia war die Jüngste und schlief deshalb zurzeit in dem kleinen rückwärtigen Zimmer mit der Tapete mit dem Kinderreim darauf, ein Zimmer, das sie alle einmal belegt hatten und aus dem sie der Reihe nach wieder vertrieben worden waren. Olivia, so niedlich wie ein Kätzchen, darin waren sich alle einig, sogar Julia, die lange gebraucht hatte, um darüber hinwegzukommen, dass sie nicht mehr das Nesthäkchen war, eine Position, die sie vor Olivias Ankunft fünf befriedigende Jahre eingenommen hatte.
Rosemary, ihre Mutter, sagte, sie wünschte, Olivia würde nie älter werden, weil sie so liebenswert sei. Sie hatten nie gehört, dass sie dieses Wort auf eine von ihnen angewandt hätte. Sie hatten nicht einmal gewusst, dass ein Wort wie dieses Bestandteil ihres Vokabulars war, das sich normalerweise auf nervtötende Anweisungen beschränkte – kommt her, geht weg, seid still und – am häufigsten – hört auf. Manchmal tauchte sie in einem Zimmer oder im Garten auf, starrte sie finster an und sagte: Was immer ihr hier tut, hört auf, und dann ging sie wieder, ließ sie in dem Gefühl zurück, ungerecht und schlecht behandelt worden zu sein, auch wenn sie sie auf frischer Tat bei irgendeinem Unfug – normalerweise ausgeheckt von Sylvia – ertappt hatte.
Ihr Geschick, Unheil anzurichten, vor allem unter Sylvias unbekümmerter Führerschaft, kannte offenbar keine Grenzen. Die ältesten drei waren (darin stimmten alle überein) »eine Plage«, vom Alter her zu nahe beieinander, als dass ihre Mutter sie hätte unterscheiden können, und sie wurden zu einem kollektiven Kind, dem sie nur schwerlich individuelle Züge zuschreiben konnte und das sie willkürlich bei einem Namen nannte – Julia-Sylvia-Amelia-wer-immer-du-bist –, in einem ärgerlichen Tonfall, als wäre es die Schuld ihrer Töchter, dass sie so viele waren. Olivia war für gewöhnlich von dieser entnervten Litanei ausgenommen; Rosemary schien sie nie mit den anderen zu verwechseln. Sie waren der Ansicht gewesen, dass Olivia die Letzte wäre, die das kleine rückwärtige Zimmer belegte, und dass eines Tages die Kinderreimtapete schließlich abgekratzt und durch etwas Erwachseneres ersetzt würde (von ihrer zermürbten Mutter, denn ihr Vater behauptete, es sei Geldverschwendung, einen Profi zu engagieren) – Blumen oder vielleicht Ponys, alles wäre besser als das Elastoplastrosa des Zimmers, das Julia und Amelia miteinander teilten, eine Farbe, die den beiden auf der Farbpalette so vielversprechend erschienen war und sich auf den Wänden als so beunruhigend erwiesen hatte und die ihre Mutter nicht überstreichen konnte, weil sie weder die Zeit noch das Geld (und erst recht nicht die Kraft) dafür hatte.
Jetzt stellte sich heraus, dass Olivia sich dem gleichen Übergangsritus wie ihre älteren Schwestern würde unterziehen und die – ziemlich schlecht ausgerichteten – Humpty Dumptys und Little Miss Muffets würde verlassen müssen, um Platz zu schaffen für einen Nachzügler, dessen Ankunft Rosemary am Tag zuvor beiläufig verkündet hatte, als sie im Garten ein notdürftiges Mittagessen aus Corned-Beef-Sandwiches und Orangensaft austeilte.
»War nicht Olivia der Nachzügler?«, sagte Sylvia zu niemandem im Besonderen, und Rosemary runzelte die Stirn, als bemerkte sie ihre älteste Tochter zum ersten Mal. Sylvia, dreizehn und bis vor kurzem ein leicht zu begeisterndes Kind (manche würden sagen übermäßig enthusiastisch), versprach ein sarkastischer und zynischer Teenager zu werden. Die tölpelhafte, Brille tragende Sylvia, deren Zähne seit kurzem in einer hässlichen Spange steckten, hatte fettiges Haar, ein wieherndes Lachen und die langen schlanken Finger und Zehen eines Außerirdischen. Wohlmeinende Menschen nannten sie ein »hässliches Entlein« (sagten es ihr ins Gesicht, als wäre es ein Kompliment; Sylvia fasste es definitiv nicht als solches auf) und stellten sich dabei eine zukünftige Sylvia vor, die ihre Zahnspange abwarf, Kontaktlinsen trug, einen Busen entwickelte und zu einem Schwan erblühte. Rosemary sah den Schwan in Sylvia nicht, vor allem dann nicht, wenn sich ein Stück Corned Beef in ihrer Zahnspange verfangen hatte. Seit geraumer Zeit wurde sie von einer ungesunden religiösen Obsession heimgesucht und behauptete, Gott hätte zu ihr gesprochen. Rosemary fragte sich, ob es sich um eine normale Phase handelte, die pubertierende Mädchen durchliefen, ob Gott schlicht eine Alternative zu Popstars oder Ponys war, und sie beschloss, dass es am besten wäre, Sylvias Tête-à-Têtes mit dem Allmächtigen zu ignorieren. Und zumindest waren Gespräche mit Gott umsonst, während der Unterhalt eines Ponys ein Vermögen gekostet hätte.
Und dann diese sonderbaren Ohnmachtsanfälle, die ihr Hausarzt darauf zurückführte, dass Sylvia »schneller wuchs als ihre Kraft« – eine medizinisch zweifelhafte Erklärung, so es je eine gegeben hatte (Rosemarys Meinung nach). Sie beschloss, die Ohnmachtsanfälle ebenfalls zu ignorieren. Wahrscheinlich versuchte Sylvia damit nur, Aufmerksamkeit zu erregen.
Rosemary hatte den Vater ihrer Kinder, Victor, geheiratet, als sie achtzehn Jahre alt war – nur fünf Jahre älter als Sylvia jetzt. Die Vorstellung, dass Sylvia in fünf Jahren erwachsen genug wäre, um zu heiraten, erschien Rosemary lächerlich und bestärkte sie in dem Glauben, dass ihre eigenen Eltern hätten einschreiten und sie davon abhalten sollen, Victor zu heiraten, sie darauf hätten hinweisen müssen, dass sie noch ein Kind war und er ein sechsunddreißigjähriger Mann. Sie ertappte sich häufig dabei, dass sie ihrer Mutter und ihrem Vater am liebsten Vorwürfe gemacht hätte für ihren Mangel an elterlicher Fürsorge, aber ihre Mutter war kurz nach Amelias Geburt an Magenkrebs gestorben und ihr Vater hatte wieder geheiratet und war nach Ipswich gezogen, wo er die meisten Tage bei den Buchmachern und jeden Abend im Pub verbrachte.
Falls Sylvia in fünf Jahren einen sechsunddreißigjährigen Kindesentführer als Verlobten nach Hause bringen sollte, dann, so glaubte Rosemary, würde sie ihm das Herz mit dem Tranchiermesser herausschneiden (insbesondere wenn er behauptete, ein großer Mathematiker zu sein). Dieser Gedanke war so erfreulich, dass die Ankündigung des Nachzüglers zeitweilig in Vergessenheit geriet und sie den dreien erlaubte, hinauszulaufen auf die Straße zum Wagen des Eisverkäufers, als dieser seine Ankunft klangvoll kundgab.
Das Sylvia-Amelia-Julia-Trio wusste, dass es so etwas wie einen Nachzügler nicht gab und der »Fötus«, wie Sylvia ihn beharrlich nannte (sie interessierte sich für naturwissenschaftliche Fächer), der ihre Mutter so reizbar und lethargisch machte, wahrscheinlich der letzte verzweifelte Versuch ihres Vaters war, einen Sohn zu zeugen. Er war kein Vater, der Töchter liebte, er schien keine von ihnen besonders zu mögen, nur Sylvia gewann gelegentlich seinen Respekt, weil sie »gut in Mathe« war. Victor war Mathematiker und lebte ein hochvergeistigtes Leben, zu dem seine Familie keinen Zutritt hatte. Was ihnen umso leichter fiel, da er kaum Zeit mit ihnen verbrachte: Er war entweder im Institut oder im College, und wenn er zu Hause war, schloss er sich in seinem Arbeitszimmer ein, manchmal mit Studenten, aber meistens allein. Ihr Vater ging nie mit ihnen ins Freibad im Park Jesus Green, spielte nie mit ihnen eine aufregende Partie Schnippschnapp oder Mau-Mau, warf sie nie in die Luft und fing sie wieder auf oder schubste sie auf der Schaukel an, er stakte nie mit ihnen über den Fluss oder wanderte über die Wiesen oder machte mit ihnen einen lehrreichen Ausflug ins Fitzwilliam-Museum. Er war mehr eine Absenz als eine Präsenz, und alles, was er war – und nicht war –, repräsentierte sein sakrosanktes Arbeitszimmer.
Sie wären überrascht gewesen, hätten sie gewusst, dass das Arbeitszimmer einst ein freundliches Wohnzimmer gewesen war, mit Blick auf den Garten hinter dem Haus, ein Zimmer, in dem frühere Bewohner aufs Angenehmste gefrühstückt hatten, in dem die Frauen die Nachmittage mit Nähen und Lesen von Liebesromanen verbrachten und in dem die Familie sich abends versammelte, ein Hörspiel hörte und dabei Karten oder Scrabble spielte. All diese Aktivitäten hatte die frisch verheiratete Rosemary im Kopf, als sie das Haus kauften – 1956, zu einem Preis, der ihre Mittel weit überstieg –, aber Victor beanspruchte den Raum sofort für sich und schaffte es, ihn in einen sonnenlosen Ort zu verwandeln, vollgestopft mit schweren Bücherregalen und hässlichen Aktenschränken aus Eichenholz und nach den filterlosen Capstans stinkend, die er rauchte. Der Verlust des Zimmers war jedoch nichts, verglichen mit dem Verlust des Lebens, mit dem Rosemary es hatte erfüllen wollen.
Was er darin tat, war allen ein Rätsel. Etwas so Bedeutendes, dass sein Familienleben im Vergleich dazu belanglos war. Ihre Mutter behauptete, er sei ein großer Mathematiker und arbeite an etwas, was ihn eines Tages berühmt machen werde, aber bei den seltenen Gelegenheiten, wenn die Tür offen stand und sie einen Blick auf ihren Vater bei der Arbeit werfen konnten, schien er nichts weiter zu tun, als an seinem Schreibtisch zu sitzen und finster ins Leere zu starren.
Wenn er arbeitete, durfte er nicht gestört werden, vor allem nicht von kreischenden, schreienden, wilden kleinen Mädchen. Die vollkommene Unfähigkeit dieser wilden kleinen Mädchen, das Kreischen und Schreien zu unterlassen (ganz zu schweigen vom Brüllen, Plärren und dem seltsamen Wolfsgeheul, das Victor sich beim besten Willen nicht erklären konnte), sorgte für eine prekäre Beziehung zwischen Vater und Töchtern.
Rosemarys Strafpredigten mochten über sie hinwegschwappen wie Wasser, aber der Anblick des aus seinem Arbeitszimmer stapfenden Victors, wie ein aus dem Winterschlaf geweckter Bär, war auf merkwürdige Weise furchterregend, und obwohl sie sich beständig über alles hinwegsetzten, was ihre Mutter untersagte, wäre es ihnen nicht im Traum eingefallen, das verbotene Arbeitszimmer zu erforschen. Sie wurden in die düsteren Tiefen von Victors Höhle nur vorgelassen, wenn sie Hilfe bei den Mathehausaufgaben brauchten. Für Sylvia war es erträglich, denn sie hatte eine reelle Chance, die verschmierten Bleistiftzeichen zu verstehen, mit denen ein ungeduldiger Victor endlose Seiten linierten Papiers bedeckte, aber was Julia und Amelia betraf, so waren ihnen Victors Gekritzel und Symbole so rätselhaft wie uralte Hieroglyphen. Wenn sie an das Arbeitszimmer dachten – und sie vermieden es, daran zu denken –, dann sahen sie eine Folterkammer vor sich. Victor gab Rosemary die Schuld an ihrer mathematischen Inkompetenz – die Mädchen hatten eindeutig das unzulängliche weibliche Gehirn ihrer Mutter geerbt.
Victors Mutter, Ellen, hatte seine frühe Kindheit versüßt, bevor sie 1924 in eine Irrenanstalt eingeliefert wurde. Victor war damals erst vier gewesen, und es wurde für besser befunden, dass er seine Mutter in einer so verstörenden Umgebung nicht besuchte, was zur Folge hatte, dass er sie sich in seiner Kindheit als tobende Wahnsinnige der viktorianischen Art vorstellte – langes, weißes Nachthemd und wildes Haar, durch die Korridore der Anstalt wandernd, wie ein Kind Unsinn vor sich hin plappernd. Erst sehr viel später fand er heraus, dass seine Mutter nicht »toll geworden« (wie die Familie es nannte), sondern in einer schweren Depression versunken war, nachdem sie ein totes Kind auf die Welt gebracht hatte, und weder tobte noch plapperte, sondern traurig und einsam in einem Zimmer lebte, das mit Fotos von Victor geschmückt war, bis sie an Tuberkulose starb, als Victor zehn war.
Oswald, Victors Vater, hatte seinen Sohn zu diesem Zeitpunkt schon in ein Internat gesteckt, und als Oswald aus Versehen in das eisige Wasser des Südpolarmeers fiel und starb, nahm Victor die Nachricht gefasst auf und wandte sich wieder dem besonders schwierigen mathematischen Problem zu, das er gerade bearbeitete.
Vor dem Krieg war Victors Vater ein Exemplar der geheimnisvollsten und nutzlosesten aller englischen Gestalten gewesen, ein Polarforscher, und Victor war froh, dass er nicht länger dem heldenhaften Vorbild von Oswald Land nacheifern musste, sondern in seinem eigenen, weniger heroischen Gebiet selbst Größe erlangen konnte.
Victor lernte Rosemary kennen, als er in die Unfallstation des Addenbrooke-Krankenhauses kam, wo sie als Schwesternschülerin arbeitete. Er war ein paar Stufen hinuntergestolpert und ungeschickt auf sein Handgelenk gefallen, aber Rosemary erzählte er, dass er Fahrrad gefahren und auf der Newmarket Road von einem Auto »geschnitten« worden sei. »Geschnitten« klang gut in seinen Ohren, es war ein Ausdruck aus der maskulinen Welt, in der er sich niemals würde erfolgreich einrichten können (die Welt seines Vaters), und »Newmarket Road« implizierte (nicht der Wahrheit entsprechend), dass er nicht sein ganzes Leben zurückgezogen in dem begrenzten Areal zwischen St.John’s College und dem Mathematikinstitut verbrachte.
Hätte diese zufällige, in jeder Beziehung fatale Begegnung im Krankenhaus nicht stattgefunden, hätte Victor vielleicht nie ein Mädchen hofiert. Er meinte, sich bereits den mittleren Jahren zu nähern, und sein soziales Leben beschränkte sich noch immer auf den Schachclub. Victor empfand nicht wirklich das Bedürfnis nach einer anderen Person in seinem Leben, ja, er fand die Vorstellung, ein Leben mit jemandem »zu teilen«, bizarr. Er hatte die Mathematik, die fast seine ganze Zeit beanspruchte, deswegen wusste er nicht genau, was er mit einer Frau anfangen sollte. Frauen schienen alle möglichen unerwünschten Eigenschaften zu besitzen, vor allem die Neigung zum Wahnsinn, aber auch eine Vielzahl von körperlichen Mängeln – Blut, Sex, Kinder –, die beunruhigend und anders waren. Doch irgendetwas in ihm sehnte sich danach, von der Betriebsamkeit und der Wärme umgeben zu sein, die seiner Kindheit gefehlt hatten, und so fand er sich, bevor er überhaupt wusste, wie ihm geschah, als hätte er die Tür zu einem falschen Zimmer geöffnet, Tee trinkend in einem kleinen Häuschen im ländlichen Norfolk wieder, wo Rosemary ihren Eltern schüchtern einen (ziemlich billigen) Verlobungsring mit einem Brillantsplitter vorführte.
Abgesehen von den schnurrbärtigen Gute-Nacht-Wünschen ihres Vaters war Victor der erste Mann, der Rosemary küsste (wenn auch tölpelhaft, er stürzte sich auf sie wie ein See-Elefant). Rosemarys Vater, ein Stellwärter bei der Eisenbahn, und ihre Mutter, eine Hausfrau, waren erstaunt, als sie Victor mit nach Hause brachte. Seine unzweifelhaften intellektuellen Referenzen (die schwarz gefasste Brille, die schäbige Sportjacke, die permanente Zerstreutheit) flößten ihnen Ehrfurcht ein, ebenso die Möglichkeit, dass er ein echtes Genie sein könnte (eine Möglichkeit, die Victor nicht von der Hand wies), ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er sich für ihre Tochter als Gefährtin fürs Leben entschieden hatte – ein stilles, leicht zu beeinflussendes Mädchen, das bislang von nahezu allen übersehen worden war.
Dass er doppelt so alt war wie Rosemary, schien sie überhaupt nicht zu beunruhigen, obschon Rosemarys Vater, ein sehr männlicher Mann, später, nachdem das glückliche Paar wieder aufgebrochen war, seiner Frau gegenüber erwähnte, dass Victor nicht gerade »ein Paradeexemplar von einem Mann« sei. Der einzige Vorbehalt von Rosemarys Mutter bestand darin, dass Victor, obwohl er Doktor war, sich schwer getan hatte, ihr einen Rat bezüglich der Magenschmerzen zu geben, die sie peinigten. An einem mit einem maltesischen Spitzentuch bedeckten und mit Makronen, Teegebäck und Kümmelkuchen beladenen Tisch in die Enge getrieben, meinte Victor schließlich: »Verdauungsprobleme, nehme ich an, Mrs.Vane«, eine Fehldiagnose, die sie erleichtert akzeptierte.
Olivia schlug die Augen auf und starrte zufrieden auf die Tapete mit den Kinderreimen. Jack und Jill quälten sich endlos den Berg hinauf, Jill trug den hölzernen Eimer für den Brunnen, den sie nie erreichen sollte, während an einer anderen Stelle des Berges Little Bo-Peep nach ihren verlorenen Schafen suchte. Olivia sorgte sich nicht sonderlich um das Schicksal der Herde, weil sie ein hübsches Lämmchen mit einem blauen Band um den Hals sah, das sich hinter einer Hecke versteckte. Olivia verstand die Sache mit dem Nachzügler nicht wirklich, aber ein Baby wäre ihr recht. Sie mochte Babys und Tiere mehr als alles andere. Sie spürte das Gewicht von Rascal, dem Terrier der Familie, neben ihren Füßen. Es war strikt verboten, dass Rascal in den Kinderzimmern schlief, aber jede Nacht schmuggelte die eine oder andere ihn in ihr Zimmer, und bis zum Morgen hatte er für gewöhnlich den Weg zu Olivia gefunden.
Olivia schüttelte sanft Blaue Maus, um sie zu wecken. Blaue Maus war ein schlaffes, schlaksiges Tier aus Frottee. Sie war Olivias Orakel, und Olivia befragte sie beständig zu allem und jedem.
Ein heller Streifen Sonnenlicht wanderte langsam über die Wand, und als er das Lämmchen hinter der Hecke erreichte, stand Olivia auf und steckte die Füße artig in die kleinen rosa Schlappen mit den Kaninchengesichtern und den Kaninchenohren, die Julia unbedingt haben wollte. Keine der anderen zog je ihre Hausschuhe an, und derzeit war es so heiß, dass Rosemary sie nicht einmal mehr dazu bringen konnte, überhaupt Schuhe zu tragen, aber Olivia war ein gefügiges Kind.
Rosemary lag in ihrem Bett, wach, aber mit Gliedern, die sie kaum bewegen konnte, als hätte sich das Mark in ihren Knochen in Blei verwandelt, und versuchte, einen Plan zu schmieden, der verhindern würde, dass die drei anderen Olivias gutes Benehmen korrumpierten. Das neue Baby verursachte Rosemary Übelkeit, und sie dachte, wie wunderbar es doch wäre, wenn Victor plötzlich aus seinem schnarchschweren Schlaf erwachte und zu ihr sagte: »Soll ich dir etwas bringen, Liebes?« Und sie würde sagen: »O ja, bitte, ich möchte Tee – ohne Milch – und eine Scheibe Toast, leicht gebuttert, danke, Victor.« Man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen …
Wenn sie nur nicht so fruchtbar wäre. Sie konnte die Pille nicht nehmen, weil sie mit hohem Blutdruck darauf reagierte, sie hatte es mit einer Spirale versucht, aber die blieb nicht an Ort und Stelle, und den Gebrauch von Kondomen betrachtete Victor als Angriff auf seine Männlichkeit. Sie war seine Zuchtstute. Das einzig Gute an der Schwangerschaft war, dass sie keinen Sex mit Victor ertragen musste. Sie behauptete, Sex wäre schlecht für das Baby, und er glaubte ihr, weil er keine Ahnung hatte – keine Ahnung von Babys oder Frauen oder Kindern, keine Ahnung vom Leben. Sie war Jungfrau gewesen, als sie ihn heiratete, und von der einwöchigen Hochzeitsreise nach Wales kehrte sie unter Schock stehend zurück. Damals hätte sie ihn selbstverständlich auf der Stelle verlassen sollen, aber Victor hatte bereits begonnen, sie auszulaugen. Manchmal fühlte sie sich, als würde er sie aussaugen.
Wenn sie die Kraft gehabt hätte, wäre sie aufgestanden und ins »Gästezimmer« geschlichen, hätte sich auf das harte, schmale Bett mit dem gänseblümchenfrischen, fest unter die Matratze geschobenen Laken gelegt. Das Gästezimmer war wie eine Luftblase im Haus, niemand außer ihr durfte dort atmen, der Teppich wurde nicht von unbedachten Füßen abgetreten. Es spielte keine Rolle, wie viele Babys sie bekam, sie konnte Jahr für Jahr eins werfen wie eine Kuh (obschon sie sich umbringen würde, wenn sie es täte), aber keins von ihnen würde je den makellosen Raum des Gästezimmers in Besitz nehmen. Es war sauber, es war unberührt, es gehörte ihr.
Der Dachboden wäre noch besser. Sie könnte Dielen legen und die Wände weiß streichen und eine Falltür einbauen lassen. Dann könnte sie hinaufsteigen, die Falltür zuziehen wie eine Zugbrücke, und niemand würde sie finden. Rosemary stellte sich vor, wie ihre Familie von Raum zu Raum ging, ihren Namen rief, und musste lachen. Victor ächzte im Schlaf. Aber dann dachte sie an Olivia, die durch das Haus wandern und sie nicht finden würde, und sie bekam Angst, es war wie ein Hieb in die Brust. Sie würde Olivia auf den Dachboden mitnehmen müssen.
Victor befand sich in dem Stadium zwischen Wachen und Schlafen, ein Ort, unbefleckt von den galligen Gefühlen seines alltäglichen Lebens, das er in einem Haus voller Frauen verbrachte, die Fremde für ihn waren.
Olivia, den Daumen im Mund und Blaue Maus in die Ellbogenbeuge geklemmt, tapste über den Flur in Julias und Amelias Zimmer und kletterte zu Julia ins Bett. Julia träumte wild. Das zerzauste Haar klebte ihr schweißnass am Kopf, ihre Lippen bewegten sich unablässig und murmelten unverständlich, während sie mit einem unsichtbaren Ungeheuer kämpfte. Julia war eine unruhige Schläferin: Sie redete und wandelte im Schlaf, sie zerwühlte die Laken und wachte auf dramatische Weise auf, starrte mit aufgerissenen Augen auf ein Phantasiebild, das verschwunden war, bevor sie es festhalten konnte. Manchmal war ihr Schlaf so opernhaft, dass sie einen Asthmaanfall heraufbeschwor und in Todesangst erwachte. Julia konnte eine sehr lästige Person sein, meinten Amelia und Sylvia übereinstimmend; sie hatte eine verwirrend quecksilbrige Persönlichkeit – trat und schlug in einem Augenblick zu und gurrte und küsste scheinheilig im nächsten. Als sie kleiner gewesen war, hatte sie die wüstesten Tobsuchtsanfälle, und auch jetzt verging kaum ein Tag, an dem sie nicht wegen irgendetwas einen hysterischen Anfall hatte und beleidigt aus dem Zimmer rauschte. Normalerweise lief ihr Olivia nach und versuchte, sie zu trösten, während alle anderen ungerührt blieben. Olivia schien zu begreifen, dass Julia nichts weiter als Aufmerksamkeit wollte (allerdings schrecklich viel).
Olivia zupfte am Ärmel von Julias Nachthemd, um sie zu wecken, ein Vorgang, der stets längere Zeit in Anspruch nahm. Im Bett daneben war Amelia bereits wach, hielt jedoch die Augen geschlossen, um den letzten Tropfen Schlaf zu genießen. Und außerdem wusste sie, dass Olivia, wenn sie sich schlafend stellte, zu ihr ins Bett kriechen und sich wie ein Äffchen an sie klammern würde, ihre sonnengebräunte Haut heiß und trocken auf ihrer eigenen, der schwammartige Körper von Blaue Maus zwischen ihnen.
Bis zu Olivias Geburt hatte sich Amelia ein Zimmer mit Sylvia geteilt, was trotz vieler Nachteile eindeutig einem gemeinsamen Zimmer mit Julia vorzuziehen war. Amelia fühlte sich zwischen den präzise definierten polaren Gegensätzen von Sylvia und Julia gestrandet, unbestimmt und substanzlos. Gleichgültig, wie viele Nachzügler es geben würde, sie spürte, dass sie immer irgendwo in der Mitte verloren wäre. Amelia war ein nachdenklicheres Mädchen als Sylvia und ein Bücherwurm. Sylvia zog Aufregung geordneten Verhältnissen vor (weshalb sie laut Victor nie eine große Mathematikerin werden würde, sondern lediglich eine hinreichende). Sylvia war natürlich verrückt. Sie hatte Amelia erzählt, dass Gott (ganz zu schweigen von Jeanne d’Arc) zu ihr gesprochen hätte. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Gott zu jemandem sprechen sollte, schien Sylvia nicht die erste Wahl.
Sylvia liebte Geheimnisse, und auch wenn sie keine Geheimnisse hatte, sorgte sie dafür, dass man glaubte, sie hätte welche. Amelia hatte keine Geheimnisse, Amelia wusste nichts. Sie hatte vor, wenn sie groß war, alles zu wissen und alles geheim zu halten.
Bedeutete die Ankunft des Nachzüglers, dass ihre Mutter sie in einer anderen willkürlichen Zusammensetzung herumjonglieren würde? Mit wem würde Olivia ein Zimmer teilen? Früher hatten sie gestritten, in wessen Bett der Hund schlafen durfte, jetzt stritten sie sich um Olivias Zuneigung. Insgesamt gab es fünf Schlafzimmer, aber eins galt als Gästezimmer, obwohl sich keine von ihnen daran erinnern konnte, dass jemals ein Gast im Haus übernachtet hätte. Jetzt sprach ihre Mutter davon, den Dachboden auszubauen. Amelia gefiel der Gedanke, ein Zimmer auf dem Dachboden zu haben, fort von allen anderen. Sie stellte sich eine Wendeltreppe und weiß gestrichene Wände vor und ein weißes Sofa, einen weißen Teppich, und in den Fenstern hingen durchscheinende weiße Gardinen. Wenn sie erwachsen und verheiratet wäre, wollte sie ein einziges Kind, ein einziges vollkommenes Kind (das genauso wäre wie Olivia), und in einem weißen Haus leben. Wenn sie sich den Mann vorzustellen versuchte, der mit ihr in diesem weißen Haus leben würde, konnte sie nur einen verschwommenen Fleck heraufbeschwören, den Schatten eines Mannes, der auf der Treppe und im Flur an ihr vorbeiging und sie höflich murmelnd grüßte.
Als Olivia alle geweckt hatte, war es fast halb acht. Sie waren selbst für ihr Frühstück zuständig, abgesehen von Olivia, die auf ein Kissen gesetzt wurde und von Amelia mit Haferflocken und Milch und von Julia mit Toaststücken gefüttert wurde. Olivia gehörte ihnen, sie war ihr Lämmchen, weil ihre Mutter von dem Nachzügler erschöpft und ihr Vater ein großer Mathematiker war.
Julia, die sich mit Essen vollstopfte (Rosemary schwor, dass sich in Julia ein Labrador versteckte), schaffte es, sich mit dem Brotmesser zu schneiden, wurde jedoch daran gehindert, zu heulen und ihre Eltern zu wecken, indem Sylvia ihr die Hand vor den Mund hielt wie eine Chirurgenmaske. Ein blutiger Unfall pro Tag war die Norm. Sie waren die unfallträchtigsten Kinder der Welt, gemäß ihrer Mutter, die endlose Fahrten mit ihnen ins Addenbrooke auf sich nehmen musste – Amelia, die sich beim Radschlagen den Arm brach, Sylvia, die sich den Fuß verbrühte (als sie versuchte, eine Wärmflasche zu füllen), Julia, die sich die Lippe spaltete (als sie vom Garagendach sprang), noch einmal Julia, die durch eine Glastür lief – unter den verblüfften und ungläubigen Blicken von Amelia und Sylvia (wie konnte sie sie nicht sehen?), und natürlich Sylvia mit ihren merkwürdigen Ohnmachtsanfällen – von der Vertikalen ohne Vorwarnung in die Horizontale, ihre Haut blutleer, ihre Lippen trocken –, eine Inszenierung des Todes, verraten nur durch ein leichtes Beben der Augenlider.
Olivia war die Einzige, die gegen diese kollektive Tollpatschigkeit immun war und sich während ihres dreijährigen Lebens nichts Schlimmeres als ein paar blaue Flecke zugezogen hatte. Was die anderen anbelangte, so meinte ihre Mutter, dass sie besser ihre Schwesternausbildung beendet hätte, angesichts der vielen Zeit, die sie im Krankenhaus verbrachte.
Am aufregendsten war natürlich der Tag, an dem sich Julia einen Finger abschnitt (Julia schien sich zu scharfen Gegenständen hingezogen zu fühlen). Julia, damals fünf Jahre alt, schlenderte unbemerkt von ihrer Mutter in die Küche, und Rosemary wurde auf den amputierten Finger erst aufmerksam, als sie im aggressiven Karottenschneiden innehielt, sich umdrehte und eine geschockte Julia sah, die in sprachlosem Staunen die Hand hochhielt und ihre Wunde zur Schau stellte wie ein heiliges Märtyrerkind. Rosemary warf ein Geschirrtuch über die blutige Hand, packte Julia und rannte zu einer Nachbarin, die sie mit hysterisch kreischenden Bremsen ins Krankenhaus fuhr. Sylvia und Amelia blieb das Problem überlassen, was sie mit dem winzigen bleichen Finger tun sollten, der in der Küche auf dem Linoleum liegen geblieben war.
(Die stets einfallsreiche Sylvia warf den Finger in eine Tüte mit gefrorenen Erbsen, Sylvia und Amelia fuhren mit dem Bus ins Krankenhaus, und Sylvia drückte unterwegs die Tüte an sich, als hinge Julias Leben von den auftauenden Erbsen ab.)
Ihr erstes Vorhaben an diesem Tag bestand darin, am Fluss entlang nach Grantchester zu gehen. Seit Beginn der Ferien hatten sie diesen Ausflug mindestens zweimal wöchentlich gemacht. Wenn Olivia müde wurde, trugen sie sie huckepack. Es war ein Abenteuer, das fast den ganzen Tag in Anspruch nahm, weil es so viel zu erforschen galt – am Ufer des Flusses, auf den Wiesen, sogar in den Gärten anderer Leute.
Rosemarys einzige Ermahnung lautete: Badet nicht im Fluss, aber sie brachen jedes Mal mit den Badeanzügen versteckt unter den Kleidern und Shorts auf, und kaum ein Ausflug ging vorüber, ohne dass sie sich ausgezogen hätten und in den Fluss gesprungen wären. Sie waren dem Nachzügler dankbar, weil er ihre üblicherweise achtsame Mutter in einen höchst sorglosen Vormund verwandelt hatte. Kein anderes Kind, das sie kannten, führte in diesem Sommer eine so riskante Existenz wie sie.
Ein- oder zweimal gab Rosemary ihnen Geld mit, damit sie nachmittags in den Orchard Tea Rooms einkehren könnten (wo sie nicht zu den beliebtesten Gästen zählten), doch meistens nahmen sie ein hastig zusammengestelltes Picknick mit, das sie regelmäßig verspeisten, bevor sie Newnham hinter sich gelassen hatten. Aber nicht so heute, heute hatte sich die Sonne noch näher an Cambridge herangeschoben und hielt sie im Garten fest. Sie versuchten, energiegeladen zu sein, spielten halbherzig Verstecken, aber niemand fand ein gutes Versteck.
Sogar Sylvia gab sich mit nichts Einfallsreicherem als dem Nest aus Timotheusgras hinter den Johannisbeersträuchern am Ende des Gartens zufrieden – Sylvia, die sich einst versteckt hatte und die Rekordzeit von drei Stunden unentdeckt geblieben war (ausgestreckt wie ein Faultier auf einem hohen, glatten Ast der Buche in Mrs.Rains Garten gegenüber) und erst gefunden wurde, nachdem sie schlafend vom Baum gefallen war und sich beim Aufprall auf dem Boden einen Knickbruch im Arm zugezogen hatte. Ihre Mutter hatte eine gewaltige Auseinandersetzung mit Mrs.Rain, die Sylvia wegen unbefugten Betretens ihres Grundstücks verhaften lassen wollte (blöde Kuh). Sie schlichen sich oft in Mrs.Rains Garten, klauten die sauren Äpfel von ihren Bäumen und spielten ihr Streiche, weil sie eine Hexe war und es deshalb verdiente, schlecht behandelt zu werden.
Nach einem apathischen Mittagessen bestehend aus Thunfischsalat begannen sie, Rundball zu spielen, aber Amelia stolperte und hatte Nasenbluten, und dann zankten sich Sylvia und Julia, was damit endete, dass Sylvia Julia ohrfeigte, und schließlich waren sie es zufrieden, Gänseblümchenketten zu machen, die sie in Olivias Haar flochten und Rascal um den Hals hängten. Bald war auch das zu anstrengend, und Julia kroch in den Schatten unter den Hortensienbüschen, wo sie neben dem Hund einschlief, während Sylvia sich mit Olivia und Blaue Maus ins Zelt setzte und ihnen vorlas. Das Zelt, ein uraltes Ding, das die früheren Bewohner des Hauses im Schuppen zurückgelassen hatten, stand seit dem Beginn der Schönwetterperiode auf dem Rasen, und sie wetteiferten miteinander um den Platz unter den verschimmelten Leinwandbahnen, wo es noch heißer und luftloser war als im Garten. Innerhalb von Minuten waren Sylvia und Olivia eingeschlafen, das Buch vergessen.
Amelia lag verträumt und träge von der Hitze auf dem Rücken im heißen, verbrannten Gras und starrte empor in das endlose, wolkenlose Blau, in das nur die riesigen, wie Unkraut im Garten wachsenden Stockrosen ragten. Sie beobachtete die tollkühnen, auf- und abtauchenden Schwalben und horchte auf das angenehme Summen und Brummen der Insektenwelt. Ein Marienkäfer kroch über die sommersprossige Haut ihres Arms. Ein Heißluftballon schwebte gemächlich vorüber, und sie wünschte, sie brächte die Energie auf, um Sylvia zu wecken und ihr davon zu berichten.
Rosemarys Blut floss im Schneckentempo durch ihre Adern. Sie trank ein Glas Leitungswasser an der Küchenspüle und sah aus dem Fenster in den Garten. Ein Heißluftballon flog über den Himmel, bewegte sich wie ein Vogel in der Thermik. Ihre Kinder schienen allesamt zu schlafen. In dieser ungewohnten Stille verspürte sie eine unerwartete Zuneigung zu dem Baby in ihrem Bauch aufwallen. Wenn alle immer schlafen würden, hätte sie nichts dagegen, ihre Mutter zu sein. Außer Olivia, Olivia sollte nicht die ganze Zeit schlafen.
Als Victor ihr vor vierzehn Jahren einen Heiratsantrag machte, hatte Rosemary keine Ahnung, wie das Leben der Frau eines Collegedozenten aussehen würde, aber sie stellte sich vor, dass sie »Tageskleider« (wie ihre Mutter sie nannte) tragen und zu Gartenpartys am Flussufer gehen und elegant über das üppige Grün der Höfe schlendern würde, während die Leute murmelten: »Das ist die Frau des berühmten Victor Land, ohne sie wäre er nichts.« Selbstverständlich stellte sich heraus, dass das Leben der Frau eines Collegedozenten nichts mit ihren Vorstellungen gemein hatte. Es gab keine Gartenpartys am Flussufer und ganz gewiss kein Schlendern über die Collegehöfe, in denen das Gras die Verehrung erfuhr, wie sie normalerweise religiösen Gerätschaften zuteil wird.
Kurz nach ihrer Heirat war sie mit Victor in den Garten des Rektors eingeladen, wo bald augenfällig wurde, dass Victors Kollegen der Ansicht waren, er hätte (schrecklich weit) unter seinem Stand geheiratet (»Eine Krankenschwester«, flüsterte jemand auf eine Weise, als handele es sich um einen Beruf, der kaum achtbarer war als Straßenmädchen). Es stimmte, Victor wäre nichts ohne sie, aber auch mit ihr war er nichts. In diesem Augenblick plagte er sich in der kühlen Dunkelheit seines Arbeitszimmers ab, die schweren Chenille-Vorhänge gegen die Sommerhitze zugezogen, vertieft in seine Arbeit, Arbeit, die keine Früchte trug, die die Welt nicht veränderte und ihm keinen Namen einbrachte. Er war keine Koryphäe auf seinem Gebiet, sondern lediglich gut. Das verschaffte ihr eine gewisse Befriedigung.
Große mathematische Entdeckungen machte man vor dem dreißigsten Lebensjahr, das war ihr jetzt klar, dank eines Kollegen von Victor. Rosemary war erst zweiunddreißig – sie konnte nicht glauben, wie jung das klang und wie alt es sich anfühlte.
Sie vermutete, dass Victor sie geheiratet hatte, weil er glaubte, sie wäre häuslich – wahrscheinlich hatte er sich vom beladenen Tisch ihrer Mutter täuschen lassen, denn Rosemary hatte nie auch nur einen einfachen Kuchen gebacken, als sie noch zu Hause lebte –, und da sie Krankenschwester war, nahm er zweifellos an, dass sie eine fürsorgliche und aufopfernde Frau war – und damals mochte auch sie dieser Ansicht gewesen sein, aber heutzutage fühlte sie sich nicht in der Lage, auch nur ein Kätzchen zu versorgen, geschweige denn vier, bald fünf Kinder und erst recht nicht einen großen Mathematiker.
Zudem vermutete sie, dass das große Werk ein Schwindel war. Sie sah die Papiere auf seinem Schreibtisch, wenn sie in diesem Loch Staub wischte, und seine Berechnungen ähnelten den intensiven Kalkulationen von Rennverläufen und Gewinnchancen, die ihr Vater anstellte. Victor kam ihr nicht wie ein Spieler vor. Ihr Vater war ein Spieler und hatte ihre Mutter damit in die Verzweiflung getrieben. Sie erinnerte sich, mit ihm als Kind einmal in Newmarket gewesen zu sein. Sie standen neben der Start-Ziel-Linie, und er setzte sie auf seine Schultern. Der Krach der auf der Zielgeraden herandonnernden Pferde machte ihr Angst, und die Zuschauer drehten durch, als würde die Welt untergehen und nicht ein 30:1-Außenseiter mit einer knappen Kopflänge gewinnen. Rosemary konnte sich Victor weder an einem so lebhaften Ort wie einer Pferderennbahn noch in dem verrauchten Chaos eines Wettbüros vorstellen.
Julia kroch unter den Hortensien hervor, verdrossen vor Hitze. Wie sollte Rosemary sie wieder in englische Schulkinder verwandeln, wenn das neue Schuljahr begann? Das Leben im Freien hatte Zigeunerinnen aus ihnen gemacht, ihre Haut braun und verkratzt, ihr sonnenversengtes Haar dick und zerzaust, und sie schienen beständig schmutzig zu sein, gleichgültig, wie oft sie sich wuschen. Eine verschlafene Olivia stand vor dem Zelteingang, und Rosemary verspürte einen kleinen Stich im Herzen. Olivias Gesicht wirkte ungewaschen, ihre gebleichten Zöpfe hingen schief, und es sah aus, als wären tote Blumen hineingeflochten. Sie flüsterte Blaue Maus ein Geheimnis ins Ohr. Olivia war ihr einziges schönes Kind. Julia mit ihren dunklen Locken und der Stupsnase war hübsch, ihr Charakter war es nicht. Sylvia – arme Sylvia, was gab es da zu sagen? Und Amelia war irgendwie … langweilig. Aber Olivia, Olivia bestand aus Licht. Es schien unmöglich, dass sie Victors Kind war, obwohl bedauerlicherweise kein Zweifel daran bestand. Olivia war die Einzige, die sie liebte, obschon Gott wusste, dass sie ihr Bestes tat, um auch die anderen zu lieben. Aber sie tat alles aus Pflichtgefühl, nichts aus Liebe. Die Pflicht brachte einen am Ende um.
Es war ganz und gar nicht richtig, es war, als hätte sie die Liebe, die sie für die anderen empfinden sollte, auf Olivia übertragen, so dass sie ihr jüngstes Kind mit einer Leidenschaft liebte, die nicht immer natürlich schien. Manchmal wollte sie Olivia fressen, in einen zarten Unterarm oder einen weichen Wadenmuskel beißen, ja, sie wie eine Schlange ganz verschlingen und sie wieder in sich aufnehmen, wo sie sicher wäre. Sie war eine schreckliche Mutter, daran gab es keinen Zweifel, aber sie hatte nicht einmal genug Kraft, sich deswegen schuldig zu fühlen. Olivia entdeckte sie und winkte.
Abends hatten sie keinen Appetit und stocherten in dem winterlichen Lammeintopf herum, den zu kochen Rosemary so viel Zeit gekostet hatte. Victor kam, blinzelte im Tageslicht wie ein Höhlenbewohner, aß seinen Teller leer und bat um mehr, und Rosemary fragte sich, wie er aussehen würde, wenn er tot wäre. Sie schaute zu, wie er aß, die Gabel in einem roboterhaften Rhythmus hob und senkte, seine Hände, so groß wie Paddel, um das Besteck geschlungen. Er hatte die Hände eines Bauern, das war ihr mit als Erstes an ihm aufgefallen. Ein Mathematiker sollte schlanke, elegante Hände haben. Sie hätte es seinen Händen ansehen müssen. Ihr war schlecht, und sie hatte Krämpfe. Vielleicht würde sie das Baby verlieren. Was für eine Erleichterung das wäre.
Rosemary stand unvermittelt vom Tisch auf und verkündete: Schlafenszeit. Normalerweise hätte es Widerstand gegeben, aber Julias Atem ging schwer, und ihre Augen waren rot von zu viel Sonne und Gras – sie hatte alle möglichen sommerlichen Allergien –, und Sylvia schien eine Art Sonnenstich zu haben, ihr war schlecht und zum Weinen, und sie sagte, der Kopf täte ihr weh, aber das hielt sie nicht davon ab, hysterisch zu werden, als Rosemary sie früh ins Bett schickte.
Fast jeden Abend hatten die ältesten drei sie in diesem Sommer gefragt, ob sie draußen im Zelt schlafen dürften, und jeden Abend antwortete Rosemary mit Nein und erklärte, es sei schlimm genug, dass sie aussähen wie Zigeunerinnen, sie müssten nicht auch noch wie Zigeuner leben, und es spiele keine Rolle, dass Zigeuner in Wohnwagen lebten – wie Sylvia nicht müde wurde, klarzustellen. Rosemary tat ihr Bestes, nicht die Kontrolle über ihre Familie zu verlieren, auch wenn kaum Aussicht auf Erfolg bestand mit einem Mann, der bei den täglichen Anforderungen der Mahlzeiten, der Hausarbeit und der Erziehung der Kinder keine Hilfe war und der sie nur geheiratet hatte, um jemanden zu haben, der ihn versorgte. Und sie fühlte sich noch schlechter, als Amelia sagte: »Geht’s dir nicht gut, Mami?«, denn Amelia war die am meisten Vernachlässigte von allen. Weshalb Rosemary seufzte, zwei Paracetamol und eine Schlaftablette nahm – wahrscheinlich ein tödlicher Cocktail für das Baby in ihrem Bauch – und zu ihrem am häufigsten vergessenen Kind sagte: »Wenn du willst, kannst du heute Nacht mit Olivia im Zelt schlafen.«
Es war aufregend, aufzuwachen und von taunassem Gras und dem Geruch von Leinwand umgeben zu sein – auf jeden Fall besser als Julias Atem, der über Nacht immer sauer zu werden schien. Olivias undefinierbarer Duft war gerade noch wahrnehmbar. Amelia ließ die Augen gegen das Licht geschlossen. Die Sonne schien schon hoch am Himmel zu stehen, und sie wartete darauf, dass Olivia sie weckte und unter das alte Federbett kroch, das als Schlafsack diente, aber es war Rascal und nicht Olivia, der sie schließlich weckte, indem er ihr das Gesicht leckte.
Von Olivia war nichts zu sehen, nur die leere Hülle der Bettdecke, als wäre sie herausgezogen worden, und Amelia war enttäuscht, dass Olivia aufgestanden war, ohne sie zu wecken. Sie ging barfuß über das taunasse Gras – Rascal folgte ihr auf den Fersen – und versuchte, die Hintertür zu öffnen, die jedoch verschlossen war – offenkundig hatte ihre Mutter nicht daran gedacht, Amelia einen Schlüssel zu geben. Was sind das für Eltern, die ihre eigenen Kinder aussperren?
Alles war still, und es schien noch früh zu sein, aber Amelia wusste nicht wirklich, wie spät es war. Sie fragte sich, ob Olivia irgendwie ins Haus gelangt sein konnte, weil sie im Garten nicht zu finden war. Sie rief ihren Namen und erschrak, als sie das Zittern in ihrer Stimme hörte; ihr war nicht klar gewesen, dass sie sich Sorgen machte, bis sie sich hörte. Lange Zeit klopfte sie an die Hintertür, aber niemand öffnete, und dann lief sie den Weg am Haus entlang – das kleine Gartentor stand offen, ein Grund mehr zur Beunruhigung für Amelia – und auf die Straße, wo sie erneut, lauter »Olivia!« rief. Rascal, der sich Spaß erhoffte, begann zu bellen.
Die Straße war leer, abgesehen von einem Mann, der in sein Auto stieg. Er warf Amelia einen neugierigen Blick zu. Sie war barfuß und trug einen von Sylvia geerbten Schlafanzug und nahm an, dass sie merkwürdig aussah, aber das war jetzt kaum von Bedeutung. Sie lief zur Vordertür und klingelte, drückte den Finger auf den Knopf, bis – ausgerechnet – ihr Vater die Tür aufriss. Sie hatte ihn offensichtlich geweckt, sein Gesicht war so zerknittert wie sein Schlafanzug, sein wirres Haar stand nach allen Seiten vom Kopf ab, er starrte sie wütend an, als hätte er keinen blassen Schimmer, wer sie war. Und als er sie als eine seiner Töchter erkannte, war er noch verwirrter.
»Olivia«, sagte sie, und diesmal war ihre Stimme nur noch ein Flüstern.
Am Nachmittag spaltete ein Blitz den tief hängenden Himmel über Cambridge und kündigte das Ende der Hitzewelle an. Zu diesem Zeitpunkt war das Zelt im Garten der Mittelpunkt eines Kreises, der im Verlauf des Tages größer und größer geworden war und immer mehr Leute in sich hineingezogen hatte – zuerst die Lands, die durch die Straßen liefen, durch Unterholz und Hecken krochen und Olivias Namen schrien, bis sie heiser waren. Mittlerweile war die Polizei an der Suche beteiligt, und Nachbarn kontrollierten ihre Gärten, Keller und Schuppen. Der Kreis wurde größer, als Polizeitaucher den Fluss absuchten und völlig fremde Menschen freiwillig Wiesen und Wälder durchforsteten. Polizeihubschrauber überflogen bis zu den Grenzen der Grafschaft Dörfer und Felder, Lastwagenfahrer waren dazu aufgerufen, die Augen auf den Autobahnen offen zu halten, und die Armee durchkämmte die Moore, aber niemand – weder Amelia, die im Garten heulte, bis ihr schlecht war, noch die Soldaten, die im Regen auf Händen und Knien über den Midsummer Common krochen – fand eine Spur von Olivia, kein Haar, keine Hautschuppe, keinen rosa Kaninchenschuh und keine blaue Maus.
2
FALL NR.2, 1994 (VORGESCHICHTE)
Ein ganz normaler Tag
Theo versuchte, häufiger zu Fuß zu gehen. Er war jetzt offiziell »krankhaft fettleibig«, laut seiner neuen mitleidslosen Allgemeinärztin. Theo wusste, dass die neue mitleidslose Allgemeinärztin – eine junge Frau mit einem sehr kurzen Haarschnitt und einer sorglos in einer Ecke der Praxis abgelegten Sporttasche – den Ausdruck benutzte, um ihm Angst einzujagen. Theo hatte sich bislang nicht als »krankhaft fettleibig« betrachtet, sondern als fidel übergewichtig, als eine runde Nikolausgestalt, und er hätte den Rat der Ärztin ignoriert, aber als er nach Hause kam und seiner Tochter Laura von dem Gespräch in der Praxis erzählte, war sie entsetzt und entwarf auf der Stelle einen Trainingsplan und eine Diät für ihn, weswegen er jetzt Spreu mit Magermilch zum Frühstück aß und jeden Morgen die drei Kilometer zu seinem Büro in Parkside zu Fuß ging.
Theos Frau Valerie war an einem postoperativen Blutgerinnsel im Hirn absurd jung mit vierunddreißig Jahren gestorben, vor so langer Zeit, dass er bisweilen kaum mehr glauben konnte, jemals eine Frau gehabt zu haben oder verheiratet gewesen zu sein. Sie war im Krankenhaus gewesen, um sich den Blinddarm herausnehmen zu lassen. Wenn er jetzt darüber nachdachte, war ihm klar, dass er das Krankenhaus oder das Gesundheitsamt wegen Fahrlässigkeit wahrscheinlich hätte anzeigen sollen, aber er war so mit der täglichen Sorge um ihre zwei Töchter beschäftigt gewesen – Jennifer war sieben und Laura erst zwei, als Valerie starb –, dass er kaum Zeit gefunden hatte, um seine arme Frau zu trauern, geschweige denn auf Rache zu sinnen. Wenn die beiden Mädchen ihr nicht so ähnlich gesehen hätten – mehr und mehr, je größer sie wurden –, wäre es ihm nur noch unter Mühen gelungen, mehr als eine vage Erinnerung an seine Frau heraufzubeschwören. Ehe und Mutterschaft hatten Valerie ernster werden lassen, als es die Studentin gewesen war, der Theo galant den Hof gemacht hatte. Theo fragte sich, ob die Menschen, denen ein früher Tod bestimmt war, eine Ahnung von der Kürze der Stunden hatten, die ihrem Leben eine Intensität, eine Ernsthaftigkeit verlieh wie einen Schatten. Valerie und Theo hatten sich gemocht, es war keine große Leidenschaft gewesen, und Theo wusste nicht, ob die Ehe gehalten hätte, wäre sie nicht gestorben.
Jennifer und Laura waren keine schwierigen Mädchen, und sie hatten es Theo leicht gemacht, ein guter Vater zu sein. Jennifer studierte jetzt in London Medizin. Sie war ein nüchternes, ehrgeiziges Mädchen, das sich nicht viel Zeit für Albernheiten und Spaß nahm, aber das hieß nicht, dass sie nicht zu Mitgefühl fähig gewesen wäre, und Theo konnte sich nicht vorstellen, dass sie eines Tages in einer Arztpraxis säße und einem fetten Kerl, den sie noch nie zuvor gesehen hatte, erklärte, er sei krankhaft fettleibig und solle seinen Arsch mehr bewegen. Das hatte die neue Ärztin nicht wirklich zu Theo gesagt, aber sie hätte es sagen können.
Wie ihre Schwester war Laura ein organisiertes, kompetentes Mädchen, das die Ziele, die es sich steckte, mit einem Minimum an Aufwand erreichte, aber im Unterschied zu Jennifer hatte Laura einen unbekümmerten Charakter. Das hieß nicht, dass sie nicht ehrgeizig war – sie hatte alle Tauchprüfungen bestanden und wollte bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr Tauchlehrerin werden. Nächsten Monat sollte sie ihren Führerschein machen, und in den Abschlussprüfungen der Schule rechnete sie mit lauter Einsen. Ein Studienplatz in Meeresbiologie in Aberdeen war ihr sicher.
Für den Sommer hatte sie einen Job in einem Pub in der King Street angenommen, und Theo sorgte sich, bis sie spätnachts nach Hause kam, stellte sich einen Irren vor, der sie in Christ’s Pieces vom Rad schlug und ihr unvorstellbare Dinge antat. Er war immens erleichtert, dass sie beschlossen hatte, im Oktober sofort ihr Studium zu beginnen und nicht wie anscheinend alle ihre Freundinnen mit einem Rucksack durch Thailand oder Südamerika zu reisen. Die Welt war ein gefahrvoller Ort. »Um Jenny machst du dir auch keine Sorgen«, sagte Laura, und es stimmte, er machte sich keine Sorgen um Jenny und tat so (vor sich selbst, vor Laura), als läge es daran, dass er Jennys Leben in London nicht verfolgen konnte, aber die Wahrheit war, dass er Jenny nicht so sehr liebte, wie er Laura liebte.
Jedes Mal, wenn Laura das Haus verließ, sich auf ihr Fahrrad schwang, ihren Taucheranzug anzog oder in einen Zug stieg, machte er sich Sorgen. Er machte sich Sorgen, dass ihr, wenn sie bei starkem Wind ausging, ein Stück Mauer auf den Kopf fallen würde, er machte sich Sorgen, dass sie eine Studentenbude mit einem nicht gewarteten Wasserboiler beziehen und an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben würde. Er machte sich Sorgen, dass ihre Tetanusimpfung nicht erneuert worden war, dass sie ein öffentliches Gebäude betreten könnte, durch dessen Klimaanlage die Legionärskrankheit verbreitet wurde, dass sie für eine Routineoperation ins Krankenhaus müsste und nie wieder nach Hause käme, dass sie von einer Biene gestochen und an einem anaphylaktischen Schock sterben würde (da sie bislang nie von einer Biene gestochen worden war, woher sollte er da wissen, dass sie nicht allergisch darauf reagierte?). Selbstverständlich erwähnte er diese Dinge Laura gegenüber nie, sie wären ihr lächerlich erschienen. Wenn er nur die kleinste Befürchtung äußerte (»Bieg vorsichtig nach links ab, dort ist ein toter Winkel« oder »Schalt das Licht aus, bevor du die Glühbirne wechselst«), lachte Laura ihn aus, sagte, er sei ein altes Weib und könne nicht einmal eine Glühbirne austauschen, ohne eine katastrophale Kette von Ereignissen vorauszusehen. Aber Theo wusste, dass die Reise, die mit einer winzigen, nicht fest genug angezogenen Schraube begann, mit der hoch in der Luft davonfliegenden Frachtraumtür endete.
»Warum machst du dir Sorgen, Papa?«, war Lauras beständige amüsierte Reaktion auf seine Bedenken. »Warum nicht?«, lautete seine unausgesprochene Antwort. Und nach einer bis in die frühen Morgenstunden dauernden Nachtwache zu viel, in der er gewartet hatte, bis sie von der Arbeit im Pub nach Hause kam (obwohl er immer so tat, als schliefe er), erwähnte Theo beiläufig, dass sie im Büro eine Sekretärin brauchten und ob sie nicht aushelfen wolle? Und zu seinem Erstaunen hatte sie kurz nachgedacht, zugestimmt und ihr hübsches Lächeln gelächelt (Stunden geduldiger, teurer kieferorthopädischer Arbeit, als sie jünger war), und Theo dachte, danke, lieber Gott, denn obwohl er nicht an Gott glaubte, sprach er oft mit ihm.
Und ausgerechnet an ihrem allerersten Arbeitstag bei Holroyd, Wyre und Stanton (Theo war »Wyre«) würde Theo nicht in der Kanzlei sein, was ihn natürlich wesentlich mehr beunruhigte als Laura. Er musste ins Gericht in Peterborough, ein langweiliger Streit um eine Grundstücksgrenze, die ein örtlicher Anwalt hätte übernehmen sollen, aber der Mandant ließ sich seit langem von Theo vertreten und war erst vor kurzem umgezogen. Laura trug einen schwarzen Rock und eine weiße Bluse und hatte ihr braunes Haar im Nacken zusammengebunden, und er dachte, wie frisch sie aussah, wie hübsch.
»Versprich mir, dass du zu Fuß zum Bahnhof gehst, Papa«, sagte Laura streng, als Theo vom Tisch aufstand, und Theo sagte: »Wenn es sein muss«, aber er wusste, dass er den Zug verpassen würde, wenn er zu Fuß ginge, und dachte, dass er ein Stück gehen und dann ein Taxi nehmen könnte. Er beendete sein kalorienarmes, ballaststoffreiches Viehfutterfrühstück und trank die Tasse mit dem schwarzen Kaffee aus, sehnte sich nach Sahne und Zucker und einem Blätterteiggebäck mit Aprikose und Vanillecreme, das aussah wie ein pochiertes Ei, und er dachte, dass er sich im Bahnhof vielleicht eins kaufen könnte. »Vergiss dein Asthmaspray nicht, Papa«, sagte Laura, und Theo langte zu seiner Jackentasche, um zu beweisen, dass er es dabeihatte. Allein der Gedanke, dass er das Spray nicht bei sich trug, versetzte Theo in Panik, obschon er nicht wusste, warum: Wenn er auf einer englischen Straße einen Asthmaanfall hätte, würde wahrscheinlich die Hälfte der Leute ein Spray aus der Tasche ziehen und ihm reichen.
Er sagte zu Laura: »Cheryl wird dir alles zeigen.« – Cheryl war seine Sekretärin – »Ich bin vor dem Mittagessen zurück im Büro, vielleicht können wir dann zusammen essen?«, und sie sagte: »Das wäre nett, Papa.« Und dann brachte sie ihn zur Tür, küsste ihn auf die Wange und sagte: »Ich liebe dich, Papa«, und er sagte: »Ich dich auch, Liebes.« Und an der Straßenecke blickte er zurück, und sie winkte ihm immer noch nach.
Laura, die braune Augen und eine blasse Haut hatte, die Pepsi und Chips mit Salz und Essig mochte, die so schlau war, die ihm sonntagmorgens Rühreier machte, Laura, die noch Jungfrau war (er wusste es, weil sie es ihm erzählt hatte, und er war verlegen gewesen), was ihn erheblich erleichterte, obwohl ihm klar war, dass sie nicht immer Jungfrau bleiben würde, Laura, in deren Zimmer ein Aquarium mit tropischen Salzwasserfischen stand, deren Lieblingsfarbe Blau war, deren Lieblingsblumen Schneeglöckchen waren, die Radiohead und Nirvana mochte und Mr.Blobby hasste, die Dirty Dancing zehnmal gesehen hatte. Und Theo liebte sie mit einer Leidenschaft, die eine Katastrophe war, ein Unheil.
Theo und David Holroyd hatten gemeinsam eine Kanzlei gegründet, kurz nachdem Theo Valerie geheiratet hatte. Jean Stanton schloss sich ihnen ein paar Jahre später an. Alle drei hatten zusammen studiert, und sie wollten eine »engagierte, sozial verantwortungsbewusste« Kanzlei, die mehr als nur den ihr üblichen Anteil an Familienrechts-, Ehescheidungs- und Pflichtverteidigungsfällen übernahm. Ihre guten Absichten waren im Lauf der Jahre schwächer geworden. Jean Stanton fand heraus, dass ihr Rechtsstreitigkeiten mehr lagen als Fälle von familiärer Gewalt, und ihre politische Einstellung hatte sich von Mitte-links zu Konservativ mit einem großen K verändert, und David Holroyd stellte fest, dass ihm als Anwalt in der fünften Generation in East Anglia notarielle Eigentumsübertragungen im Blut lagen, und so blieb es normalerweise Theo überlassen, »die moralische Fahne hochzuhalten«, wie David Holroyd sich ausdrückte. Die Kanzlei hatte sich erheblich vergrößert; sie hatten drei Juniorpartner aufgenommen und zwei weitere Anwälte eingestellt, und das Büro platzte aus allen Nähten, aber keiner ertrug den Gedanken an einen Umzug.
Das Gebäude war ursprünglich ein Wohnhaus gewesen, insgesamt fünf Stockwerke, von den feuchten Vorratsräumen im Keller bis zu den Dienstbotenkammern auf dem Dachboden, die Zimmer willkürlich aneinandergefügt, aber nichtsdestoweniger ein anständiger Wohnsitz für eine begüterte Familie. Nach dem Krieg war es in Büros und Wohnungen aufgeteilt worden, und jetzt waren nur noch Fragmente und gespenstische Spuren des Inneren übrig – eine dekorative Stuckleiste aus Girlanden und Urnen über dem Schreibtisch, an dem Cheryl arbeitete, und die Ornamente über dem Sims in der Eingangshalle.
Der Salon, auf einer Seite abgerundet und in seiner Zurückhaltung neoklassizistisch, ging hinaus auf Parker’s Piece und diente jetzt als Konferenzraum für Holroyd, Wyre und Stanton. Im Winter brannte immer ein echtes Kohlenfeuer im marmornen Kamin, denn David Holroyd war von der altmodischen Sorte. Theo hatte oft im Konferenzraum gestanden und mit seinen Partnern und Angestellten ein Glas Wein getrunken, alle erfüllt von der provinziellen Jovialität beruflich erfolgreicher Menschen. Und Jennifer und Laura waren selbstverständlich seit ihrer Kindheit hier ein und aus gegangen, aber der Gedanke, dass sie heute dort arbeitete, Akten ablegte, holte und hin- und hertrug, war merkwürdig, und er wusste, wie höflich und zuvorkommend sie wäre, und war stolz, denn die Mitarbeiter im Büro würden zueinander sagen: »Laura ist ein so nettes Mädchen«, wie es die Leute im Allgemeinen immer taten.
Schafe auf den Gleisen. Der Schaffner ließ sich nicht darüber aus, ob es sich um eine Herde oder ein paar versprengte Tiere handelte. Es waren jedenfalls so viele, dass alle im Zug nach Cambridge das Geholper und Gerüttel spürten. Der Zug stand bereits zehn Minuten, als der Schaffner durch die vier Wagen ging, sie über die Schafe informierte und Spekulationen über Kühe, Pferde und Selbstmörder zurückwies. Nach einer halben Stunde stand der Zug immer noch, weswegen Theo annahm, dass es eine Herde gewesen war und nicht ein paar vom Weg abgekommene Tiere. Er wollte nach Cambridge zurück und mit Laura essen gehen, aber das lag »im Schoß der Götter«, wie der Schaffner sich ausdrückte. Theo fragte sich, warum es im Schoß der Götter lag und nicht in der Hand der Götter.
Die Luft im Zug war stickig, und jemand, der Schaffner vermutlich, öffnete die Türen, und die Leute begannen hinauszuklettern. Theo war überzeugt, dass es den Eisenbahnstatuten widersprach, aber neben dem Zug befanden sich ein schmaler Grünstreifen und ein Bahndamm, und es schien ungefährlich – es gab keine Möglichkeit, dass ein anderer Zug so in sie hineinfahren würde, wie ihr Zug in die Schafe gefahren war. Theo stieg vorsichtig und unter Mühen aus, zufrieden mit sich selbst, weil er dieses Abenteuer auf sich nahm. Er war neugierig, wie Schafe nach einer so hautnahen Begegnung mit einem Zug aussahen. Nachdem er das Gleis ein Stück entlanggegangen war, fand er die Antwort auf diese Frage – Schafteile, wie Fleischstücke mit Wolle darauf, lagen überall verstreut, als hätte ein Rudel Wölfe sie in einem blutigen Massaker zerfleischt. Theo war erstaunt, wie gut er dieses Gemetzel verkraftete, andererseits verglich er Anwälte immer mit Polizisten und Krankenschwestern, wenn es darum ging, sich über den Saustall und die Tragödie des alltäglichen Lebens zu erheben und auf eine gleichgültige Art damit umzugehen. Theo empfand ein seltsames Triumphgefühl: Er war mit einem Zug gefahren, der beinahe entgleist wäre, aber nichts Schlimmes war passiert. Seine Chancen (und die Chancen der ihm Nahestehenden), noch einmal einen Zugunfall zu erleben, mussten gesunken sein.
Der Lokführer stand neben dem Zug, blickte verwirrt drein, und als Theo ihn fragte, ob er »okay« wäre, gab er zur Antwort: »Ich hab nur ein Schaf gesehen und gedacht, also, wegen dem muss ich nicht bremsen, und dann« – er fuchtelte dramatisch mit den Armen, als versuchte er, eine sich auflösende Schafherde nachzuahmen –, »und dann wurde die Welt weiß.«
Theo war so fasziniert von diesem Bild, dass er für den Rest der Fahrt, die begann, kaum waren sie in einen anderen Zug umgestiegen, darüber nachdachte. Er stellte sich vor, wie er Laura diese Szene beschrieb, und er stellte sich ihre Reaktion vor – entsetzt und zugleich amüsiert. Nach der Ankunft in Cambridge nahm er ein Taxi, stieg auf halbem Weg aus und ging zu Fuß weiter. So käme er zwar noch später, aber Laura würde sich freuen.
Theo blieb eine Minute auf dem Gehsteig stehen, bevor er die steile Treppe zum Büro von Holroyd, Wyre und Stanton im ersten Stock in Angriff nahm. Die Ärztin hatte Recht, Laura hatte Recht, er musste abnehmen. Die Haustür wurde von einem gusseisernen Türstopper offen gehalten.
Jedes Mal, wenn Theo das Gebäude betrat, bewunderte er diese Tür. Sie war glänzend dunkelgrün gestrichen, und Briefschlitz, Türbeschlag und löwenköpfiger Türklopfer waren die originale Ausstattung aus Messing. Das Messingschild auf der Tür, das jeden Morgen vom Putzdienst poliert wurde, verkündete »Holroyd, Wyre und Stanton – Anwälte und Notare«. Theo holte tief Luft und stieg die Treppe hinauf.
Auch die Innentür, die in den Empfangsbereich führte, stand – ungewöhnlicherweise – offen, und sobald Theo eintrat, wusste er, dass etwas Schreckliches geschehen war. Jean Stantons Sekretärin kauerte auf dem Boden, ihre Kleider voll Erbrochenem. Moira, für den Empfang zuständig, telefonierte und diktierte die Adresse der Kanzlei mit hysterischer Geduld. Sie hatte Blut im Haar und im Gesicht, und Theo glaubte, sie wäre verletzt, aber als er ihr zu Hilfe eilen wollte, winkte sie ihn fort, und er meinte, sie würde ihn wegschicken, bis er begriff, dass sie ihn ins Konferenzzimmer zu dirigieren versuchte.
Später setzte Theo die Ereignisse, die diesem Augenblick vorausgegangen waren, wieder und wieder zusammen.
Laura hatte gerade das Formular für einen Grundbucheintrag kopiert, als ein Mann den Empfangsbereich betrat, ein so unauffälliger Mann, dass später kein Einziger bei Holroyd, Wyre und Stanton eine halbwegs anständige Beschreibung seines Aussehens geben konnte. Das Einzige, woran sie sich erinnerten, war, dass er einen gelben Golfpullover trug.
Der Mann schien verwirrt und desorientiert, und als Moira am Empfang sagte: »Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir?«, erwiderte er mit hoher, angespannter Stimme: »Mr.Wyre, wo ist er?«, und Moira, beunruhigt vom Verhalten des Mannes, sagte: »Es tut mir leid, er hat sich im Gericht verspätet. Haben Sie einen Termin? Kann ich Ihnen weiterhelfen?«, aber der Mann rannte auf merkwürdige Art den Flur entlang wie ein Kind und stürmte ins Konferenzzimmer, wo die Partner eine Besprechung beim Mittagessen abhielten, obschon Theo fehlte, der sich noch auf dem Rückweg vom Bahnhof befand (und die Besprechung vergessen hatte).
Laura war losgeschickt worden, um für die Besprechung Sandwiches zu kaufen – mit Krabbencocktail, Käse und Krautsalat, Roastbeef, Thunfisch und Mais und eines mit Hühnchen und Salat (ohne Mayonnaise) für ihren Vater, denn er musste wirklich mehr auf sein Gewicht achten, und sie hatte voller Zuneigung gedacht, was für ein Esel er doch war, weil er nicht an die Besprechung gedacht hatte, als er sie heute Morgen zum Mittagessen eingeladen hatte. Sandwiches, Kaffee, Notizblöcke, alles befand sich auf dem Konferenztisch aus Mahagoni (oval wie die Form des Zimmers), aber noch niemand hatte sich an den Tisch gesetzt. David Holroyd stand vor dem Kamin und erzählte einem Juniorpartner von dem »verdammt phantastischen« Urlaub, aus dem er gerade zurückgekehrt war, als der Fremde in den Raum stürzte und von irgendwo, vermutlich unter dem gelben Golfpullover hervor, aber niemand erinnerte sich genau, ein langes Jagdmesser zog und damit durch das dunkle Kammgarn von David Holroyds Austin-Reed-Anzug, den weißen Popelin seines Charles-Tyrwhitt-Hemds, die tropische Bräune der Haut seines linken Arms und schließlich durch die Arterie im Arm schnitt. Und Laura, die Aprikosenjoghurt mochte und Tee trank, aber keinen Kaffee, die Schuhgröße neununddreißig hatte und Pferde liebte, die Bitterschokolade Milchschokolade vorzog und fünf Jahre lang klassische Gitarre gelernt, aber nie wieder gespielt hatte, und die noch immer traurig war, weil ihre Hündin Poppy im Sommer zuvor überfahren worden war, Laura, die Theos Tochter und beste Freundin war, ließ den Grundbucheintrag fallen und lief hinter dem Mann ins Konferenzzimmer – vielleicht weil sie einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hatte oder weil sie im College einen Selbstverteidigungskurs gemacht hatte, oder vielleicht war es auch nur schlichte Neugier oder Instinkt, niemand konnte wissen, was sie dachte, als sie ins Konferenzzimmer lief, wo der Mann, dieser vollkommen Fremde, sich auf den Fußballen so behände und elegant wie ein Tänzer umdrehte, während seine Hand noch den Bogen vollendete, in dem er David Holroyds Arm durchschnitten hatte und der jetzt auf Lauras Hals traf und ihre Halsschlagader durchtrennte, so dass ein großer Strahl ihres kostbaren schönen Bluts durch das Zimmer schoss.




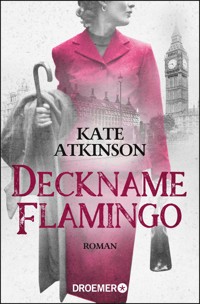

![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)