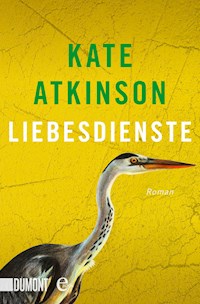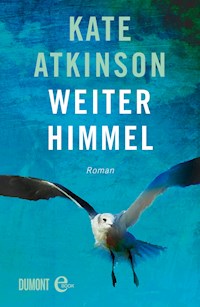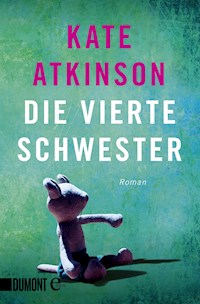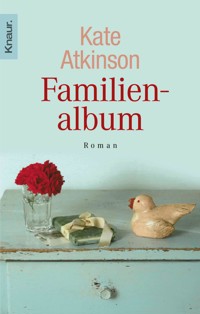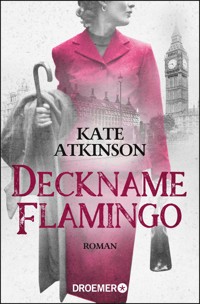
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kate Atkinsons unvergleichlicher Spionage-Roman um eine junge britische Geheimagentin - Lesevergnügen auf höchstem Niveau "'Sehen Sie es als Abenteuer', hatte Perry ganz am Anfang gesagt. Und so hatte sie den Spionagedienst auch empfunden. Ein Jux, hatte sie gedacht. Das Russische Teehaus, das Etikettenkleben, die Flucht den Wilden Wein hinunter. Aber es war kein Abenteuer. Jemand war gestorben." Im Jahr 1940 gerät die 18-jährige Julia Armstrong eher unfreiwillig in die Welt der Spionage. Ihr Auftrag ist, Gesprächsprotokolle von Treffen britischer Nazi-Sympathisanten zu erstellen - Gespräche, die sie heimlich belauschen kann, da ein Agent des MI5 in die Gruppe eingeschleust wurde. Ihre Arbeit ist ebenso furchteinflößend wie langweilig, und als der 2. Weltkrieg vorbei ist, hofft sie, dass all dies für immer der Geschichte angehört. Doch zehn Jahre später - Julia ist inzwischen Redakteurin beim BBC-Schulfunk - beginnt ihre Vergangenheit (oder vielmehr: eine Menge alter Bekannter) sie einzuholen. Alte Rechnungen sind zu begleichen, und Julia muss einsehen, dass jede klitzekleine Handlung große Konsequenzen hat. "Kate Atkinson ist wundervoll; ich möchte schreiben können wie sie, wenn ich mal groß bin. 'Deckname Flamingo' ist eine Spitzenleistung - ein Spionage-Roman, der das ganze Genre auseinandernimmt!" Matt Haig "Atkinson baut ihre Handlung im John-le-Carré-Stil meisterhaft. Und die Atmosphäre der Kriegs- wie der Nachkriegszeit ist absolut überzeugend getroffen." James Walton "Ich liebe 'Deckname Flamingo' - man weiß nicht, ob Kate Atkinson sich über Spionage lustig macht oder ob einem das Lachen über Spionage im Halse steckenbleiben soll." Hanya Yanagihara "Kate Atkinson ist ein Genie." Gillian Flynn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kate Atkinson
DecknameFlamingo
Roman
Aus dem Englischen von Anette Grube
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»›Sehen Sie es als Abenteuer‹, hatte Perry ganz am Anfang gesagt. Und so hatte sie den Spionagedienst auch empfunden. Ein Jux, hatte sie gedacht. Das Russische Teehaus, das Etikettenkleben, die Flucht den Wilden Wein hinunter. Aber es war kein Abenteuer. Jemand war gestorben.«
Im Jahr 1940 gerät die 18-jährige Julia Armstrong eher unfreiwillig in die Welt der Spionage. Ihr Auftrag ist, Gesprächsprotokolle von Treffen britischer Nazi-Sympathisanten zu erstellen – Gespräche die sie heimlich belauschen kann, da ein Agent des MI5 in die Gruppe eingeschleust wurde. Ihre Arbeit ist ebenso furchteinflößend wie langweilig, und als der 2. Weltkrieg vorbei ist, hofft sie, dass all dies für immer der Geschichte angehört.
Doch zehn Jahre später – Julia ist inzwischen Redakteurin beim BBC-Kinderfunk – beginnt ihre Vergangenheit (oder vielmehr: eine Menge alter Bekannter) sie einzuholen. Alte Rechnungen sind zu begleichen, und Julia muss einsehen, dass jede klitzekleine Handlung große Konsequenzen hat.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1981. Kapitel
Die Kinderstunde
1950. Kapitel
Mr Toby! Mr Toby!
1940. Kapitel
Einer von uns
Dolly ist da
Warten auf Otter
Kennen Sie einen Spion?
Toter Briefkasten
Kriegsanstrengung
Maskerade
Täuschungsmanöver
Viel Lärm um nichts
Der Würfel ist gefallen
1950. Kapitel
Technische Störung
1940. Kapitel
Dolly ist da
1950. Kapitel
Regnum defende
1981. Kapitel
Das unsichtbare Licht
Nachwort der Autorin
Quellen
Aus den National Archives
DVDs
Dank
Für Marianne Velmans
In Kriegszeiten ist die Wahrheit so kostbar, dass man sie immer mit einer Leibgarde aus Lügen schützen sollte.
Winston Churchill
Dieser Tempel der Künste und Musen wird im Jahr 1931 dem Allmächtigen Gott von den ersten Statthaltern des Rundfunks gewidmet, mit Sir John Reith als Generaldirektor. Sie beten dafür, dass gute Samen gute Ernte tragen werden, dass alles, was Frieden und Reinheit zerstören will, aus diesem Haus verbannt sein möge, und dass die Menschen, die ihr Ohr dem Schönen, Aufrechten und Guten leihen, den Pfad der Weisheit und der Aufrichtigkeit beschreiten werden.
Lateinische Inschrift im Foyer des British Broadcasting House
N Steht für »Null«, die Stunde, die sich noch im Schlafe wiegt,
Da ein neues England erwacht und das alte tot darniederliegt.
Aus dem »Kriegsalphabet« des Right Club
1981
Die Kinderstunde
Miss Armstrong? Miss Armstrong? Können Sie mich hören?«
Sie konnte, doch sie war nicht in der Lage zu antworten. Sie war schwer beschädigt. Zerbrochen. Sie war von einem Auto angefahren worden. Möglicherweise war es ihr eigener Fehler gewesen, sie war zerstreut – sie hatte so lange im Ausland gelebt, dass sie wahrscheinlich in die falsche Richtung geschaut hatte, als sie im mittsommerlichen Dämmerlicht die Wigmore Street überquerte. Zwischen Dunkelheit und hellem Tag.
»Miss Armstrong?«
Ein Polizist? Oder ein Sanitäter. Jemand Offizielles, jemand, der in ihre Tasche gesehen haben musste und etwas mit ihrem Namen darauf gefunden hatte. Sie war in einem Konzert gewesen – Schostakowitsch. Die Streichquartette, alle fünfzehn zerlegt in Portionen von drei pro Tag in der Wigmore Hall. Es war Mittwoch – das Siebte, Achte und Neunte. Sie nahm an, dass sie die restlichen jetzt versäumen würde.
»Miss Armstrong?«
Im Juni 1942 war sie in der Royal Albert Hall zur Konzertpremiere der 7. Sinfonie, der Leningrader, gewesen. Ein Mann, den sie kannte, hatte eine Karte für sie organisiert. Der Saal war bis auf den letzten Platz ausverkauft, die Atmosphäre elektrifizierend und überwältigend gewesen – sie hatten sich eins mit den Belagerten gefühlt. Und auch mit Schostakowitsch. Ein kollektives Anschwellen der Herzen. So lange her. So bedeutungslos jetzt.
Die Russen waren ihre Feinde gewesen, und dann waren sie Verbündete, und dann waren sie wieder Feinde. Mit den Deutschen war es das Gleiche – der große Feind, der schlimmste von allen, und jetzt waren sie unsere Freunde, eine tragende Säule Europas. Es war alles so vergeblich. Krieg und Frieden. Frieden und Krieg. Es würde endlos so weitergehen.
»Miss Armstrong, ich werde Ihnen jetzt eine Halskrause umlegen.«
Sie dachte an ihren Sohn. Matteo. Er war sechsundzwanzig Jahre alt, das Resultat eines kurzen Verhältnisses mit einem italienischen Musiker – sie hatte viele Jahre in Italien gelebt. Julias Liebe für Matteo war eins der überwältigenden Wunder ihres Lebens. Sie sorgte sich um ihn – er lebte in Mailand mit einem Mädchen zusammen, das ihn unglücklich machte, und das hatte an ihr genagt, als der Wagen sie anfuhr.
Als sie auf dem Pflaster der Wigmore Street lag, betroffene Passanten um sie herum, wusste sie, dass es jetzt keinen Ausweg mehr gab. Sie war erst sechzig, andererseits war es für ein Leben wahrscheinlich lang genug. Doch plötzlich erschien ihr alles wie eine Illusion, wie ein Traum, den jemand anders geträumt hatte. Was für eine seltsame Sache die Existenz doch war.
Es sollte eine königliche Hochzeit stattfinden. Sogar heute noch, während sie auf diesem Londoner Pflaster lag, umgeben von diesen freundlichen Fremden, wurde irgendwo die Straße hinauf eine Jungfrau zur Opferung vorbereitet, um das Bedürfnis nach Glanz und Gloria zu befriedigen. Überall hingen Union Jacks. Es bestand kein Zweifel, dass sie zu Hause war. Endlich.
»Dieses England«, murmelte sie.
1950
Mr Toby! Mr Toby!
Julia kam aus der U-Bahn und ging die Great Portland Street entlang. Als sie auf die Uhr blickte, stellte sie fest, dass sie erstaunlich spät dran war zur Arbeit. Sie hatte verschlafen wegen eines langen Abends im Belle Meunière in der Charlotte Street mit einem Mann, der im Lauf des Abends immer uninteressanter geworden war. Trägheit – oder vielleicht Ennui – veranlasste sie, am Tisch sitzen zu bleiben, und auch die Spezialitäten des Hauses, viande de bœuf Diane und crêpe Suzette halfen dabei.
Ihr etwas farbloser Begleiter war ein Architekt, der behauptete, »das Nachkriegslondon wiederaufzubauen«. »Ganz allein?«, hatte sie etwas unfreundlich gefragt. Sie gestattete ihm einen – flüchtigen – Kuss, als er sie am Ende des Abends in ein Taxi setzte. Aus Höflichkeit, nicht aus Verlangen. Er hatte schließlich für das Abendessen bezahlt, und sie war unnötig gemein zu ihm gewesen, auch wenn er es nicht zu bemerken schien. Der Abend hatte einen sauren Nachgeschmack hinterlassen. Ich bin eine Enttäuschung für mich selbst, dachte sie, als das Broadcasting House in Sichtweite kam.
Julia war Produzentin für den Schulfunk, und als sie sich dem Portland Place näherte, verdüsterte sich ihre Stimmung bei der Aussicht auf den langweiligen Tag, der vor ihr lag – ein Abteilungstreffen mit Prendergast, gefolgt von einer Aufnahme von Frühere Leben, einer Serie, die sie von Joan Timpson übernommen hatte, weil sich Joan einer Operation unterziehen musste. (»Nur eine kleine, Liebes.«)
Der Schulfunk hatte kürzlich aus dem Keller des Film House in der Wardour Street ausziehen müssen, und Julia vermisste die schäbige Liederlichkeit von Soho. Die BBC hatte keinen Platz für sie im Broadcasting House, deswegen waren sie auf der anderen Straßenseite in Nr. 1 untergebracht worden, und sie schauten nicht ohne Neid auf ihr Mutterschiff, den großen, vielstöckigen Ozeandampfer des Broadcasting House, dessen Kriegstarnung abgewaschen war und der den Bug in ein neues Jahrzehnt und eine ungewisse Zukunft streckte.
Im Gegensatz zu dem unablässigen Kommen und Gehen auf der anderen Straßenseite war es still im Schulfunkgebäude, als Julia es betrat. Sie hatte ein sehr dumpfes Gefühl im Kopf von der Karaffe Rotwein, die sie mit dem Architekten getrunken hatte, und war erleichtert, dass sie sich nicht am üblichen Austausch von morgendlichen Begrüßungen beteiligen musste. Die junge Frau am Empfang blickte pikiert zur Uhr, als sie Julia durch die Tür kommen sah. Das Mädchen hatte eine Affäre mit einem Produzenten vom World Service und schien zu glauben, dass sie deswegen unverschämt sein durfte. Die Mädchen am Empfang vom Schulfunk wechselten mit verblüffender Rasanz. Julia gefiel die Vorstellung, dass sie von einem Ungeheuer gefressen wurden, vielleicht von einem Minotaurus in den labyrinthischen Eingeweiden des Gebäudes – obwohl man sie tatsächlich nur in glanzvollere Abteilungen im Broadcasting House auf der anderen Straßenseite versetzte.
»Die U-Bahn hatte Verspätung«, sagte Julia, obwohl sie nicht glaubte, dass sie dem Mädchen eine Erklärung schuldig war, ob wahrheitsgemäß oder nicht.
»Schon wieder?«
»Ja, die Strecke ist sehr anfällig.«
»Offensichtlich. (Die Dreistigkeit!) Mr Prendergasts Besprechung findet im ersten Stock statt«, sagte das Mädchen. »Ich nehme an, dass sie schon angefangen hat.«
»Das nehme ich auch an.«
»Ein Tag im Arbeitsleben«, sagte Prendergast ernst zu der Rumpfversammlung am Tisch. Wie Julia bemerkte, hatten sich mehrere Personen verabsentiert. Prendergasts Besprechungen erforderten eine besondere Art von Durchhaltevermögen.
»Ah, Miss Armstrong, da sind Sie ja«, sagte Prendergast, als sie eintrat. »Ich habe schon geglaubt, Sie wären verloren gegangen.«
»Aber man hat mich wiedergefunden«, sagte Julia.
»Ich sammle gerade Ideen für neue Sendungen. Ein Besuch bei einem Schmied in seiner Schmiede zum Beispiel. Themen, für die sich Kinder interessieren.«
Julia konnte sich nicht erinnern, sich als Kind für eine Schmiede interessiert zu haben. Sie interessierte sich auch jetzt nicht dafür.
»Unterwegs mit einem Schäfer«, fuhr Prendergast hartnäckig fort. »Während der Ablammsaison. Alle Kinder mögen Lämmer.«
»Haben wir nicht schon genug Landwirtschaft in Für Schulen auf dem Land?«, fragte Charles Lofthouse. Charles hatte auf den »Brettern, die die Welt bedeuten« gestanden, bis ihm 1941 durch die Bombe auf das Café de Paris ein Bein abgerissen wurde und er nicht mehr stehen konnte. Jetzt hatte er ein künstliches Bein, das man nie und nimmer mit einem echten verwechseln würde. Die Leute waren deswegen nett zu ihm, obwohl es keinen wirklichen Grund dafür gab, da er zur bissigen Sorte gehörte und es zweifelhaft war, dass ihn der Verlust seines Beines milder gestimmt hatte. Er war als Produzent für die Serie Club der Forscher verantwortlich. Julia konnte sich niemanden vorstellen, der ungeeigneter gewesen wäre.
»Aber Lämmer gefallen allen, nicht nur Kindern vom Land«, widersprach Prendergast. Er war der Programmmanager, und insofern gehörten sie auf die eine oder andere Weise alle zu seiner Herde, vermutete Julia. Er blickte vage auf den ordentlich frisierten Kopf von Daisy Gibbs, während er sprach. Er hatte Probleme mit den Augen – er war im Ersten Weltkrieg in einen Gasangriff geraten –, und es gelang ihm nur selten, jemandem in die Augen zu schauen. Er war ein strammer Methodist und Laienprediger und fühlte sich zum Seelsorger »berufen«, wie er Julia ein halbes Jahr zuvor, als sie von der Kinderstunde in Manchester nach London zurückgekehrt war, um beim Schulfunk zu arbeiten, bei einer Kanne peinlich schwachen Tees in der Cafeteria anvertraut hatte. »Ich nehme an, dass Sie das Konzept der Berufung verstehen, Miss Armstrong.«
»Ja, Mr Prendergast«, hatte Julia gesagt, weil es eine viel einfachere Antwort war als »Nein«. Sie hatte aus Erfahrung gelernt.
Sie versuchte herauszufinden, an welchen Hund er sie erinnerte. An einen Boxer vielleicht. Oder an eine Englische Bulldogge. Zerknittert und ziemlich traurig. Wie alt war Prendergast?, fragte sich Julia. Er war seit Urzeiten bei der BBC und während der frühen Pionierzeit unter Reith dazugekommen, als die Corporation noch im Savoy Hill residierte. Prendergast betrachtete den Schulfunk als sakrosankt – Kinder, Lämmer und so weiter.
»Das Problem mit Reith war natürlich«, sagte er, »dass er nicht wirklich wollte, dass die Leute Freude am Radio hatten. Er war schrecklich puritanisch. Die Leute sollen sich doch freuen, oder? Wir sollten alle freudig leben.«
Prendergast schien in Gedanken versunken – über Freude oder, wahrscheinlicher, den Mangel daran, vermutete Julia –, doch nach ein paar Sekunden riss er sich mit einem kleinen Ruck zusammen. Eine Bulldogge, kein Boxer, entschied Julia. Lebte er allein? Prendergasts Personenstand war unklar, und niemand schien sich genug dafür zu interessieren, um ihn zu dem Thema zu befragen.
»Freude ist ein bewundernswertes Ziel«, hatte Julia gesagt. »Selbstverständlich völlig unerreichbar.«
»Ach, du liebe Zeit. So jung und schon so zynisch?«
Julia mochte ihn, aber sie war vielleicht die Einzige. Ältere Männer eines bestimmten Schlags fühlten sich zu ihr hingezogen. Sie schienen sie in irgendeiner Weise optimieren zu wollen. Julia war fast dreißig und meinte keine große Optimierung mehr zu brauchen. Dafür hatte der Krieg gesorgt.
»Auf See mit den Trawlerfischern«, schlug jemand – Lester Pelling – vor. Er erinnerte Julia an eine von Lewis Carrolls bedauernswerten jungen Austern, gar eifrig im Vereine. Er war ein junger Tontechniker, erst siebzehn, kaum aus dem Stimmbruch. Warum nahm er an dieser Besprechung teil?
»Genau.« Prendergast nickte wohlwollend.
»Mein Vater war –«, setzte Lester Pelling an, wurde jedoch durch ein weiteres freundliches »Genau« von Prendergast unterbrochen, der die Hand in einer eher päpstlichen als methodistischen Geste hob. Julia fragte sich, ob sie je erfahren würden, was Lester Pellings Vater war. Ein Trawlerfischer, ein Kriegsheld, ein Wahnsinniger? König, Edelmann, Bauer, Bettelmann?
»Alltägliche Geschichten über Leute vom Land, so was in der Art«, sagte Prendergast. Wusste er, dass Beasley von der BBC Midland Region am Konzept einer Serie arbeitete, die sich genauso anhörte? Ein landwirtschaftliches Informationsprogramm, getarnt als Fiktion, ein »bäuerlicher Radiodetektiv« hatte die Beschreibung gelautet. (Wer um alles auf der Welt wollte so etwas hören?) Julia wurde ein wenig neugierig. Klaute Prendergast anderer Leute Ideen?
»Arbeiter in einer Textilfabrik«, schlug Daisy Gibbs vor. Sie blickte zu Julia und lächelte. Sie war die neue Programmassistentin, frisch aus Cambridge und kompetenter, als eigentlich nötig war. Sie hatte etwas Mysteriöses, das Julia erst noch enträtseln musste. Wie Julia war Daisy keine Lehrerin. (»Kein Nachteil«, sagte Prendergast, »überhaupt keiner. Ganz im Gegenteil.«)
»O nein, Miss Gibbs«, sagte Prendergast. »Industrie fällt in den Zuständigkeitsbereich des Nordens, nicht wahr, Miss Armstrong?« Julia galt als die Expertin für den Norden, weil sie aus Manchester gekommen war.
Als der Krieg vorbei war und ihr Land in Gestalt des Geheimdienstes sie nicht mehr brauchte, war Julia in den anderen großen nationalen Monolithen weitergezogen und hatte eine Karriere beim Hörfunk begonnen, obwohl sie die Sache auch jetzt noch, fünf Jahre später, nicht als Karriere betrachtete, es war einfach etwas, was sie zufälligerweise tat.
Die BBC-Studios in Manchester waren über einer Bank in Piccadilly einquartiert. Julia war als Sprecherin angestellt gewesen. (»Eine Frau!«, sagten alle, als hätten sie nie zuvor eine Frau sprechen gehört.) Sie hatte noch immer Albträume wegen der Übergänge – Angst vor Stille oder davor, über das Zeitsignal hinaus zu sprechen oder nicht mehr zu wissen, was sie sagen sollte. Es war keine Arbeit für Feiglinge. Sie hatte Nachtdienst, als ein Notruf von der Polizei einging – manchmal war jemand todkrank, und es musste dringend ein Verwandter gefunden werden. Damals suchten sie jemandes Sohn, »der sich vermutlich im Gebiet von Windermere aufhielt«, als plötzlich eine Katze im Studio (einer ehemaligen Besenkammer) auftauchte. Die Katze, eine rötlich-gelbe – sie waren Julias Ansicht nach die schlimmsten aller Katzen – sprang auf den Tisch und biss sie ziemlich heftig, sodass sie nicht umhinkonnte, einen leisen Schmerzensschrei auszustoßen. Anschließend wälzte sich die Katze auf dem Schreibtisch hin und her, bevor sie sich das Gesicht am Mikrofon rieb und so laut hineinschnurrte, dass jeder, der zuhörte, glauben musste, im Studio wäre ein Tiger los, der höchst zufrieden mit sich selbst war, weil er eine Frau gemeuchelt hatte.
Schließlich packte jemand das verfluchte Vieh am Genick und warf es hinaus. Julia nieste sich durch den Rest der Ansagen und gab dann den falschen Einsatz für Schuberts »Forelle«.
»Durchhalten«, lautete die Losung der BBC. Julia hatte einmal das Hallé-Orchester angekündigt – Barbirolli dirigierte Tschaikowskys Pathétique –, und als sie ansetzte mit »Hier ist der Northern Home Service«, hatte ihre Nase angefangen, schrecklich zu bluten. Sie hatte Mut geschöpft, als sie sich daran erinnerte, wie sie 1940 während der Neunuhrnachrichten die Übertragung einer Bombenexplosion gehört hatte. (O nein, um Himmels willen, hatte sie gedacht, nicht die BBC.) Der Nachrichtensprecher, Bruce Belfrage, hatte innegehalten – es folgte der übliche schreckliche Krach, den eine Bombe macht –, und dann sagte eine ganz leise Stimme »Alles in Ordnung«, und Belfrage fuhr fort, als wäre nichts passiert. Was auch Julia tat, obwohl ihr Tisch mit Blutflecken übersät war (ihr eigenes Blut – normalerweise beunruhigender als fremdes Blut). Jemand schob ihr einen kalten Schlüsselbund in den Rücken, eine Methode, die noch nie funktioniert hatte.
Natürlich war nicht alles in Ordnung bei der BBC, denn sieben Mitarbeiter lagen tot in den oberen Stockwerken, aber das konnte Belfrage nicht wissen, und selbst wenn er es gewusst hätte, hätte er weitergesprochen.
Damals war Julia so darauf geeicht gewesen, Godfrey Tobys undeutliche Gespräche am Dolphin Square abzuhören, dass sie sich fragte, ob allein sie die leise beruhigende Stimme gehört hatte. Vielleicht wollte sie deswegen nach dem Krieg für die BBC arbeiten. Alles in Ordnung.
Es war fast Mittag, als Prendergasts Besprechung ein ergebnisloses Ende fand.
»Mittagessen in der Cafeteria, Miss Armstrong?«, fragte er, bevor sie flüchten konnte. Sie hatten eine eigene Cafeteria in Nr. 1, ein armseliger Schatten der Kantine im Keller des Flaggschiffs auf der anderen Straßenseite, und Julia mied wenn möglich ihre verrauchte, übel riechende Atmosphäre.
»Ich habe Sandwiches dabei, Mr Prendergast«, sagte sie und blickte bedauernd drein. Mit ein bisschen Schauspielerei kam man weit bei Prendergast. »Warum fragen Sie nicht Fräulein Rosenfeld?« Fräulein Rosenfeld war zwar Österreicherin, aber alle bestanden darauf, sie als Deutsche zu bezeichnen (»Kein Unterschied«, sagte Charles Lofthouse). Sie war ihre Beraterin für Deutsch. »Das Fräulein«, wie sie oft genannt wurde, war über sechzig, stämmig, miserabel angezogen und von einer resignierten Ernsthaftigkeit selbst bei den banalsten Dingen. Sie war 1937 nach England gekommen, um an einer Konferenz über Ethik teilzunehmen, und hatte sich klugerweise dafür entschieden, nicht zurückzukehren. Und nach dem Krieg gab es natürlich niemanden mehr, zu dem sie hätte zurückkehren können. Sie hatte Julia ein Foto gezeigt, fünf hübsche Mädchen, die vor langer Zeit ein Picknick machten. Weiße Kleider, breite weiße Schleifen im langen dunklen Haar. »Meine Schwestern«, sagte Fräulein Rosenfeld. »Ich bin die in der Mitte – da«, sagte sie und deutete schüchtern auf die am wenigsten hübsche der fünf. »Ich war die älteste.«
Julia mochte Fräulein Rosenfeld, sie war so ausgeprägt europäisch, und alle anderen in Julias Umgebung waren so ausgeprägt britisch. Vor dem Krieg war Fräulein Rosenfeld eine andere Person gewesen – Philosophiedozentin an der Universität Wien –, und Julia vermutete, dass jedes dieser Dinge – Krieg, Philosophie, Wien – einen in die Resignation, Ernsthaftigkeit und vielleicht auch in hässliche Kleidung treiben konnte. Es wäre eine Herausforderung für Prendergast, ihr Mittagessen mit Freude zu erfüllen.
Es stimmte sogar, Julia hatte Sandwiches dabei – Mayonnaise mit einem Ei, das sie hastig gekocht hatte, als sie sich am Morgen in der Küche wach gegähnt hatte. Es war erst Anfang März, aber die Luft roch deutlich nach Frühling, und sie hatte gedacht, dass es eine Abwechslung wäre, al fresco zu essen.
In Cavendish Square Gardens war mühelos eine freie Bank zu finden, da niemand anderes so dumm war, es für warm genug für ein Mittagessen im Freien zu halten. Im Gras waren Andeutungen von Krokussen zu sehen, und Narzissen bohrten sich tapfer aus der Erde, aber die anämische Sonne wärmte nicht, und bald war Julia steif vor Kälte.
Die Sandwiches waren kein Trost, es waren bleiche, schlaffe Dinger und hatten nichts mit dem déjeuner sur l’herbe gemein, das sie sich am Morgen vorgestellt hatte, dennoch aß sie sie pflichtbewusst. Vor Kurzem hatte sie sich ein neues Buch von Elizabeth David gekauft – Das Buch der mediterranen Küche. Ein hoffnungsvoller Kauf. Das einzige Olivenöl, das sie finden konnte, verkaufte ihr Drogist in einer winzigen Flasche. »Um Ohrenschmalz aufzuweichen?«, fragte er, als sie ihm das Geld reichte. Irgendwo gab es ein besseres Leben, vermutete Julia, wenn sie sich nur die Mühe machte, es zu finden.
Als sie die Sandwiches gegessen hatte, stand sie auf, um die Krümel vom Mantel zu schütteln, und scheuchte eine Schar aufmerksamer Spatzen auf, die geschlossen mit ihren staubigen Londoner Flügeln davonflatterten, um sofort wieder zu ihrem Futter zurückzukehren, sobald sie gegangen wäre.
Julia machte sich auf den Weg in die Charlotte Street, nicht zum Restaurant vom Abend zuvor, sondern zum Moretti’s – einem Café nahe dem Scala-Theater, das sie gelegentlich aufsuchte.
Gerade als sie an der Berners Street vorbeikam, sah sie ihn.
»Mr Toby! Mr Toby!« Julia beschleunigte den Schritt und schloss zu ihm auf, als er um die Ecke in die Cleveland Street ging. Sie fasste ihn am Ärmel seines Mantels. Es schien gewagt. Sie hatte ihn einmal erschreckt, als sie das Gleiche getan und ihm einen Handschuh gereicht hatte, der ihm heruntergefallen war. Sie erinnerte sich, dass sie damals gedacht hatte: Signalisiert auf diese Weise nicht eine Frau einem Mann ihre Absichten, indem sie das neckische Taschentuch, den koketten Handschuh fallen lässt? »Danke, Miss Armstrong«, hatte er damals gesagt. »Ich hätte mich über seinen Verbleib gewundert.« An Flirten hatten sie beide nicht gedacht.
Jetzt war es ihr gelungen, ihn aufzuhalten. Er drehte sich um, offenbar nicht überrascht, deswegen war sie sicher, dass er sie gehört hatte, als sie seinen Namen gerufen hatte. Er sah sie unverwandt an, wartete auf mehr.
»Mr Toby? Ich bin’s, Julia, erinnern Sie sich an mich?« (Wie sollte er sich nicht erinnern!) Fußgänger umrundeten sie ungeschickt. Wir sind eine kleine Insel, dachte sie, wir beide. »Julia Armstrong.«
Er lüpfte den Hut – einen grauen Filzhut, den sie meinte wiederzuerkennen, lächelte matt und sagte: »Tut mir leid, Miss … Armstrong? Ich glaube, Sie verwechseln mich. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.« Er drehte sich um und ging weiter.
Er war es, sie wusste, dass er es war. Dieselbe (ziemlich korpulente) Figur, das ausdruckslose Eulengesicht, die Schildpattbrille, der alte Filzhut. Und schließlich der unwiderlegbare – und etwas enervierende – Beweis: der Gehstock mit dem silbernen Knauf.
Sie sagte seinen wahren Namen. »John Hazeldine.« Nie zuvor hatte sie ihn so genannt. In ihren Ohren klang es wie ein Vorwurf.
Er blieb stehen, den Rücken ihr zugewandt. Ein Hauch Schuppen lag wie Puder auf den Schultern seines schäbigen Trenchcoats. Er sah aus wie der, den er während des Kriegs getragen hatte. Kaufte er nie neue Kleider? Sie wartete darauf, dass er sich umdrehte und sich erneut verleugnete, doch nach einer Sekunde ging er einfach weiter, sein Stock klopf-klopf-klopfte auf das graue Londoner Pflaster. Sie war ausgemustert worden. Wie ein Handschuh, dachte sie.
Ich glaube, Sie verwechseln mich. Wie seltsam, seine Stimme wieder zu hören. Er war es, warum tat er so, als wäre er es nicht?, fragte sich Julia, als sie sich im Moretti’s an einen Tisch setzte und bei einem missmutigen Kellner einen Kaffee bestellte.
Sie war schon vor dem Krieg in dieses Café gegangen. Der Name war geblieben, der Besitzer war jemand anderes. Das Café war klein und ziemlich schmuddelig, die rot-weiß karierten Tischdecken waren nie wirklich sauber. Das Personal schien ständig zu wechseln, und nie grüßte jemand Julia oder schien sie wiederzuerkennen, was ihr per se nicht unrecht war. Eigentlich war es ein schrecklicher Ort, aber ihr gefiel er. Es war ein Faden im Labyrinth, dem sie in die Welt vor dem Krieg, zu ihrem Selbst vor dem Krieg folgen konnte. Unschuld und Erfahrung stießen im schmierigen Dunst vom Moretti’s aufeinander. Sie war erleichtert gewesen, als sie bei ihrer Rückkehr nach London feststellte, dass es noch existierte. So viel anderes war verschwunden. Sie zündete sich eine Zigarette an und wartete auf den Kaffee.
Das Café wurde überwiegend von Ausländern frequentiert, und Julia mochte es, einfach nur dazusitzen und zuzuhören, zu versuchen herauszufinden, woher die Leute waren. Als sie hierherzukommen begann, wurde das Café von Mr Moretti selbst geführt. Er war immer aufmerksam ihr gegenüber, nannte sie signorina und erkundigte sich nach ihrer Mutter. (»Wie geht es Ihrer mamma?«) Nicht dass Mr Moretti je ihrer Mutter begegnet wäre, aber so waren die Italiener vermutlich nun mal. Begeisterter von Müttern als die Briten.
Sie antwortete immer »Sehr gut, danke, Mr Moretti«, traute sich nie signor statt »Mister« zu sagen – es erschien ihr ein zu vermessener Schritt in das linguistische Territorium einer anderen Person. Der namenlose Mann, der derzeit hinter dem Tresen stand, behauptete, Armenier zu sein, und erkundigte sich bei Julia nie nach irgendetwas, schon gar nicht nach ihrer Mutter.
Es war natürlich eine Lüge gewesen. Ihrer Mutter war es nicht gut gegangen, überhaupt nicht gut, ja, sie lag im Sterben, in der Middlesex Street, gleich ums Eck vom Moretti’s, aber Julia hatte die Ausflucht, ihre Mutter sei gesund, vorgezogen.
Bevor sie zu krank wurde, um noch zu arbeiten, war ihre Mutter Schneiderin gewesen, und Julia hatte immer gehört, wie sich die »Damen« ihrer Mutter die drei Stockwerke in ihre kleine Wohnung in Kentish Town hinaufquälten, um in ihren Korsetts und üppigen BHs steif in Habtachtstellung dazustehen, während sie mithilfe von Nadeln in Kleidungsstücke gesteckt wurden. Wenn sie unsicher auf einem dreibeinigen Schemel balancierten, hielt Julia sie manchmal fest, während ihre Mutter auf den Knien um sie herumrutschte und einen Saum absteckte. Dann ging es ihrer Mutter zu schlecht, um auch nur noch den einfachsten Saum zu nähen, und die Damen kamen nicht mehr. Julia hatte sie vermisst – sie hatten ihr die Hand getätschelt und Bonbons geschenkt und sich dafür interessiert, wie gut sie in der Schule war. (Was für eine schlaue Tochter Sie haben, Mrs Armstrong.)
Ihre Mutter hatte geknausert und gespart und bis in die Nacht gearbeitet, um Julia Schliff zu geben, sie für eine glorreiche Zukunft auf Hochglanz zu polieren, und für Ballett- und Klavier- und sogar für Sprechunterricht bei einer Frau in Kensington gezahlt. Sie hatte ein Stipendium für eine gebührenpflichtige Schule, eine Schule, die bevölkert war von entschlossenen Mädchen und noch entschlosseneren Lehrerinnen. Die Direktorin hatte vorgeschlagen, dass sie moderne Sprachen oder Jura an der Universität studieren sollte. Oder vielleicht sollte sie die Aufnahmeprüfungen für Oxbridge machen? »Sie suchen Mädchen wie dich«, hatte die Direktorin gesagt, aber nicht ausgeführt, was für eine Sorte Mädchen das war.
Julia hatte aufgehört, in diese Schule zu gehen, sich auf diese glanzvolle Zukunft vorzubereiten, damit sie ihre Mutter pflegen konnte – sie waren immer nur zu zweit gewesen –, und war nach ihrem Tod nicht dorthin zurückgekehrt. Es erschien ihr irgendwie unmöglich. Das Mädchen, das es allen recht machen wollte, die akademische Sechstklässlerin, die Linksaußen in der Hockeymannschaft spielte, die wichtigste Darstellerin des Dramaclubs war und nahezu jeden Tag in der Schule Klavier übte (weil zu Hause kein Platz für ein Klavier war), dieses Mädchen, das eine begeisterte Pfadfinderin war und Schauspiel, Musik und Kunst liebte, war von der Trauer verwandelt worden und verschwunden. Und soweit Julia wusste, war es nie zurückgekehrt.
Sie hatte sich angewöhnt, zum Moretti’s zu gehen, wann immer ihre Mutter im Krankenhaus behandelt wurde, und dort war sie auch, als ihre Mutter starb. Es war nur noch »eine Frage von Tagen«, laut dem Arzt, der ihre Mutter am Morgen im Krankenhaus in der Middlesex aufgenommen hatte. »Es ist so weit«, sagte er zu Julia. Verstand sie, was das bedeutete? Ja, sie verstand, sagte Julia. Es bedeutete, dass sie die einzige Person verlieren würde, von der sie geliebt wurde. Sie war siebzehn, und sie trauerte fast so sehr um sich selbst wie um ihre Mutter.
Da sie ihn nicht kannte, empfand Julia nichts für ihren Vater. Ihre Mutter war hinsichtlich dieses Themas immer etwas ambivalent gewesen, und Julia schien der einzige Beweis zu sein, dass er jemals existiert hatte. Er war Matrose bei der Handelsmarine gewesen, bei einem Unfall ums Leben gekommen und im Meer bestattet worden, bevor Julia geboren wurde, und obwohl sie sich manchmal seine perlengleichen Augen und korallenen Knochen heraufbeschwor, blieb sie dem Mann selbst gegenüber leidenschaftslos.
Der Tod ihrer Mutter jedoch erforderte Poetisches. Als die erste Schaufel Erde auf ihren Sarg fiel, bekam Julia kaum noch Luft. Ihre Mutter würde unter der vielen Erde ersticken, dachte sie, aber auch Julia war am Ersticken. Ihr ging ein Bild durch den Kopf – die Märtyrer, die von Steinen, die man auf sie häufte, zu Tode gedrückt wurden. Das bin ich, dachte sie, ich werde vom Verlust erdrückt. »Such nicht nach ausgefallenen Metaphern«, hatte ihre Englischlehrerin zu ihren Schulaufsätzen gesagt, doch der Tod ihrer Mutter zeigte ihr, dass es keine zu pompöse Metapher für den Schmerz gab. Er war etwas Schreckliches und verlangte nach Ausschmückung.
Am Tag, als ihre Mutter starb, war das Wetter mies gewesen, nass und windig. Julia blieb so lange wie möglich in der warmen Zuflucht vom Moretti’s. Sie aß Toast mit Käse zu Mittag – der Toast mit Käse, den Mr Moretti machte, war unvergleichlich viel besser als alles, was es zu Hause gab (»Italienischer Käse«, erklärte er. »Und italienisches Brot«) – und kämpfte sich dann unter dem Regenschirm die Charlotte Street entlang in die Middlesex. Als sie auf der Station ankam, musste sie feststellen, dass es nicht angezeigt war, irgendetwas zu glauben, was irgendjemand erzählte. Bei ihrer Mutter war es nicht mehr »eine Frage von Tagen« gewesen, sondern nur noch eine Frage von Stunden, und sie war gestorben, während Julia zu Mittag aß. Als sie die Stirn ihrer Mutter küsste, war sie noch warm, und unter den schrecklichen Krankenhausgerüchen war noch eine leise Spur ihres Parfüms – Maiglöckchen – zu riechen.
»Du hast es knapp verpasst«, sagte die Schwester, als wäre der Tod ihrer Mutter ein Bus oder der Beginn eines Theaterstücks, obwohl es tatsächlich das Ende eines Dramas war.
Und damit hatte es sich. Finito.
Und es war auch das Ende für Morettis Personal, denn nach der Kriegserklärung wurden sie alle interniert, und keiner von ihnen kehrte je zurück. Julia erfuhr, dass Mr Moretti im Sommer 1940 mit der Arandora Star zusammen mit Hunderten seiner inhaftierten Landsleute unterging. Viele von ihnen hatten wie Mr Moretti in der Gastronomie gearbeitet.
»Das ist ein verdammt ärgerliches Problem«, sagte Hartley. »Man kriegt keinen anständigen Service im Dorchester mehr.« Aber so war Hartley nun mal.
Julia wurde melancholisch, wenn sie beim Moretti’s war, und doch kam sie immer wieder. Die Verdüsterung ihrer Stimmung beim Gedanken an ihre Mutter verschaffte ihr eine Art Ballast, ein Gegengewicht zu ihrem (ihrer Meinung nach) oberflächlichen, ziemlich leichtfertigen Charakter. Ihre Mutter hatte eine Form von Wahrheit repräsentiert, von der sich Julia, wie sie wusste, in den zehn Jahren seit ihrem Tod entfernt hatte.
Sie fummelte an der Perlenkette an ihrem Hals. In jeder Perle befand sich ein winziges Sandkorn. Das war das wahre Selbst der Perle, nicht wahr? Die Schönheit der Perle war nur der armen Auster zu verdanken, die sich zu schützen versuchte. Vor dem Sandkorn. Vor der Wahrheit.
Bei »Auster« dachte sie an Lester Pelling, den jungen Tontechniker, und bei Lester dachte sie an Cyril, mit dem sie während des Kriegs zusammengearbeitet hatte. Cyril und Lester hatten viel gemeinsam. Dieser Gedanke führte zu vielen anderen, bis sie wieder bei Godfrey Toby war. Alles war miteinander verbunden, ein großes Netz, das sich über die Zeit und die Geschichte erstreckte. Forster hatte zwar gesagt, Verbindung ist alles, aber Julia dachte, dass es viel für sich hatte, diese Fäden durchzuschneiden und die Verbindungen zu kappen.
Die Perlen um ihren Hals gehörten nicht Julia, sie hatte sie der Leiche einer toten Frau abgenommen. Der Tod war natürlich auch eine Wahrheit, weil er etwas Absolutes war. Ich fürchte, sie ist schwerer, als sie aussieht. Bei drei heben wir sie hoch – eins-zwei-drei! Julia schauderte bei der Erinnerung. Am besten nicht daran denken. Am besten wahrscheinlich überhaupt nicht denken. Denken war immer ihr Verderben gewesen. Julia trank die Tasse aus und zündete sich noch eine Zigarette an.
Mr Moretti hatte ihr stets einen wunderbaren Kaffee gemacht – »wienerisch« – mit geschlagener Sahne und Zimt. Den hatte natürlich auch der Krieg kassiert, und heute offerierte Moretti’s nur mehr oder weniger untrinkbaren türkischen Kaffee. Er wurde in einem dicken Fingerhut von Tasse serviert, war bitter und körnig und wurde nur erträglich durch das Hinzufügen mehrerer Löffel Zucker. Europa und das Osmanische Reich in der Geschichte einer Tasse. Julia war verantwortlich für eine Serie für kleine Kinder mit dem Titel Wir schauen Sachen an. Sie wusste viel über Tassen. Sie hatte sie angeschaut.
Sie bestellte noch einen schrecklichen Kaffee, und um ihn nicht zu ermuntern, versuchte sie, nicht zu dem komischen kleinen Mann zu sehen, der an einem Tisch in der Ecke saß. Seitdem sie sich gesetzt hatte, starrte er sie auf extrem beunruhigende Weise immer wieder an. Wie viele im Moretti’s hatte er das schäbige Aussehen der europäischen Nachkriegsdiaspora. Er hatte etwas von einem Troll, als wäre er aus Resten zusammengesetzt. Er hätte von der Rollenbesetzung geschickt worden sein können, um einen Vertriebenen zu spielen. Eine hochgezogene Schulter, Augen wie Kieselsteine – etwas ungleich, als wäre eins ein wenig verrutscht – und pockennarbige Haut, als wäre er von Schrotkugeln getroffen worden. (Vielleicht war es so.) »Die Wunden des Krieges«, dachte Julia und freute sich über den Klang der Worte in ihrem Kopf. Es könnte der Titel eines Romans sein. Vielleicht sollte sie einen schreiben. Aber war künstlerisches Streben nicht die letzte Zuflucht der Unentschlossenen?
Julia überlegte, ob sie den komischen Mann auf die höfliche Weise englischer Frauen konfrontieren sollte – Entschuldigen Sie, kenne ich Sie? –, obwohl sie ziemlich sicher war, dass sie sich an eine so merkwürdige Person erinnern würde. Doch noch bevor sie ihn ansprechen konnte, stand er abrupt auf.
Sie war überzeugt, dass er zu ihr kommen und sie ansprechen würde, und wappnete sich für einen wie auch immer gearteten Konflikt, doch stattdessen schlurfte er zur Tür – ihr fiel auf, dass er hinkte, und statt auf einen Gehstock stützte er sich auf einen eingerollten Regenschirm. Er verschwand auf der Straße. Er hatte nicht gezahlt, aber der Armenier hinter dem Tresen blickte nur kurz auf und blieb untypisch gelassen.
Als ihr Kaffee gebracht wurde, schluckte ihn Julia wie Medizin und hoffte, er würde sie munter machen für den nachmittäglichen Ansturm, dann studierte sie wie eine Hellseherin den Boden der kleinen Tasse. Warum weigerte sich Godfrey Toby, sie wiederzuerkennen?
Er war aus einer Bank gekommen. Das war seine Tarnung gewesen – Bankangestellter. Das war wirklich clever, niemand wollte mit einem Bankangestellten über seine Arbeit sprechen. Julia hatte immer geglaubt, dass jemand, der so gewöhnlich wirkte wie Godfrey Toby, ein Geheimnis haben musste – eine aufregende Vergangenheit, eine grauenhafte Tragödie –, doch im Lauf der Zeit war ihr klar geworden, dass seine Gewöhnlichkeit sein Geheimnis war. Es war die beste Tarnung überhaupt, nicht wahr?
Julia dachte nie als »John Hazeldine« an ihn, weil er die scheinbar langweilige Welt von Godfrey Toby so durch und durch, so großartig ausfüllte.
Von Angesicht zu Angesicht war er »Mr Toby« gewesen, aber sonst nannten ihn alle nur »Godfrey«. Das bedeutete weder Vertrautheit noch Vertraulichkeit, es war einfach Gewohnheit. Sie hatten ihre Operation den »Godfrey-Fall« genannt, und in der Registratur lagen ein paar Akten, die schlicht mit »Godfrey« betitelt waren, und nicht alle von ihnen waren ordnungsgemäß mit Querverweisen versehen. Das gehörte natürlich zu den Dingen, die die Königinnen der Registratur in helle Aufregung versetzten.
Es war davon gesprochen worden, ihn nach dem Krieg ins Ausland zu schicken. Neuseeland. Irgend so etwas. Südafrika vielleicht. Um ihn zu schützen vor eventuellen Vergeltungsmaßnahmen, aber war Vergeltung – auf die eine oder andere Weise – nicht etwas, wovor sie sich alle fürchten mussten?
Und seine Informanten, die Fünfte Kolonne – was war mit ihnen? Es war geplant gewesen, sie in Friedenszeiten zu überwachen, aber Julia wusste nicht, ob der Plan je umgesetzt worden war. Sie wusste von dem Beschluss, sie nach dem Krieg in Unkenntnis zu lassen. Niemand hatte ihnen vom Doppelspiel des MI5 erzählt. Sie hatten nie erfahren, dass sie von Mikrofonen aufgenommen worden waren, die im Verputz der Wohnung am Dolphin Square steckten. Der Wohnung, die sie jede Woche so eifrig aufsuchten. Ebenso wenig ahnten sie, dass Godfrey Toby für den MI5 arbeitete und nicht der Spion der Gestapo war, dem sie ihre verräterischen Informationen zu bringen glaubten. Und sie wären überrascht gewesen, hätten sie gewusst, dass am nächsten Tag ein Mädchen an einer großen Schreibmaschine Marke Imperial in der Nachbarwohnung saß und diese verräterischen Gespräche abtippte, ein Original und zwei Durchschläge. Und dieses Mädchen war Julia gewesen, um für ihre Sünden zu büßen.
Als die Operation Ende 1944 abgewickelt wurde, erzählte man ihnen, dass er abgesetzt und nach Portugal »evakuiert« würde; tatsächlich wurde er nach Paris geschickt, um gefangen genommene deutsche Offiziere zu verhören.
Wo war Godfrey seit dem Krieg wirklich gewesen? Warum war er zurückgekehrt? Und, am rätselhaftesten von allem, warum tat er so, als würde er sie nicht kennen?
Ich kenne ihn, dachte Julia. Sie hatten während des gesamten Krieges zusammengearbeitet. Sie war obendrein bei ihm daheim – in Finchley – gewesen, wo er in einem Haus mit einer soliden Eingangstür aus Eiche und einem robusten Türklopfer aus Messing in Form eines Löwenkopfs wohnte. In einem Haus mit bleiverglasten Fenstern und Parkettböden. Sie hatte auf dem Mokettbezug seines massiven Sofas gesessen. (Kann ich Ihnen eine Tasse Tee bringen, Miss Armstrong? Würde das helfen? Das war ein ziemlicher Schock.) Sie hatte sich die Hände mit der nach Freesien duftenden Seife im Bad gewaschen, die Mäntel und Schuhe im Flurschrank gesehen. Ja, sie hatte sogar einen Blick auf den rosafarbenen Satinbezug des Daunenbetts geworfen, unter dem er und Mrs Toby (so es diese Person wirklich gab) schliefen.
Und gemeinsam hatten sie eine abscheuliche Tat begangen, die Art Tat, die einen für immer verbindet, ob es einem nun gefiel oder nicht. Verleugnete er sie deswegen jetzt? (Zwei Stück Zucker? Ja, oder, Miss Armstrong?) Oder war er deswegen zurückgekommen?
Ich hätte ihm folgen sollen, dachte sie. Aber er hätte sie abgehängt. Er war immer gut im Ausweichen gewesen.
1940
Einer von uns
Sein Name ist Godfrey Toby«, sagte Peregrine Gibbons. »Er gibt sich als Agent der deutschen Regierung aus, aber er ist natürlich einer von uns.«
Es war das erste Mal, dass Julia den Namen Godfrey Toby hörte, und sie sagte: »Er ist also kein Deutscher?«
»Um Himmels willen, nein. Es gibt niemanden, der englischer wäre als Godfrey.«
Andererseits, dachte Julia, war Peregrine Gibbons – allein schon der Name – selbst schon der Inbegriff eines Engländers.
»Und auch niemanden, der vertrauenswürdiger wäre«, sagte er. »›Godfrey‹ war lange Zeit undercover, war schon in den Dreißigerjahren bei Treffen von Faschisten und so weiter dabei. Bereits vor dem Krieg hatte er Kontakte zu Mitarbeitern von Siemens – die Siemens-Fabriken in England waren immer Tummelplatz für den deutschen Geheimdienst. Die Fünfte Kolonne kennt ihn gut, sie fühlen sich sicher mit ihm. Ich nehme an, Sie sind mit den Einzelheiten der Fünften Kolonne vertraut, Miss Armstrong?«
»Sympathisanten der Faschisten, unterstützen den Feind, Sir?«
»Genau. Subversive. Die Nordische Liga, der Link, der Right Club, die Imperial Fascist League und hundert kleinere Gruppierungen. Die Leute, die sich mit Godfrey treffen, sind überwiegend alte Mitglieder der British Union of Fascists – Mosleys Leute. Unser hausgemachtes Übel, leider. Und anstatt sie auszurotten, wollen wir sie gedeihen lassen – aber innerhalb eines ummauerten Gartens, aus dem sie nicht entkommen können, um die Samen des Bösen zu verbreiten.«
Eine junge Frau konnte auf eine Metapher wie diese hin an Altersschwäche sterben, dachte Julia. »Sehr schön ausgedrückt, Sir«, sagte sie.
Julia arbeitete seit zwei langweiligen Monaten in der Registratur, als sich ihr Peregrine Gibbons in der Kantine genähert und gesagt hatte: »Ich brauche ein Mädchen.«
Und siehe da, heute war sie hier. Sein Mädchen.
»Ich bereite einen Sondereinsatz vor«, sagte er, »eine Art Täuschungsmanöver. Sie werden eine wichtige Rolle dabei spielen.« Sollte sie als Agentin eingesetzt werden? (Als Spionin!) Nein, sie sollte offenbar an eine Schreibmaschine gekettet bleiben. »In Kriegszeiten können wir unsere Waffen nicht frei wählen, Miss Armstrong«, sagte er. Warum eigentlich nicht?, dachte Julia. Wofür würde sie sich entscheiden? Einen scharfen Säbel, einen Bogen aus flammendem Gold? Vielleicht für Pfeile des Begehrens.
Doch sie war genommen worden – erwählt. »Die Arbeit, die wir machen, erfordert eine ganz spezielle Person, Miss Armstrong«, sagte er. So wie Peregrine Gibbons (»Nennen Sie mich Perry«) sprach, fühlte man sich, als wäre man einen Tick besser als alle anderen – die Elite der Herde. Er war attraktiv, vielleicht nicht Hauptrollenmaterial, mehr Charakterdarsteller, fand sie. Er war groß und ziemlich schick, trug mit unbekümmerter Extravaganz eine Fliege zu einem zweireihigen, dreiteiligen Anzug aus Tweed mit Fischgrätmuster unter einem langen Mantel (ja, auch Tweed). Später erfuhr sie, dass er in jüngeren Jahren unter anderem Mesmerismus studiert hatte, und Julia fragte sich, ob er Leute hypnotisierte, ohne dass sie es merkten. Sollte sie der Trilby zu seinem Svengali sein? (Sie musste immer an den Hut denken. Es schien absurd.)
Und jetzt waren sie hier in Pimlico, am Dolphin Square, wo er ihr »die Falle« zeigen wollte. Er hatte zwei benachbarte Wohnungen gemietet. »Abschottung ist die beste Form von Geheimhaltung«, sagte er. »Mosley hat hier eine Wohnung«, sagte er. »Er ist einer unserer Nachbarn.« Das schien ihn zu amüsieren. »Auf Tuchfühlung mit dem Feind.«
Die Wohnblocks am Dolphin Square waren erst ein paar Jahre zuvor errichtet worden, nahe der Themse, und bislang hatte Julia den Komplex nur von außen gesehen. Er bot einen Respekt einflößenden Anblick, wenn man ihn durch die großen Torbögen am Fluss betrat – zehn Blocks mit Wohnungen, jeder zehn Stockwerke hoch, gebaut um einen viereckigen Hof mit Bäumen und Blumenbeeten und einen im Winter stillgelegten Springbrunnen. »In Planung und Ausführung ziemlich sowjetisch, finden Sie nicht auch?«, sagte Perry.
»Vermutlich«, sagte Julia, obwohl sie nicht glaubte, dass die Russen ihre Wohntürme nach legendären britischen Admirälen und Kapitänen benannten – Beatty, Collingwood, Drake und so weiter.
Ihre Wohnungen befanden sich im Nelson House, erklärte Perry. In einer Wohnung wollte er wohnen und arbeiten – auch Julia sollte dort arbeiten –, und in der Wohnung nebenan würde sich ein Mitarbeiter des MI5 – Godfrey Toby – als Nazi-Spion ausgeben und Sympathisanten der Faschisten ermuntern, ihm Bericht zu erstatten. »Wenn sie Godfrey ihre Geheimnisse erzählen«, sagte Perry, »dann erzählen sie sie nicht den Deutschen. Godfrey wird als Rohr fungieren, das ihren Verrat in unsere Zisterne umleitet.« Metaphern waren definitiv nicht seine Stärke.
»Und einer wird uns zum nächsten führen und so weiter«, fuhr er fort. »Das Schöne daran ist, dass sie das Zusammentreiben selbst übernehmen.«
Perry hatte die Wohnung bereits bezogen – Julia konnte einen kurzen Blick auf sein Rasierzeug auf der Ablage über dem Waschbecken in dem winzigen Bad werfen, und durch eine halb offen stehende Tür sah sie ein weißes Hemd auf einem Kleiderbügel an der Schranktür hängen – schwerer Köper guter Qualität, wie sie bemerkte, den ihre Mutter gutgeheißen hätte. Der Rest des Zimmers wirkte allerdings so streng wie eine Mönchszelle. »Ich habe natürlich woanders noch eine Wohnung«, sagte er. »In der Petty France, aber dieses Arrangement ist zweckdienlich für Godfreys Operation. Und es gibt hier alles, was wir brauchen – ein Restaurant, ein Einkaufszentrum, ein Schwimmbad, sogar unseren eigenen Taxidienst.«
Das Wohnzimmer der Wohnung war in ein Büro umgewandelt worden, doch zu ihrer Erleichterung stellte Julia fest, dass noch immer ein tröstliches kleines Sofa darin stand. Peregrine Gibbons’ Schreibtisch war ein Ungeheuer von einem Sekretär, ein vielgestaltiges Konstrukt aus herausziehbaren Fächern, winzigen Kästchen und zahllosen Schubladen voller Papierklemmen, Gummibänder, Reißzwecken und so weiter, alles pedantisch sortiert und geordnet von Perry höchstpersönlich. Er war von der ordentlichen Sorte. Und ich bin unordentlich, dachte sie bedauernd. Es zöge zwangsläufig Ärger nach sich.
Der einzige Ziergegenstand auf seinem Sekretär war eine kleine, schwere Büste von Beethoven, der Julia wütend anstarrte, wenn sie an ihrem eigenen Schreibtisch saß – ein Möbelstück, das, verglichen mit Perrys, nichts weiter als ein armseliger Tisch war.
»Mögen Sie Beethoven, Sir?«, fragte sie.
»Nicht besonders«, sagte er scheinbar verwundert über die Frage. »Er gibt allerdings einen guten Briefbeschwerer ab.«
»Darüber würde er sich sicherlich freuen, Sir.« Sie sah, dass Perry kurz die Stirn runzelte, und dachte: Ich muss meine Neigung zur Ungezwungenheit in Zaum halten. Sie schien ihn zu verwirren.
»Und natürlich«, fuhr Perry fort und hielt einen Augenblick inne, als wollte er warten, ob sie noch mehr Unwesentliches zu sagen hatte, »werden Sie abgesehen von unserer kleinen Operation« (unserer, dachte sie und freute sich über das Possessivpronomen) »noch allgemeine Büropflichten für mich übernehmen. Ich leite noch weitere Einsätze, aber keine Sorge, ich werde Sie nicht übermäßig belasten.« (Stimmte nicht!) »Ich tippe meine Berichte gern selbst.« (Tat er nicht.) »Je weniger Leute etwas sehen, umso besser. Abschottung ist die beste Form der Geheimhaltung.« Das haben Sie schon gesagt, dachte Julia. Er musste ganz angetan davon sein.
Es waren attraktive Aussichten gewesen. Im letzten Monat hatte sie in einem Gefängnis gearbeitet – der MI5 war nach Wormwood Scrubs umgezogen, um die expandierenden Ränge unterzubringen, die der Krieg nötig machte. Es war ein unangenehmer Ort zum Arbeiten. Den ganzen Tag lang klapperten Leute die offenen eisernen Treppen hinauf und hinunter. Dem weiblichen Personal war sogar die Sondererlaubnis erteilt worden, Hosen zu tragen, weil die Männer unter ihre Röcke schauen konnten, wenn sie die Treppen hinaufgingen. Und »Damen« waren überhaupt keine Damentoiletten, sondern grässliche Orte für Häftlinge mit Schwingtüren, hinter denen man von der Brust aufwärts und den Knien abwärts für alle sichtbar war. Die Zellen wurden als Büros genutzt, und ständig wurde jemand aus Versehen eingesperrt.
Pimlico hatte im Vergleich dazu wie ein attraktiver Vorschlag geklungen. Und dennoch. Dieses viele Gerede von Abschottung und Geheimhaltung – sollte sie auch hier eingesperrt werden?
Es erschien seltsam, dass sie ihren Arbeitstag in so großer Nähe zu Perry Gibbons’ häuslichen Arrangements verbringen sollte – nur einen Atemzug entfernt von seinem Schlafzimmer, ganz zu schweigen von den intimeren Verrichtungen seines Alltags. Was, wenn sie im Bad auf seine zum Trocknen aufgehängte Unterwäsche stoßen oder seinen geräucherten Schellfisch vom Vorabend riechen sollte? Oder – schlimmer noch – wenn sie hören würde, wie er die Toilette benutzte (oder – o Horror – umgekehrt!). Das könnte sie nicht ertragen. Aber natürlich wurde seine Wäsche woanders gewaschen, und er kochte nie. Was die Toilette betraf, schien er sowohl seine Körperfunktionen als auch ihre nicht zu bemerken.
Sie fragte sich, ob es letztlich nicht besser gewesen wäre, in der Registratur zu bleiben. Nicht dass sie die Wahl gehabt hätte. Entscheidungsfreiheit war eins der ersten Opfer des Kriegs.
Julia hatte sich nicht beim Geheimdienst beworben, sie hatte sich bei den Streitkräften melden wollen, nicht notwendigerweise aus Patriotismus, sondern weil sie erschöpft davon war, nach dem Tod ihrer Mutter monatelang für sich selbst sorgen zu müssen. Aber nach der Kriegserklärung war sie zu einem Vorstellungsgespräch aufgefordert worden, und die Aufforderung erfolgte auf dem Briefpapier der Regierung, deswegen musste sie ihr wohl Folge leisten.
Sie war nervös, als sie ankam, weil ihr Bus direkt am Piccadilly Circus den Geist aufgegeben hatte und sie die ganze Strecke zu einem obskuren Büro in einem noch obskureren Gebäude in der Pall Mall hatte zu Fuß gehen müssen. Erst nachdem sie das Gebäude davor durchquert hatte, fand sie den Eingang. Sie fragte sich, ob es eine Art Test war. »Passamt« stand auf einem kleinen Messingschild an der Tür, aber niemand wollte einen Pass haben oder gab Pässe aus.
Julia hatte den Namen des Mannes, der mit ihr sprach, nicht wirklich verstanden (Morton?). Er lehnte sich – ziemlich nonchalant – auf seinem Stuhl zurück, als würde er erwarten, dass sie ihn unterhielt. Er führe normalerweise keine Vorstellungsgespräche, sagte er, aber Miss Dicker sei indisponiert. Julia hatte keine Ahnung, wer Miss Dicker war.
»Julia?«, sagte der Mann nachdenklich. »Wie in Romeo und Julia? Sehr romantisch«, sagte er und lachte, als wäre es ein Witz, den nur er verstand.
»Soweit ich weiß, war es eine Tragödie, Sir.«
»Ist das etwas anderes?«
Er war nicht alt, aber er sah auch nicht mehr jung aus, hatte vielleicht noch nie jung ausgesehen. Er wirkte wie ein Ästhet und war dünn, nahezu lang gestreckt – ein Reiher oder ein Storch. Er schien sich über alles zu amüsieren, was sie – und er selbst – sagte. Er griff nach einer Pfeife, die auf seinem Schreibtisch lag, und zündete sie an, ließ sich Zeit dabei, paffte und stopfte und saugte und vollführte alle anderen seltsamen Rituale, die Pfeifenraucher offenbar für notwendig halten, bevor er sagte: »Erzählen Sie mir von Ihrem Vater.«
»Meinem Vater?«
»Ihrem Vater.«
»Er ist tot.« Es folgte ein Schweigen, und sie nahm an, dass sie es füllen sollte. »Er wurde auf See bestattet«, lautete ihr Angebot.
»Wirklich? Königliche Marine?«
»Nein, Handelsmarine«, sagte sie.
»Ah.« Er zog eine Augenbraue in die Höhe.
Sie mochte diese herablassende Augenbraue nicht, weswegen sie ihren unergründlichen Vater beförderte. »Er war Offizier.«
»Selbstverständlich«, sagte er. »Und Ihre Mutter? Wie geht es ihr?«
»Es geht ihr sehr gut, danke«, antwortete Julia automatisch. Sie spürte das Einsetzen von Kopfschmerzen. Ihre Mutter hatte immer gesagt, dass sie zu viel nachdachte. Julia hielt es für möglich, dass sie nicht genug nachdachte. Die Erwähnung ihrer Mutter legte ihr einen weiteren Stein aufs Herz. Ihre Mutter war in ihrem Leben immer noch eher eine Präsenz als eine Absenz. Julia nahm an, dass es eines Tages in der Zukunft umgekehrt wäre, aber sie bezweifelte, dass das eine Verbesserung darstellte.
»Wie ich sehe, sind Sie auf eine gute Schule gegangen«, sagte der Mann. (Marsden?) »Und eine ziemlich teure – für Ihre Mutter, nehme ich an. Sie nimmt Näharbeiten an, nicht wahr? Eine Näherin.«
»Eine Schneiderin, das ist etwas anderes.«
»Ja? Ich kenne mich da nicht aus.« (Sie hatte das Gefühl, dass er sich sehr wohl auskannte.) »Sie müssen sich gefragt haben, wie sie sich die Gebühren leisten konnte.«
»Ich hatte ein Stipendium.«
»Wie haben Sie sich da gefühlt?«
»Gefühlt?«
»Minderwertig?«
»Minderwertig? Selbstverständlich nicht.«
»Mögen Sie Malerei?«, fragte er unvermittelt zu ihrer Überraschung.
»Malerei?« Was meinte er damit? In der Schule hatte sie eine begeisterte Kunsterzieherin, Miss Gillies, unter ihre Fittiche genommen. (»Du hast ein Auge dafür«, hatte Miss Gillies gesagt. Ich habe zwei, hatte sie gedacht.) Vor dem Tod ihrer Mutter war sie oft in die National Gallery gegangen. Sie mochte weder Fragonard noch Watteau noch das ganze hübsche französische Zeug, das in jedem Sansculotte, der etwas auf sich hielt, den Wunsch aufwallen ließ, jemandem den Kopf abzuschlagen. Ähnliches galt für Gainsborough und seine reichen Aristokraten, die selbstgefällig in ihren großartigen Landschaften posierten. Und Rembrandt, den sie besonders unsympathisch fand. Was war so wunderbar an einem hässlichen alten Mann, der sich die ganze Zeit selbst malte?
Vielleicht mochte sie Malerei nicht, jedenfalls hatte sie eine eindeutige Meinung dazu. »Natürlich mag ich Malerei«, sagte sie. »Tun das nicht alle?«
»Nun – Sie wären überrascht. Jemand Speziellen?«
»Rembrandt«, sagte sie und legte in einer Geste der Ergebenheit die Hand aufs Herz. Sie mochte Vermeer, wollte das jedoch keinem Fremden anvertrauen. »Ich verehre Vermeer«, hatte sie einmal zu Miss Gillies gesagt. Es schien ewig her.
»Was ist mit Sprachen?«
»Ob ich sie mag?«
»Ob Sie sie sprechen.« Er biss auf den Stiel seiner Pfeife, als wäre es der Beißring eines Babys.
Oh, um Himmels willen, dachte sie. Sie staunte, was für widersprüchliche Gefühle sie für diesen Mann empfand. Später erfuhr sie, dass das seine Stärke war. Er war Verhörspezialist, obwohl es reiner Zufall schien, dass er sich freiwillig dafür gemeldet hatte, an diesem Nachmittag Miss Dicker zu vertreten.
»Nicht wirklich«, sagte sie.
»Wirklich? Keine Sprachen? Kein Französisch oder ein bisschen Deutsch?«
»Kaum.«
»Was ist mit einem Musikinstrument? Spielen Sie eins?«
»Nein.«
»Nicht einmal ein bisschen Klavier?«
Bevor sie es ein weiteres Mal bestreiten konnte, klopfte jemand an die Tür, und eine Frau steckte den Kopf herein und sagte: »Mr Merton.« (Merton!) »Colonel Lightwater würde gern mit Ihnen sprechen, sobald Sie Zeit haben.«
»Sagen Sie ihm, dass ich in zehn Minuten bei ihm bin.«
Meine Güte, noch weitere zehn Minuten Kreuzverhör, dachte Julia.
»So …«, sagte er – ein kleines Wort, das mit Bedeutung befrachtet schien. Weiteres Hantieren mit der Pfeife vergrößerte die Last. Hatte das Kriegsministerium Wörter rationiert?, fragte sie sich. »Sie sind achtzehn?« Aus seinem Mund klang es wie ein Vorwurf.
»Das bin ich.«
»Ziemlich weit für Ihr Alter, finden Sie nicht?«
War das eine Beleidigung? »Nein, ganz und gar nicht«, antwortete sie bestimmt. »Ich bin absoluter Durchschnitt für mein Alter.«
Er lachte, ein ungeheucheltes Bellen der Heiterkeit, schaute auf Papiere auf seinem Schreibtisch, dann starrte er sie an und sagte: »St-James’s-Sekretärinnen-College?«
Auf das St James’s gingen wohlerzogene Mädchen. Seit dem Tod ihrer Mutter hatte Julia abends einen Kurs in einem maroden College in Paddington absolviert, während sie tagsüber als Zimmermädchen in einem ebenso maroden Hotel in Fitzrovia arbeitete. Sie war durch die Pforten von St James’s gegangen, um sich nach den Gebühren zu erkundigen, deswegen fühlte sie sich gerechtfertigt, jetzt zu sagen: »Ja, ich habe dort angefangen, aber woanders abgeschlossen.«
»Und haben Sie?«
»Habe ich was?«
»Abgeschlossen?«
»Ja. Danke.«
»Gute Geschwindigkeit?«
»Wie bitte?« Julia war verwirrt, es klang, als würde er sie fortschicken. (Gott sei mit dir?) Weil er nicht glaubte, dass sie abgeschlossen war. Sie war es nicht. Sie war extrem unabgeschlossen, ihrer eigenen Ansicht nach.
»Geschwindigkeit – beim Schreibmaschineschreiben und so weiter«, sagte er und fuchtelte mit der Pfeife herum. Er hatte keine Ahnung, dachte Julia.
»Ah, Geschwindigkeit«, sagte sie. »Ja. Sie ist gut. Ich habe Zeugnisse.« Sie führte nicht weiter aus – er brachte sie dazu, störrisch und unkooperativ zu sein. Nicht die beste Einstellung bei einem Vorstellungsgespräch, vermutete sie. Aber sie wollte auch keinen Bürojob.
»Noch etwas, das Sie mir über sich erzählen wollen?«
»Nein. Nicht wirklich, Sir.«
Er schien enttäuscht.
Und dann fragte er sie auf beiläufige Weise, als würde er sie fragen, ob sie lieber Brot oder Kartoffeln aß oder ob ihr Rot lieber war als Grün: »Wenn Sie sich entscheiden müssten, was wären Sie lieber – eine Kommunistin oder eine Faschistin?«
»Das ist keine besonders gute Auswahl, oder, Sir?«
»Sie müssen sich entscheiden. Jemand hält Ihnen eine Pistole an den Kopf.«
»Ich könnte mich dafür entscheiden, erschossen zu werden?« (Wer hielt die Pistole?, fragte sie sich.)
»Nein, das können Sie nicht. Sie müssen sich für das eine oder das andere entscheiden.«
Der Kommunismus erschien Julia als die freundlichere Doktrin. »Faschismus«, bluffte sie. Er lachte.
Er wollte etwas aus ihr herauskitzeln, aber sie wusste nicht, was. Sie könnte zum Mittagessen in ein Lyons gehen, dachte sie. Sich verwöhnen. Niemand sonst tat es.
Merton überraschte sie, indem er plötzlich aufstand und um seinen Schreibtisch zu ihr ging. Auch Julia stand auf, wich etwas zurück. Er kam näher, und Julia war unsicher, was er vorhatte. Einen panischen Augenblick lang dachte sie, dass er sie küssen wollte. Was würde sie dann tun? Im Hotel in Fitzrovia wurde ihr viel unerwünschte Aufmerksamkeit zuteil, etliche Gäste waren Handlungsreisende, weit weg von ihren Frauen, und normalerweise konnte sie sich ihrer mit einem heftigen Tritt gegen das Schienbein erwehren. Aber Merton arbeitete für die Regierung. Sie könnte sich womöglich strafbar machen, wenn sie ihn trat. Vielleicht wäre es sogar irgendeine Art Verrat.
Er hielt ihr die Hand hin, und ihr wurde klar, dass er darauf wartete, dass sie sie schüttelte. »Ich bin sicher, Miss Dicker wird Ihre Zeugnisse und so weiter überprüfen und Sie vereidigen.«
Sie bekam also den Job? War es so?
»Natürlich«, sagte er. »Sie hatten den Job schon, bevor Sie durch die Tür gekommen sind, Miss Armstrong. Ich musste nur die richtigen Fragen stellen. Um mich zu vergewissern, dass Sie ehrenwert und aufrichtig sind. Und so weiter.«





![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)