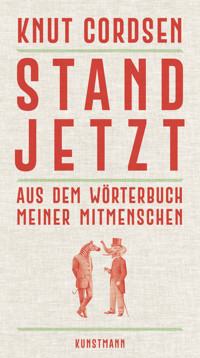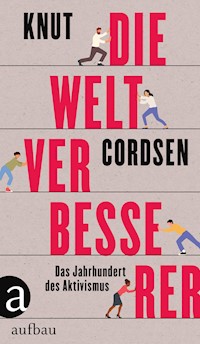
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frisst der Aktivismus seine eigenen Kinder?
Knut Cordsen setzt den Aktivismus der Gegenwart – von »Fridays for Future« bis zu Greenpeace im Außenministerium – in einen historischen Kontext. Sein Buch ist reich an Lehren, die Aktivist:innen aus ihrer gut 100-jährigen Geschichte ziehen sollten.
»Dies ist ein mitreißendes Buch über die Kunst, andere mitzureißen. Es erzählt mit feinem Humor und tiefer Sachkenntnis von einem Jahrhundert voll Aktivisten: Knut Cordsen zeigt, warum die Sehnsucht, die Welt zu retten, gerade bei uns Deutschen immer so riesig ist – und warum sich die Welt immer so trotzig dagegen wehrt.«Florian Illies.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Knut Cordsen besichtigt ein Jahrhundertphänomen. Er setzt ein mit einem Aktivistenkongress im Jahre 1919, an dem Robert Musil am Ende doch nicht teilnahm. Und er endet mit den Cancel-Culture-Debatten der Gegenwart. Indem er die aktivistische Arbeit zu Rassismus, Gender oder Klimawandel in einen historischen Kontext setzt, lässt er uns verstehen, welche Dogmen dem Aktivismus notwendig innewohnen – und wo die Gesellschaft vom Siegeszug aktivistischer Bewegungen profitiert. Cordsen entwirft eine Typologie der Akivist:innen, trennt Spreu von Weizen – und vermag so die Orte in Licht zu tauchen, an denen sich der »Irrtum des Aktivismus« wiederholt, den Walter Benjamin schon im Jahr 1932 konstatiert hatte.
»Jeder möchte heute einen aktivistischen Beitrag leisten, oft auf Kosten anderer Aktivisten. Ob sich die Erde davon nachhaltig beeindrucken lässt, ist noch nicht ausgemacht. Knut Cordsen bringt mit ruhiger Hand Ordnung in die Aktivistische Internationale.« Michael Krüger
Über Knut Cordsen
Knut Cordsen, geboren 1972 in Kiel, besuchte in München die Deutsche Journalistenschule und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität Kommunikationswissenschaften, Politologie und Soziologie. Seit 1997 arbeitet er in der Kulturredaktion des BR und für andere ARD-Anstalten - als Literaturkritiker und Moderator der Sendungen "kulturWelt" und "Diwan. Das Büchermagazin" (Bayern2).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Knut Cordsen
Die Weltverbesserer
Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Willkommen in einer Weltära
Wozu Aktivismus?
Das Jahrhundert des Aktivismus
Der »Gesamtdeutsche Aktivisten-Kongress« 1919
Die große Spielwiese des Aktivismus. Ein kleines Florilegium
Als Aktivisten noch Kohlekumpel waren
Journalismus und Aktivismus
Was tun, sprach Beuys. Über Artivismus
Er kann links wie rechts, der Aktivismus
Die Studentenrevolte 1968
»Entrüsteriche« in der Twitteria
Auch an der Börse hoch im Kurs. Über aktivistische Aktionäre
Die tun was
Der Gelehrte als Gefährte
Der hedonistische Aktivist
Allzeit sprungbereit? Die Zukunft des Aktivismus
Impressum
Willkommen in einer Weltära
Gerade eben noch waren es doch nur einige wenige. Als Umwelt-, Menschenrechts- und Friedensaktivisten traten sie vereinzelt in Erscheinung. Ihre Ziele waren hehr und aller Ehren wert, ob sie Bootsflüchtlinge retteten, für die Gleichberechtigung der Geschlechter, für zu Unrecht Inhaftierte, das Existenzrecht indigener Völker oder Abrüstung stritten. Sie hießen Rupert Neudeck, Petra Kelly und Rüdiger Nehberg, sie blicken so wie Alice Schwarzer, Amnesty International oder Greenpeace auf eine stolze und grosso modo erfolgreiche Geschichte zurück. In den 70er-, 80er-, 90er-, selbst in den sogenannten Nullerjahren noch war ihre Anzahl übersichtlich und ihre Mittel waren begrenzt. Das Verb »aktivieren« hörte man damals höchstens in der Serie »Raumschiff Enterprise«, wenn von der Kommandobrücke der Befehl an den Bordcomputer ausgegeben wurde, die Schutzschilde zu aktivieren. Heute aktivieren wir nicht allein jeden Tag den Virenschutz, Benutzerkonten oder Cookies. Wir kommen denen, die uns in welcher Angelegenheit auch immer aktivieren wollen, nicht mehr aus. Aktivisten demonstrieren, mobilisieren, emotionalisieren auf allen ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen. Es gehört zudem mittlerweile zum guten Ton, sein gutes Tun öffentlich auszuweisen und sich entsprechend als Aktivistin oder Aktivist vorzustellen. Jeder Schauspieler, der etwas auf sich hält, inszeniert sich neuerdings ganz natürlich als Aktivist. Musiker bemühen sich auf einmal um eine aktivistische Note, Comedians ebenso. War früher »Intellektueller« ein begehrtes Adelsprädikat, wird nun auch in Autorenkreisen die Nomenklatur »Aktivist« bevorzugt. Man engagiert sich nicht nur, man ist kampagnenfähig. Man beherrscht den öffentlichen Diskurs. Der Aktivismus ist ein flächendeckendes Phänomen geworden. Auf der Straße, vor allem aber im Netz. Nicht umsonst heißt eine wichtige Internetplattform »WeAct«. Hier werden Forderungen erhoben und im Dreischritt umgesetzt: »Petition starten – Unterschriften sammeln – Politik verändern«.
Von Jean-Paul Sartre stammt der Satz, die Jugend sei das Alter des Ressentiments. Sie ist auch das Alter der Revolte. Selten ist uns das eindrucksvoller vor Augen geführt worden als bei Greta Thunbergs »How dare you?«-Rede auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen 2019, gerichtet an die dort in New York versammelten Staatsoberhäupter. Selten auch hat eine unlängst erst volljährig gewordene Aktivistin ein derart erlöserinnenhafter Nimbus umgeben wie die junge Schwedin, die es binnen kürzester Zeit im Verbund mit anderen vermocht hat, mit »Fridays for Future« eine weltweite Bewegung zu etablieren. Den omnipräsenten Klimaaktivisten und ihrem existenziellen Anliegen gesellen sich jede Menge anderer Aktivisten zur Seite: seien es Kunst-Aktivisten – sogenannte »Artivisten« – wie das »Zentrum für Politische Schönheit«, Bildungsaktivisten, spirituelle Aktivisten, die einen »sacred activism« verfolgen, oder auch – der Spaß soll bei alledem nicht zu kurz kommen – »Vergnügungsaktivisten«. Denn auch diese Spielart gibt es, den »pleasure activism«. Diversität hat sich der Aktivismus auf die Fahnen geschrieben, und er lebt sie auch. Tierschutz, Datenschutz und auch Heimatschutz haben jeweils eigene Aktivisten. »Strickguerilla«-Aktivisten »umgarnen« Laternenpfähle, Schilder und Poller im öffentlichen Raum als Zeichen des Protests. Was sich früher noch Sozialarbeiterin nannte, firmiert nun unter »Armutsaktivistin«. Sogar von einer »Möbelaktivistin« war schon zu lesen, die als Handwerkerin ausgedienten Hausrat aufarbeitet und umgestaltet. Um Umgestaltung geht es allen. Queere und postkoloniale Aktivisten treten für geschlechtliche Vielfalt und ein zeitgemäßes, nicht länger herrenmenschelndes Geschichtsbild ein, stürzen alte Denkmäler vom Sockel und errichten ihren Vorreitern neue Standbilder. Kippten 2020 »Black Lives Matter«-Aktivisten unter Applaus die 125 Jahre alte Statue des Sklavenhändlers und Kaufmanns Edward Colston ins Bristoler Hafenbecken, so wurde 2021 im New Yorker Greenwich Village eine Bronzebüste der schwarzen Dragqueen und Transgender-Aktivistin Marsha P. Johnson feierlich eingeweiht – im Christopher Park, nur einen Steinwurf entfernt vom »Stonewall Inn«, jener Nachtbar, in der 1969 die LGBTQ-Bewegung ihren Ausgang nahm. Der Siegeszug des Aktivismus ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er vom Kapitalismus vereinnahmt wird. Anfang 2022 kam eine neue Barbie-Puppe auf den Markt: Ida B. Wells, die afroamerikanische Journalistin, Anti-Rassismus-Aktivistin und Mitbegründerin der Bürgerrechtsorganisation »National Association for the Advancement of Colored People«, wurde damit in die Reihe »inspirierender Frauen« aufgenommen, die der Spielzeughersteller Mattel neuerdings mit einer eigenen Barbie würdigt.
Keine Nachrichtensendung kommt heute mehr ohne sie oder ihn aus, keine Talkshow und kein ach so soziales Medium. Im Sommer 2021 hat sich in Hamburg gar eine »Aktivistinnen-Agentur« gegründet, betrieben, natürlich, von einer Vollblut-Aktivistin. Sie bietet Trainings an. Denn auch der Aktivist will gecoacht sein. Wenn es noch eines Beweises seiner Wirkmacht bedurft hätte, so lieferte den im Herbst 2021 das amerikanische Fernsehnetzwerk CBS. Dort wollte man ein neues Reality‑TV-Format ausstrahlen unter dem Titel »The Activist«. Eine sogenannte »Challenge Show«. Darin sollten verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten mit ihren jeweiligen gemeinnützigen Projekten gegeneinander antreten. Die Zuschauer sollten online die Bemühungen der Kandidaten beurteilen, die versuchen, »echte Veränderung in einem von drei lebenswichtigen globalen Bereichen herbeizuführen: Gesundheit, Bildung und Umwelt«. Wie nicht anders zu erwarten war, scheiterte das Projekt – am lautstarken Protest von Aktivisten, unter ihnen Naomi Klein. »Könnten sie das Geld nicht direkt an Aktivisten geben, anstatt Aktivismus in ein Spiel zu verwandeln und einen Bruchteil des benötigten Geldes in einen ›Preis‹ zu investieren? Menschen sterben«, sekundierte die Schauspielerin und feministische Aktivistin Jameela Jamil auf Twitter. Die Produzenten des obskuren televisionären Schaulaufens machten einen Rückzieher, ja mehr als das: sie machten einen Kotau und verbreiteten eine wortreiche Bitte um Entschuldigung. Es sei falsch gewesen, die ehrenwerte Arbeit der »unglaublichen« Aktivistinnen und Aktivisten derart in Konkurrenz zueinander zu setzen, der Aktivismus sei nicht kompetitiv, ihm gehe es um »Kollaboration und Kooperation«. Kurze Zeit später wurden vier verschiedene Aktivisten aus Kamerun, Russland, Kanada und Indien in Stockholm mit dem Alternativen Nobelpreis bedacht.
Die »Aktivisti«, wie sie sich gern selbst bezeichnen, verfügen nicht allein über ein enormes aufmerksamkeitsökonomisches Kapital, sie sind die Bewusstseinsgroßindustriellen unserer Tage. Dem philosophischen Zeitdiagnostiker Peter Sloterdijk mag derlei schon 2001 gedämmert haben. Er ließ damals mit der Bemerkung aufhorchen: »Man könnte sagen, eine Weltära der überwiegenden Seinspassivität geht zu Ende und eine Ära des Aktivismus beginnt …« Diese Ära, die man mit dem in Aktivistenkreisen weitverbreiteten Pathos umstandslos eine »Weltära« taufen kann, währt indessen schon viel länger als gemeinhin angenommen. Über hundert Jahre schon, und es spricht vieles dafür, dass der Aktivismus eine deutsche Wortprägung und Idee ist. »Jede Zeit bringt ihre eigenen Schlagworte hervor«, hebt am 1. März 1918 die Erklärung eines späteren Friedensnobelpreisträgers an: »Seit Jahresfrist oder – ich weiß wirklich nicht wie lange – durchzuckt die deutsche Öffentlichkeit das Schlagwort Aktivismus, begierig aufgegriffen von der literarischen Jugend … Was haben wir in dem Worte zu suchen? Sehnsucht nach Taten, Wille, zu wirken, Tagespolitik mit geistiger Kraft zu durchsetzen, Abkehr von intellektuellem Chinesentume. Das Losungswort einer neuen Jugend also.« So hat das Carl von Ossietzky seinerzeit in den »Monatlichen Mitteilungen des Deutschen Monistenbundes« formuliert. Sein Artikel »Ein Wort über Aktivismus« schloss in dramatischem Tremolo: »Unser Pfad ist vorgezeichnet: er führt entweder in einen Tempelbau, groß genug, ganze Völker zu umfassen – oder in den bescheidenen Raum eines Klubhauses, in dem zweimal monatlich eine kleine Sekte kannegießert.«
Der Aktivismus hat den Weg fern der Stammtische eingeschlagen, auch wenn er seit jeher nicht frei davon ist, sich in Parolen zu ergehen. Was für einen prägenden Aktivisten der ersten Stunde, den »logokratischen Aktivisten« Kurt Hiller, 1920 das »Pachulkenregime« der Mächtigen war (womit der vernunftverliebte Berliner die geistesfernen Lümmel da oben meinte), ist 2021 für den »konstruktiven Inklusionsaktivisten« Raul Krauthausen, der sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung stark macht, »dieses kriminelle, gierige Konstrukt aus Wirtschaft und Politik«. Doch der Status des Aktivisten hat sich in den vergangenen hundert Jahren fundamental verändert. Er ist von der Randfigur zur bestimmenden Sozialfigur geworden. Während sich die frühen Aktivisten sowie jene der mittleren Generation, die studentischen Aktivisten der außerparlamentarischen 68er-Generation, noch in einer Außenseiterposition befanden, nimmt der zeitgenössische Aktivist eine zentrale Stellung innerhalb der Gesellschaft ein, was man auch daran ablesen kann, dass 2021 einige Aktivistinnen und Aktivisten als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Wovon Heinrich Mann als einer der ersten Aktivisten 1918 nur träumen konnte – »Gruppen der Tat sind schon da in den Städten Deutschlands, gebildet aus lauter Jugend«, schrieb er hoffnungsfroh über »Das junge Geschlecht« der Zwanzigjährigen –, ist mit »Fridays for Future« Realität geworden. Das Ziel damals wie heute ist es, mit Heinrich Manns Worten, »der ›Realpolitik‹ der Gealterten« »große Wandlung, tiefe Erneuerung«, ja »Besserung« entgegenzusetzen. Der moderne Aktivist entfacht Debatten und treibt sie voran, er wird gehört und ernst genommen. Unvermeidlich, dass er sich im Zuge seines Bedeutungszugewinns professionalisieren musste. Berufsaktivisten sind heute so selbstverständlich wie Berufspolitiker. Selbst eine Berufskrankheit hat man sich zugelegt. »Activist Burn-out« wird diagnostiziert bei jenen, die sich verausgaben im Kampf für eine bessere, gerechtere Welt. Aktivismus ist ein Full-Time-Job geworden. Um Erschöpfung und Frustration vorzubeugen, werden Seminare über »Mindful Activism« angeboten.
Da erscheint es sinnvoll, diese Jahrhundertfigur näher zu beleuchten. Angefangen bei den künstlerischen Wurzeln des Aktivismus und der vergleichsweise geringen Resonanz, unter welcher die ersten Aktivisten litten. Einige von ihnen versammelten sich 1919 zum ersten und vorläufig letzten »Gesamtdeutschen Aktivisten-Kongress« in Berlin. Schon deren kulturrevolutionär gestimmte Teilnehmer waren der Auffassung, dass ihren Gegnern einzig daran gelegen sei, »die Umwandlung der bestehenden Gesellschaftsordnung in eine vernünftige hinauszuzögern«, wie sie in ihrer abschließenden Resolution beklagten. Eine Tatsache, mit der sich Aktivisten bis heute herumplagen müssen: Die Gesellschaft, diese fürchterlich träge Masse, will ihren Forderungen nie so rasch Folge leisten wie erwünscht. Darüber hinaus begleitet den Aktivismus seit seinem Beginn der Verdacht des »Scheinaktivismus«, wie das der hellsichtige Georg Lukács schon 1934 nannte. Der Scheinaktivismus unserer Tage heißt »Slacktivism«. Schließlich kann auch der Faulenzer (»slacker«) sich und anderen bequem Aktivismus vorgaukeln – per Like, Retweet oder auch durch ein regenbogenfarbenes Profilbild auf Instagram und Facebook. Ein Hashtag ist noch keine Haltung, von einer Handlung ganz zu schweigen.
Noch eine weitere Beobachtung von Georg Lukács bewahrheitet sich heute. Die Feststellung nämlich, dass der Aktivismus seinem Wesen nach sozialistischen Geistern ebenso verführerisch winkt wie faschistischen. Heute bilden die beiden Enden des politischen Spektrums der linksradikale »Ende Gelände«-Aktivismus einerseits, der im Tagebau Bagger besetzt, und der rechtsextreme »nationale Aktivismus« der Identitären Bewegung andererseits, der die Angst vor »Überfremdung« schürt. Bevor jetzt einige gleich den üblichen Reflexen gehorchend »Hufeisen« rufen und betonen, dass diese Extremismen doch kaum etwas verbindet: Es war Joseph Goebbels, der 1933 im Propagandaministerium die »Zentralstelle für geistigen Aktivismus« einrichtete. Der Nationalsozialismus hat den Aktivismus schon früh für sich entdeckt. Auch er wollte den Menschen zu einer Art progresspflichtigem Wesen erklären – fortschrittlich im Sinne der »Volksgesundheit«. Diese politische Bipolarität mag erstaunen. Allein: »Die Gabe, Paradoxe auszuhalten, ist nicht der unwichtigste Teil der Ausrüstung, die Aktivisten besitzen sollten«, hat die Amerikanerin Rebecca Solnit in anderem Zusammenhang schon 2004 geschrieben.
Oft beklagen Aktivistinnen und Aktivisten, dass der Begriff Aktivismus im abwertenden Sinne benutzt wird. Diese pejorative Konnotation allerdings kommt nicht von ungefähr. Denn der Aktivismus bringt nicht nur immer neue Kinder hervor, er frisst diese auch. Ihm wohnt bisweilen ein unangenehm totalitärer Zug inne. War es doch in Gestalt von Janice Deul eine Modeaktivistin, die 2021 erfolgreich zu skandalisieren verstand, dass die weiße, non-binäre Autorin Marieke Lucas Rijneveld das Inaugurationsgedicht »The Hill We Climb« der schwarzen Lyrikerin und Aktivistin Amanda Gorman ins Niederländische übersetzte. Derlei Kampagnen unter »literarischer Aktivistentugendhaftigkeit« (Thomas Mann 1916 über seinen Bruder Heinrich) zu verbuchen, hieße das Phänomen unterschätzen. »Stark und reisig« hatte sich Carl von Ossietzky den Aktivismus 1918 gewünscht – heute ist er v. a. reichweitenstark. Und er ist nicht davor gefeit, sich in Widersprüchen zu verfangen. Man muss im Fall Gorman/Rijneveld fragen, was genau progressiv daran ist, im Sinne identitätspolitischer Homologie zu behaupten, dass es besser ist, wenn Schwarze Schwarze übersetzen, und im Jahre 2021 ernsthaft die Tatsache zum Problem zu erklären, dass eine nicht binäre Person die Zeilen einer Frau überträgt.
Dass ein Aktivismus den anderen durchaus zu torpedieren in der Lage ist, sieht man z. B. an Attacken wie jener der intersektionalen Aktivistin und Kolumnistin Michaela Dudley auf die feministische Aktivistin und Publizistin Alice Schwarzer. Hier warf die eine, jüngere aktivistische Seite der anderen, älteren Rückschrittlichkeit vor. Schwarzer gilt seit ihren Einlassungen zu den »Neo-Transsexuellen« als TERF, unter welcher Abkürzung man einen »trans-exclusionary radical feminism« brandmarkt. Ihre Warnung vor einem irreversiblen vorschnellen operativen Geschlechterwechsel vor Erreichen des Erwachsenenalters wird als menschenverachtend verworfen. Vergessen wird dabei gern, dass Schwarzer sich 1984 in ihrer Zeitschrift »Emma« als eine der ersten überhaupt öffentlich mit den Transsexuellen solidarisierte und um Verständnis für deren Nöte warb. Von Exklusion keine Spur, im Gegenteil. Ganz ähnliche Erfahrungen machte die Britin Kathleen Stock, als sie darauf hinzuweisen wagte, dass die Existenz eines biologischen Geschlechts schlechterdings nicht zu bestreiten ist. Die feministische Philosophin war bei dem daraufhin gegen sie veranstalteten sozialmedialen Haberfeldtreiben nicht so standhaft wie ihre ebenfalls von Transgender-Aktivisten heimgesuchte Landsfrau Joanne K. Rowling. Sie gab von sich aus ihren Lehrstuhl an der Universität von Sussex auf. Den Pranger, an den sie sich unversehens gestellt sah, verglich sie mit den Methoden des Mittelalters.
Die Dynamiken, die Aktivistinnen und Aktivisten auszulösen imstande sind, darf man mindestens beachtlich, manchmal auch gefährlich selbstgerecht nennen. Vor allem dort, wo sie Zwänge auszuüben versuchen. Die Frage stellt sich, ob, mit einem Wort aus Marion Poschmanns »Hundenovelle« (2008), nicht auch zunehmend in unserer Gesellschaft so etwas wie »falscher Aktivismus« Platz greift. Ihr Erzähler bezeichnet damit eine »Art von Handlungsmanie, starrköpfig, brutal, die die Welt regierte und kaputt machte«. Es ist manchmal nur ein kleiner Schritt von der Unbeugsamkeit, die viele Aktivismen charakterisiert, bis zur Verstocktheit. »Der Sprung ins Helle« heißt eines der Grundlagenwerke des Aktivismus von Kurt Hiller. Wir haben gelernt, bei großen Sprüngen nach vorn Vorsicht walten zu lassen. So licht, wie er seinen Sprung in die Zukunft gern ausmalt, so sehr neigt der Aktivismus auch zu ideologischen Verhärtungen, zu Dogmen. Walter Benjamin, alles andere als ein Reaktionär, sprach 1932 vom »Irrtum des Aktivismus«. Könnte es sein, dass sich 90 Jahre später dieser Irrtum unter anderen Vorzeichen wiederholt?
Wozu Aktivismus?
Einer der beliebtesten Glaubenssätze lautet: Bewegung ist gut. Bewegung tut not. Nicht nur rät uns jeder Mediziner dazu. Bewegung assoziieren wir mit Vorankommen, obgleich es neben der Vorwärts- (und Seitwärts‑) genauso die Rückwärtsbewegung gibt und man in Deutschland weiß, dass die schrecklichste Tyrannei sich in einer sogenannten »Hauptstadt der Bewegung« formiert hat. Doch dieser semantische backlash ficht sie nicht an. Sie hat einen gleichbleibend guten Leumund. Schon von Aristoteles hat uns Arthur Schopenhauer den Satz überliefert: »Das Leben besteht in der Bewegung und hat sein Wesen in ihr.« Bräuchte der Aktivismus einen Leitsatz, hier wäre er. Soziale Bewegungen finden ihr Wesen darin, dass sie für den Fortschritt kämpfen, Rechte erstreiten, dass sie etwas anschieben und eintreten für eine bessere Welt. Sie sind zutiefst überzeugt von ihrer Mission und setzen alles daran, ihre Botschaft zu streuen und auf allen denkbaren Wegen weiterzuverbreiten.