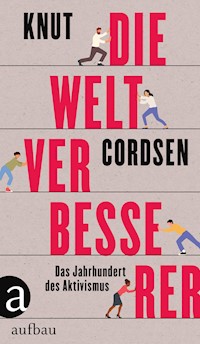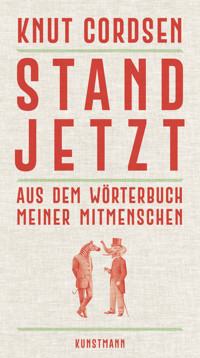
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Gebrauch der Sprache lässt sich etwas über den Zustand unserer Gesellschaft ablesen. Dachten Sternberger, Storz und Süskind, als sie kurz nach Kriegsende ihr Buch Aus dem Wörterbuch des Unmenschen kompilierten und zeigten, welche Verheerungen der Nationalsozialismus auch in der deutschen Sprache hinterlassen hatte. Knut Cordsen übersetzt diesen Ansatz in die Gegenwart – natürlich im Bewusstsein, dass sich Geschichte immer zweimal ereignet, einmal als Tragödie und einmal als Farce. So stellt sich Stand jetzt in eine doppelte Tradition. Im Sinne einer ernsten Sprachkritik forscht Knut Cordsen nach der tieferen Bedeutung des heutigen Jargons, spürt dem Jägerlatein einer Alice Weidel nach, schaut, was hinter der Brandmauer steckt, und begibt sich auf die Suche nach den Ursprüngen des Kampfbegriffs »Lügenpresse«. Zum anderen speist sich Stand jetzt aber auch aus einer unbändigen Sprachlust, labt sich an Worthülsenfrüchten, feiert Brot und Wortspiele, spaziert fröhlich und ergebnisoffen durch unsere nicht immer armutsfeste schöne Sprache und stärkt ihr den Rücken, nachdem man sie hinterhältig unter den Bus geworfen hat. Ein so heldenhaftes wie mitmenschliches, meinungsstarkes wie lückenhaftes Kommentariat zum zeitgeistigen und zeitnahen Sprachgebrauch, das uns vor die großen Fragen stellt: Sollen wir weinen, weil das alles so komisch ist, oder lachen, weil das alles so tragisch enden wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
KNUT CORDSEN
STAND JETZT
Aus dem Wörterbuchmeiner Mitmenschen
VERLAG ANTJE KUNSTMANN
VORWORT
Neulich stolperte ich über das offenbar in gewissen Kreisen derzeit angesagte Wort »nowness«. Ein Wort von ungeheurer Jetzigkeit. Von reiner Gegenwart. Eben das möchte dieses kleine Diktionär auch sein. Es versammelt in nicht allzu ernster Manier ein paar Begriffe und Wendungen, die nowness atmen. Die »zur Stunde«, wie man früher sagte, viele von uns benutzen. Leider auch der Verfasser dieser Zeilen.
Jeder Mensch hat seine Eigenheiten, seine Macken und Empfindlichkeiten. Die gesteigerte Form davon heißt Idiosynkrasie und bezeichnet eine Abneigung, die z. B. dazu führen kann, dass man in jungen Jahren schon die Sprache seiner Umwelt so, nun ja, kurios findet, dass man sich einen Spaß daraus macht, ein »Wörterbuch der Gemeinplätze« zu kompilieren. So ein Dictionnaire des idées reçues hat Gustave Flaubert für sich zusammengestellt. Darin finden sich lauter Phrasen, die zu seiner Zeit endemisch waren. Weil dieser vielleicht größte aller Schriftsteller sie auflistete und so kurz wie denkbar komisch kommentierte, wissen wir, was ihn auf- und zum Widerspruch reizte. Bevor hier jemand Anmaßung wittert: Mich verbindet mit dem weltliterarischen Giganten aus Frankreich nur eines. Wir sind zufällig beide an einem 12. Dezember geboren. Das war’s dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
Also – fast. Auch ich stoße mich mitunter – okay, recht oft sogar – daran, wie man so spricht. Leben wir alle doch in einer Welt zwischen »Fitshop« und »Gutkauf«. Stöhnen Sie nicht auch manchmal leise auf: Nennt mir den Tag, an dem der deep dive den Tiefgang abgelöst hat! Stört es Sie nicht auch, wenn Menschen, die man bisher für ganz verträgliche Zeitgenossen gehalten hatte, auf Sitzungen plötzlich irgendwelche halbgaren Kollegen-Anregungen, die sie mit Sicherheit für genauso sinn- und wertlos halten wie man selbst, mit einem »Ich nehm’s mal mit« quittieren? Was ja, wie jeder weiß, die sich im Gesicht widerspiegelnde Interesselosigkeit des Sprechers kaum kaschieren kann und auf Deutsch heißt: Du kannst mich mal.
Mich nimmt das mit, jedes Mal, um es in jenem durchtherapierten Jargon zu formulieren, der eine Zeit lang sehr in Mode war und seine Hochphase hatte, als Eckhard Henscheid in den 1980er-Jahren daran ging, das seinerzeit grassierende »Dummdeutsch« zusammenzutragen und elegant zu zerwirken. Dieser Altmeister der Sprachkritik konnte noch nicht ahnen, dass es dermaleinst als Distinktionsmerkmal, ja als Erkennungszeichen weniger Eingeweihter gelten würde, in seiner E-Mail-Korrespondenz das Anredepronomen doch tatsächlich weiterhin und allen orthografischen Neuerungen zum Trotz großzuschreiben – aus schierer Höflichkeit! Hallo? Deine Pronomen lauten ernsthaft »Du«, »Ihr« und »Euch«? Echt jetzt? Sie gestatten mir hoffentlich, dass ich Sie hier sehr gelegentlich direkt adressiere.
Was erwartet Sie auf den folgenden Seiten? Ein alphabetisch sortiertes Kompendium von »Angebot machen« bis »Zurückholen«, das sich an gewissen Sprachgebräuchen der Gegenwart reibt. Apropos: »Gebräuche«. Oder, auch schon gehört, »Verbräuche« und »Verkehre« (Deutsche Bahn). Für mich genauso wie »Bedarfe« eine Art Ekel-Plural, bei dem sich mir alles sträubt. Sie merken schon: Hier hat jemand Sprechbedarf. Beziehungsweise Schreibbedarf – aber hießen so nicht früher mal die Läden, in denen man Bleistifte, Kugelschreiber und Notizhefte kaufte?
Ich habe, wie man das halt so macht als Journalist, mitgeschrieben, wenn mir Dinge auffielen, wenn es mir merkwürdig vorkam, wie meine Mit- und Nebenmenschen redeten. Nebenmensch trifft es oft besser als das eingemeindende »Mitmensch«. Politiker z. B. sind eindeutig Nebenmenschen, da können sie noch so häufig »Mensch« auf ihre Wahlplakate schreiben. Ein paar von ihnen kommen in diesem Buch vor. Den Begriff »Nebenmensch« verdanken wir dem nie um ein Wort verlegenen Johann Wolfgang von Goethe, der der Auffassung war: »Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf. Am allerfördersamsten aber sind unsere Nebenmenschen, welche den Vorteil haben, uns mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und daher nähere Kenntnis von uns zu erlangen, als wir selbst gewinnen mögen.« Das steht in seinem Aufsatz »Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort«. Guter Titel, nicht wahr?
Dieses Buch ist ein bescheidener Versuch, Wörter und Wendungen, die – »Stand jetzt« – kursieren, ein wenig genauer auf ihren historischen Gehalt, ihre Herkunft, ihren literarischen Hallraum hin anzuschauen und zu befragen. Es möchte nicht verdammen, es möchte erheitern, und es mag seine eher geringe Halbwertszeit schon durch seinen Titel signalisieren. Das unerreichbare Vorbild dieses Buches aber ist – Sie werden es längst erraten haben – »Aus dem Wörterbuch des Unmenschen« von Dolf Sternberger, Gerhard Storz und Wilhelm Emanuel Süskind. Das ist das Urmeter, an dem sich alle nachfolgenden Bücher messen lassen müssen, die versuchen, anhand der näheren Betrachtung sprachlicher Phänomene etwas über die Gesellschaft herauszufinden. Mich fasziniert dieses schmale, stilistisch ausgefeilte Werk bis heute.
Sieht man im Inhaltsverzeichnis, welche Wörter das Autoren-Trio in seinen Kolumnen auf das hin abhorchte, was in ihnen als Erbe der Sprache des Nationalsozialismus mitschwang, wird man als heutiger Leser eine Liste auf den ersten Blick unverdächtiger Begriffe antreffen: Was soll schon schlimm sein am kleinen unscheinbaren »echt«, das nach Meinung von Sternberger/Storz/Süskind schon kurz nach Kriegsende nicht mehr wegzudenken war »aus dem Adjektiv-Portemonnaie des öffentlichen Redners«? Was hatten sie gegen das hohle Gepränge eines Verbs wie »durchführen«? Und warum noch mal sollte man besser darauf verzichten, raunend zu behaupten, man »wisse um« etwas? Letzteres Beispiel mag die Vergeblichkeit eines jeden Unterfangens dieser Art illustrieren. »Darumwisser« gibt es heute nämlich wieder zuhauf, vermutlich so viele wie eh und je. Achten Sie mal darauf. Und keiner unserer Mitmenschen, der »um etwas weiß«, scheint zu wissen, was an dieser wolkigen Formulierung so problematisch ist.
Dolf Sternberger hat 1957 in der Vorbemerkung zur Neuausgabe dieses Klassikers »Aus dem Wörterbuch des Unmenschen« geschrieben: »Möge es helfen, die Augen zu öffnen, das Gehör zu schärfen, die Zungen schamhaft zu machen und ihnen schließlich ihre natürliche Geläufigkeit zurückzugeben! Möge es auch unterhalten und Vergnügen bereiten! An Zuversicht soll’s uns nicht fehlen.« Besser vermag ich es nicht auszudrücken. Nehmen Sie dieses kleine Buch als ein Geleit zur Zeit, die oft schwer genug zu ertragen ist. Wie sagt man? Danke, für den Moment.
MACHEN SIE DOCH MAL EIN ANGEBOT! Über eine Phrase, die sich über mangelnde Nachfrage leider nicht beklagen kann
Am Freitag, dem 29. November 2024, war’s mal wieder so weit. Es lag nicht am Black Friday, wie manche vielleicht denken werden. Es war nur eine komische Koinzidenz, dass es just an diesem Tag der Schnapper-Jäger geschah. Ja, Schnapper, so heißen Schnäppchen doch heute. Die Werbung verfällt regelmäßig in Schnapper-Atmung, preist günstige Ware als »echten« oder »absoluten Schnapper« an und ruft schon mal eine ganze »Woche der Schnapper« aus. Wer spricht noch von Rabatt? Man muss nicht an Oniomanie, an zwanghafter Kaufsucht, leiden, um »einen Schnapper machen« und, zurückgekehrt vom Einkauf, mit eben diesem zu Hause renommieren zu wollen.
Mit alledem aber hatte es wohl nichts zu tun, dass Christian Lindner seiner Partei an just jenem Schwarzen Freitag ein Angebot unterbreitete, von dem er meinte, dass sie es weder ablehnen konnte noch ausschlagen sollte.
Und so sprach der verkrachte Ampel-Koalitionär und krisengebeutelte Freidemokrat am Abend besagten Tages im Fernsehen: »Ich mache meiner Partei das Angebot, sie in die Bundestagswahl zu führen.« Damit lag Lindner ganz auf der Linie des Berliner Polit-Argots. Seiner Partei oder am besten gleich dem ganzen Land ein Angebot zu machen: ohne das geht’s heute gar nicht mehr. Das weiß auch Robert Habeck, der kurz zuvor in einem am Küchentisch aufgenommenen Video nicht allein leicht bedröppelt erklärt hatte, dass er »in Erfahrung gehärtet« sei, was eher unangenehme Erinnerungen an Ernst Jünger aufkommen ließ, der nach eigener Auskunft in den Stahlgewittern des Krieges »in allen Feuern und Stichflammen gehärtet«, »gehämmert, gemeißelt und gehärtet« worden war. War denn Politik jetzt auch schon ein inneres Erlebnis? Habeck jedenfalls hub an zu sprechen: »Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten, wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Deshalb mache ich ein Angebot nach vorne.«
Die Richtungsangabe »nach vorne« irritierte zunächst, aber dann besann man sich: Es ging ja um eine sogenannte »Richtungswahl«, was die Union mit ihrem Claim »wieder nach vorne« unterstrich. Wer sich indessen zurückbeamte ins Jahr 2021, zu Annalena Baerbock, wusste, dass diese pseudodemütige Phrase vom »Angebot machen« nicht erst am Küchentisch beim Abendbrotmachen entstanden war. Geradezu angebotsselig warb die damalige Kanzlerkandidatin mit diesen Worten für sich: »Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen, für die gesamte Gesellschaft. Dass wir Zukunft gestalten, das ist mein Angebot, das ist unser Angebot, dafür treten wir an.« Applaus. Damit dürfte die mir noch aus Kindheitstagen im Ohr klingende Trainer-Klage vom Spielfeldrand, es habe sich mal wieder »keiner angeboten«, endgültig passé gewesen sein. Die Grüne Ricarda Lang kreierte die Maxime »Allen ein Angebot machen, aber nicht allen gefallen müssen«.
Der Kunde, vulgo Wähler ist König und der Schlussverkäufersprech allüberall. Deshalb machte Lars Klingbeil ein »vernünftiges Angebot« und Olaf Scholz mal ausnahmsweise kein besonnenes, dafür aber ein »umfassendes«: »Ein Angebot zur Stärkung Deutschlands auch in schwieriger Zeit, ein Angebot, das auch Vorschläge der FDP aufgreift. Ich muss jedoch abermals feststellen: Der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen.« Schrecklicher Verdacht: Ging die Ampel-Koalition an einem Angebotsüberschuss zugrunde? Angebotslücken sehen jedenfalls anders aus.
»Noch mal zu uns jetzt aber«, brüllte der sich chronisch von Berlin missachtet fühlende Markus Söder allerdings schon 2020 beim Politischen Aschermittwoch in der Passauer Dreiländerhalle: »Was ist unser Angebot an die Menschen?« Sollte ausgerechnet er es gewesen sein, der das Nebelwort in Umlauf gebracht hatte? 2021 – der Machtkampf zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur kulminierte gerade – dozierte der Franke breitbeinig, es reiche nicht mehr aus, ein Programm »nach dem reinen Herzen der Stammwählerschaft« zu machen: »Sie müssen ein breiteres Angebot machen.«
Seit dem Sommer 2024 hört man nun Friedrich Merz unentwegt – als sei er in einer Art Wiederholungsschleife gefangen – »Angebote machen«: erst der Ampel-Koalition (»Ich mache dieses Angebot aus tiefster Überzeugung, dass wir gemeinsam hier zu Lösungen kommen müssen«), dann der SPD, dann den Grünen. Man muss darin nicht gleich einen Sprachverfall erkennen; einen Preisverfall aber vielleicht schon. Geht Offerieren jetzt über Regieren? Wie sehr das Ganze abfärbt, kann man an Karl-Theodor zu Guttenberg studieren, der längst kein politisches Amt mehr bekleidet, sondern sich als Lobbyist und Laber-Podcaster mit Gregor Gysi von der Linken rehabilitiert. Und warum? »Es ist ein Angebot einer Gesprächskultur, die es in unserem Land schon mal gab, die aber zusehends verloren geht.« Beeindruckend irritationsfest schließlich resümierte Robert Habeck nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei 2025 auf der Bundespressekonferenz: »Das Angebot war top, aber die Nachfrage war nicht so dolle.« So kann man das natürlich auch sehen.
»ARMUTSFEST« Ein Begriff aus dem Arsenal politischer Magie
Überzeugungen können felsenfest sein, Klamotten wind- und wetterfest. Kürzlich hörte ich einen jungen Zimmermann sagen, in seinem Beruf komme es darauf an, »dachfest« zu sein. Denn wer nicht dachfest sei, der laufe Gefahr, das Richtfest nicht mehr zu erleben. Dachfest nämlich bedeute nicht nur, sein Haus in Ordnung zu halten, sondern auch schwindelfrei in luftiger Höhe über Balken und Bretter beim Bau desselben wandeln zu können. Ich kam ins Sinnieren und erinnerte mich an die schöne Geschichte von der Trunkenheitsfahrt Wiglaf Drostes, die damit endete, dass ihm von polizeilicher Warte aus attestiert wurde, in erhöhtem Maße »giftfest« zu sein, worüber er noch Jahre später jubeln sollte: »Ich bin giftfest.« Giftfest, hier hatte man es gleichsam urkundenfest, ist die höchste Steigerungsform von »trinkfest«.
Sind Sie bibelfest? Gut, dann kennen Sie ja