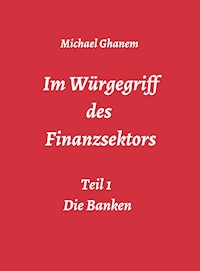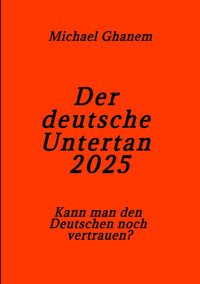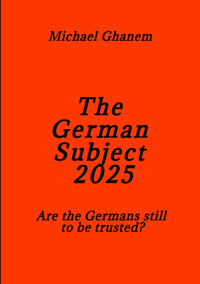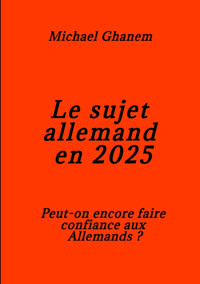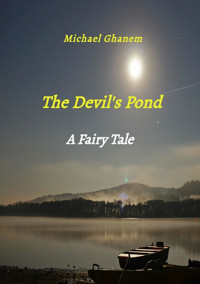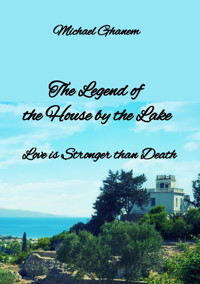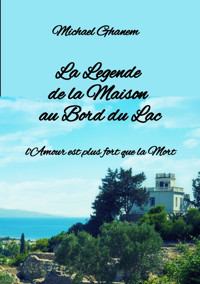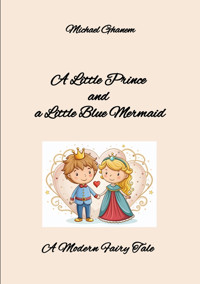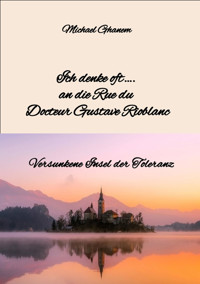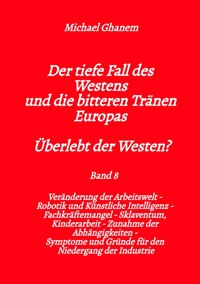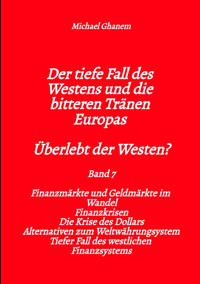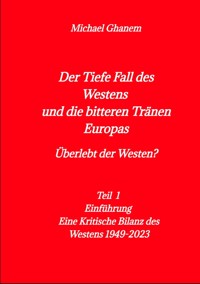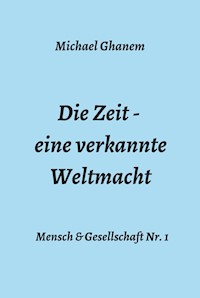
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Mensch & Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Wir Menschen sprechen ständig über die Zeit und es gibt sehr viele Meinungen darüber, was Zeit ist und was Zeit bedeutet. Und noch nie wurde über den Begriff Zeit so sehr diskutiert und gestritten wie heute. Man findet jedoch kaum ein grundlegendes Verständnis über die Bedeutung der Zeit. Dabei lehrt uns die Geschichte, dass kein Mensch, so mächtig und so reich er sein mag, etwas gegen die Zeit und die Beherrschung durch die Zeit unternehmen kann. Keine Religion, keine Philosophen und keine Propheten können die Zeit beherrschen oder sie anhalten. Ein großer Teil der Bevölkerung versteht die Zeit als Orientierungspunkt zum Erreichen von Zielen, seien es wirtschaftliche, persönliche, gesellschaftliche oder politische. Die Endlichkeit der Lebenszeit ist für jeden Einzelnen mit der Geburt vorgegeben. Problematisch ist jedoch, dass der Mensch sich mit dieser Endlichkeit und seiner eigenen Endlichkeit kaum abfinden kann. Seit Menschengedenken gibt es den Versuch sich unsterblich, das heißt unabhängig von den Zeiträumen, zu machen. Das hat schon die alten Völker wie z. B. Ägypter, Römer, Griechen beschäftigt. In diesem Buch beschreibt der Autor die verschiedenen Facetten der Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dieses Buch ist allen Mahnern und einsamen Rufern gewidmet, denen das Wohlergehen unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Jeder kritische Geist ist einsam und gehört zu einer Minderheit. Die Minderheit von heute kann jedoch die Mehrheit von morgen sein.
Dieses Buch ist auch meiner Frau Marlene gewidmet für ihre kritischen und klugen Ratschläge, die mich in meinem Leben begleitet und die stets eine gute Ratgeberin ist.
Bonn, im Mai 2021
Michael Ghanem
„Die Gedanken sind frei“
Die Zeit
Eine verkannte
Weltmacht
Mensch & Gesellschaft Nr.1
© 2021 Michael Ghanem
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-32523-4 (Paperback)
978-3-347-32524-1 (Hardcover)
978-3-347-32525-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Über den Autor: Michael Ghanem
https://michael-ghanem.de/
https://die-gedanken-sind-frei.org/
Jahrgang 1949, Studium zum Wirtschaftsingenieur, Studium der Volkswirtschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Ethik, arbeitete viele Jahre bei einer internationalen Organisation, davon fünf Jahre weltweit in Wasserprojekten, sowie einer europäischen Organisation und in mehreren internationalen Beratungsunternehmen.
Bonn, im Mai 2021
Er ist Autor von mehreren Werken, u.a.
„Ich denke oft…. an die Rue du Docteur Gustave Rioblanc – Versunkene Insel der Toleranz”
„Ansätze zu einer Antifragilitäts-Ökonomie“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 1: Angela Merkel – Eine Zwischenbilanz“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 2: Politisches System – Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 3: Gesellschaft - Bilanz und Ausblick
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 4: Deutsche Wirtschaft-Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 5: Innere Sicherheit-Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 6: Justiz-Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 7: Gesundheit-Quo vadis? Band A, B und C“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 8: Armut, Alter, Pflege - Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 9: Bauen und Vermieten in Deutschland - Nein danke“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 10: Bildung in Deutschland“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 11: Der Niedergang der Medien“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 12: Literatur – Quo vadis - Teil A“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 13: Entwicklungspolitik – Quo vadis - Teil A“
„Eine Chance für die Demokratie“
„Deutsche Identität – Quo vadis?
„Sprüche und Weisheiten“
„Nichtwähler sind auch Wähler“
„AKK – Nein Danke!“
„Afrika zwischen Fluch und Segen Teil 1: Wasser“
„Deutschlands Titanic – Die Berliner Republik“
„Ein kleiner Fürst und eine kleine blaue Sirene“
„21 Tage in einer Klinik voller Narren“
„Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe, Armut, Ernährung Teil 1“
„Im Würgegriff von Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Rechtsradikalismus, Faschismus, Teil 1“
„Im Würgegriff der politischen Parteien, Teil 1“
„Die Macht des Wortes“
“Im Würgegriff des Finanzsektors, Teil 1”
”Im Würgegriff von Migration und Integration“
„Weltmacht Wasser, Teil 1“
„Herr vergib ihnen nicht! Denn sie wissen was sie tun!“
„Verfallssymptome Deutschlands – Müssen wir uns das gefallen lassen?“
„Deutsche identität und Heimat – Quo vadis?
„I know we can! Eine Chance für Deutschland“
„Im Würgegriff der Staatsverschuldung, Teil 1 und Teil 2“
„50 Jahre Leben in Deutschland – Ein Irrtum? Ein Schicksal“
„Eine Straße ohne Seele“
„Ist Deutschland auf Sand gebaut?“
„Leonidas der Große – Ich bin ein Mensch“
„Vier Millionen entrechtete Deutsche“
„Der Teich des Teufels – ein Märchen“
„Die heutigen Reiter der Apokalypse“
„Die Deutschen – ein verfluchtes Volk?
„Krisen in Zeiten von Corona, Teil 1“
„Thesen zur Gleichheit der Rassen“
„Die Sage vom Haus am See“
„2005 – 2021 Deutschlands verlorene 16 Jahre – Die Bilanz der Angela Merkel“
„Corona 2021 – Warten auf Godot“
„Wenn ich einmal der Herrgott wär“
„Liebe heißt“
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Die Zeit: Ein Guthaben?
2.1 Vorbemerkung
2.2 Willkürliche Zeitaufteilung
2.3 Grundwissen
2.3.1 Lebenszeit
2.3.2 Kalender
2.3.3 Zeitmessung
2.3.4 Uhr
2.3.5 Geschichte der Zeitmessgeräte
2.3.6 Eine kurze Geschichte der Zeit
3. Zeit als wertvollstes Guthaben
4. Die verkannte Weltmacht?
5. Wichtigstes Gut?
6. Die Mächtigen sind gegen die Zeit machtlos
7. Propheten und Philosophen machtlos?
8. Die Frauen und die Zeit
9. Die Jugend und die Zeit
10. Die Messung und Berechnung der Zeit
11. Beginn der Zeitrechnung: Willkürlich durch den weißen Mann
12. Stell dir vor es gibt keine Zeit
13. Ohne Zeit keine Gesellschaft
14. Ohne Zeit keine moderne Wirtschaft
15. Ohne Zeit gibt es keine Geschichte
16. Ohne Zeit keine Kultur
17. Die Uhr und die Uhrzeit
18. Verflucht sei die Zeit
19. Wertvollstes Kapital: die Zeit
21. Ich habe keine Zeit
22. Zeit ist Geld
23. Ich habe Zeit
24. Zeichen der Endlichkeit
25. Zeit: Glück oder Fluch
26. Zeit ist Relativ
27. Die Verblendung des weißen Mannes
28. Die vergebliche Suche nach der Zeit oder Goethes Faust
29. Gleich verteiltes Kapital
30. Das Zeitparadoxon
31. Deja Vu
32. Epilog
33. Literaturverzeichnis
1. Vorwort
Wir Menschen sprechen ständig über die Zeit und es gibt sehr viele Meinungen darüber, was Zeit ist und was Zeit bedeutet. Und noch nie wurde über den Begriff Zeit so sehr diskutiert und gestritten wie heute. Man findet jedoch kaum ein grundlegendes Verständnis über die Bedeutung der Zeit.
Dabei lehrt uns die Geschichte, dass kein Mensch, so mächtig und so reich er sein mag, etwas gegen die Zeit und die Beherrschung durch die Zeit unternehmen kann. Keine Religion, keine Philosophen und keine Propheten können die Zeit beherrschen oder sie anhalten. Ein großer Teil der Bevölkerung versteht die Zeit als Orientierungspunkt zum Erreichen von Zielen, seien es wirtschaftliche, persönliche, gesellschaftliche oder politische.
Die Endlichkeit der Lebenszeit ist für jeden Einzelnen mit der Geburt vorgegeben. Problematisch ist jedoch, dass der Mensch sich mit dieser Endlichkeit und seiner eigenen Endlichkeit kaum abfinden kann.
Seit Menschengedenken gibt es den Versuch sich unsterblich, das heißt unabhängig von den Zeiträumen, zu machen. Das hat schon die alten Völker wie z. B. Ägypter, Römer, Griechen beschäftigt. Im Folgenden soll eine kleine Abhandlung über die Zeit und ihre verschiedenen Facetten vorgenommen werden.
Der Autor versichert, dass er für das Zustandekommen dieses Buches keine Rückgriffe auf Informationen aus seinem beruflichen Werdegang genommen und lediglich die öffentlich zugänglichen Quellen genutzt hat.
2. Die Zeit: Ein Guthaben?
2.1 Vorbemerkung
Mit der Geburt eines Menschen, der Gründung einer Gesellschaft, dem Beginn einer wirtschaftlichen Macht und dem Entstehen von Religionen bildet die Zeit als Guthaben das Fundament des Lebens. Dieses Guthaben ist mehr oder weniger vorgegeben und endet unwiderruflich mit Beendigung des Lebens, dem Niedergang von Zivilisationen und Kulturen, dem Niedergang von Weltmächten. Insoweit stellt die Zeit ein Guthaben dar, das es ermöglicht, Ziele zu erreichen. Dabei ist zu beobachten, dass die vorgegebenen Guthaben in vier verschiedene Phasen einzuteilen sind: Geburt und Aufstieg, Höhepunkt, Niedergang, und Verfall. Um die Dimensionen der Zeit zu erfassen wird im Folgenden das notwendige Grundwissen skizziert.
2.2 Willkürliche Zeitaufteilung
Die Zeitaufteilung – seien es die vorgegebenen Guthaben an Stunden, Tagen, Monaten und Jahre - ist menschengemacht und daher nicht naturgegeben. Sie ist zwar orientiert an der Natur und an dem Wechsel von Tag und Nacht, an der Helligkeit durch die Sonne und der Dunkelheit der Nacht und an dem Mond; die genaue Aufteilung wurde jedoch mithilfe von Astronomie und Astrologie festgelegt. Insoweit sie ist menschengemacht und hat sie keinen direkten natürlichen Ursprung. Sie wird jedoch aus der Natur abgeleitet.
2.3 Grundwissen
2.3.1 Lebenszeit
Die Lebenserwartung ist die im Durchschnitt zu erwartende Zeitspanne, die einem Lebewesen ab einem gegebenen Zeitpunkt bis zu seinem Tod verbleibt, wobei bestimmte Annahmen über die Sterberaten zugrunde gelegt werden. Diese werden in der Regel mit Hilfe einer Sterbetafel, meist einer Periodensterbetafel, ermittelt, die auf beobachteten Sterbehäufigkeiten der Vergangenheit und auf Modellannahmen für deren zukünftige Entwicklung basiert. Grundsätzlich kann der Zeitpunkt, ab dem die restliche Lebenserwartung ermittelt werden soll, beliebig gewählt werden. Im allgemeinen Fall ist es der Zeitraum, der mit der biologischen Entwicklung des Lebewesens beginnt, beim Menschen und den meisten Säugetieren nach der Geburt.
Die Lebenserwartung von Menschen bei Geburt lag laut Angaben der WHO im weltweit berechneten Durchschnitt 2019 bei 73,4 Lebensjahren.
Berechnung der Lebenserwartung
Am häufigsten wird die Lebenserwartung ab dem Zeitpunkt des Eintritts in das Leben berechnet. Die Lebenserwartung bei der Geburt gibt das Alter an, das die Neugeborenen eines bestimmten Jahrgangs durchschnittlich erreichen würden, wenn die altersspezifische Mortalität künftig konstant bleibt. Häufig wird dabei nicht die Gesamtpopulation der Neugeborenen betrachtet, sondern eine nach gewissen Kriterien ausgewählte Teilpopulation (etwa nach Wohnort, Geschlecht). Interessant sind dabei Angaben über die statistische Streuung der Lebenserwartung.
Menschliche Lebenserwartung
Allgemeines
Die menschliche Lebenserwartung wird von verschiedenen Einflussfaktoren bestimmt. Statistische Verzerrungen können sich durch die Säuglingssterblichkeit und weitere Mortalitätsdaten ergeben. So lag die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr in der Zentralafrikanischen Republik 2010–2015 nach Angaben der UNO bei rund 8,2 Prozent. Die durchschnittliche weitere Lebens-erwartung gibt an, wie viele weitere Lebensjahre Menschen eines bestimmten Alters nach den in der aktuellen Berichtsperiode geltenden Sterblichkeitsverhältnissen durchschnittlich noch weiterleben.
Die weitere Lebenserwartung wächst mit dem Lebensalter an, da verschiedene Sterberisiken bereits überlebt wurden. Ein neugeborener Junge hat, nach Daten aus 2018, in Deutschland eine Lebenserwartung von gerundet 78 Jahren, im Alter von 5 Jahren sind es 79 Jahre, im Alter von 50 sind es 80 Jahre, mit 60 sind es 82, mit 70 sind es 84, mit 80 sind es 88 und mit 85 sind es 90 Jahre. Ein neugeborenes Mädchen hat in Deutschland eine Lebenserwartung von gerundet 83 Jahren, also 5 Jahre mehr als ein Junge. Dieser Abstand verringert sich im Laufe des Lebens. Im Alter von 50 beträgt die Lebenserwartung 84 Jahre, mit 60 sind es 85 Jahre (also noch 3 Jahre mehr als Männer), mit 80 sind es 90 Jahre (2 Jahre mehr) und mit 85 sind es 91 Jahre (ein Jahr mehr als Männer).
Sofern Populationen nicht durch Kriege, Genozide, Naturkatastrophen, Völkerwanderungen, Seuchen, Hungersnöte oder im Einzelfall Unfälle dezimiert werden, spielen die genetischen Anlagen der biologischen Lebenserwartung (Zellalterung), Qualität der medizinischen Versorgung, Stress, Ernährung und Bewegung wichtige Rollen. Unter guten Rahmenbedingungen können Menschen 100 Jahre und älter werden. Der bisher älteste Mensch (Jeanne Calment) erreichte ein Lebensalter von 122 Jahren. Die maximale Lebenserwartung von Menschen wird unter Forschern seit vielen Jahren kontrovers diskutiert: Während die einen die Ansicht vertreten, dass Menschen (und die meisten Tiere) theoretisch unbegrenzt leben können, sind viele davon überzeugt, dass es eine natürliche Obergrenze für die maximale Lebenszeit gibt. Statistische Untersuchungen legen nahe, dass eher letzteres zutrifft und Menschen – unter natürlichen Umständen – selbst bei optimalen Bedingungen nicht älter als durchschnittlich 115 bis maximal 125 Jahre alt werden können. Als Grund nennen die Forscher in erster Linie die kontinuierliche Anhäufung von DNA-Schäden im Laufe des Lebens eines Menschen – mit der Folge von schädlichen Mutationen und zunehmend defekten Proteinen und Enzymen. Durch eine gesunde Lebensweise, bestimmte Medikamente und mit Hilfe der körpereigenen Reparatursysteme kann dieser Prozess zwar verlangsamt, aber letztendlich nicht aufgehalten werden: Überschreiten die akkumulierten Zellschäden einen bestimmten Schwellenwert, ist der Tod des Individuums unausweichlich. Dies trifft auch dann zu, wenn zuvor keine zwangsläufig zum Tode führende Erkrankung, wie z. B. eine bösartige Krebskrankheit vorhanden war.
Die höchste Lebenserwartung haben die Menschen in Monaco mit 89,52 Jahren, die geringste Lebenserwartung im afrikanischen Land Tschad mit 49,81 Jahren (Stand 2015). 2007 hatten noch die höchste Lebenserwartung die Menschen in Andorra mit 83,5 Jahren (2015:82,72), die geringste Lebenserwartung im afrikanischen Land Eswatini mit 34,1 Jahren (2015:51,05).
Lebenserwartung ist eine wichtige sozioökonomische Messgröße. Je höher sie für eine bestimmte Gruppe ist, desto höher ist deren Lebensstandard, beispielsweise medizinische Versorgung, Hygiene, Trinkwasserqualität und Ernährungslage. Unterschieden wird die Lebenserwartung häufig nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Berufszugehörigkeit oder nach speziell ausgewiesener Risikogruppe. Während die Statistiken, die sich auf Staaten oder Regionen beziehen, vorwiegend volkswirtschaftliche Indikatoren ausweisen, wird die Unterscheidung nach bestimmten Bevölkerungsgruppen, insbesondere in der Versicherungswirtschaft, zur Berechnung von Risiken und der Bemessung von Prämien oder Renten herangezogen.
Die Berechnung der Lebenserwartung erfolgt anhand von Sterbetafeln, welche die genaue Zahl der Überlebenden und Gestorbenen pro 100.000 Einwohner früherer Jahrgänge nach dem durchschnittlichen Lebens- bzw. Sterbealter in Jahren ausweisen.
Beispiel Deutschland
Im Jahr 2015 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung neugeborener Jungen 77 Jahre und 9 Monate (2010:77 Jahre und 4 Monate). Die entsprechende Zahl für neugeborene Mädchen lautete 82 Jahre und 10 Monate (2010:82 Jahre und 6 Monate). Die so berechnete durchschnittliche Lebenserwartung ist eine ungenaue Prognose, die im Wesentlichen den jetzigen Trend extrapoliert. Dieser könnte einerseits durch Kriege oder Seuchen abrupt gestoppt oder sogar ins Gegenteil gekehrt werden, aber auch beispielsweise durch medizinische Durchbrüche verstärkt werden.
Im Jahr 2007 hatten Jungen in den alten Bundesländern bei ihrer Geburt eine Lebenserwartung von 76,9 Jahren, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) eine von 75,5 Jahren. Der Ost-West-Unterschied betrug 1,4 Jahre. Bei den neugeborenen Mädchen betrug der Abstand zugunsten der im Westen geborenen Mädchen 0,3 Jahre.
Die Lebenserwartung hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verlängert. Faktoren wie Friedenszeit, gestiegenes Einkommen, höherer Lebensstandard, bessere Ernährungslage etc. spielen dabei eine wesentlich größere Rolle als Medizinfortschritt oder Änderung des Zigarettenkonsums in der Gesamtbevölkerung.
In Deutschland im Zeitraum 2016/18 betrug die Lebenserwartung für Männer 78,5 Jahre und für Frauen 83,3 Jahre.
Risikofaktoren
Genetische Faktoren, unzureichende Ernährung, mangelnde Hygiene, unsauberes Trinkwasser, Stress sowie mangelnde ärztliche Versorgung begrenzen in der Hauptsache die Lebenserwartung. Das galt für die vorindustrielle Zeit und gilt noch für viele Entwicklungsländer. Dort, wo diese Verhältnisse auf einem akzeptablen Niveau sind, gelten unter anderem nachstehende Schlüsselfaktoren als bedeutsam.
• Bluthochdruck
• Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum
• Adipositas (Fettleibigkeit) und Übergewicht
• Diabetes bzw. hoher Blutzuckerspiegel
• Bewegungsmangel
Wie eine amerikanische Studie belegt, geht die gestiegene Lebenserwartung dennoch mit einem verschlechterten Gesundheitszustand der alten Menschen einher. So ist auch die Zahl der Lebensjahre, in denen Menschen eine schwere Erkrankung erleiden, kontinuierlich gestiegen. Auch dafür werden die vorgenannten Risikofaktoren verantwortlich gemacht, da sie bei alten Menschen noch deutlich riskanter sind als bei Jüngeren.
Bezüglich krankheitsbedingter Sterblichkeit wurden als Schlüsselfaktoren erkannt: übertragbare und geburtsbedingte Erkrankungen, die sich in der Kindheit auswirken. Die Ergebnisse der Studie gelten weltweit, da alle übrigen wichtigen Mortalitätsrisikofaktoren (Mangelernährung, ungenügende Wasserversorgung, bauliche, persönliche und häusliche Hygienebedingungen, ungeschützter Geschlechtsverkehr, Tabaknutzung, Alkohol, Arbeitssicherheit, Bluthochdruck, Bewegungsarmut, Drogenverwendung und Luftverschmutzung) in jeder der 107 Weltregionen statistisch getrennt berücksichtigt wurden.
Über 20 % der weltweit 56 Millionen Verstorbenen 2001 waren Kinder unter fünf Jahren. So liegt die Wahrscheinlichkeit einer 70-jährigenPerson, 90 Jahre alt zu werden, zwischen 5 % und 54 %, je nachdem wie günstig oder ungünstig vorstehende Faktoren gegeben sind. Alkoholkonsum und Cholesterinspiegel wurden vor dieser Untersuchung als ebenfalls bestimmende Faktoren betrachtet, ihr Einfluss wurde im Vergleich als wesentlich geringfügiger erkannt.
Einfluss des Geschlechts auf die Lebenserwartung
Der Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und dem Geschlecht einer Person ist für Deutschland eindeutig belegt. Eine Untersuchung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) aus dem Jahre 2008 belegt für die letzten 130 Jahre, dass die Sterblichkeit von Frauen im Altersbereich von 20 bis 70 nur etwa halb so groß ist wie von Männern. Frauen erreichen in den meisten Industrieländern eine um vier bis acht Jahre höhere Lebenserwartung (Westdeutschland fünf Jahre, Ostdeutschland sechs Jahre).
Gesundheitsbewusstsein und Lebensweise
Als Ursache für die unterschiedliche Lebenserwartung wird von Wissenschaftlern das geringere Gesundheitsbewusstsein von Männern genannt, das sich unter anderem dadurch äußert, dass Männer mehr rauchen und mehr Alkohol trinken, sowie bei Krankheitssymptomen seltener einen Arzt aufsuchen. Eine 2011 veröffentlichte Studie, die Daten aus 30 europäischen Ländern untersuchte, kam zu dem Schluss, dass zwischen 40 und 60 Prozent des Geschlechterunterschieds in der Lebenserwartung auf das Rauchen von Tabak zurückzuführen seien. 10 bis 30 Prozent können dem Genuss von Alkohol zugeschrieben werden. Aber auch die höhere Risikobereitschaft und die potenziell höhere Morbiditätsrate in typischen Männerberufen, die häufig mit gefahrgeneigter Arbeit und körperlich schädigenden oder stressbehafteten Tätigkeiten verbunden sind, werden als Ursachen angeführt. Weitere Ursachen finden sich in den Artikeln Schwerarbeit und Frauenanteil in der Privatwirtschaft.
Die Klosterstudie ergab im Vergleich der Lebenserwartung zwischen Ordensmitgliedern und Allgemeinbevölkerung, dass bei Ordensmitgliedern signifikant geringere Unterschiede bei der geschlechts-spezifischen Lebenserwartung vorliegen. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ist die Lebenserwartung von Mönchen um rund 4,5 Jahre signifikant höher als die der männlichen Allgemeinbevölkerung, während solche Unterschiede zwischen den weiblichen Vergleichsgruppen nicht zu verzeichnen sind. Die Ursachen liegen neben dem höheren