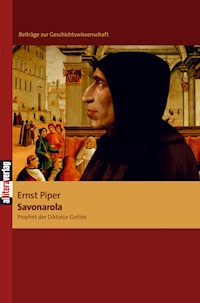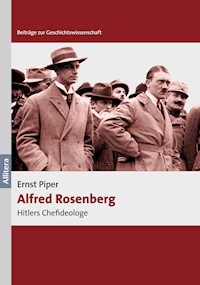18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Vermessung der Untiefen deutscher Geschichte.
Dieses Buch versammelt Beiträge von Bestsellerautor Ernst Piper (»Rosa Luxemburg«) zur deutschen Kultur- und Ideengeschichte der letzten 150 Jahre. Im Zentrum stehen der Nationalsozialismus, die ideengeschichtlichen Voraussetzungen für den Triumph dieser totalitären Bewegung, das ideologische Fundament des NS-Staates und der Umgang mit Schuld und Erinnerung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Bogen reicht von Paul de Lagarde über Ernst Jünger, Oswald Spengler und Alfred Rosenberg bis hin zu wissenschaftlichen Kontroversen wie dem Historikerstreit und Fragen der Erinnerungskultur, wie sie sich in Deutschland seit 1945 entwickelt hat. Piper nimmt in diesem Kontext auch das kulturelle Leben an ausgewählten Beispielen in den Blick.
»Objektiv brillant.« ALEXANDER CAMMANN, DIE ZEIT, ÜBER »ROSA LUXEMBURG«.
»Exzellent erzählt und dokumentiert.« RAINER STEPHAN, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, ÜBER »ROSA LUXEMBURG«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ERNST PIPER
Diese Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich selbst nicht zu kennen
ERNST PIPER
Diese Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich selbst nicht zu kennen
DEUTSCHE GESCHICHTE IM ZEITALTER DER EXTREME
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Markeder Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Ernst Piper, Berlin 2022
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
entspricht der 1. Druckauflage von 2022
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, unterVerwendung einer Aufnahme vom Denkmal für dieermordeten Juden Europas (FinePic®, München)
ISBN 978-3-96289-150-3eISBN 978-3-86284-514-9
Inhalt
Einleitung
Das Zeitalter der Weltkriege
Das kulturelle Leben im Kaiserreich
Der Orient als Dystopie
Paul de Lagarde und der Mythos der deutschen Nation
Dona nobis pacem
Ernst Barlach und der Erste Weltkrieg
Ernst Jünger und der heroische Realismus
Das Deutsche Reich zwischen Revolution und Hitler-Putsch
„Pest in Rußland“
Alfred Rosenberg und die Russische Revolution
Nation und Sozialismus
Staat und Gemeinschaft im Denken von Oswald Spengler
„Der Nationalsozialismus steht über allen Bekenntnissen“
Alfred Rosenberg und die völkisch-religiösen Erneuerungsbestrebungen
„Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission“
Grundlinien der nationalsozialistischen Kulturpolitik
Weltkampf in Frankfurt
Das Institut zur Erforschung der Judenfrage
War der Staat Hitlers Hitlers Staat?
Martin Broszats Strukturanalyse der NS-Herrschaft
Saul Friedländer, Die Jahre der Vernichtung
Die Schuldfrage
Die deutsche Öffentlichkeit und das Erbe des Dritten Reiches
Woran wir uns erinnern, wenn wir uns erinnern
Geeintes Land, geteilte Erinnerung
Ernst Nolte und der Historikerstreit
Zur Genese eines Konflikts
Vom Täterort zum Dokumentationszentrum
Die Topographie des Terrors in Berlin
Anhang
Anmerkungen
Editorische Notiz
Quellennachweis
Verzeichnis der selbstständigen Veröffentlichungen des Autors
Danksagung
Zum Autor
Einleitung
Meine Eltern waren keine Helden.1 Sie taten das, was unvermeidlich war. Aber das, was man vermeiden konnte, taten sie nicht. Als die zuständige Ortsgruppe der NSDAP meinen Vater zu einem Gespräch einlud, schickte er einen Freund, den Komponisten Karl Amadeus Hartmann, der behauptete, Klaus Piper sei schwer krank und könne nicht kommen. 1940 wurde mein Vater Gesellschafter im väterlichen Verlag und fragte sich, ob er als „Betriebsführer“, der er nach dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 nun war, vielleicht doch der Partei beitreten musste. Er holte sich Rat bei dem bayerischen Erzähler Wilhelm Dieß, der von Beruf Rechtsanwalt war und den Verlag in rechtlichen Fragen beriet. Dieß sagte ihm: „Sie müssen, lieber Piper, überhaupt nicht in die Partei. In keinem Fall!“2
Mein Großvater Reinhard Piper war Mitglied der Reichsschrifttumskammer, sonst hätte er seinen Beruf als Verleger nicht ausüben können. (Vgl. den Beitrag „Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission“ in diesem Band.) Und für die Kammermitgliedschaft war ein Ariernachweis erforderlich, den er nolens volens erbrachte. Aber mein Großvater gehörte, wie auch die anderen Mitglieder meiner Familie, keiner nationalsozialistischen Parteiorganisation an. Das hat später vieles erleichtert. Es musste nichts verschwiegen oder verheimlicht werden. Im Gegenteil waren die jüngsten Ereignisse der deutschen Geschichte in meinem Elternhaus ein sehr präsentes Gesprächsthema, und das hat mich bleibend geprägt.
Ein entscheidendes Datum für meine politische Sozialisation ist das Jahr 1965. Im Mai wurde die KZ-Gedenkstätte Dachau mit einer ersten Dokumentarausstellung eröffnet. Meine Eltern besuchten sie bald nach der Eröffnung, weil sie der Überzeugung waren, das dort Dokumentierte gehöre zum notwendigen Grundwissen eines in Deutschland Heranwachsenden. Am 19. September 1965 fand die erste Bundestagswahl statt, die ich bewusst wahrnahm. Mein Vater hatte, gemeinsam mit seinem Verlegerkollegen Carl Hanser und anderen Vertretern des öffentlichen Lebens, in der Süddeutschen Zeitung zur Wahl der SPD aufgerufen. Solche öffentlichen Aufrufe waren damals noch ziemlich ungewöhnlich.
Im März 1965 war es zu einer Debatte im Deutschen Bundestag gekommen, da wenige Wochen später alle in der NS-Zeit begangenen und noch ungesühnten Mordtaten unter die damals 20 Jahre betragende Verjährungsfrist gefallen wären. 1960 hatte es eine erste Verjährungsdebatte über den Straftatbestand des Totschlages gegeben, der nach nur 15 Jahren verjährte. Die SPD-Fraktion beantragte damals, angesichts der unzureichenden Möglichkeiten der Strafverfolgung in der frühen Nachkriegszeit mit der Berechnung dieser Frist nicht schon 1945, sondern erst im September 1949 zu beginnen, doch der Antrag wurde von der Regierungsmehrheit verworfen.
1965 war die Situation anders als fünf Jahre zuvor. Der greise Bundeskanzler Adenauer hatte seinen Stuhl für seinen langjährigen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard geräumt. Der entscheidende Mann der CDU/CSU-Fraktion war nicht mehr der reaktionäre Fritz Schäffer, sondern Ernst Benda, den der sozialdemokratische Abgeordnete Martin Hirsch als „Sprecher der jungen deutschen Generation“ begrüßte. Benda stellte den Antrag, die Verjährungsfrist für Mord auf 30 Jahre zu verlängern. 1965 war die Zeit noch nicht reif für diese Idee, aber gleichzeitig war erkennbar, dass eine Mehrheit der Parlamentarier zu einem konstruktiven Ergebnis kommen wollte. Am Vorabend der Parlamentsdebatte veröffentlichte der Spiegel unter dem Titel „Für Völkermord gibt es keine Verjährung“ ein Gespräch zwischen Rudolf Augstein und Karl Jaspers, in dem Jaspers, der auch dem Auschwitz-Prozess als Zuhörer beigewohnt hatte, vehement für die Aufhebung der Verjährungsfrist plädierte.
Die Debatte vom 10. März 1965 wurde zu einer der Sternstunden in der Geschichte des Deutschen Bundestages. Einer der Höhepunkte war die Rede des sozialdemokratischen Rechtspolitikers Adolf Arndt, er schloss mit den Worten: „Es geht darum, dass wir dem Gebirge an Schuld und Unheil, das hinter uns liegt, nicht den Rücken kehren.“3 Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU), der am 20. Juli 1944 verhaftet und vom Volksgerichtshof zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden war, dankte Arndt ausdrücklich für seine Rede, die Fraktionen von SPD und CDU/CSU applaudierten anhaltend.
Am Ende beschloss der Bundestag, den Beginn der Verjährungsfrist auf den 31. Dezember 1949 festzulegen, sodass immerhin vier Jahre Zeit gewonnen waren. Dafür stimmten alle Abgeordneten der SPD und 180 der 217 CDU/CSU-Abgeordneten. Die FDP votierte fast geschlossen dagegen. Justizminister Ewald Bucher (FDP) trat anschließend zurück. Im Jahr darauf bildeten CDU/CSU und SPD eine Große Koalition, Ernst Benda wurde bald darauf Bundesinnenminister, danach Präsident des Bundesverfassungsgerichts. 1969 setzte der Bundestag nach einer dritten Debatte die Verjährungsfrist für Mord auf 30 Jahre herauf, 1979 hob er sie nach einer vierten und letzten Debatte ganz auf.
Im April 1966 brachte mein Vater Jaspers’ Buch Wohin treibt die Bundesrepublik? heraus. Das Spiegel-Gespräch bildete den ersten Teil, es folgte eine Analyse der Verjährungsdebatte, außerdem eine kritische Bestandsaufnahme des politischen Zustands der Bundesrepublik Deutschland.4 Das Buch fand sehr große Beachtung und löste eine enorme Diskussion aus. 18 Wochen lang stand es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.5
Als am 1. Dezember 1966 der ehemalige Nationalsozialist Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler wurde, gaben Karl Jaspers und seine Frau Gertrud, die schon lange in Basel lebten, aus Protest ihre deutsche Staatsangehörigkeit auf und wurden Schweizer Bürger. Im März 1979, zur vierten Verjährungsdebatte, brachte mein Vater das Spiegel-Gespräch noch einmal in einer preiswerten Neuausgabe6 heraus und schickte auf eigene Kosten jedem Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein Exemplar zu, weil ihm als liberalem Antifaschisten die weitere Verfolgung von NS-Verbrechen ein besonderes Anliegen war.
Zurück ins Jahr 1965. Neben dem Besuch der Gedenkstätte Dachau und der Verjährungsdebatte war ein drittes prägendes Erlebnis für mich das Hörspiel Die Ermittlung. Zugrunde lag ihm das Theaterstück Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen, in dem Peter Weiss mit den Mitteln des Dokumentartheaters den ersten Auschwitz-Prozess thematisiert. Am 19. Oktober 1965 wurde das Theaterstück simultan auf 15 verschiedenen west- und ostdeutschen Bühnen uraufgeführt, ein einmaliger Vorgang in der deutschen Theatergeschichte. Es beginnt mit dem „Gesang von der Rampe“ und endet mit dem „Gesang von den Feueröfen“. Die 20 Angeklagten treten mit ihren realen Namen auf, die etwa 400 Zeugen sind in neun anonymen Rollen konzentriert, die 24 Verteidiger zu einem einzigen Rechtsradikalen geronnen.
Die ungeheure Wirkung des Stückes lag vor allem in seiner dokumentarischen Kargheit begründet. Wenige Tage später gab es bereits eine dreistündige Hörspielfassung, die von allen ARD-Anstalten ausgestrahlt wurde und als Höhepunkt deutscher Hörspielkunst gilt. Ich hörte das Hörspiel heimlich unter der Bettdecke, da ich als 13-Jähriger eigentlich schon schlafen sollte. Das Theaterstück findet sich heute auf kaum einem Spielplan, aber das Hörspiel ist seit 2001 auch als Audiobuch lieferbar. Wer es einmal gehört hat, vergisst es nicht mehr.
Ein viertes prägendes Erlebnis sei hier genannt. Im Juni 1968 sprach Fritz Bauer an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität im Rahmen einer von der Humanistischen Union organisierten Vortragsreihe über „Ungehorsam in Geschichte und Gegenwart“. Es war seine letzte große öffentliche Rede, am 1. Juli starb er in seiner Wohnung in Frankfurt am Main. Die Humanistische Union stiftete damals in Andenken an ihren Mitgründer den Fritz-Bauer-Preis, der noch heute verliehen wird. Bauer hat nicht nur als Architekt des großen Auschwitz-Prozesses Rechtsgeschichte geschrieben. Er hat auch durch die Rehabilitierung des Widerstandsrechts einen entscheidenden Beitrag zur Ausbildung einer demokratischen Rechtskultur geleistet. (Vgl. den Beitrag Die Schuldfrage in diesem Band.)
1972 machte ich Abitur und studierte zunächst in München, dann in Berlin Geschichte. Nach meiner Promotion an der TU Berlin 1981 entschied ich mich gegen eine akademische Laufbahn und habe dann von 1982 bis 2002 als Verleger gearbeitet, bevor ich mich wieder intensiver der Welt der Wissenschaft zuwandte und mich 2006 an der Universität Potsdam habilitierte. Auch in meinen Jahren als Verleger habe ich mich jedoch immer sehr stark für Themen der deutschen Zeitgeschichte interessiert und engagiert. Ich will hier keine großen Titellisten zitieren, sondern mich auf einige signifikante Beispiele beschränken.
Die größte Herausforderung war für mich, als Verleger und auch als Herausgeber, die Dokumentation des Historikerstreites, die 1987 erschien. (Vgl. den Beitrag Ernst Nolte und der Historikerstreit. Zur Genese eines Konflikts in diesem Band.) Im Jahr darauf fand in Nürnberg eine Konferenz aus Anlass des 50. Jahrestags der „Reichskristallnacht“ statt. Ich hielt dort einen Vortrag zur nationalsozialistischen Kulturpolitik und ihren Profiteuren am Beispiel Münchens und verlegte auch den Tagungsband7. In Nürnberg lernte ich Jörg Friedrich und seine Arbeitsgruppe kennen, die die zwölf Nürnberger Nachfolgeprozesse in je einem Band dokumentieren wollten. Die Idee war aus einer Tagung im Rahmen der Nürnberger Gespräche8 hervorgegangen. Friedrich, der auch Robert Kempner bei der Niederschrift seiner Lebenserinnerungen unterstützt hatte, sollte den Band über den OKW-Prozess schreiben. Die Jahre gingen ins Land, das Buch, das am Ende über 1000 Seiten hatte, erschien schließlich 19939 und war nicht nur der erste, sondern zugleich auch der letzte Band der geplanten Reihe. Der Autor, der nie Geschichte studiert hatte, erhielt 1995 für seine fulminante Arbeit einen Ehrendoktortitel der Universität Amsterdam.
1990 kam die von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem verantwortete dreibändige Enzyklopädie des Holocaust heraus. Schon im Vorfeld hatte ich mich stark für die deutschen Übersetzungsrechte engagiert, da ich den israelischen Verleger Tsvi Raanan gut kannte. Als Herausgeber für die deutsche Ausgabe waren ursprünglich Martin Broszat, Andreas Hillgruber und Eberhard Jäckel vorgesehen, mit denen wir in München auch eine Arbeitsbesprechung veranstalteten, wobei zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt war, wie sich die Übersetzung finanzieren lassen würde. Nachdem Hillgruber und Broszat 1989 verstorben waren, wurden durch meine Vermittlung neben Jäckel Peter Longerich und Julius H. Schoeps als Herausgeber gewonnen. Das Finanzierungsproblem löste sich schließlich durch eine sehr großzügige Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Der Betrag war dreimal so hoch wie derjenige, den wir kalkuliert hatten, die Zuwendung war aber an einen Berliner Empfänger gebunden. So mussten wir dem Argon Verlag zunächst den Vortritt lassen. Immerhin konnte die Taschenbuchausgabe zwei Jahre später in der Serie Piper herauskommen und wurde sehr erfolgreich.
Die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung waren geprägt von einer erschreckenden Welle von Gewalttaten und einem Wiederaufflammen des Rechtsextremismus. Ein furchtbarer Höhepunkt war der Brandanschlag in Solingen am 29. Mai 1993, bei dem fünf türkischstämmige Frauen und Mädchen ermordet wurden. Ich initiierte an der Ludwig- Maximilians-Universität München die Vortragsreihe „Der neue alte Rechtsradikalismus“, die dann auch als Buch erschien.10
Am 19. April 1993 wurde in Bonn die Vereinigung Gegen Vergessen – Für Demokratie gegründet. Ihr Ziel war es, die Auseinandersetzung mit Rassismus, Fremden- und Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und anderen Formen des politischen Extremismus zu führen. Der Gründungsvorsitzende Hans-Jochen Vogel machte mich auf die Möglichkeit aufmerksam, dort Mitglied zu werden. Auf einen solchen Hinweis zögerlich oder gar ablehnend zu reagieren, war nicht vorgesehen. Am 1. November 1993 führte die Vereinigung ihre erste große öffentliche Veranstaltung durch. Die dort gehaltenen Reden habe ich anschließend als Buch herausgebracht.11 Die Vereinigung hat die Arbeitsbereiche Nationalsozialismus, SED-Regime, Politischer Extremismus und Demokratieförderung. Schon bald nach der Gründung war eine Tagung in Potsdam dem Erbe der DDR gewidmet, deren Ergebnisse ich ebenfalls publiziert habe.12
1995 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 40. Mal. Erstmals wurde der Jahrestag dieses Ereignisses mit sehr großem medialen Aufwand begleitet. Hans-Jochen Vogel war es ein Anliegen, dass im Jahr danach keine der erschöpften Aufmerksamkeit geschuldeten Schlussstrichgedanken aufkamen. Auf seine Bitte hin organisierte ich die Vortragsreihe „Kein Schlussstrich. Gegen das Vergessen“, die im Münchner Alten Rathaussaal stattfand und die wir anschließend mit einigen weiteren Texten gemeinsam als Buch herausgaben.13
Damals war ich bei Piper bereits ausgeschieden. 1997 erwarb ich gemeinsam mit einem Schweizer Partner den Zürcher Pendo Verlag. Dort erschien 1999 eine Dokumentation der langen und kontroversenreichen Debatte über das Denkmal für die ermordeten Juden Europas14, die mich auch deshalb beschäftigte, weil ich Mitglied im Kuratorium des Fördervereins war. Der Schweizer Historiker Stefan Mächler schrieb ein ausgezeichnetes Buch über den Fall Wilkomirski15, der uns als Schweizer Verlag ganz besonders interessierte. (Vgl. dazu den Beitrag Woran wir uns erinnern, wenn wir uns erinnern in diesem Band.) Das Moses-Mendelssohn-Zentrum, wo ich 1998 auch Fellow war, veranstaltete später eine Konferenz zum Wilkomirski-Syndrom16, die wir ebenfalls publizierten.
2001 geschah etwas, das mich noch einmal mit meiner früheren Wirkungsstätte in Verbindung brachte. Der Piper Verlag nahm das höchst umstrittene Buch Die Holocaust-Industrie des Politikwissenschaftlers und Israelhassers Norman Finkelstein ins Programm.17 Dem Verlag ging es um „Kasse statt Klasse“ (Salomon Korn). Das widersprach allem, wofür mein Vater und ich immer eingetreten waren. Ich wandte mich in einem Artikel gegen die Publikation, der zuerst in den Frankfurter Jüdischen Nachrichten18 erschien, und gab einen Sammelband mit überwiegend kritischen Stimmen heraus, was auch damit zusammenhing, dass einige der Verteidiger Finkelsteins, die wir selbstverständlich genauso zu Wort kommen lassen wollten, ihre Mitwirkung ablehnten.
Obwohl der Piper Verlag versuchte, das Erscheinen des Bandes zu verhindern, versammelte sich darin eine stattliche Zahl sehr bedeutender Autoren, so zum Beispiel Omer Bartov, Raul Hilberg, Iring Fetscher, Shlomo Aronson, Natan Sznaider, Philipp Blom und Michael Brenner.19 Interessant waren die Erfahrungen, die ich in diesem Zusammenhang mit der Medienlandschaft machte. Während mich nahezu jeder öffentlich-rechtliche Fernsehsender um ein Interview bat, was dem Erfolg des Buches sehr zugutekam, ist das Wort Holocaust für die privaten Fernsehsender ganz offensichtlich ein unbekanntes Fremdwort.
Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Staatenwelt hatte sich eine ganz neue Situation ergeben. Es endete das „kurze 20. Jahrhundert“, wie der ungarische Historiker Iván Tibor Berend die Zeit von 1914 bis 1989 genannt hat. Sein britischer Kollege Eric Hobsbawm bezog sich darauf, sprach selbst aber vom Zeitalter der Extreme.20 Das Ende dieses Zeitalters, um das es in diesem Buch geht, brachte neue Probleme mit sich, denn es prallten ganz unterschiedliche historische Narrative und Memorialkulturen aufeinander, die sich über Jahrzehnte ausgebildet hatten.
Die Menschen in den mittel- und osteuropäischen Staaten haben eine doppelte Diktaturerfahrung machen müssen. Dies gilt auch für die Deutschen in der DDR. (Vgl. dazu den Beitrag Geeintes Land, geteilte Erinnerung in diesem Band.) Entweder wurden diese Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg Sowjetrepubliken wie die baltischen Staaten und Belarus oder Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes wie die DDR, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Sie waren zum Teil nach Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes von der Sowjetunion besetzt worden. Im Zweiten Weltkrieg litten sie unter dem deutschen Besatzungsregime, und nach dem Krieg hatten sie kommunistische Regime, die sich dem Führungsanspruch der Sowjetunion unterwerfen mussten. Mit Ausnahme von Belarus, heute die einzige lupenreine Diktatur in Europa, sind alle diese Staaten 2004 bzw. 2007 Mitglied der Europäischen Union geworden.
Diese Osterweiterung der EU stellt für die Diskussionen über eine europäische Erinnerungskultur eine neue Herausforderung dar. So hat die damalige lettische Außenministerin Sandra Kalniete 2004 bei der Eröffnungsveranstaltung der Leipziger Buchmesse erklärt, „dass beide totalitäre Regime – Nazismus und Kommunismus – gleich kriminell waren. Es darf niemals eine Unterscheidung zwischen ihnen geben, nur weil eine Seite auf der Seite der Sieger gestanden hat.“21 Diese Auffassung stieß hierzulande auf Unverständnis. Verständlich wird sie aus der Diktaturerfahrung in einem Staat wie Lettland. Einer relativ kurzen Zeit der deutschen Okkupation, in der vor allem die jüdische Minderheit der Verfolgung ausgesetzt war, folgten Jahrzehnte der sowjetischen Herrschaft, die die ganze Gesellschaft überformten und eine völlig andere Erinnerungskultur etablierten.
Dies manifestierte sich insbesondere an signifikanten Erinnerungsorten wie zum Beispiel dem polnischen Katyn, wo der NKWD, das sowjetische Volkskommissariat des Inneren, auf Befehl Stalins im April 1940 Tausende von polnischen Offizieren ermordet hatte. Wer die offizielle sowjetische Version in Frage stellte, dass diese Morde von „deutschfaschistischen Henkern“ verübt worden waren, musste erhebliche berufliche Schwierigkeiten gewärtigen, wenn nicht Schlimmeres. Erst Michail Gorbatschow setzte dieser Geschichtsfälschung 1990 durch eine offizielle Entschuldigung gegenüber dem polnischen Volk ein Ende.
Auch das Okkupationsmuseum in der lettischen Hauptstadt Riga ist ein gutes Beispiel für den Wandel der nationalhistorischen Narrative. Bis 1990 war es das Museum der Roten Lettischen Schützen, die das Land im Ersten Weltkrieg gegen die deutschen Truppen verteidigt hatten. Erst nach dem Ende der Sowjetunion entstand das Okkupationsmuseum, das Nazismus und Kommunismus nicht gleichsetzt, wie von Sandra Kalniete gefordert, sondern deutlich gewichtet. Über 80 Prozent der Ausstellung sind der sowjetischen Okkupation gewidmet, die deutschen Untaten werden sehr knapp dargestellt, und die lettische Mitwirkung daran reduziert sich auf ein paar irregeleitete Individuen. Tatsächlich hatte die 1943 aufgestellte Lettische Legion, die der Waffen-SS angegliedert war, fast 100 000 Mitglieder. An sie wird noch heute jedes Jahr am „Tag des Soldaten“ erinnert, der für kurze Zeit sogar ein staatlicher Gedenktag war.
Auch auf gesamteuropäischer Ebene kam es zu einer deutlichen Akzentverschiebung. Tunne Kelam, ehemals einer der führenden estnischen Dissidenten, gründete im Januar 2008 die Arbeitsgruppe „Vereintes Europa – vereinte Geschichte“, wobei die Geschichte durch eine Gleichsetzung der Verbrechen Stalins und Hitlers vereint werden sollte. Kelam gehörte damals der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament an, zu seinen Mitstreitern zählten Vytautas Landsbergis, der erste Staatspräsident Litauens nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit, und der frühere (und spätere) ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Kelam und Landsbergis gehörten auch zu den Initiatoren der „Prager Erklärung zum Gewissen Europas und zum Kommunismus“, die sich für einen „Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus“ einsetzte. Kritiker warfen der Erklärung vor, sie verharmlose den Holocaust und ignoriere bewusst dessen genozidalen Charakter.
Dennoch beschloss das Europäische Parlament im Frühjahr 2009 mit großer Mehrheit, den 23. August, den Tag, an dem 1939 der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt unterzeichnet worden war, zum „europaweiten Gedenktag an die Opfer aller totalitären Regime“ zu erklären. Den Antrag dazu hatten Abgeordnete der EVP-Fraktion gestellt, darunter der Deutsche Bernd Posselt (CSU). Posselt, der auch Vorsitzender der Sudentendeutschen Landsmannschaft war, erklärte in diesem Zusammenhang, die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg sei „gezielter Völkermord“ gewesen,22 eine Behauptung, die fatal an die AfD-Rhetorik vom „Bevölkerungsaustausch“ erinnert, ein Begriff, der suggerieren soll, dass die deutsche Nation ausgelöscht wird, um Platz für Einwanderer, etwa aus dem Nahen Osten, zu schaffen.
Die Entscheidung des Europäischen Parlamentes stieß auf breiten Widerspruch. Das Internationale Ravensbrück-Komitee nannte den 23. August einen „Gegengedenktag zum 27. Januar“, also dem Holocaust-Gedenktag, und der Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) Ulrich Schneider sprach von einem „ideologischen Gegenangriff auf das historische Fundament der europäischen Nachkriegsentwicklung“.23 Der Historiker Wolfgang Benz kritisierte: „Das pauschale Gedenken, das der 23. August symbolisiert, nivelliert die Unterschiede zwischen nationalsozialistischer Verfolgung und kommunistischem Terror und marginalisiert damit den Judenmord wie den Genozid an Sinti und Roma.“24 Durchgesetzt hat sich der neue Gedenktag, für den ein Bedarf nie erkennbar war, nicht.
Dramatisch verschärft haben sich die Spannungen zwischen den von sowjetischer Besatzung befreiten ehemaligen Ostblockstaaten und Russland, seit im Februar 2014 getarnte russische Truppen und von Russland unterstützte Milizen in der Ostukraine einen verdeckten Krieg gegen die Regierung in Kiew begonnen haben. Zudem konstituierte sich die Krim, bis dahin Teil der Ukraine, nach einer von der Völkergemeinschaft nicht anerkannten Abstimmung als unabhängige Republik und schloss sich im März 2014 der russischen Föderation an. Infolge dieser Ereignisse war bei den im selben Jahr stattfindenden Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges und 2015 zum 70. Jahrestag seines Endes eine gemeinsame Teilnahme der Staatschefs aller beteiligten Länder nicht mehr möglich. Nicht nur zwischen der Ukraine und Russland, sondern auch zwischen Polen und Russland kam es im Vorfeld zu heftigen Auseinandersetzungen.
Als Bundespräsident Joachim Gauck am 1. September 2014 in Danzig auf der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen sprach, beklagte er die kriegerischen Auseinandersetzungen am südöstlichen Rand Europas und fügte hinzu: „Nach dem Fall der Mauer hatten die Europäische Union, die Nato und die Gruppe der großen Industrienationen jeweils besondere Beziehungen zu Russland entwickelt und das Land auf verschiedene Weise integriert. Diese Partnerschaft ist von Russland de facto aufgekündigt worden.“25 So ist es bis heute.
Der Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz am 27. Januar 2015 blieb der russische Staatspräsident Wladimir Putin demonstrativ fern. Dass Putin, der sich einst bei den Polen für den Hitler-Stalin-Pakt entschuldigt hatte, nun auf dessen Legitimität insistiert und in Russland einen Stalinkult mindestens duldet, wenn nicht fördert, fügt sich ins Bild. Der Historiker Heinrich August Winkler, der bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages am 8. Mai 2015 die Hauptrede hielt, hält die Rehabilitierung des Hitler-Stalin-Paktes für den größten geschichtspolitischen Sündenfall des russischen Präsidenten: „Putins Geschichtsrevisionismus harmoniert fatal mit seiner Zusammenarbeit mit rechtsradikalen und neofaschistischen Parteien in Europa.“26
Über 70 Jahre nach Kriegsende hat sich Russland von dem bis dahin geltenden Konsens, der die Ablehnung der gewaltsamen Veränderung von Staatsgrenzen ausdrücklich einschloss, verabschiedet. Gleichzeitig haben in vielen Ländern nationalistische Kräfte Erfolg, die die Idee der europäischen Integration grundsätzlich in Frage stellen. Es gibt identitäre Bewegungen, die einen „Ethnopluralismus“ propagieren, der jegliche Migration ablehnt und Menschen nur im Land ihrer Herkunft ein Lebensrecht zubilligt. Diese neue Form der Ausländerfeindlichkeit stellt zentrale Errungenschaften der Europäischen Union wie das Prinzip der Freizügigkeit in Frage und widerspricht diametral der von Jürgen Habermas propagierten Idee des Verfassungspatriotismus, einer Nation von Staatsbürgern, deren Loyalität sich nicht auf gemeinsame ethnische Wurzeln, sondern auf gemeinsame Verfassungsnormen richtet. Die Verankerung des Nationalstaates in universalen Verfassungsprinzipien ist gerade für Deutschland, das Land, das einst den Nationalsozialismus hervorgebracht hat, von ganz besonderer Bedeutung. Ein Rückfall in nationalen Egoismus, wie ihn bestimmte politische Kräfte anstreben, wäre fatal.
Eine weitere Herausforderung für unsere Memorialkultur besteht darin, dass die kommunikative Verbindung zur Zeit des Nationalsozialismus unwiderruflich verloren geht. Wer bei Kriegsende 18 Jahre alt war, ist heute 95. Noch sind einige Menschen unter uns, die Zeugnis ablegen können von dem, was sie in der NS-Zeit erlebt haben. Es wird der Tag kommen, an dem es niemanden mehr gibt, der dazu in der Lage wäre. Es droht eine Mediatisierung unseres sozialen Gedächtnisses, eine „Entwirklichung der Erinnerung“ (Aleida Assmann). Viele, vor allem jugendliche Besucher der KZ-Gedenkstätten vermögen heute schon das Gesehene nicht mehr ohne Weiteres in Beziehung zur eigenen Lebenswelt zu setzen.
Das Gedenken an den Holocaust hat inzwischen eine globale Dimension, „Auschwitz“ ist zu einer universalen Katastrophenmetapher geworden. Als die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 1. November 2005 den 27. Januar zum „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ erklärte,27 verurteilte sie „vorbehaltlos alle Manifestationen von religiöser Intoleranz, Verhetzung, Belästigung oder Gewalt gegenüber Personen oder Gemeinschaften aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder religiösen Überzeugung, gleichviel wo sie sich ereignen“. Die Mitgliedsstaaten wurden aufgefordert, „Erziehungsprogramme zu erarbeiten, die die Lehren des Holocaust im Bewusstsein künftiger Generationen verankern werden, um verhindern zu helfen, dass es in der Zukunft wieder zu Völkermordhandlungen kommt“. Anerkennung wurde den Staaten gezollt, „die sich aktiv um die Erhaltung der von den Nazis während des Holocaust als Todeslager, Konzentrationslager, Zwangsarbeitslager und Gefängnisse genutzten Stätten bemüht haben“. In der Debatte über die Resolution verwies der chinesische Delegierte Liu Zhongxin, selbst Vertreter einer brutalen Diktatur, auf „die unbestreitbare Bedeutung von Werten wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit“. Liu betonte, dass es die Aufgabe der Vereinten Nationen sei, „zukünftigen Generationen die ‚tiefgreifenden Lektionen‘ des Holocaust zu vermitteln, um die Wiederholung ähnlicher Menschenrechtsverbrechen zu verhindern“. Es ist bezeichnend, dass in der von allen konkreten Bezügen zum Tatgeschehen befreiten Resolution das Wort Antisemitismus nicht einmal vorkommt. Auch der Hinweis darauf, dass es im Holocaust um Verbrechen an den europäischen Juden ging, ist sorgfältig vermieden.
Es hat Jahrzehnte gedauert, bis der Holocaust als singuläres Menschheitsverbrechen wahrgenommen wurde. Dem Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg lagen 1946 vier Anklagepunkte zugrunde: 1. Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, das Kriegsrecht und die Humanität, 2. Teilnahme an der Planung, Vorbereitung, Entfesselung und Führung von Angriffskriegen, 3. Verbrechen gegen Mitglieder feindlicher Truppen und die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete, 4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie zum Beispiel die Ermordung und Verfolgung von Oppositionellen und die Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Deportation und andere unmenschliche Handlungen gegen Zivilbevölkerungen vor oder während des Krieges. Der Massenmord an den europäischen Juden fungierte als eines von vielen Beispielen für den vierten Punkt der Anklage. Den Holocaust besonders hervorzuheben, lag nicht im Interesse der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaften. Unangenehme Fragen nach Komplizenschaft der eigenen Bevölkerung bei den Verbrechen hätten die Folge sein können. Die alliierten Regierungen wollten auch nicht den Boden dafür bereiten, dass die jüdischen Überlebenden besondere Entschädigungsansprüche stellen konnten, weil sie etwa schlimmer gelitten hätten als andere Bevölkerungsgruppen. Der Antisemitismus wurde einfach unter dem Oberbegriff Rassismus rubriziert.28
Die Holocaustforschung blieb lange Zeit ein Randthema, mit dem sich vornehmlich engagierte jüdische Publizisten wie Eugen Kogon, H. G. Adler und Joseph Wulf beschäftigten. (Vgl. den Beitrag Vom Täterort zum Dokumentationszentrum. Die Topographie des Terrors in Berlin in diesem Band.) In den Hitler-Biografien der ersten Nachkriegsjahrzehnte kam die Judenvernichtung kaum vor. Bei der Darstellung der Kriegsjahre stand das Geschehen an der Ostfront im Mittelpunkt, die Mordaktionen an der jüdischen Bevölkerung wurden allenfalls am Rande erwähnt. Es ging mehr um die Taten als um die Untaten der deutschen Wehrmacht. 1973 erschien die Biografie von Joachim Fest, die damals schon nicht mehr auf der Höhe der Forschung war, mit 850 000 verkauften Exemplaren dennoch für lange Zeit zur einflussreichsten zeitgeschichtlichen Darstellung der Nachkriegszeit wurde. Fest schildert ausführlich Hitlers Aufstieg vom Männerheiminsassen zum Demagogen. Wenige Seiten nur standen ihm für Hitlers Antisemitismus zur Verfügung, und die Nürnberger Rassengesetze fallen ganz unter den Tisch. Beim Überfall auf die Sowjetunion geht es Fest weniger um den rassenpolitisch motivierten Vernichtungskrieg als vielmehr darum, Hitlers „nahezu antikisch anmutende Feldherreneinsamkeit“ ins rechte Licht zu rücken. Noch problematischer als die Biografie war Fests Film Hitler – Eine Karriere (1977), der in erster Linie mit nur sehr sparsam kommentierten Filmsequenzen aus dem Reichspropagandaministerium arbeitete.
Erst in den 1970er und vor allem in den 1980er Jahren „verdichteten sich die einzelnen Forschungen zu einem breiter angelegten Trend, deutlich sichtbar an ersten internationalen Konferenzen, die sich mit dem nun als ‚Holocaust‘ bezeichneten Massenmord beschäftigten.“29 Damals entstand die Überzeugung, „dass der Holocaust ein präzedenzloses Menschheitsverbrechen darstellt, das sich durch eine Reihe singulärer Merkmale von anderen Genoziden unterscheidet“30. Der erste Großangriff gegen diese Position ging von Ernst Nolte aus. (Vgl. den Beitrag Ernst Nolte und der Historikerstreit. Zur Genese eines Konflikts in diesem Band.) Damals kam der Angriff gegen die Singularitätsthese von rechts, heute kommt er zumeist von links. Ein früher Proponent eines linken israelbezogenen Antisemitismus, der Israel insgesamt delegitimieren will, war der schon erwähnte Norman Finkelstein, der den Gazastreifen mit dem Warschauer Getto verglich und behauptete, die Singularitätsthese sei ein Produkt der „Holocaust-Industrie“. Seine Website ist bis heute voller Anklagen gegen den Apartheid-Staat Israel, Werbung für die Hisbollah und Propaganda für die radikalen Palästinenser.31
Ein prominenter Vertreter des neuerdings wieder viel diskutierten Postkolonialismus ist der kamerunische Historiker Achille Mbembe, der, jedenfalls hierzulande, von Leuten hofiert wird, bei denen man bezweifeln darf, dass sie seine Arbeiten wirklich gelesen haben.32 Mbembe ist ein typischer Vertreter des israelbezogenen Antisemitismus. Der Holocaust ist für ihn eine beliebig instrumentalisierbare Chiffre für jede Art von Verfolgung oder Diskriminierung. Der Holocaust, so sagt er, dauert an, solange es Lager gibt,33 und – das ist nicht überraschend – der „größte moralische Skandal unserer Zeit“ ist die israelische Herrschaft über die in den von Israel besetzten Gebieten lebende palästinensische Bevölkerung. Waren die europäischen Juden einst in der Position „weißer Neger“, so seien die Israelis heute als „weiße Juden“ selbst in der Rolle von Kolonialherren. Bei Mbembe ist der Begriff des „Negers“ von der Hautfarbe gänzlich abgelöst, sodass Palästinenser zu „Negern“, die Juden aber zu „Weißen“, d. h. Unterdrückern werden.34 Der Postkolonialismus, der alle Übel dieser Welt aus dem Kolonialismus ableiten will und deshalb überall, wo es Unterdrückung, Ausbeutung und Mord gibt, koloniale Verhältnisse sieht, möchte konsequenterweise auch den Holocaust zum Kolonialverbrechen erklären und die von den Nationalsozialisten zur Vernichtung bestimmten Juden zu einer Opfergruppe unter vielen.
Der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Rothberg stellt die Singularitätsthese mit anderen Argumenten in Frage, aber auch bei ihm ist die antiisraelische Stoßrichtung klar. Im Untertitel seines Buches ist zwar vom Zeitalter der Dekolonisierung die Rede, also einer Epoche, die ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Seine These von der multidirektionalen Erinnerung35 zielt aber auf die Gegenwart. Rothberg wirft den amerikanischen Juden vor, dass sie „ihre Loyalität zugleich auf einer Besessenheit vom Holocaust und einer Loyalität zu Israel aufbauten“.36 Die Bedeutung des Antisemitismus für die Ermordung der europäischen Juden leugnet er insofern, als der Antisemitismus zum „antijüdischen Rassismus“ diminuiert wird, sodass die eliminatorische Ideologie des nationalsozialistischen Antisemitismus aus dem Blick gerät. Es ist dann nur konsequent, dass im Zuge der multidirektionalen Erinnerung der Holocaust in das große globale Feld der Untaten und Opfererzählungen eingereiht wird. Die historische Dimension des Ereignisses geht verloren, der zeitliche und der räumliche Kontext verschwinden im Nebel heilloser Vergangenheit.
Der australische Historiker A. Dirk Moses hat den jüngsten und niveaulosesten Beitrag zu dieser Debatte geliefert. Er vergleicht nicht nur die israelische Verwaltung der besetzten Gebiete mit „the Nazi empire’s conquest of Europe and mass crimes during World War II“37, er hat auch einen „Katechismus der Deutschen“ erfunden, der angeblich „mit amerikanischen, britischen und israelischen Eliten“ ausgehandelt worden ist38 – eine typische antisemitische Verschwörungserzählung. Moses’ Katechismus besteht aus fünf „Überzeugungen“: 1. Der Singularitätsthese, 2. der von Dan Diner entwickelten These vom Zivilisationsbruch, 3. Angela Merkels Aussage, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei, 4. der Überzeugung, dass der Antisemitismus ein spezifisch deutsches Phänomen sei und nicht mit Rassismus verwechselt werden dürfe, und 5. der Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus. Diese Überzeugungen sind „für eine ganze Generation zu Glaubensartikeln geworden“. Der Katechismus impliziere eine Heilsgeschichte, in der die Opferung der Juden durch die Nazis die Voraussetzung für die Legitimität der Bundesrepublik sei. Eine zentrale Rolle komme in diesem christologischen Erlösungsnarrativ der Wiederauferstehung des Opfers zu, deshalb „unternimmt der deutsche Staat diverse Maßnahmen, die eine ‚Wiederaufforstung‘ von Juden in Deutschland hervorbringen sollen“. Es ist erstaunlich, dass ein solch abenteuerlicher und bösartiger Unsinn in deutschen Feuilletons ernsthaft diskutiert wird.
Die fünf „Überzeugungen“ sind nicht alle so unvernünftig, wie Moses es gerne hätte. Die Behauptung, dass der Antisemitismus ein deutsches Phänomen sei, ist so haltlos, dass man darüber nicht diskutieren muss. Antisemitismus gibt es auf der ganzen Welt. Sicher ist man vor ihm, wie Hannah Arendt einmal bemerkt hat, nur auf dem Mond. Richtig ist allerdings, dass er nirgends so mörderische Konsequenzen hatte wie in Deutschland. Und richtig ist auch, dass er nicht mit Rassismus gleichgesetzt werden kann. Angela Merkel hat aus guten Gründen die deutsche Verantwortung für die Sicherheit Israels betont, und wir können sicher sein, dass sie sich nicht zuvor mit irgendwelchen ausländischen Eliten deswegen abgesprochen hat. Antizionismus ist nicht mit Antisemitismus identisch, man findet ihn zum Beispiel auch unter ultraorthodoxen Juden. Aber sehr häufig verbergen sich hinter der Maske des Antizionismus tatsächlich verschiedene Formen des Antisemitismus.
Dan Diner bezeichnet den Holocaust als Zivilisationsbruch, als „Zerbrechen ontologischer Sicherheit“, das „Geschehen Auschwitz“ war eine „prospektive Vernichtung aller Juden, weil sie Juden waren, ein ultimativer Genozid, der bislang am radikalsten durchgeführte Völkermord der Geschichte“.39 Moses schreibt dazu: „Für den Historiker Dan Diner etwa nimmt der Holocaust als Zivilisationsbruch den Platz ein, der vormals Gott zukam.“40 Hier artikuliert sich der bekannte Vorwurf der Sakralisierung des Holocaust in einer besonders bizarren Variante. Von konservativer Seite wird dieser Vorwurf schon länger erhoben. So attestiert René Schlott Diner eine „eurozentrische Sprecherposition“ und bezeichnet sein Buch Gegenläufige Gedächtnisse als „Ausdruck einer überholten Geschichtsschreibung“.41 Egon Flaig sprach schon vor Jahren vom „Tanz ums goldene Kalb ‚Unerklärbarkeit‘“ und „quasi-religiöser Sinnstiftung“.42
Wollte man polemisch argumentieren, könnte man sagen, zum Katechismus der Postkolonialisten in der Nachfolge von Aimé Césaire43 gehört die Ineinssetzung von Antisemitismus und Rassismus. Das ist die einfachste und wirkungsvollste Form, die Singularitätsthese zu negieren. Es geht aber gar nicht nur um die Singularitätsthese, sie gilt ohnehin lediglich für die vergangene Zeit, bis zu unserer Gegenwart. Dem Zivilisationsbruch des Holocaust könnte eines Tages ein noch schlimmeres Verbrechen folgen. Entscheidend ist vielmehr, dass Antisemitismus nicht dasselbe ist wie Rassismus. Der Rassismus ist eine Herrschaftsideologie, die die Menschheit aufgrund von äußeren Merkmalen in unterschiedliche „Rassen“ einteilt und dabei zugleich die Überlegenheit der eigenen „Rasse“ betont und so ihre Herrschaft über die anderen „Rassen“ rechtfertigt. Entstanden ist diese relativ junge Ideologie im Kontext des modernen Sklavenhandels. Ihr Ziel ist nicht Vernichtung, sondern Herrschaft und Ausbeutung, wobei auch Millionen von Menschen umgekommen sind, deren Leben aus der Sicht der Rassisten als wertlos galt.
Der Antisemitismus ist dagegen ein universelles Phänomen, dem ein manichäisches Weltbild zugrunde liegt. (Vgl. den Beitrag „Pest in Rußland“. Rosenberg und die Russische Revolution in diesem Band.) Im Manichäismus steht dem göttlichen Lichtreich das Reich der Finsternis gegenüber. Im nationalsozialistischen Antisemitismus befindet sich das nordische Blut in einem Kampf auf Leben und Tod mit dem jüdischen Streben nach Weltherrschaft. Es geht nicht um Herrschaft und Ausbeutung, sondern das Ziel muss die Vernichtung des Gegners sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wird auch der eigene Untergang in Kauf genommen. Diese manichäische Antithetik wurde forciert durch das Erlebnis des Ersten Weltkrieges, dessen Bedeutung für den Prozess der deutsch-jüdischen Dissimilation nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Auschwitz ist eine zentrale Signatur der deutschen Geschichte im Zeitalter der Extreme. Man verkleinert nicht Gräueltaten anderer totalitärer oder kolonialer Regime, wenn man feststellt, dass dieser Versuch, eine ganze Ethnie systematisch auszulöschen, ein einzigartiger Vorgang war. Jede Zeit hat ihre Deutungen, und das Ringen um die Erinnerung wird immer wieder neue Formen annehmen und immer wieder zu anderen Ergebnissen führen. Aber für die Gemeinschaft der Deutschen, die in der Tradition der deutschen Geschichte steht, wird auch weiterhin gelten, dass es zur Erinnerung an Auschwitz keine Alternative gibt. Der amerikanische Historiker Raul Hilberg, als Kind einer aus Galizien stammenden jüdischen Familie in Wien geboren, hat über die Vernichtung der europäischen Juden geschrieben: „Geschichte lässt sich nicht ungeschehen machen, erst recht nicht die Geschichte dieses Ereignisses, das im Zentrum einer Erschütterung stand, die die Welt verändert hat. Diese Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich selbst nicht zu kennen.“44
Das Zeitalter der Weltkriege
Die von Europa ausgehende Durchdringung der Welt seit 1500, die Entstehung des modernen Weltsystems, war zugleich eine Geschichte der Gewalt. Es entstand eine globale Hierarchie der Herrschaftsverhältnisse, Kommunikationswege und Warenströme, deren imperiale Ansprüche gewaltsam durchgesetzt wurden. In Europa selbst war die Zeit zwischen 1500 und 1914 gekennzeichnet durch die Entstehung immer größerer politischer Einheiten, sodass ihre Gesamtzahl sich von etwa 500 auf kaum 30 reduzierte. Nationalstaaten wurden die entscheidenden Akteure bei der Ausbildung von Imperien. Zugleich verlagerte sich die Gewalt in die Peripherien. Zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und der Französischen Revolution war in Europa die große Zeit der Kabinettskriege, die von kleinen stehenden Heeren für begrenzte Ziele unter möglichst weitgehender Schonung der Zivilbevölkerung geführt wurden.
Die Sattelzeit um 1800 brachte den Volkskrieg nach Europa zurück. Die Demokratisierung des Krieges führte zu seiner Brutalisierung. Kriege wurden nicht länger von Söldnern, Berufssoldaten oder Spezialisten geführt, sondern von Volksheeren. Die Kabinettskriege wurden abgelöst durch eine Generalmobilmachung, die alle Ressourcen in den Dienst des Krieges stellte und nichts und niemanden schonte. Jeder Angehörige der Nation war potenziell auch ein Kombattant. Diese Entwicklung nahm an der Schwelle zum 19. Jahrhundert ihren Anfang, sie ging zurück auf die Französische Revolution. Am 23. August 1793 wurde die Anordnung der Levée en masse vom Wohlfahrtsausschuss, dem Nationalkonvent in der Zeit der Französischen Revolution, verabschiedet, nachdem Danton gefordert hatte, jedem Franzosen ein Gewehr in die Hand zu geben. Alle unverheirateten Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren waren nun zum Kriegsdienst verpflichtet. Diese Anordnung gilt als der erste Fall einer allgemeinen Wehrpflicht in der europäischen Geschichte, sie diente anderen Staaten als Vorbild. 1814 wurde im Zuge der Heeresreform auch in Preußen die Wehrpflicht gesetzlich verankert. Die Bewaffnung des Volkes trug maßgeblich zum Sieg Frankreichs im Ersten Koalitionskrieg 1797 bei, wandte sich aber nur wenige Jahre später in der Völkerschlacht bei Leipzig, dem Höhepunkt der deutschen Befreiungskriege, und auch im Spanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen.
Und doch war eine der großen Leistungen des 19. Jahrhunderts in Europa die Einhegung der Gewalt. Die Doktrin vom schnellen und überschaubaren Kabinettskrieg lebte fort und lag auch noch den deutschen Planungen für den Ersten Weltkrieg, dem Schlieffen-Plan, zugrunde, auch wenn im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 Volksbewaffnung, Partisanen und asymmetrische Kriegsführung wieder ein Thema gewesen waren. Mit der Gefangennahme Napoleons III. am 4. September 1870 kam die Monarchie in Frankreich endgültig an ihr Ende. Jules Favre und Léon Gambetta traten an die Spitze einer republikanischen „Regierung der nationalen Verteidigung“. Gambetta, der den Krieg ursprünglich abgelehnt hatte, proklamierte nun einen Volkskrieg gegen die Deutschen. Nach der Kriegserklärung an Preußen war die französische Armee unerwartet schnell in die Defensive geraten. Um den Vormarsch der preußischen Truppen zu stoppen, hatte schon Kaiser Napoleon III. die Franktireurs zu den Waffen gerufen. Die Franktireurs, wörtlich übersetzt „Freischützen“, waren irreguläre Truppen, die den Feind durch eine Art Partisanenkrieg beschäftigen sollten. Gambetta weitete diese Art der Kriegsführung erheblich aus, konnte die Niederlage Frankreichs aber nicht verhindern. Bei den deutschen Soldaten wurden die Franktireurs dennoch zu einem stark wirkenden Feindbild, da sie zum Teil ohne Uniformen und oft aus Hinterhalten und mit Sabotageakten die deutschen Nachschublinien angriffen. Bei dem Versuch, die deutschen Repressions- und Vergeltungsmaßnahmen im August 1914 in Belgien zu rechtfertigen, spielte die Erinnerung an die französischen Franktireurs eine bedeutende Rolle.
1914 kehrte die exzessive Gewalt von der Peripherie ins europäische Zentrum zurück. Der Erste Weltkrieg markiert einen Übergang. Er steht am Beginn eines Zeitalters, das durch ein bis dahin undenkbares Ausmaß an Massengewalt gekennzeichnet war. Der Historiker Eric Hobsbawm spricht von einem „Zeitalter des Massakers“. Doch auch in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte es schon gewaltige Massaker gegeben, nur eben nicht auf dem europäischen Kontinent. Besonders brutal war das belgische Kolonialregime im Kongo gewesen. Die einheimische Bevölkerung, die 1880 noch 20 Millionen Menschen umfasst hatte, halbierte sich innerhalb von 30 Jahren. In den Kolonialkriegen in Deutsch-Südwestafrika kam es nach 1904 zu genozidalen Aktionen, das Volk der Herero wurde nahezu ausgerottet. Noch mehr Menschen, wenn auch ein geringerer Prozentsatz der Gesamtbevölkerung, kamen bei dem fast gleichzeitigen Krieg gegen die Maji-Maji in Deutsch-Ostafrika um. Der erste Genozid auf europäischem Boden, die massenhafte Ermordung der im Osmanischen Reich lebenden Armenier, vollzog sich dann bereits 1915/16 im Windschatten des Ersten Weltkrieges. Die Schätzungen der Zahl der Opfer gehen zum Teil weit über eine Million.
Ein ganz entscheidendes Charakteristikum der Kolonialkriege waren die extrem unterschiedlichen Opferzahlen auf beiden Seiten. Dass bei einem solchen Krieg vielleicht ein Dutzend Kolonialsoldaten einer europäischen Macht umkamen, auf der anderen Seite aber viele Tausend Einheimische, war nicht ungewöhnlich. So starben zum Beispiel 1898 bei der Schlacht von Omdurman drei britische Offiziere und 25 britische Soldaten, die Ägypter, die auf der Seite der Briten kämpften, verloren zwei Offiziere und 18 Soldaten. Die Zahl der gefallenen Sudanesen betrug dagegen fast 10 000, hinzu kamen mindestens noch einmal so viele Verwundete, außerdem gerieten 5000 Soldaten in Gefangenschaft, sodass die Armee des Mahdi Muhammad Ahmad, der eine Rebellion der afrikanischen Bevölkerung gegen die ägyptische Herrschaft angeführt hatte, praktisch vollständig vernichtet war. Die Schlacht gilt als ein Wendepunkt der Militärgeschichte, unmittelbar nach ihrem Sieg sicherten sich die Briten die Herrschaft über den Sudan und damit ihre Position im östlichen Afrika.
Der Grund für die extremen Zahlenverhältnisse war vor allem in einer neuen Waffe zu sehen, dem Maschinengewehr, das der amerikanisch-britische Erfinder Hiram Maxim 1885 auf den Markt gebracht hatte. Die Maxim Gun konnte 500 bis 600 Schuss pro Minute abfeuern, sodass eine kleine, mit Maschinengewehren ausgerüstete Truppe ganze Armeen in Schach halten und auch besiegen konnte. Im Russisch-Japanischen Krieg von 1905/06, der in mancher Hinsicht den großen industrialisierten Krieg zehn Jahre später antizipierte, kämpften beide Seiten mit Maxim Guns. Im Ersten Weltkrieg setzten die großen Nationen dann eigene Entwicklungen ein, die Deutschen ab 1915 das berühmte MG 08/15.
Das Prinzip der Volksbewaffnung gewann im Ersten Weltkrieg noch ganz andere Dimensionen als seinerzeit in den Befreiungskriegen. Es ging nicht mehr um einen wilden Volkskrieg, sondern um die Militarisierung der ganzen Nation. Der Krieg war ungleich totaler als die Kriege zuvor, auch die Heimat war Front, der Feind war überall, und erstmals kam er auch aus der Luft. Das äußerte sich nicht nur in der allgegenwärtigen Spionagehysterie, die zahlreiche Menschen das Leben kostete, sondern ebenso in der Ausgrenzung innerer Feinde und im generellen Verdacht der Illoyalität gegenüber ethnischen Minoritäten, wofür der unglaublich brutale Krieg, den die Russen gegen die eigene Bevölkerung führten, soweit sie nicht aus Russen bestand, ein extremes Beispiel ist.
Das Zeitalter der Weltkriege umfasst die Zeit von 1914 bis 1945. Manchmal, vor allem in England und Frankreich, ist dieser Zeitraum auch mit dem Dreißigjährigen Krieg verglichen worden. In Deutschland dagegen dominiert die Einteilung in einen Ersten und einen Zweiten Weltkrieg. Wer die Kriege nummeriert, betont die Unterschiede, wer von einem Dreißigjährigen Krieg spricht, hebt auf die Gemeinsamkeiten ab. Für beides kann man gute Argumente anführen.
Es gibt Parallelen zwischen beiden Kriegen, aber die Unterschiede sind beachtlich. Davon abgesehen, dass der erste der beiden Weltkriege ungleich europäischer war als der zweite, waren auch die Konstellationen recht unterschiedlich. Während das Deutsche Reich Russland am 1. August 1914 den Krieg erklärt hat, war es 1939 mit der Sowjetunion durch den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt verbunden. Erst durch den deutschen Überfall im Juni 1941 wurde die Sowjetunion zum Kriegsgegner. Japaner und Italiener waren im Ersten Weltkrieg Gegner der Deutschen, im Zweiten dagegen ihre Verbündeten. In der Achse Berlin – Rom – Tokio fanden sich drei autoritäre Regime mit einer expansionistischen Agenda zusammen, deren Interessensphären kompatibel waren. Auch im Ersten Weltkrieg hatten Deutschland, Italien und Japan expansionistische Kriegsziele gehabt, sie aber nicht oder jedenfalls nicht im gewünschten Umfang erreicht. Ihre Achse war ein Bündnis von Mächten, deren Großmachtträume bisher nicht in Erfüllung gegangen waren. Ihnen gegenüber standen einerseits die Kolonialmächte England und Frankreich, die den Höhepunkt ihrer Macht eher hinter als vor sich hatten, andererseits die aufstrebenden Weltmächte Vereinigte Staaten und Russland, die beide auf eine lange Expansionsgeschichte bei der Durchdringung ihrer Kontinente zurückblicken konnten. Und der Zweite Weltkrieg begann anders als der Erste im Grunde genommen in Asien, mit dem japanischen Angriff auf China am 7. Juli 1937, auch wenn wir in Europa vor allem auf das Jahr 1939 schauen. Der Zweite Weltkrieg endete auch in Asien, mit der japanischen Kapitulation am 15. August 1945.
Wichtiger als die Frage der Nomenklatur ist aber noch etwas anderes. Der Erste Weltkrieg ist gelegentlich als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Dieses Bild ist nicht wirklich hilfreich. Ein Krieg ist kein Naturereignis, das unvermittelt über uns hereinbricht wie zum Beispiel 1908 das Erdbeben von Messina, bei dem mehr als 80 000 Menschen ums Leben kamen. Er ereignet sich nicht voraussetzungslos. Das gilt gerade für den Ersten Weltkrieg, dessen Vorgeschichte inzwischen außerordentlich gut erforscht ist. Dem Kriegsausbruch war ein Jahrzehnt der diplomatischen Krisen, der kalten und heißen Kriege vorausgegangen. Russland verfolgte nach der Niederlage im Krieg gegen Japan und nach der bosnischen Annexionskrise vor allem das Ziel, seine Position in Südosteuropa zu verbessern. In Österreich-Ungarn gab es seit Langem Pläne zur Eingliederung Serbiens. Auch über einen Präventivkrieg gegen Italien wurde diskutiert. Umgekehrt gab es in Italien die Bewegung der Irredenta, die die von Österreich beherrschten sogenannten „unerlösten Gebiete“ befreien wollte. Und im Italienisch-Türkischen Krieg (1911/12) hatten die Italiener von der Schwäche des Osmanischen Reiches profitiert und vor allem in Nordafrika erhebliche territoriale Zugewinne erzielt. Eine unmittelbare Folge waren die beiden Balkankriege, durch die das Osmanische Reich seine europäischen Territorien nahezu vollständig verlor.
Die politischen Akteure der fünf europäischen Großmächte sahen im Sommer 1914 die gewachsene Gefahr eines militärischen Konflikts, aber sie sahen auch ihre jeweiligen Interessen. Sie verfolgten weiterhin die Strategie des kalkulierten Risikos, wobei man für das Deutsche Reich sagen muss, dass dieses Risiko seit dem sogenannten Blankoscheck vom 6. Juli 1914, einem Telegramm, in dem Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg der Regierung in Wien unbedingte Bündnistreue zusicherte, eigentlich nicht mehr kalkulierbar war.
Vor allem die zweite Marokkokrise von 1911 erwies sich im Nachhinein als Präludium des Ersten Weltkrieges. Sie fand ihren Abschluss in einem Abkommen, in dem Deutschland seine Ansprüche in Marokko zugunsten Frankreichs aufgab, was die Gemüter der Alldeutschen und anderer Nationalisten nachhaltig in Wallung versetzte, die ohnehin argwöhnten, Deutschland, der Parvenü unter den Großmächten, sei bei dem sogenannten Wettlauf um Afrika unzumutbar ins Hintertreffen geraten und lasse sich von den anderen Kolonialmächten immer wieder übervorteilen.
In der Reichstagssitzung vom 9. November 1911 überzogen die konservativen Parteien das von der Regierung Erreichte mit herber Kritik, während einzig die Sozialdemokraten die Reichsregierung unterstützten, die das Spiel mit dem Feuer gerade noch rechtzeitig beendet hatte. Der SPD-Vorsitzende August Bebel sah die Kriegsgefahr und warnte vor einer kommenden Katastrophe, vor dem „großen Generalmarsch“, wie er es nannte, bei dem „16 bis 18 Millionen Männer, die Männerblüte der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwerkzeugen, gegeneinander als Feinde ins Feld rücken“. Auf den großen Generalmarsch würden, so Bebel weiter, Massenelend, Arbeitslosigkeit, Hungersnot und der gesellschaftliche Umsturz folgen. Diese ziemlich zutreffende Prognose provozierte in den Reihen der Konservativen den bemerkenswerten Zwischenruf: „Nach jedem Kriege wird es besser!“ Hier artikulierte sich zum einen die Erinnerung an die Befreiungs- und die Reichseinigungskriege, zum anderen die Überzeugung, dass ein weiterer Krieg ohnehin nicht zu vermeiden sei. Die Deutschen, man darf es nicht vergessen, hatten in den 100 Jahren vor 1914 mit Kriegen gute Erfahrungen gemacht.
Die zweite Marokkokrise war der unmittelbare Anstoß für Friedrich von Bernhardis Buch Deutschland und der nächste Krieg. Bernhardi, ein pensionierter preußischer General, warb für die Militarisierung des öffentlichen Lebens, um das Deutsche Reich wehrhaft für einen kommenden, seiner Ansicht nach unvermeidlichen Krieg zu machen. Sein Buch war Wasser auf die Mühlen derjenigen, die das Ergebnis der Marokkokrise als Demütigung Deutschlands empfunden, Reichskanzler Bethmann Hollweg im Parlament entsprechend zugesetzt hatten und später dann erfolgreich seinen Sturz betrieben. Bernhardi war der Überzeugung, Deutschland müsse eine Rolle als Weltmacht anstreben, andernfalls werde es auch seine Position als europäische Großmacht auf lange Sicht verlieren. Damit befand er sich in Einklang mit der in jener Zeit populären Weltreichslehre, die davon ausging, dass die europäische Pentarchie nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in die Weltpolitik durch ein Weltstaatensystem abgelöst würde, in dem sich nur ein Teil der europäischen Großmächte würde behaupten können, weshalb Deutschland das Ziel haben müsse, zur Weltmacht aufzusteigen. Konkret forderte Bernhardi die Niederwerfung Frankreichs, einen mitteleuropäischen Staatenbund unter deutscher Führung und die Erweiterung des deutschen Kolonialbesitzes.
Was Bernhardi formulierte, war nicht die Politik der deutschen Regierung, insbesondere nicht bis zum Sturz Bethmann Hollwegs am 13. Juli 1917. Aber seine Positionen waren in alldeutschen Kreisen, einer einflussreichen Minderheit, populär. Es gab einen lautstarken Chor von Nationalisten, die nicht müde wurden zu betonen, Deutschland brauche eine seiner Bedeutung gemäße Machtposition und einen der Größe des Volkes entsprechenden Lebensraum. Ziel müsse wirtschaftliche Dominanz in Europa, eine der britischen Flotte ebenbürtige Seemacht, die dauerhafte Ausschaltung der potenziellen Kriegsgegner Frankreich und Russland und ein ausreichend großes Kolonialreich in Afrika sein. Dies alles wurde im Ausland aufmerksam rezipiert. Bernhardis Buch verkaufte in englischer und französischer Übersetzung mehr Exemplare als das deutsche Original.
1912 erschien in Deutschland auch ein Buch gänzlich anderer Art, der Jugendroman Das Menschenschlachthaus des sozialdemokratischen Volksschullehrers Wilhelm Lamszus. Der Krieg von 1870/71 erschien ihm wie ein „Vorpostengefecht“. Deshalb trägt sein Roman den Untertitel Bilder vom kommenden Krieg. Der Pazifist Lamszus versuchte, die Realität des eigentlichen Krieges zu schildern, vom Leben in der Kaserne über die Mobilisierung gegen Frankreich bis zum Einsatz an der Front. Das letzte Kapitel „Wir armen Toten“ ist den Gefallenen gewidmet. Es nimmt in aller Drastik die Schrecken des Stellungskrieges vorweg und beschreibt, wie die Gefallenen einträchtig nebeneinander in der Erde liegen, ein Arbeiter neben dem abgerissenen Bein eines Briefträgers, daneben der Rumpf eines Mannes, der seinen Kopf verloren hat, sodass die Luftröhre hervorschaut. Der Tod an der Front hatte sie zu einer Gemeinschaft werden lassen, die später von den Nationalsozialisten zum Frontsozialismus umgedeutet wurde.
Bernhardi und Lamszus zeigen, von völlig unterschiedlichen Positionen ausgehend, die Vorkriegsstimmung, in der die Menschen sich in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges befanden. Der Krieg wütete in den Menschen, lange bevor er im August 1914 erklärt wurde. Er bemächtigte sich der Kombattanten, ehe diese ihrer Rolle gewahr wurden. Und die Kombattanten konnten nicht wissen, wie furchtbar der Krieg sein würde. 1939 wusste man es, da war dann von Euphorie keine Rede mehr. Nie war Adolf Hitler seinem Sturz durch einen Staatsstreich so nahe wie während der Sudetenkrise 1938, als es so aussah, dass ein neuer Krieg, ausgehend von Deutschland, in Europa beginnen könnte, weil Hitler seine Politik der kalkulierten Provokationen überreizt zu haben schien. Einflussreiche Kreise des deutschen Militärs wollten einen Krieg verhindern. Das Münchner Abkommen, das Ende September 1938 in letzter Minute zustande kam, hat dann den Ausbruch eines europäischen Krieges noch einmal verhindert und den Staatsstreichplänen die Grundlage entzogen.
Ein Krieg setzt nicht nur Armeen in Bewegung, er verändert auch die Menschen. Der Philosoph Theodor Lessing hat angesichts des Ersten Weltkrieges ein prägnantes Bild dafür gefunden: „Im August 1789 beschlossen die Menschen, Weltbürger zu werden. Im August 1914 beschlossen sie das Gegenteil.“ Niemals waren sich die kulturellen und wissenschaftlichen Eliten in Europa näher gewesen und hatten einander besser gekannt als in der Zeit vor dem Kriegsausbruch. Und doch setzten sich nationale Egoismen radikal über diese gewachsenen Verbindungen hinweg. Die über viele Jahre aufgebauten Netzwerke hielten dem nationalistischen Furor nicht stand. Es war frappierend, mit welcher Vehemenz viele deutsche Kunstfreunde, Publizisten und Künstler, die in den Jahren zuvor begeistert nach Frankreich und Italien gereist waren, um sich an den Schönheiten dieser Länder zu berauschen und um neue künstlerische Entwicklungen zu studieren, die gegen die Enge und den Starrsinn des kaiserlichen Kunstverstandes und für die Moderne gekämpft hatten, die Sezessionen und Salons gegründet und aufsehenerregende Ausstellungen organisiert hatten, nunmehr die nationale Sache zu der ihren machten. Sie wandten ihren Furor nicht mehr gegen Tradition und Konvention, sondern gegen den Landesfeind. Die Begeisterung für den Krieg verbreitete sich im August 1914 geradezu explosionsartig. Die erbitterten Auseinandersetzungen zwischen der traditionellen akademischen Schule, die die Sympathie des Kaisers genoss, und den verschiedenen Richtungen der Moderne spielten plötzlich keine Rolle mehr.
Das galt natürlich nicht nur für Deutschland. So wie die Deutschen die Kultur gegen die französische Zivilisation verteidigen wollten, rief der französische Philosoph und Akademiepräsident Henri Bergson seine Landsleute dazu auf, die Zivilisation gegen die deutsche Barbarei zu verteidigen, und der englische Schriftsteller Rudyard Kipling sprach in einem populären Gedicht davon, dass die Hunnen vor den Toren stünden. In allen Krieg führenden Staaten gab es Strategien der geistigen Mobilmachung, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Kriegsgesellschaften gab.
Die anfängliche Begeisterung verflog rasch, dennoch endete der Erste Weltkrieg erst nach mehr als vier Jahren im November 1918. Er entließ die Menschen in eine friedlose Welt. Zurück blieben nicht nur neun Millionen militärische und sechs Millionen zivile Todesfälle, sondern auch acht Millionen Kriegsinvaliden. Diese lebenden Kriegsdenkmäler, wie Joseph Roth sie nannte, verwiesen auf die Schutzlosigkeit der Soldaten, ihre zerstörten Leiber spiegelten die Verletzungen der nationalen Gemeinschaft. Die politische Landkarte war vollkommen umgestaltet worden. Zwischen 1917 und 1923 entstanden mit der Ukraine, Finnland, Litauen, Estland, Polen, der Tschechoslowakei, dem Staat der Slowenen, Kroaten und Serben (dem späteren Jugoslawien), Ungarn, Österreich, Lettland, Irland und der Türkei ein Dutzend Nationalstaaten – manche wie die Ukraine zum ersten Mal, andere wie Polen erneut. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es 38 souveräne politische Einheiten in Europa und doppelt so viele nationale Währungen wie zuvor.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Europa noch von multiethnischen Imperien dominiert gewesen, von denen drei – Großbritannien, Dänemark und Preußen – eine hoch entwickelte Nationalkultur hervorgebracht hatten, während die anderen drei – das Habsburgerreich, das Osmanische Reich und das Zarenreich – einen ausgesprochen multikulturellen Charakter aufwiesen und den Ersten Weltkrieg nicht überlebten. Der Zerfall dieser Vielvölkerreiche führte dazu, dass ein enger Zusammenhang zwischen Nationalität und Ethnizität entstand, dessen unvermeidliches konzeptionelles Nebenprodukt die ethnische Minderheit war. In Südosteuropa lebten jetzt 60 Millionen Menschen, bei denen Territorium und Ethnizität zusammenfielen, während 25 Millionen ethnischen Minderheiten angehörten. Die Folge war ein nicht abreißender Strom von Flüchtlingen. Etwa eine Million Deutsche wurde aus den Polen zugesprochenen östlichen Provinzen Oberschlesien, Pommern und Posen vertrieben oder floh aus den vom Bürgerkrieg heimgesuchten baltischen Staaten. Umgekehrt strebten zwei Millionen Polen in den wieder errichteten polnischen Nationalstaat. Auch Ungarn nahm Hunderttausende von Zuwanderern aus den angrenzenden Ländern auf. Die Bevölkerung Griechenlands vergrößerte sich um nicht weniger als ein Viertel, vor allem durch Zuwanderer aus der Türkei, aber auch aus Bulgarien, und es gab ähnlich große Wanderbewegungen in die jeweils entgegengesetzte Richtung. 300 000 Armenier, die den Genozid überlebt hatten, verließen die Türkei, und der Zusammenbruch des Zarenreichs und die Russische Revolution führten zur Flucht von zwei Millionen Russen und Angehörigen anderer Ethnien.
Viele der Flüchtlinge, vor allem Russen und Armenier, verloren mit ihrer Flucht die Staatsbürgerschaft ihrer Herkunftsländer. Das Massenphänomen der Staatenlosen war ein Resultat des Ersten Weltkrieges. Um diesem Problem zu begegnen, schuf Fridtjof Nansen, der Hochkommissar für Flüchtlingswesen des Völkerbundes, 1922 den nach ihm benannten Nansen-Pass, wofür er den Friedensnobelpreis erhielt. Der Nansen-Pass wurde von der Behörde des Staates ausgestellt, in dem sich der Flüchtling aufhielt. Er war ein Jahr gültig und musste dann verlängert werden. Der Pass gestattete seinem Inhaber die Rückkehr in das den Pass ausstellende Land und gewährte ihm so einen gewissen Schutz vor Verfolgung.
Die vielen nationalen Minderheiten, die durch die radikal veränderte politische Landkarte entstanden, waren ein drängendes Problem. Um sie zu schützen, wurde im Kontext der Pariser Vorortverträge ein Regelwerk geschaffen, das die Errichtung moderner Nationalstaaten mit der völkerrechtlichen Sicherung der Minderheitenrechte verbinden wollte. Dabei ging es ausdrücklich nicht nur um individuelle, sondern auch um kollektive Rechte, also das Recht auf die eigene kulturelle Tradition, Sprache und Religion. Durchgesetzt hat sich aber nicht das Konzept von Versailles, sondern der Geist des Vertrages von Lausanne, der nach dem Griechisch-Türkischen Krieg von 1922 zu einem weitreichenden Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei führte und zur Blaupause für unzählige weitere Versuche der ethnischen Entmischung avancierte. Insgesamt zehn Millionen Zwangsmigranten mussten in der Zwischenkriegszeit ihre Heimat verlassen, was für viele von ihnen entsetzliches Leid mit sich brachte.
In den ersten Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gab es in Europa eine Fülle von Kriegen und Bürgerkriegen. Der Zerfall der Vielvölkerreiche war ebenso Anlass zu Kriegen wie die Konstitution alter und neuer nationaler Staaten. Neben dem Griechisch-Türkischen Krieg ist zum Beispiel der irische Unabhängigkeitskrieg zu nennen, außerdem die verschiedenen Grenzkriege zwischen Russland, Lettland, Litauen, Polen, der Ukraine und der Tschechoslowakei. Deutschland war Schauplatz eines jahrelangen Bürgerkrieges, der erst 1923 mit der Niederschlagung des Hitler-Ludendorff-Putsches sein vorläufiges Ende fand. Obwohl der Erste Weltkrieg Opfer in einer Dimension gefordert hatte, die bis dahin unvorstellbar gewesen war, war Gewalt auch weiterhin das Mittel der Wahl zur Durchsetzung politischer Ziele.
Die Entgrenzung der Gewalt war ein zentrales Charakteristikum des Ersten Weltkrieges gewesen. In der Folge gab es Versuche einer erneuten Einhegung der Gewalt, etwa durch den Völkerbund, der Anfang 1920 seine Arbeit aufnahm, oder das Genfer Protokoll von 1925 über das Verbot des Einsatzes von Giftgas und bakteriologischen Waffen im Krieg. Aber was sich durchsetzte, war eine gesamteuropäische Kultivierung und Praktizierung kriegerischer Gewalt. Die Ablehnung der Ideen von 1789, von Freiheit, Gleichheit und Aufklärung, denen das vom preußischen Militarismus geprägte wilhelminische Kaiserreich die antiliberalen, antidemokratischen und nationalistischen „Ideen von 1914“ entgegensetzt hatte, war ein weitverbreitetes Phänomen. Sie war nicht nur das Charakteristikum eines wie immer zu charakterisierenden „deutschen Sonderweges“, sie hat vielmehr einen großen Teil der europäischen Kulturlandschaft der Zwischenkriegszeit geprägt. Nationalismus, Antisemitismus, antidemokratischer Elitismus und Faschismus faszinierten Intellektuelle nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Italien, Spanien und vielen anderen Ländern, selbst in Großbritannien.