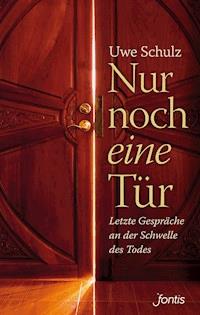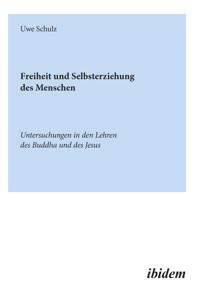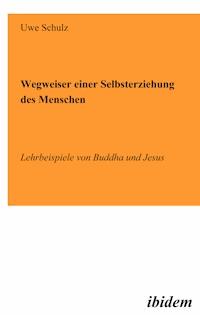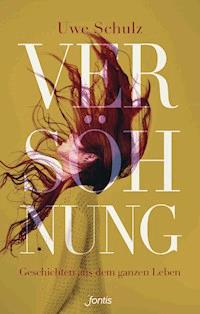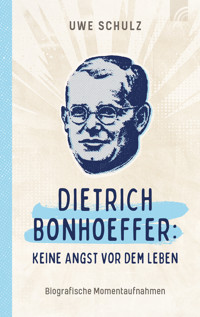
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dietrich Bonhoeffer ist heute noch einer der bekanntesten und prägendsten Theologen Deutschlands. Ein Kirchenvater des 20. Jahrhunderts: Theologe. Pazifist. Widerstandskämpfer. Märtyrer. Christ. Er leitete das Predigerseminar der Bekennenden Kirche, auch noch als es von den Nationalsozialisten als illegal erklärt wurde und gehörte zu den Verschwörern um Graf von Stauffenberg, die das Attentat auf Hitler vorbereiteten. Fast 200 Straßen sind nach ihm benannt, Lieder, Zitate und Gebete finden sich in Büchern, auf Postkarten und online im Netz. Bekannt ist vor allem sein Gedicht "Von guten Mächten wunderbar geborgen…", das er kurz vor seinem Tod im Gefängnis formuliert hat. Vor 80 Jahren wurde Dietrich ermordet – in einer dunklen Zeit, in der nationalsozialistischer Terror halb Europa im Würgegriff hatte. Trotzdem – oder gerade deshalb – sind seine Gedanken heute wieder (oder immer noch) aktuell. Diese neue Biografie schlägt eine Brücke über 80 Jahre hinweg und zeigt, wie brandaktuell Bonhoeffers Gedanken noch heute sind. Wahrheit, Verantwortung, Liebe, Schuld, Leiden, Nachfolge und Tod – das alles waren Themen, mit denen sich Bonhoeffer nicht nur als Theologe auseinandersetzen musste. Es waren für ihn Lebens- und Überlebensfragen in einer Welt, die aus den Fugen geraten war. Mit diesem Buch begibt sich Uwe Schulz auf eine Spurensuche nach Worten und Gedanken, die Mut geben, Hoffnung machen und neue Perspektiven öffnen. Ein Buch, das helfen kann, den eigenen Weg durchs Leben zu finden – geborgen und getröstet trotz aller Widerstände und Herausforderungen. QR-Codes machen das Buch interaktiv und verweisen auf wichtige Dokumente und Erinnerungsorte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zitat Hanns Dieter Hüsch: Hanns Dieter Hüsch/Michael Blum:
Das kleine Buch zum Segen, Düsseldorf: tvd, 1998, S. 18 f.
© der deutschen Ausgabe:
2025 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Brunnen Verlag GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen
www.brunnen-verlag.de
Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Training
und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.
Umschlagfoto: Adobe Stock
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul/Brunnen Verlag GmbH
Satz: Brunnen Verlag GmbH
ISBN Buch: 978-3-7655-0889-9
ISBN E-Book: 978-3-7655-7743-7
www.brunnen-verlag.de
Der Herr nehme von uns die dunklen Gedankendes Herrschens und des Kriechensund das Rechthaben und alle Besserwisserei.Es ist nicht des Menschen Glück auf Dauer.Es ist sein Krieg und sein Verderben.
(Hanns Dieter Hüsch)
Ja, wir lieben dieses Land.Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen –wir fühlen international.In der Heimatliebe von niemand – nicht einmal von jenen, auf deren Namen das Land grundbuchlich eingetragen ist.Unser ist es.
(Kurt Tucholsky, 1929)
Für alle, die sich nach dem Frieden Gottes sehnen, der höher ist als alle Vernunft.Der kommenden Generation – mit Daniel, Vera, Johanna, Mathilde (und ein bisschen auch Oscar).
Uwe Schulz, im Frühjahr 2025
Inhalt
Einleitung EIN HALLO!
Kapitel 1 DAZUGEHÖREN Gemeinschaft, die den Tod überdauert
Kapitel 2 SINN Selfie mit einem guten Unbekannten oder warum es keine Dietrich-Formel gibt
Kapitel 3 WAHRHEIT Dietrichs Hitlergruß und eine Frage von Leben und Tod
Kapitel 4 LIEBE „Ich sehe Deine Augen, ich spüre Deine Hand“
Kapitel 5 SCHULD „Schießen ist ja gar nicht das Problem.“
Kapitel 6 LEIDEN Were you there when they crucified my Lord?
Kapitel 7 TOD Die Maschinerie des Mordens
SCHLÜSSE Vorletzte Worte und sieben Anregungen
DER GANG DER DINGE Wichtige Daten zu Dietrichs Leben
Anmerkungen
Einleitung EIN HALLO!
Es ist ein kleines Wunder, dass dieses Buch hierher gefunden hat. Obwohl es von einem Mann handelt, der eine halbe Ewigkeit weit weg zu sein scheint, Lichtjahre. Schon der Name: Dietrich – wer heißt denn heute noch so?
Schätzungsweise 190 Straßen und zwei Dutzend Schulen allein in Deutschland sind nach ihm benannt. An vielen Orten überall auf der Welt stehen Denkmäler, die an ihn erinnern. In London haben sie ihm zu Ehren sogar eine Statue an der Fassade der großen Kathedrale Westminster Abbey befestigt. Ein Meter achtzig aus hellem Kalkstein herausgemeißelt, fast so groß, wie er wirklich war. Mit Brille auf der Nase und Buch in der Hand steht er da in einer Reihe mit neun anderen Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Martin Luther King Jr. zum Beispiel zwei Plätze weiter links. Als wären sie Heilige oder Superhelden, meilenweit entfernt von uns und ohne jede Ahnung davon, wie es ist, hier und jetzt zu leben. Dietrich hatte nicht mal Internet.
Dieses Buch hier und auch die QR-Codes, die mit dem Phone abzuscannen sind, um selbst auf Spurensuche zu gehen: Sie sind hier, weil Dietrich wesentliche Dinge zu sagen hat. Dinge, die guttun, die Klarheit schaffen. Dinge, die Hoffnung stärken, die Lust zu leben machen und Mut geben, mit Widerständen zurechtzukommen. Selbst mit dem Schrecklichen, das leider auch in der Welt ist: Hass, Krankheit, Katastrophen, Krieg, Tod und all dem anderen, das uns Angst machen kann. Wenn dieses Buch hier so wirkt wie erhofft, kann es helfen, einen eigenen Weg durchs Leben zu finden. Dietrich ist dabei wie ein Chat-Partner, der gute Ideen hat – immer dann, wenn jemand danach fragt. Interessanterweise liebt er es zeitlebens, erst einmal mit Gegenfragen zu antworten. Das könnte auf den folgenden Seiten auch gelegentlich vorkommen.
Hier wartet keine neue Sammlung von Zitaten. Bonhoeffer heute auf ein Dutzend Sinnsprüche zu reduzieren, ist ungefähr so schlau, wie von Taylor Swift immer dieselben drei Hits zu spielen. Es ist auch keine klassische Biografie, die mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Der chronologische Lebenslauf ist in Zeiten von Wikipedia anderswo leichter zu haben. Es geht hier um Fragen, die uns alle plagen, und um die Art, wie Dietrich mit ihnen umgegangen ist. Sie stehen als Stichwörter über jedem Kapitel.
Frei nach Rainer Maria Rilke – dessen Lyrik Dietrich übrigens nicht besonders mochte, was wiederum seine Verlobte gar nicht verstehen konnte –, also frei nach diesem Dichter geht es darum, die Fragen zu leben und damit vielleicht allmählich in die Antworten hineinzuleben.
Natürlich werden auch einige kurze Bonhoeffer-Texte erscheinen, die man zweimal lesen muss, bevor sie sich erschließen. Gut, dass sie gedruckt vor Augen stehen.
Hier ist eine neue Begegnung mit einem modernen Mann, der an Gott glaubt. Mehr noch: Dietrich ist nicht denkbar ohne Gott und ohne Bibel. Wahrscheinlich ist sie das Buch in der Hand der Kalkstein-Skulptur in London. Dietrich kann mit seinem klaren Verstand sagen, warum er sich selbst nicht denken will ohne den Gott, der als Mensch auf der Erde gelebt hat.
Dieses Buch kann Gespräche in Gang bringen, vielleicht Streitgespräche. Weil er sich über Dinge Gedanken gemacht hat, die alle Menschen beschäftigen: Wozu sind Kriege da? zum Beispiel. Können wir die Welt retten? Und die große Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mensch irgendwann im Leben stellt: Wozu lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn?
Irgendwann begegnen fast alle im deutschsprachigen Raum Dietrich Bonhoeffers größtem Hit „Von guten Mächten“. Einem Lied, das zunächst nur ein Gedicht war, mit der Hand auf ein DIN-A4-Blatt geschrieben.
Der ganze Text ist hier nachzulesen: https://www.ekd.de/eg-65-von-guten-machten-wunderbar-geborgen-11493.htm.
Den wichtigsten Vers daraus kennen viele auswendig:
„Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Diese Worte, die er aufgeschrieben hat in einem Brief an seine Familie, wirken wahrscheinlich sehr heilig, religiös, fromm. Worte, die fast so in Stein gemeißelt wirken wie der 1,80-Dietrich an der Fassade der Abtei Westminster. Im selben Brief schreibt er nur ein paar Zeilen weiter vorne: „Könnt Ihr meine Unterhosen so konstruieren, dass sie nicht rutschen? Man hat hier keine Hosenträger.“
Denn er sitzt im Gefängnis, als er das schreibt, und er hat in diesem Moment große Sehnsucht. Vor allem danach, endlich wieder seine Freundin in den Arm nehmen zu können, Maria, die er bald heiraten will. Dinge, die ganz anders wirken als die Heiligenstatue. Dietrich ist ein Mensch mit Unterhosen und Zärtlichkeit und Zweifeln. Wahrscheinlich ahnt er, als er das alles schreibt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Sechzehn Wochen sind es noch, dann lässt Adolf Hitler ihn töten, am 9. April 1945, als der Krieg in Europa schon fast zu Ende ist. Aus Rache, denn Dietrich war am Bombenanschlag beteiligt, der Hitler töten sollte.
Im Netz finden sich viele Fotos von Dietrich. Die beste digitale Sammlung wahrscheinlich hier: https://www.dietrich-bonhoeffer.net/bilder/.
Zwei Fotos stechen heraus, weil sie völlig verschiedene Phasen dokumentieren.
Die eine Phase – seine ersten Schritte auf dem Weg in den Widerstand.
Die andere Phase – die letzten Stufen zur Ergebung in sein Schicksal.
Das eine Foto ist im Sommer 1934 entstanden (S. 16). Es zeigt Dietrich an einem Strand in Dänemark. Im Kapitel „Dazugehören“ (S. 12) steht mehr dazu. Es zeigt ihn als Hochschullehrer, umgeben von Studentinnen und Studenten. Er gehört zu ihnen.
Auf dem anderen Foto ist er zehn Jahre älter (S. 25). Im Sommer 1944 verrät sein Gesicht nicht viel über Dietrichs Innenleben nach mehr als fünfzehn Monaten Einzelhaft. Oder doch: Er sieht so aus, wie Gefangene ihn später beschreiben, die überleben: gelassen. Er gehört zu ihnen. Die Kapitel „Tod“ (S. 161) und „Dazugehören“ befassen sich auch mit dieser Zeit.
Wenn die Sprache auf Dietrich Bonhoeffer kommt, scheint sich oft eine gewisse Schwere auszubreiten. Keine Spur mehr von der heiteren Gelassenheit, die beide Fotos erahnen lassen. Zum Glück finden sich ein paar Belege für die Leichtigkeit, die sein Leben auch durchzogen hat. Etwa die Notiz eines Studenten, der 1934 am Strand in Dänemark dabei war. Am Rand einer internationalen Kirchenkonferenz:
Wie sehr Dietrich dort bei aller Beanspruchung seinen Schülern und Freunden zur Verfügung stand, die ihn nach längerer Zeit wieder sahen. Wie er mit ihnen diskutierte, spielte, in der stürmischen Nordsee badete und immer aufgelegt war zu Scherzen. – Während der behäbigen Ansprache eines sehr umfangreichen Kirchenfürsten schob er uns einen Zettel zu mit dem Vers von Christian Morgenstern: „Ein dickes Kreuz auf dickem Bauch. Wer spürte nicht der Gottheit Hauch?“1
Kein humoristischer Kracher, aber vielleicht eine Ahnung davon, dass es auch Freude machen kann, sich mit Dietrich gemeinsam den großen Fragen zu stellen.
39 Jahre hat er gelebt, durchlebt, erlebt. Dieses Buch zeigt, was für ein großes Geschenk das heute noch für uns alle ist.
Uwe Schulz
Kapitel 1 DAZUGEHÖRENGemeinschaft, die den Tod überdauert
Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass manfür andere Menschen etwas sein kann.2
Dietrich Bonhoeffer
Er kann den anderen kaum erkennen neben sich in der Finsternis. Schwarzer Schatten vor grauer Wand. Nur wenn ein Lichtstrahl die Pappe vor dem Fenster durchsticht, blitzt das Gesicht des anderen kurz auf. Er weiß: Gleich folgt von allen Seiten ein Grollen, als würden sämtliche U-Bahnen der Stadt auf einmal durch den Bau rasen. Er hört, wie schwer der andere die Luft einzieht durch eine Kehle, in der die Angst krampft und würgt. Spürt das eigene Herz hämmern.
Hier haben sie etwas Schutz, sollte wieder eine Druckwelle einschlagen oder sich ein faustgroßer Steinbrocken hierher verirren. Beim Einschlag in die Wände klingen die feinsten Bombensplitter wie der Hagelsturm, der einmal aufs Verdeck seines Audi geprasselt ist, irgendwo auf dem Weg nach – war es Pölitz oder Gullnow? Wo immer das war. Es war in einem anderen Leben. Lange vor dem Krieg, der jetzt zurückgekommen ist in die Stadt, in der er geplant wurde.
Wieder haben die Schließer einen Gefangenen runtergebracht aus einer Zelle im dritten Stock, gleich als der Vollalarm in der Stadt losging, und ihn hier eingeschlossen.3 Die Gefangenen im zweiten müssen in ihren Zellen bleiben, dem Inferno ausgeliefert, das die Royal Air Force über die Hauptstadt bringt. Es regnet Feuer auf ein ganzes Land; sein Land, in das er freiwillig zurückgekehrt ist. Die nächste Welle von viermotorigen Bombern. Er hört das Schreien und Toben aus der Etage über sich, bis es ganz in der Nähe einschlägt. Ehe er nachgedacht hat, liegt er auf dem Bauch, den Kopf auf den Boden gepresst. Hört den anderen rufen: „Ach Gott, ach Gott!“, erinnert sich stumm an die ersten Verse aus dem Psalm, den er gestern noch gelesen hat: „HERR, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Mein Leben ist nahe dem Totenreich.“ Dietrich fühlt diesen Psalm in der Finsternis. Zu dem anderen, der irgendwo neben ihm liegt, sagt er nur: „Es dauert höchstens noch 10 Minuten.“4
Er will den anderen nicht alleinlassen in der Not. Er will ihm auch nicht irgendeinen frommen Satz sagen. Nicht angesichts der Todesangst des anderen, der sein „Gott, ach Gott!“ vergisst, sobald die Sirenen draußen Entwarnung heulen. So hat er es seine Studenten gelehrt, die jungen Pfarrer. So wird er es gleich am Morgen danach im nächsten geschmuggelten Brief seinem besten Freund Eberhard Bethge schreiben. (Eberhard wird in diesem Buch immer wieder zu Wort kommen. Weil wir ihm so viel Wissen verdanken über Dietrichs Leben.) In seinem Buch „Nachfolge“ hatte Dietrich 1937 noch geschrieben: „Jeder Versuch, mit eigener Macht etwas am anderen auszurichten, ist vergeblich und gefährlich. […] Die Verschleuderung der billigen Gnade wird der Welt zum Überdruß.“5 Dietrich weiß in dieser Bombennacht im Januar 1944, so hart wie damals würde er jetzt nicht mehr texten, auch wenn es heute so wahr ist wie vor sieben Jahren.
Ein O-Ton von Eberhard über Dietrich findet sich hier: https://www.zeitzeugen-portal.de/personen/zeitzeuge/eberhard_bethge.
Die Zeit vor der Angst
Damals, Mitte der 1930er – das ist wie ein anderes Leben. Das Leben vor dem Eingesperrtsein. Die Zeit vor dem Krieg, vor der Angst, die heute überall in diesem Gefängnis lauert, immer wieder auch in ihm selbst. Jetzt, 1944, das ist wie der praktische Teil der „Nachfolge“: Christlicher Glaube ist kein spirituelles Wellness-Programm. Christliches Leben bedeutet, die Welt so zu sehen, wie Jesus von Nazareth sie sieht: von unten. Das weiß Dietrich theoretisch, als er es 1937 im Buch „Nachfolge“ schreibt. Jetzt, 1944, mitten im Chaos, erlebt er es. Als er am Boden einer schmuddeligen Einzelzelle auf dem Bauch liegt.
Deshalb vielleicht zitiert Dietrich in dieser Nacht nicht den Bibelspruch, der ihm in den Sinn kommt. Er gibt dem anderen in der Zelle das, was ein Mensch in Panik braucht, der sonst nicht nach „Gott, ach Gott“ fragt: etwas, das ihn herausholt aus der Angst. Fakten. Dietrich sagt dem anderen die Tatsache, die auch ohne einen biblischen Wellness-Spruch gilt: Auch der längste Bombenangriff ist einmal zu Ende. Noch zehn Minuten, dann müssen wir uns nicht mehr fürchten.
Dietrich hat ein Gespür dafür entwickelt, wann ein frommes Wort angebracht ist. Er verteilt es nicht ungefragt. Er weiß, wer im Bau Sehnsucht danach hat. Die Seelsorger, die regelmäßig zu den Gefangenen dürfen, haben es ihm erzählt. In ihren Gebetsbüchern haben sie merkwürdigerweise keine Verse ausdrücklich für Menschen, die eingesperrt sind. Bonhoeffer gehört zu ihnen, er steckt mittendrin in einer Mischung aus Unruhe, Langeweile, Verwirrung, Grübelei – und findet immer wieder heraus. Aus der Ruhe seiner eigenen Meditation entstehen eine Handvoll Gebete, die er aufschreibt. Sie werden im Dezember 1943 in den anderen Zellen verteilt. Ein Weihnachtgeschenk.
„Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht
ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen
laß mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.
Du läßt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.“6
Dietrich verschenkt Gebete. Und er empfängt selbst dankbar Gebete. Es tut ihm gut, wenn der Gefängnispfarrer ihn am Ende des Besuchs segnet. Um 4:20 Uhr endlich die Entwarnung.
Vielleicht gehen in diesem Augenblick Dietrichs Gedanken zurück in das andere Leben. Zum Anfang des Weges, der hierhergeführt hat …
Sonne und Strand
Sommer 1934. Wie er dasitzt, die Arme vor den angewinkelten Knien verschränkt, der Blick durch die randlose Brille Richtung Sonne. Die Schuhabsätze in den Sand gestemmt, um Halt zu finden auf dem kleinen Hügel, der mal eine Düne werden will. Ja, Schuhe. Am Strand. Und Anzug mit Bügelfalte. Krawatte. Dietrich sitzt und guckt leger, und er ist dabei gut angezogen. Wie immer. Und wie an diesem Tag auch die anderen vier um ihn herum auf diesem Foto. Schließlich vertreten sie hier ihr Land. Ganz links zum Beispiel Inge, die es Jahrzehnte später schaffen wird, dass endlich auch Frauen Pfarrerinnen werden dürfen in der evangelischen Kirche, ohne Wenn und Aber.
Dietrich liebt den Strand. Die Wärme, wie er sie in Spanien genossen hat, 1929 auf Mallorca. Bei seinem Trip kurz rüber aus Barcelona, wo er in der deutschen Gemeinde als Vikar arbeitet. Nebenbei will er an seiner nächsten großen wissenschaftlichen Arbeit schreiben, um eines Tages Professor zu werden. Eigentlich sollte er daran schreiben. Er kommt nur kaum dazu: Er hat gut zu tun als Aushilfspastor, ständig bekommt er Einladungen zum Skat, zum Schach, zum Tennis, zu Essen … und dann ist ihm noch die Reise mit Klaus dazwischengekommen: erst mit der Bahn nach Madrid, Sevilla, Ronda. Dann mit dem Auto die Südküste entlang. Picknicken, wo du willst, schwimmen, wann du willst. Mit dem großen Bruder. Klaus hat gerade wieder Zeit. Den fertigen Abschluss in Jura in der Tasche und noch keinen Plan, wie es weitergehen soll. Schon ihre erste Reise war großartig, die Wochen in Italien. Bis nach Libyen haben sie sich rausgewagt, immer Richtung Hitze …
Dietrich liebt auch die Strände der Ostsee gleich hinter den Dünen des Seminar-Hauses, in dem er später selbst Vikare ausbildet. Die Erinnerungen seiner Studenten sind voller Strandbilder. Wie Dietrich sich reinhaut beim Steinstoßen und oft gewinnt; wie er sie immer wieder überrascht mit Kraft und Ausdauer beim Handball, mit der Power seiner knapp ein Meter neunzig, die er beim Schwimmen aufgebaut hat.
Pastor Bonhoeffer in Badehose, anders als jetzt im August 1934 auf dem Sandhügel …
Gospel am Prenzlauer Berg
An der theologischen Fakultät in Berlin erzählt man sich in diesem Sommer 1934 vielleicht eine Geschichte, die sich drei Jahre vorher ereignet haben muss, als Privatdozent Bonhoeffer Vorlesungen zur Systematischen Theologie gehalten hat. 1931 also sitzen seine Studenten im Seminarraum und warten. Dietrich kommt nicht. Das haben sie noch nie erlebt, nicht eine Minute Verspätung. Und jetzt ist er schon 20 Minuten überfällig … 25 Minuten, warum auch immer. Das Mobiltelefon ist noch nicht erfunden. Eine halbe Stunde. Sie überlegen schon, wieder zu gehen. Da öffnet er plötzlich die Tür, ohne Hektik, die Tasche mit dem Skript in der Hand, grüßt, geht an seinen Platz. Und als ihn alle fragend anschauen, sagt er mit seiner etwas kehligen Stimme: „Ich war bei einem meiner Jungs.“
Seine Studenten hören an diesem Tag zum ersten Mal davon: „Meine Jungs“, das ist eine Horde von 14- oder 15-Jährigen im vielleicht verkommensten Viertel der Stadt. Im Norden, wo die Eltern die Kommunisten wählen, weil die sich wenigstens um die Arbeiter kümmern. Die Väter schuften bei der AEG oft 50 Stunden und mehr in der Woche, trinken nach der Schicht ein Bier, wenn das Geld reicht. Und hoffen, dass die Gewerkschaft mehr Lohn erstreitet oder das Parlament die Arbeitszeit auf 40 Stunden drückt. So ist das Leben in den frühen 1930ern im Wedding und am Prenzlauer Berg.
Zu Hause – das sind für Dietrichs „Jungs“ fünf, sechs Leute auf 30 Quadratmetern und immer zu wenig Essen auf dem Tisch. Kein Bad, nicht mehr als ein Schimmer Tageslicht vom Hinterhof. Wenn die Väter nach Hause kommen in die viel zu enge Wohnung, dann sind sie oft zu kaputt, um mehr anzufangen als Streit mit der Frau. Sie bringen den Streit oft schon von der Straße mit: Draußen werden die „Braunen“ anscheinend immer mehr, Leute, die NSDAP wählen, weil die ja schließlich auch „Arbeiterpartei“ heißt. Das Leben als „Roter“ wird riskant.
Hier werden „seine Jungs“ groß. Die meiste Zeit auf der Straße, bloß raus aus der Enge. Hier im Wedding werden sie bald tun, was sich gehört, damit sie endlich keine „Pimpfe“ mehr sind: Sie werden zur Konfirmation in der Zionskirche gehen. Und der Neue soll sie darauf vorbereiten, Herr Bonhoeffer.
Der Pastor, der es vor ihm versucht hat, ist daran kaputtgegangen. An den Grobheiten der Jungs, ihrem Lärm, der Aggression. Dietrich haben sie genauso empfangen: Als er das erste Mal zu ihnen ins Klassenzimmer will, hagelt es auf seinem Weg durchs Treppenhaus Müll. Er weicht dem Dreck aus, als ob nichts wäre, lässt sie sich austoben, steht im Klassenraum ruhig da, bis sie müde werden von ihrer „Bon! Bon! Bon!“-Schreierei. Staunt, wie lustig sie es finden, seinen Nachnamen zu verhunzen. Und als der Spaß sie zu langweilen beginnt, sagt er ganz leise, dass sie ihn beeindruckt haben. Und dann erzählt Dietrich eine Geschichte. Von da an hat er einen Draht zu ihnen.
Denn das ist neu für die Jungs in kurzen Hosen: dass da einer erst einmal zuhört, auch wenn sie herumbrüllen. Einige Zeit später wird er sie noch mehr überraschen. Er lädt sie ein in seine kleine Bude in der Oderbergerstraße. Sie dürfen herumkramen und Schallplatten hören aus dem Land, von dem schon seine erste Geschichte gehandelt hat. Dem Land, in dem er selbst wenige Monate vorher noch Gaststudent war. Geschichten von Jungs in viel zu kleinen Buden in New York, deren Väter nach der Arbeit zu kaputt sind, um noch irgendetwas anzufangen. Für die es riskant ist, durch manche Straßen zu gehen, weil sie schwarz sind. Geschichten von Jungs in dem Viertel, das die meisten Weißen für das verkommenste der Stadt halten, Harlem. Dietrich erzählt von Familien, die aus der Hoffnung leben, aus der Liebe, die sie in der Gemeinde finden. In den Worten und Liedern ihrer Gottesdienste. Spirituals, die „Pastor Bonhoeffer“ auf seinen Schallplatten mitgebracht hat von drüben.
Schach und Brot
So erreicht Dietrich die „Jungs“. Sie spüren, dass er zu ihnen gehört. Und er hat immer etwas zu essen parat, wenn sie bei ihm anklopfen; der Vermieter ist schließlich Bäcker, seine Frau kann gut kochen, und der „Herr Pastor“ zahlt nicht nur fürs Abendessen, er lädt die Bäckerskinder gleich mit ein. Falls er nicht zu Hause ist – und Dietrich ist schon in diesen Jahren ständig unterwegs –, können die Jungs auch ohne ihn sein Zimmer benutzen. Die Vermieterin soll sie einfach reinlassen. Ein Mini-Jugendheim. Ein Platz, an dem sie immer willkommen sind.
Dietrich sieht den Mangel seiner Gäste, übt mit ihnen Schach und ein paar englische Sätze. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home …, spricht mit ihnen nicht zuerst über seine Antworten, sondern über ihre Fragen. Nur wenige der 50 Konfirmanden werden den Krieg überleben. Hitler wird die meisten in Russland in den Tod schicken.
Dietrich sieht, dass die Jungs kaum einmal rauskommen aus der Stadt. Also lädt er sie zu Ausflügen ein. Einmal sogar 250 Kilometer weit raus bis in den Harz, wo seine Eltern ein Ferienhaus haben. Acht Jungs kommen mit, Dietrichs Cousin hilft, sie zu bespaßen. Das Haus in Friedrichsbrunn ist seine eigene Zuflucht seit seiner Kindheit. Zeiten, in denen Papas Regeln lockerer sind, die Hosen immer schmutzig, Bäume und Käfer und Gräser immer greifbar. Hierher zieht Dietrich sich auch als Erwachsener immer wieder allein zurück, um längere Texte zu schreiben. Die Haushälterin macht sich Sorgen um die gute Stube, als Dietrich die kleine Reisegruppe einquartiert. Acht wilde Jungs aus dem Berliner Norden. Aber es bleibt alles heil, außer einer Fensterscheibe; ein Querschläger beim Fußball. Dietrich macht daraus kein Drama, meldet den Schaden aber vorsichtshalber in seinem Dankesbrief an seine Eltern.
Das Haus steht noch, ist heute eine Begegnungsstätte mit Café und Ferienwohnungen und hier zu finden: www.bonhoeffer-hausfriedrichsbrunn.de.
„50 Jungens. Das ist wirklich Arbeit“, schreibt er in einem seiner unendlich vielen Briefe. Die Besuche bei deren Eltern sind wie eine Begegnung mit Außerirdischen. Sie verstehen ihn einfach nicht. Zur Konfirmation am 13. März 1932 kauft er den Stoff, aus dem die Anzüge geschneidert werden. Die Predigt bereiten sie mit ihm gemeinsam vor, sie wünschen sich klare Ansagen, „eine ernste Mahnung fürs Leben“7. Also hören sie von Dietrich von der Kanzel einige „Mahnungen“. Und die Worte, denen dieses Buch hier seinen Titel verdankt:
Ich darf euch heute nicht den Blick in die Zukunft noch schwerer und dunkler machen, als er schon ist. Und ich weiß, manche von euch sehen schon eine ganze Menge von den Wirklichkeiten des Lebens. Es soll euch heute nicht Angst gemacht werden vor dem Leben, sondern Mut. Darum werden wir heute in der Kirche mehr denn je von der Hoffnung reden müssen, die wir haben und die euch keiner rauben darf.8
Wir wissen heute nicht genau, wie er im Konfirmationsunterricht mit ihnen gebetet hat. Aus Dietrichs Notizen lässt sich immerhin herauslesen, dass er mit ihnen die Bibel nach den großen Fragen des Lebens durchforstet hat: Was ist Liebe? Was Wahrheit? Was bedeutet Schuld? Warum das Leiden? Wo ist der Sinn? Wie können wir mit dem Tod leben? Und oft haben ihm die Gospel-Texte geholfen. He’s Got the Whole World in His Hands.
„Warum sollen wir uns fürchten?“, so endet Dietrichs Predigt, „Gott, Christus ist der Herr, die Gemeinde unsere Heimat. Ist Gott für uns, wer will gegen uns sein?“
Ihr erstes Abendmahl teilt er übrigens an einem anderen Tag aus, in einem getrennten Abendgottesdienst. Dietrich will denen einen inneren Konflikt ersparen, die nur Opa und Tante zuliebe zur Konfirmation gekommen sind. Das Sakrament feiert er mit denen, die wirklich wollen. Sie sind reif genug, das zu entscheiden.
Für einen dieser Konfirmanden hat Dietrich seine Studenten warten lassen im Seminarraum. Für die Zeit im Krankenhaus, die er an seinem Bett gewacht hat. Nicht zum ersten Mal, wie sie jetzt erfahren, aber vielleicht zum letzten Mal. Manche erzählen, der Junge hat die riskante Operation danach nicht überlebt …
„Seine Jungs“ haben ihm auch etwas mit auf seinen Weg gegeben: die Erfahrung, dass er mit dem Evangelium nicht nur die Hirne erreichen will. Er will die Herzen erreichen. Mit allem, was er ist und kann, denn:
Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit.9
Herz und Hirn
Später bringt Dietrich diese zwei parallelen Leben zusammen. Das eine fürs Herz und das andere fürs Hirn. Das eine Leben als Dozent für erwachsene Akademiker und das andere als Mentor für fast erwachsene Lehrlinge, die er einmal konfirmiert hat. Er spürt, wie es manche einschüchtert, in der feinen Villa seiner Eltern zu Gast zu sein. In Grunewald. Wo der Vater, der berühmte Charité-Professor Karl Bonhoeffer, schon Eindruck macht, wenn er einen nur konzentriert anschaut. Nicht nur die Konfirmanden werden in dieser bürgerlichen Umgebung ganz blass. Auch wenn Dietrich seine Studenten zum Abendessen einlädt, scheinen manche zu fremdeln.
Bliebe die eigene kleine Bleibe am Prenzlauer Berg. Aber die ist nur auf Zeit gemietet und auf Dauer zu eng. Dietrich findet etwas anderes Eigenes: Er pachtet im Frühjahr 1932 gut 20.000 Quadratmeter Land in Brandenburg und lässt eine schlichte Baracke hinstellen. Sturmfreie Bude für alle, Zeit und Raum für Wanderungen und endlose Gespräche. Er weiß, die fast 50 Kilometer raus nach Biesenthal sind für viele zu weit und die Themen manchmal zu abgehoben. Deshalb organisiert er im selben Jahr eine „Jugendstube“ in Berlin-Charlottenburg, eine Zuflucht für junge Arbeitslose. Heutzutage sind solche Förderprogramme Standard. Damals ist das Projekt etwas Besonderes. Das Geld spendiert eine wohlhabende Bekannte.
Die Datsche in Biesenthal ist einige Zeit lang sogar die einzige Rettung für einzelne „seiner“ Konfirmanden: Hierher können sie flüchten, als Nazi-Trupps beginnen, gezielt Jagd auf „die Roten“ zu machen. Mehr über die Straßenschlachten dieser Jahre steht im Kapitel „Wahrheit“ (S. 53).
Das Foto vom August 1934 mit Dietrich und den anderen am Strand ist auf Fanø entstanden, der dänischen Insel. In der Nähe der Stelle steht heute ein kleiner Granitblock. „Det økumeniske kirkemøde“ steht darauf. „Die ökumenische Konferenz. Fanø 24.–30. August 1934. Dietrich Bonhoeffer in memoriam.“ Dietrich ist auf dieser Konferenz, um Gesicht für die wahre evangelische Kirche zu zeigen. Die „Bekennende Kirche“, die er seit ein paar Monaten mit aufbaut. Was das bedeutet, ist auch im Kapitel „Wahrheit“ näher beschrieben: Dietrich will keine Nazi-Kirche, er will eine Christus-Kirche. Seine Gegner sind auch auf dieser Konferenz; hätten sie damals einen TikTok-Account gehabt, sie hätten vielleicht über Dietrich und seine Leute so etwas gepostet wie: „Links-woke Jesus-Träumer“, obwohl Dietrich in vielen Dingen konservativ war.
Vier auf dem Foto am Strand schauen konzentriert zu Boden, Dietrich scheint gerade etwas zu sagen, den Blick nach vorn gestellt. Wer würde darauf kommen, dass er der Hochschullehrer ist – mit seinen 28 Jahren – und die anderen bei ihm lernen, christlichen Glauben und wissenschaftliches Denken zu vereinen? Hätte die kleine Gruppe damals schon etwas zum Foto posten können, dann vielleicht: „Ruhe vor dem Sturm“. Fünf Jahre später überfällt Hitlers Armee Polen und stürzt damit die halbe Welt in einen neuen Krieg. Und noch einmal fünf Jahre später sitzt Dietrich im Auge des Sturms, umgeben vom Chaos.
Im Gefängnis
Sommer 1944. Dietrich gehört nicht mehr dazu. Er ist weit weg von „seinen Konfirmanden“, die gerade im Schützengraben krepieren. Solange er draußen war, hat er Kontakt zu ihnen gehalten. Wie zu fast allen Vikaren, die er mit ausgebildet hat. Er ist getrennt von seinem besten Freund. Eberhard ist auch eingezogen worden als Soldat, zum Glück hinter die Front als Schreiber in einer Abwehr-Einheit in Italien.
In einem Berliner Gefängnis hörst du in diesen Monaten irgendwann auf, die Bombennächte zu zählen. Wahrscheinlich auch die Tage, seit sich zum ersten Mal die Zellentür hinter dir geschlossen hat. Es ist der 299. Tag, als Dietrich im Dunkel auf dem Boden liegt und wartet, dass es vorbei ist. Die Nacht auf den 29. Januar 1944. Warten hilft ihm, Tag für Tag durchzuhalten. Warten auf den Sommer, wenn er keinen Rheuma-Schub fürchten muss. Warten auf den Tag, da er Maria berühren kann. Auf Gottesdienste ohne Bewacher:
„Nun feiern wir also auch Pfingsten noch getrennt“, schreibt er im ersten Sommer seiner Haft:
Als die Glocken heute früh läuteten, hatte ich große Sehnsucht nach einem Gottesdienst, aber dann habe ich für mich allein einen so schönen Gottesdienst gehalten, daß die Einsamkeit gar nicht zu spüren war, so sehr wart Ihr alle, alle dabei und auch die Gemeinden, in denen ich Pfingsten schon gefeiert habe.10
Warten. Wieder das geliebte Klavier spielen zu können. Warten auf den Tag, da es vorbei ist mit Hitler. Über dieses Warten hat schon der zweite Sommer als Untersuchungshäftling begonnen, Dietrichs letzter Sommer, der Sommer 1944.
Diesmal ist er allein auf dem Foto. Wie er dasteht. Immer noch ein Blick, der bis zum Horizont zu reichen scheint, der aber nach wenigen Metern endet. An der Mauer, die sein Drinnen trennt vom Draußen, das Heute vom Damals. Keine zehn Kilometer hinter der Mauer ist das Zuhause, in das er gehört. In dem die Eltern sind – die Mama vor allem – und so viele Erinnerungen. Da sind Schwägerinnen, Neffen, Nichten, Menschen, die ihn nur alle paar Wochen besuchen dürfen.
Manchmal ist da jetzt auch Maria, wenn sie es die gut 100 Kilometer herüberschafft aus Pätzig, um ihn zu besuchen. Noch trägt sie den Namen „von Wedemeyer“. Wann wird sie endlich „Maria Bonhoeffer“ heißen? Anderthalb Jahre sind seit der Verlobung vergangen. Ein Jahr, seit sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Vor den Augen des Mannes, der ihn an den Galgen bringen will und es nicht schafft. Oberkriegsgerichtsrat Roeder hat alles versucht, den „Pfaffen“ Bonhoeffer mit dessen merkwürdigen
Verbindungen zur Heeresleitung zu packen. Der neue Ermittler kommt auch nicht voran. Und Sonderegger von der Gestapo macht vorerst auch nur seinen Job.
Gleich beim ersten Verhör hat Roeder ihm gedroht: „Niemand hört Ihr Schreien, falls Sie hier schlimme Schmerzen erleiden …“ Dietrich hat gesehen, wie sie andere zugerichtet haben. Das Blut, das Wimmern aus anderen Zellen. Dietrich weiß nicht, was er täte. Solange sie ihn nicht foltern, kann er klar denken, die anderen schützen. Vor allem Hans, seinen Schwager, bei dem alle Fäden zusammengelaufen sind über die Jahre. Irgendwann spricht sich herum, dass Dietrichs Onkel ein hohes Tier bei der Wehrmacht ist, auch zuständig für dieses Gefängnis. Das scheint Dietrich zu schützen. Die anderen im Block vertrauen ihm. Und Dietrich hat ein gutes Gespür, wem er trauen kann. Selbst aus dem Wachpersonal suchen einige seine Nähe, seinen Rat. Einer der Schließer schmuggelt inzwischen sogar die heimlichen Briefe rein und raus.
„Liebe Mama“, schreibt Dietrich nach mehr als 20 Monaten im Knast – in der Rechtschreibung von damals: „Du mußt wissen, daß ich jeden Tag unzählige Male an Dich und Papa denke und daß ich Gott danke, daß Ihr da seid für mich und für die ganze Familie.“11
Einer von Hunderten Briefen, die Freunde und Familie aufbewahrt haben wie kleine Schätze, lange schon, bevor sie fürchten mussten, Dietrich zu verlieren. Lauter feine Fäden, die sie miteinander verbinden. In der Staatsbibliothek Berlin liegen mehr als 10.000 Papierblätter, die von ihm erzählen. Dazu mehr als 250 Fotos und viele Ansichtskarten. Die meisten Stücke hat Eberhard Bethge gesichert. Der Mensch, mit dem Dietrich mehr Zeit verbracht haben dürfte als mit irgendwem sonst. Der ihn auch anders kennt, als er heute erscheint. Eberhard kennt seinen Freund auch aufgekratzt, albern, ironisch. Auf manchen Fotos sind die zwei zu sehen, wie sie Grimassen schneiden.
Wir haben kaum Fotos von den vielen leichten Momenten, die er mit anderen genossen hat. Seine Nichte Renate hat ihr Leben lang einige Bilder davon im Kopf.
Candystorm und Wünschelrute
Dietrich hatte irgendwo einen Wünschelrutengänger getroffen, und der hatte ihm wohl gesagt, er habe dafür Begabung. Dann ist er mit uns Kindern in den Garten gegangen, hat Ruten abgeschnitten, und wir sind im Garten herumgelaufen. Er sagte, bei ihm ginge das, darunter müsse Wasser sein. – Vielleicht auch typisch für ihn, weil er sich immer für neue Sachen interessierte.12
Renates Erinnerung an Tage wahrscheinlich im Sommer 1936, an denen sie Schularbeiten auf der Terrasse macht. Das Haus ihrer Eltern liegt direkt neben dem der Großeltern. Dietrich hat darin ein eigenes Zimmer unter dem Dach. Hier arbeitet er viel am Schreibtisch, hier durchpflügt er seine üppige Büchersammlung oder macht ein Nickerchen. Hier wird Roeder ihn am Nachmittag des 5. April 1943 verhaften.