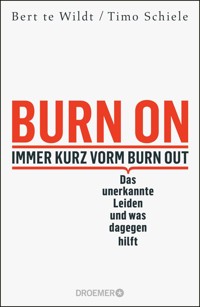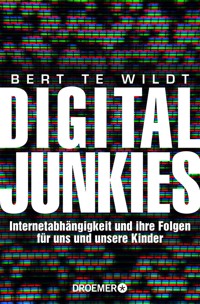
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sucht, Vereinsamung und Verwahrlosung sind die Kehrseiten des World Wide Web. Als Ersatz für unerfüllte Wünsche und unerreichte Ziele ist das Internet der Nährboden für neue Verhaltenssüchte. Online-Spielabhängigkeit, Cybersexsucht und die Abhängigkeit von sozialen Netzwerken entstehen im Netz, altbekannte Süchte wie Glücksspiel- und Kaufsucht verlagern sich dorthin. Bert te Wildt ist Deutschlands führender Experte für Internetabhängigkeit. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Arzt und Psychologe in Wissenschaft und Praxis mit Menschen, die unter einer exzessiven Internetnutzung leiden. In diesem Buch schlägt er Alarm, damit die Digital Natives nicht zu Digital Junkies werden. Dabei ist er weit davon entfernt, dass Internet und die digitale Entwicklung generell zu verdammen. Kritisch beleuchtet er anhand von ausgewählten Fallbeispielen die Gefahren einer exzessiven Internetnutzung, die zur Sucht und einer therapiebedürftigen psychischen Erkrankung werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bert te Wildt
Digital Junkies
Internetabhängigkeit und ihre Folgen für uns und unsere Kinder
Knaur e-books
Über dieses Buch
In den letzten Jahren kommen immer mehr tief verstörte Jugendliche und Erwachsene in die Sprechstunde von Bert te Wildt. Sie zeigen alle Anzeichen schwerer Abhängigkeit und stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie sind einsam und verlieren sich in Chats. Sie sind cybersexsüchtig und können nicht einmal im Arbeitsalltag von der Pornographie lassen. Sie sind Gamer und spielen bis zu 72 Stunden ohne Unterbrechung. Internetsüchtige vernachlässigen Schule, Arbeitsplatz und soziale Kontakte. Wird ihnen der Zugang zum Netz verwehrt, können sie hochgradig depressiv oder aggressiv reagieren. Auf Schlaf, Mahlzeiten und Hygiene achten sie nicht mehr. Sie verwahrlosen dramatisch. In den schlimmsten Fällen klicken sie sich zu Tode: Sie sterben an Schlaf- und Flüssigkeitsmangel oder begehen Selbstmord.
Inhaltsübersicht
»Wir sollten zum Nutzen zukünftiger Generationen
über die digitalen Schichten nachdenken, die wir jetzt legen.«
Jaron Lanier, 2010
Vorwort
Den Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit Medien bildeten heftige Auseinandersetzungen mit meinem Vater. Die Geburtsstunde des Internets war im Jahr 1969, in dem auch ich zur Welt kam. Als ich mich Ende der 80er Jahre regelmäßig mit meinem Vater über die fragwürdige Qualität der Medien stritt, hatten wir noch nicht einmal davon gehört. Er empörte sich vor allem über das damals wichtigste Medium, das Fernsehen. Es hatte schon über 30 Jahre auf dem Buckel, war aber noch auf drei Sender beschränkt.
Mein Vater war der Meinung, dass die Medien die Menschen vor allem dumm machen und manipulieren würden. Ich dagegen vertrat die Ansicht, dass die Medien einfach nur das abbilden, was in uns Menschen längst vorhanden ist.
Hätte ich damals schon etwas von Psychologie verstanden, hätte ich sagen können, dass die Medien einfach nur das beinhalten, was wir in sie hineinprojizieren. Sicherlich geht alles, was wir in den Medien finden, irgendwie auf den Menschen zurück. Aber indem wir Menschen unser Innerstes in Medien auslagern, bekommt es eine Eigendynamik. Mit dem Internet erreicht diese mediale Eigendynamik eine Dimension, die mein Vater und ich uns damals in unseren kühnsten (Alp-)Träumen nicht hätten ausmalen können.
Vor Abschluss meines Studiums begann ich mich Ende der 90er Jahre wissenschaftlich mit den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Medien zu beschäftigen. Medizin hatte ich mit dem Ziel studiert, ärztlicher Psychotherapeut zu werden. Und mit der Wahl meines Forschungsthemas bot sich die Möglichkeit, mich noch dazu mit Medien beschäftigen zu können. Zu dieser Zeit hatte ich es zwar noch nicht für möglich gehalten, dass Medien eine so starke Rückwirkung auf den Menschen entfalten könnten, dass man von ihnen abhängig werden kann. Durch die rapide Zunahme von privaten Internetanschlüssen und die Verschiebung eines Großteils der privaten wie beruflichen Kommunikation ins Netz wurde mir allerdings schnell klar, dass sich auch unser Seelenleben nach und nach ins Internet verlagern würde und mit ihm psychische Krankheitsphänomene und psychotherapeutische Verfahren. Ich ging davon aus, dass die digitalen Medien nicht nur im positiven, sondern auch im negativen Sinne auf unser Fühlen, Denken und Handeln zurückwirken.
Deshalb gründete ich im Jahre 2002 an der Medizinischen Hochschule Hannover eine »Sprechstunde für Menschen mit medienassoziierten psychischen Erkrankungen«. Dieses Wortungetüm war der Vorannahme geschuldet, dass sich eine exzessive Internetnutzung auf vielfältige Art und Weise zeigen könnte, aber eher als Symptom bekannter psychischer Erkrankungen zu verstehen sei. Zu meiner Überraschung kamen aber ausschließlich Menschen in die Sprechstunde, die im Hinblick auf ihre Mediennutzung allesamt die Symptome einer einzigen psychischen Störung aufwiesen: der Abhängigkeit vom Internet.
Das gilt nun genauso für die Medienambulanz, die ich 2012 in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am LWL-Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum begründet habe. Seit insgesamt zwölf Jahren beschäftige ich mich nun in Wissenschaft und Praxis mit Menschen, die unter einer exzessiven Internetnutzung leiden. Mittlerweile setzt sich in nationalen und internationalen Fachkreisen die Erkenntnis durch, dass wir es bei der Internetabhängigkeit tatsächlich mit einem eigenständigen Krankheitsbild im Sinne einer Suchterkrankung zu tun haben. Dass ich mich selbst eingehend davon überzeugen konnte, verdanke ich den internetabhängigen Patienten und Patientinnen, die sich mir über die Jahre hinweg in Klinik und Forschung anvertraut haben, und vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in Klinik und Wissenschaft zusammenarbeiten darf.
Bis vor wenigen Jahren wurden wir auf medizinischen Kongressen noch aufgrund unserer Arbeit belächelt und kritisiert. Heute findet Internetabhängigkeit in Fachkreisen zunehmend Interesse und erstmals auch offizielle Anerkennung. Im Jahre 2013 wurde die Online-Computerspiel-Abhängigkeit als häufigste Variante der Internetabhängigkeit von einem führenden internatiolen Gremium von Ärzten und Psychologen der Status einer Forschungsdiagnose zuerkannt. Bis zu einer vollständigen Anerkennung ist es jedoch noch ein Stück Weg. Für viele Betroffene und deren Angehörige ist es nach wie vor schwierig, fachkompetente Hilfe zu erhalten. Derweil fragen sich allerdings immer mehr Menschen, wann bei der exzessiven Nutzung von Internet und Computerspielen die Grenze zu einer therapiebedürftigen psychischen Erkrankung überschritten ist und wie sie sich davor schützen können.
Dieses Buch richtet sich an diejenigen, die wissen möchten, wie man eine Internetabhängigkeit erkennen und behandeln kann. Zudem geht es mir darum, ein Verständnis für die Entstehungsbedingungen zu vermitteln, um Präventionsmöglichkeiten für diese neue Suchterkrankung aufzeigen zu können. Es ist mir jedoch wichtig zu betonen, dass es nicht in meinem Interesse liegt, das Internet zu verdammen. Ich möchte selbst nicht darauf verzichten. Es geht mir vielmehr um eine im besten Sinne kritische Begleitung und achtsame Gestaltung der digitalen Revolution und nicht um eine Fundamentalkritik am Internet. Wenn Sie mich aber fragen, ob sich unsere Gesellschaft momentan zu viel oder zu wenig Gedanken über die Folgen der digitalen Entwicklung macht, dann ist meine Antwort eindeutig. Sie macht sich vor allem im Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder zu wenig Sorgen. Wenn ich in meinem Buch vor allem auf die negativen Seiten des Internets eingehe, erklärt sich das aus meinen Erfahrungen als Arzt und Psychotherapeut mit Menschen, die von Internetabhängigkeit betroffen sind.
Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass sich mehr Menschen mit den Gefahren dieser neuartigen Erkrankung auseinandersetzen, um ihr konstruktiv entgegenzuwirken. Dies geschieht in der Hoffnung, dass die überschießende digitale Entwicklung irgendwann eine Gegenbewegung provoziert, dass wir uns stärker auf unsere analoge Lebenswelt zurückbesinnen, auf unmittelbare Begegnungen von Mensch zu Mensch, in Natur und Kultur. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn dieses Buch auch als Plädoyer für ein gemeinsames Leben im Hier und Jetzt der wirklichen Welt[1] verstanden würde.
Dortmund, November 2014
Einleitung: Vernetzt, verspielt, verloren
Den Digital Natives gehört die Welt! Dieser Slogan ist in aller Munde. Ihm zufolge hängen die digitalen Eingeborenen die Generation der Digital Immigrants kurzerhand ab. Der Stamm der digitalen Einwanderer – das heißt jener, die noch nicht mit dem Internet groß geworden sind und zu denen immer noch die meisten von uns gehören – käme beim Umzug in den Cyberspace zwangsläufig nicht mit. Die Politik und die Konzerne, die digitale Medien für ihre Zwecke missbrauchen, mag man kritisieren. Aber für die Digital Natives ist die Güte ihres Lebensraums über jeden Zweifel erhaben.
Diese Haltung ist in meinen Augen nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Denn sie führt zu einer einseitigen Verklärung der digitalen Medien und ist der Grund dafür, warum wir Erwachsenen Kinder viel zu früh und viel zu lange vor digitalen Bildschirmmedien sitzen lassen, während wichtige Entwicklungsaufgaben in der analogen Welt unbewältigt bleiben.
Mit dem Hinweis auf die glorreiche Zukunft der Digital Natives ziehen wir uns allzu bequem aus der Verantwortung. Der unkritische Umgang mit der schönen neuen Welt des Internets hat mittlerweile atemberaubende Ausmaße angenommen. Warum ist das so? – Haben wir Angst davor, den Anschluss an das digitale Zeitalter zu verpassen? Ist es ein Mangel an Information darüber, welche Gefahren vom Internet ausgehen? Oder sind wir einfach zu bequem, um etwas dagegen zu unternehmen?
Das Gefühl, dass hier etwas grundsätzlich im Argen liegt, beschleicht mittlerweile jeden, der aufmerksam durch die Welt geht. Wer kennt nicht die digitale Katerstimmung, viel zu viel mit anderen digital kommuniziert zu haben und sich danach zu sehnen, einfach ganz in Ruhe mit einem nahestehenden Menschen Zeit zu verbringen? Wer hat es noch nicht erlebt, mit welcher archaischen Wut Kinder manchmal darauf reagieren, wenn man ihnen ihr Computerspiel wegnimmt? Und wer ist noch nicht auf der Straße mit einem Jugendlichen zusammengestoßen, der in selbstgefährdender Weise laufend mit seinem Smartphone beschäftigt ist? – Im Grunde ist die Allgegenwart unserer Abhängigkeit vom Internet doch nicht mehr zu übersehen.
Mit diesem Buch verbindet sich die Hoffnung, dass immer mehr von uns von ihren digitalen Bildschirmen aufblicken, sich in der analogen Welt umsehen und den Handlungsbedarf erkennen. Kurz gesagt, es geht um die erschreckende Aussicht, dass immer mehr digitale Eingeborene von heute die digitalen Junkies von morgen sein werden. Im Zweifelsfall sind sie es – und nicht die digitalen Einwanderer –, die von der Entwicklung abgehängt werden. Die Internetabhängigen sind die Verlierer der digitalen Revolution.
Der entscheidende Grund, warum wir einen blinden Fleck für die Abhängigkeitsgefahren haben, die vom Internet ausgehen, ist ganz einfach der, dass sich unsere Gesellschaft kollektiv längst derart abhängig von den digitalen Medien gemacht hat, dass uns die Einzelschicksale kaum auffallen.
Es ist wie mit dem Alkohol. Gegen diesen Vergleich habe ich mich lange gesträubt. Aber die Parallelen sind zu offensichtlich geworden. Einerseits gehört der Alkohol zu unserer Kultur. Andererseits ist die Alkoholabhängigkeit – abgesehen von der Nikotinabhängigkeit – in den deutschsprachigen Ländern nicht nur die am meisten verbreitete Suchterkrankung, sie gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt. Das wird gerne verdrängt. Gerade weil die meisten Menschen alkoholische Getränke als ein Kulturgut empfinden, haben sie bezüglich ihrer Gefahren einen blinden Fleck. Seien wir ehrlich: Auf einem sommerlichen Volksfest freuen sich die meisten über ein kühles Bier. Wenn es etwas zu feiern gibt, dann stoßen wir gerne mit einem Glas Sekt an. Zu einem festlichen Essen in netter Runde gehört ein gutes Glas Wein. Und für die Verdauung gibt es danach einen Schnaps. Nur wenige sagen dazu nein. Das Risiko, vom Alkohol abhängig zu werden, blenden wir aus. Ganz darauf zu verzichten kommt im Grunde nur denen wirklich in den Sinn, die Alkoholismus am eigenen Leib oder als Angehörige erlebt haben oder die Alkohol aus religiösen Motiven gänzlich ablehnen. Bei der allgemeinen Bierseligkeit und Weinkultur nicht mitzumachen ist jedoch gar nicht so einfach. Wer weiß kein Lied davon zu singen, wie schwer es ist, sich dem Gruppendruck einer trinkfreudigen Gesellschaft zu entziehen.
Mit dem Internet ist es kaum anders. Ihnen hat sicherlich schon jemand vorgeworfen, dass Sie nicht schnell genug auf ihre oder seine E-Mails reagieren. Oder Sie kennen das Gefühl, bei einer Gruppe von Menschen völlig abgemeldet zu sein, weil Sie nicht in einem bestimmten sozialen Netzwerk wie z.B. Facebook angemeldet sind. Vielleicht haben Ihnen Ihre Kinder schon einmal gesagt, dass sie ins soziale Abseits gedrängt werden, wenn Sie ihnen keinen permanenten Internetzugang verschaffen, sowohl im Kinderzimmer als auch per Smartphone, versteht sich[2] Dieser digitale Gruppenzwang trifft längst auch die Älteren in unserer Gesellschaft. Wenn man Computer und Internet nicht nutzen kann oder will, fühlt man sich heute ziemlich aufgeschmissen und von vielem ausgeschlossen.
Viele Dienstleistungen und Produkte sind kaum noch vor Ort zu haben. Wenn wir heute an allem, was in unserer Gesellschaft passiert, teilhaben wollen, müssen wir uns dem digitalen Netz wohl oder übel anschließen. Der Gruppendruck hat gesiegt. So ist es kein Wunder, dass in den deutschsprachigen Ländern heute bereits weit mehr als 90% der Menschen einen Internetzugang haben. Ganz ohne Netz geht’s nicht mehr, für nichts und niemanden.
An dieser Stelle hinkt allerdings der Vergleich zwischen der Abhängigkeit von Alkohol und Internet etwas. Das Internet ist nicht nur ein Genussmittel zu unserem Vergnügen, sondern auch ein Werkzeug, mit dem wir die Welt gestalten. Das Funktionieren von Politik und Wirtschaft, unser Bildungs- und Arbeitswesen sind kaum mehr ohne das Internet denkbar. Gäbe es von heute auf morgen keinen Alkohol mehr, würde zwar ein riesiger Wirtschaftszweig kollabieren, das gesellschaftliche und politische Leben wäre davon aber im Kern nicht berührt, zumindest nicht lahmgelegt. Dagegen wäre der Zusammenbruch des Internets heute schon gleichbedeutend mit einem Kollaps unserer Gesellschaft. Wir haben so viele Prozesse auf digitale Füße gestellt und dabei so viele analoge Standbeine verloren, dass wir in vielerlei Hinsicht hilflos dastehen würden. Dass wir uns dadurch immer weiter in eine allgemeine Abhängigkeit hineinbewegt haben, ist kaum jemandem bewusst.
Da wir dem Internet regelrecht verfallen sind, sehen wir hauptsächlich die vermeintlichen Gewinne, die die digitale Zukunft für uns bereithält. Dabei übersehen wir, was wir aufgeben und vielleicht unwiederbringlich verlieren. Oder sollte es besser heißen, was wir bereits aufgegeben und verloren haben? Da wir uns dies nicht eingestehen wollen, übersehen wir auch, dass einzelne Menschen völlig die Kontrolle über ihre Mediennutzung verlieren und einer Abhängigkeit im engeren Sinne zum Opfer fallen. So wie unsere trinkfeste Gesellschaft gerne die Kollateralschäden des Alkoholismus ausblendet, verliert die Netzgesellschaft diejenigen aus dem Blick, die im Internet ihr zumeist noch junges Leben digital vor die Wand fahren. Um unser eigenes Verhalten nicht in Frage stellen zu müssen, verdrängen wir die Abhängigkeitsgefahren aus unserem Blickfeld. Von den Opfern der Auswüchse unserer Trink- und Internetkultur wollen wir uns den Spaß doch nicht verderben lassen.
Dies gilt bedauerlicherweise auch für Eltern. Wenn im Wohnzimmer ununterbrochen der Fernseher läuft, werden Eltern ihre Kinder kaum davon überzeugen können, nicht jeden Abend und das ganze Wochenende vor Computern und Konsolen in ihren Zimmern zu hocken. Wenn die Erwachsenen bei jeder Gelegenheit auf die Bildschirme ihrer Smartphones starren und tippen, haben sie schlechte Karten, ihrem Nachwuchs ein gesundes Maß und Manieren im Umgang mit elektronischen Medien beizubringen. Warum sollten sich die Heranwachsenden mit einem Verzicht zufriedengeben, wenn die Erwachsenen selbst immer mehr hinter Bildschirmmedien verschwinden, anstatt sich mit ihren Kindern unmittelbar zu beschäftigen und auszutauschen? Wenn es aber um unseren Nachwuchs geht, müsste der Spaß doch eigentlich aufhören oder zumindest ab und zu seine Grenzen haben.
Nichts geht über eine gute Unterhaltung. Allerdings ist mit guter Unterhaltung heute und nicht erst seit gestern vor allem das gemeint, was uns Bildschirmmedien bieten. Unterhaltung hat immer auch etwas Spielerisches. Und Verspieltheit gehört zum Menschsein dazu. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
Dass der Mensch quasi von Natur aus ein Spielender sei, auf Lateinisch der sprichwörtliche Homo ludens, wird gerne von der Computerspielindustrie besonders betont. Mit diesem Argument verteidigt sie ihre enorme Erfolgsgeschichte gegen Kritik. Deutschland beispielsweise hat mit einem Jahresumsatz von 2,65 Milliarden Euro im Jahr 2013 europaweit den größten Markt für Computerspiele. Wenn es um die Lobby der Hersteller von Computerspielen geht, wird es ernst. Genauso offensiv wie die Vertreter der Glücksspielbranche vertreten sie ihre Interessen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern in Berlin und Brüssel. Das Bedürfnis der Menschen, Spiele zu spielen und zu verkaufen, wird also auch politisch sehr ernst genommen.
Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen, wie Menschen mit Spielen in Abhängigkeit gehalten werden können. Das Begriffspaar Brot und Spiele, das noch aus der Zeit der Gladiatorenkämpfe stammt, illustriert diesen Zusammenhang sehr treffend. Damit ist gemeint, dass man ein Volk klein und gefügig halten kann, wenn man für seinen Unterhalt und seine Unterhaltung mit Essen und Spielen sorgt. Gestern wie heute sind es Diktatoren, die ihre Untertanen zum Beispiel mit Olympischen Spielen bei Laune und Fahne halten. Derzeit besteht wenig Hoffnung, dass das Erkaufen von Zustimmung und Gehorsam bald Geschichte sein wird. Derweil unterhalten wir uns mit modernen Varianten der Gladiatorenkämpfe in den Medien, sei es mit Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar und Germany’s Next Topmodel, mit Romanen und Filmen wie Die Tribute von Panem, Fernsehserien wie Spartacus und Computerspielen wie Rome.
In Zukunft dürfte die Vereinnahmung des Menschen über die Befriedigung seines Spieltriebs immer raffinierter ausfallen. In seinem Zukunftsroman Schöne neue Welt prophezeite Aldous Huxley 1932, dass der Mensch der Zukunft in Abhängigkeit gehalten werde, indem man ihn permanent unterhält. Dieses Szenario folgt einem kapitalistischen Prinzip. Mit dem vorläufigen Sieg des Kapitalismus leben noch mehr Menschen mit dem Anspruch, dass alle Bedürfnisse unmittelbar zu befriedigen seien.
Da wir in unserer Gesellschaft so leben, als gäbe es keinen Hunger, hat das Bedürfnis nach unbeschwerter Unterhaltung und damit auch unser Spieltrieb an Macht gewonnen. Gleichzeitig arbeiten wir in Zeiten der Globalisierung länger und härter als noch vor einigen Jahren. Umso mehr sollte es uns also zustehen, unsere Freizeit so spielerisch wie möglich zu gestalten, oder? Und sind wir nicht sogar dazu verpflichtet, uns am Abend und am Wochenende besonders gut abzulenken und zu unterhalten, um am Montag wieder mit voller Kraft der Marktwirtschaft zur Verfügung zu stehen? – Insofern dürfte es wohl kein Zufall sein, dass gerade in Ländern wie Südkorea und China, wo der wirtschaftliche Erfolgsdruck enorme Ausmaße angenommen hat, die Computerspielabhängigkeit besonders verbreitet ist.
Tatsächlich ist die Abhängigkeit von Online-Computerspielen die weltweit mit Abstand häufigste Form der Internetabhängigkeit. Und kaum ein Wirtschaftszweig verzeichnet weltweit ähnlich hohes Wachstum und schnellen Wandel wie die Computerspielindustrie. Es bedarf wenig Phantasie zu erkennen, dass es hierbei unrühmliche Zusammenhänge gibt, die so manche Wirtschaftsverbände, Lobbyisten und Politiker gerne übersehen, um nicht zu sagen vertuschen. Wir wissen, mit welcher Macht die Genussmittelindustrie und die von ihr abhängige Werbebranche der Politik entgegenwirken, wenn es um Beschränkungen des Alkohol-, Zigaretten- und Glücksspielmarkts geht. Es ist davon auszugehen, dass es mit den Genussmitteln des Internetzeitalters genauso läuft, auch wenn wir es uns anders wünschen mögen.
Naivität können wir uns jedoch in diesem Zusammenhang nicht leisten. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die heranwachsenden Generationen. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich die Suchtgefährdung eines Menschen erhöht, je früher er mit einem Suchtmittel in Kontakt kommt.[3] Dies gilt ganz besonders auch für Computerspiele, insbesondere wenn sie im Internet gespielt werden. Es besteht kein Zweifel: Wir haben es hier mit Genussmitteln zu tun, die ebenso zu Suchtmitteln werden können. Und so sollten wir auch mit ihnen umgehen.
Vielleicht sind die Computerspielabhängigen nicht genügend vorbereitet auf ein Leben in der Erwachsenenwelt, weil sie immer schon zu viel im Internet gespielt haben. Eventuell ist es ihnen aber einfach zuwider, in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen, deren Ansprüche sie nicht erfüllen können oder wollen. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben es hier nicht mit einem Widerspruch zu tun, sondern mit zwei Kehrseiten ein und derselben Medaille. Wir setzen unsere Kinder einerseits zu großem Leistungsdruck aus und lassen sie andererseits ihre Zukunft verspielen.
Wenn wir uns also um die digitale Revolution Gedanken machen sollten, dann vor allem deshalb, weil uns die Zukunft der kommenden Generationen am Herzen liegt. Wir sind dabei, einen Fehler zu wiederholen. Wären wir im Zuge der industriellen Revolution klüger gewesen, hätten wir nicht die massiven Umweltprobleme, die jetzt unseren Planeten bedrohen. Sicherlich ist es gut, sich vor Augen zu führen, wie die elektronischen Medien unser Leben in Zukunft positiv verändern können. Aber es ist ebenso notwendig, darüber nachzudenken, an welchen Stellen wir dabei negative Konsequenzen zu erwarten haben. Nur so können wir wirklich kluge Entscheidungen über unsere digitale Zukunft treffen. Selbstverständlich können wir nicht jedes Risiko ausschließen, das das Internet mit sich bringt. Wir können aber gegen die größte Gefahr, die für unsere Gesundheit vom Internet ausgeht, etwas tun: die Abhängigkeit.
Die Zahlen sind tatsächlich alarmierend, wobei zwischen »eindeutig internetabhängigen Menschen« und »Menschen mit problematischer Internetnutzung« unterschieden wird. In einer aufwendigen Erhebung aus dem Jahr 2011 wurden an der Universität Lübeck von einem Team um Hans-Jürgen Rumpf im Rahmen einer repräsentativen Stichprobe über 15000 Menschen im Alter von 14 bis 64 Jahren per Telefoninterview befragt. Aus dieser vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierten PINTA-Studie[4] ergab sich, dass ungefähr 1% der Deutschen an einer Internetabhängigkeit leiden.[5] Bei einer Einwohnerzahl von etwa 80 Millionen ist dementsprechend in Deutschland heute von 800000 Internetabhängigen auszugehen. Überträgt man die Zahlen auf die anderen deutschsprachigen Länder, kommt man jeweils auf etwa 80000 Betroffene in Österreich und der Schweiz. Da gerade auch bei Heranwachsenden unter 14 Jahren zunehmend häufiger eine Internetabhängigkeit auftritt, diese aber in der Studie nicht berücksichtig wurden, ist davon auszugehen, dass wir es allein in den deutschsprachigen Ländern mit mindestens einer Million Internetabhängigen zu tun haben.
Auch wenn es hierzu bislang keine Langzeitstudien gibt, sprechen die bisherigen Zahlen dafür, dass die Krankheitsfälle weiter steigen werden. Dies liegt vor allem daran, dass die Kinder und Jugendlichen heute noch früher und noch viel mehr Zeit mit digitalen Medien verbringen. Die Kriterien für eine Internetabhängigkeit erfüllten in der PINTA-Studie 2,4% der 14- bis 24-Jährigen und 4% der 14- bis 16-Jährigen. Und dies sind nur die Zahlen für eine manifeste Abhängigkeit.
Wie beim Alkohol unterscheidet man auch hier zwischen Abhängigkeit (pathologischer Internetgebrauch) und Missbrauch (problematischer Internetgebrauch), wobei anzumerken ist, dass bei den anerkannten stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen schon der Missbrauch als Diagnose gestellt wird und somit einen Krankheitswert hat.
Menschen, die einen Internetmissbrauch betreiben, weisen zwar schon ein typisches Suchtverhalten auf, haben sich aber durch ihre exzessive Internetnutzung noch nicht nachhaltig geschädigt. Sie leben allerdings permanent in der Gefahr, eine Abhängigkeit im engeren Sinne zu entwickeln. An einem solchen Internetmissbrauch leiden gemäß der PINTA-Studie weitere 4,6 % der Deutschen im Alter zwischen 14 und 64 Jahren. Das entspricht einer Zahl von etwa 3,6 Millionen Menschen. Wenn man von diesen Zahlen ausgeht, kommt man auch bei vorsichtiger Schätzung auf erschreckende Summen. Demnach sind in den deutschsprachigen Ländern über fünf Millionen Menschen von einer problematischen oder pathologischen Internetnutzung betroffen.
1 Vom Missbrauch bis zur Sucht. Diagnose
Eine Frau Anfang 20 zog ihrem Partner zuliebe in eine weit entfernte Stadt, weil er dort eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Wenig später wurde sie schwanger, verlor aber das Kind. Daraufhin zerbrach ihre Beziehung. In ihr Elternhaus wollte die junge Frau nicht zurück. Sie entschied sich, in einer weiteren, ihr fremden Stadt einen Neuanfang zu suchen. Dort fand sie jedoch keinen Anschluss, weder eine Arbeitsstelle noch neue Freunde. Vereinsamt und traurig zog sie sich in ihre Wohnung und immer weiter ins Internet zurück.
In einem Online-Rollenspiel baute sie sich mit Gleichgesinnten eine Scheinwelt auf. Auf diese Weise versuchte sie sich über ihre deprimierende reale Situation hinwegzutrösten, dies oft mehr als zwölf Stunden am Tag. In ihr Therapie-Tagebuch, das sie mir überließ, schrieb sie: »Dann lernte ich das Internet kennen, baute mir einen Schutzraum auf, und plötzlich war ich in dem Kasten wieder wer. – Maske aufgesetzt, und los geht’s. Rollenspiel gefunden, aufgelebt nur dort, aber auch da zerbrach meine Maske durch die Unlösbarkeit meines Alltags. Da ich mit mir und niemandem mehr klarkam, schlief ich nicht mehr, aß nicht mehr, war nur noch für die Kiste da, weil mich eh keiner verstand und liebte.«
In dem Spiel ging es darum, ein Unternehmen im mittelalterlichen Holland aufzubauen. Die junge Frau trat darin in verschiedenen Charakteren, vor allem in männlichen Rollen, auf. Eine ganze Weile war sie dort sogar der Chef. Die Rollen ergriffen jedoch allmählich Besitz von ihr. Wenn sie den Computer einmal kurzzeitig verließ, um zum Kühlschrank oder zum Kiosk zu gehen, blieb sie immer häufiger innerlich in einer ihrer Rollen hängen. Da sie Tag und Nacht hinter den Masken ihrer Spielfiguren verschwand, verlor sie den Kontakt zu sich selbst und zur Außenwelt. Irgendwann wusste sie kaum noch, wer sie war. Um ihr wirkliches Dasein, ihre körperlichen Bedürfnisse und ihre wirtschaftlichen Lebensbedingungen kümmerte sie sich kaum noch. Sie stand kurz davor, wegen einer Räumungsklage auf die Straße gesetzt zu werden, als sie den entscheidenden Hilferuf aussandte: »Mit letzter Kraft rief ich meine Eltern an, um mich dort und aus meiner inneren Hölle rauszuholen. Halt doch bitte einer den Film an!« Die Eltern befreiten sie schließlich aus dem Internet, der verwahrlosten Wohnung und der ihr fremd gebliebenen Stadt.
Sie brachten sie zur Aufnahme in unsere Klinik. Nachdem sie sich auf einer psychiatrischen Station auch mit Hilfe von Psychopharmaka von der akuten Krise ein wenig erholt hatte, wurde sie auf eine Psychotherapiestation verlegt. Im Kontakt fiel dort auf, dass sich die Patientin gegenüber den Mitarbeitern und Mitpatienten sehr unterschiedlich verhielt, so als hätte man es mit unterschiedlichen Persönlichkeiten in ein und derselben Person zu tun. Tatsächlich zeigte die Patientin die Symptome einer dissoziativen Identitätsstörung, auch »multiple Persönlichkeitsstörung« genannt. Die von ihrer Umwelt wahrgenommenen Identitätssplitter ähnelten den Rollen, die sie im Online-Spiel gespielt hatte.
Im Verlauf der zwölfwöchigen Behandlung stellte sich allerdings heraus, dass die Patientin schon vor ihrer Rollenspiel-Abhängigkeit fragile Identitätsgrenzen hatte. Je länger sie im Laufe der stationären Behandlung Abstand vom Internet gewann und je häufiger unmittelbare Kontakte mit realen Menschen zustande kamen, umso mehr fielen die Masken. So stellte sie sich als erste Patientin in der »Sprechstunde für Menschen mit medienassoziierten psychischen Störungen« vor. Hier überließ sie mir auch das Tagebuch, das sie während der Therapie geschrieben hatte und aus dem sie mir zu zitieren erlaubte.[6]
Das Besondere an dieser Krankengeschichte war, dass es bei der jungen Frau um die Abhängigkeit von einem Computerspiel ging, das nicht auf einer kommerziellen Software basierte, sondern völlig frei von mehreren hundert Personen im Internet und über sprachliche Kommunikation entwickelt und gespielt wurde. Das heißt, dass die Spielwelt ausschließlich den Phantasien der Mitspieler entsprungen war, die durch Textnachrichten über Internetforen, Chats und E-Mails miteinander geteilt wurden. Dass ein solches Spiel, das nur auf textbasierter Kommunikation beruht, so abhängig machen kann, fasziniert mich noch immer.
Heute haben wir es in den Sprechstunden für Internetabhängige vor allem mit den deutlich komplexeren, bunteren und schnelleren Online-Spielen zu tun, die mit Bild und Ton viel stärker die Sinne ansprechen und hinter denen eine riesige Industrie steht. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen an Internetabhängigkeit erkranken.
1.1 Die Entdeckung der Internetabhängigkeit
Bahnbrechende Entdeckungen kommen oft nicht auf geradem Wege zustande. Die Entdeckung der Internetabhängigkeit ist eine besonders ungewöhnliche Geschichte. Sie ereignete sich ebenso zufällig wie unfreiwillig.
Mit seinem grauen Bart und seiner dicken Hornbrille sah der heute über 80 Jahre alte Arzt Ivan Goldberg schon im Jahre 1987 so aus, wie man sich einen klassischen Psychiater vorstellt. Der Mann war seiner Zeit weit voraus, ohne sich dessen bewusst zu sein. 1986 hatte er ein beliebtes Internetforum für Psychiater und Psychotherapeuten gegründet, in dem sie sich miteinander über ihre Arbeit austauschen konnten. Die Resonanz war groß. Zum Spaß präsentierte Dr. Goldberg seinen Kollegen ein Jahr später die Liste von Symptomen eines neuartigen Krankheitsbildes. Er bezeichnete es als »Internet Addiction Disorder«, zu Deutsch »Internetabhängigkeitsstörung«.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die digitale Revolution in den USA zwar längst an Fahrt aufgenommen. Und doch war Goldbergs Überraschung groß, als sich etliche Kollegen bei dem Psychiater meldeten, weil sie meinten, tatsächlich unter einer solchen Internetabhängigkeit zu leiden und Hilfe zu benötigen. Da er dies nicht glauben konnte, ging er mit seinem ursprünglich scherzhaft gemeinten Experiment noch einen Schritt weiter. Er gründete eine Online-Selbsthilfegruppe für Internetabhängige, für die sich bald Hunderte von Betroffenen anmeldeten.
Soweit bekannt, ist Ivan Goldberg bis heute skeptisch geblieben, ob Internetabhängigkeit überhaupt als eine ernstzunehmende Erkrankung zu verstehen ist. Die Geister, die er rief, ist er allerdings nicht mehr losgeworden. Sein Name und das Jahr 1987 sind untrennbar mit der Entdeckung der Internetabhängigkeit verbunden. In jedem Fall hat Goldberg damals einen Nerv getroffen, und mehr als ein Vierteljahrhundert später sind die negativen Folgen individueller und kollektiver Internetabhängigkeit nicht nur in den USA, sondern rund um den Globus unübersehbar.
Die wissenschaftliche Pionierin auf dem Gebiet der Internetabhängigkeit ist ebenfalls US-Amerikanerin. Kimberly Young etablierte zunächst die Bezeichnung »Pathologische Internetnutzung« (Pathological Internet Use), weil man sich anfangs noch nicht sicher sein konnte, ob es sich wirklich um eine Abhängigkeitserkrankung handelte.
Kimberly Young war es auch, die 1995 das weltweit erste Zentrum zur Behandlung von Internetabhängigkeit gründete, das »Internet Addiction Treatment and Recovery Center« am Bradford Regional Medical Center in Pennsylvania.[7] Mit viel Engagement, Erfahrung und eigener Forschungstätigkeit wurde sie mit ihren Publikationen zur Wegbereiterin dafür, dass sich die Experten heute weltweit weitgehend darüber einig sind, es mit einem eigenständigen Krankheitsbild im Sinne einer Sucht zu tun zu haben.
Wenn Ärzte und klinische Psychologen die Diagnose einer Abhängigkeitserkrankung stellen, richten sie sich weniger danach, wie viel von dem betreffenden Suchtmittel konsumiert wird, sondern vielmehr nach Kriterien, die von internationalen Expertenteams und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten ausgearbeitet worden sind. In der Regel muss dabei eine bestimmte Anzahl von Symptomen vorliegen, um eine Diagnose stellen zu können.[8]
Kimberly Young war es, die 1996 die ersten fundierten Kriterien zur Diagnosestellung von Internetabhängigkeit formulierte. Sie orientierte sich dabei an den Kriterien für Glücksspielsucht, die wiederum auf diejenigen für Alkoholsucht zurückgehen.[9]
Kriterien für Internetabhängigkeit gemäß Kimberly Young, 1996
Zur Diagnose einer Internetabhängigkeit müssen mindestens fünf der acht folgenden Kriterien erfüllt sein:
Ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Internet (Gedanken an vorherige Online-Aktivitäten oder Antizipation zukünftiger Online-Aktivitäten).
Zwangsläufige Ausdehnung der im Internet verbrachten Zeiträume, um noch eine Befriedigung zu erlangen.
Erfolglose Versuche, den Internetgebrauch zu kontrollieren, einzuschränken oder zu stoppen.
Ruhelosigkeit, Launenhaftigkeit, Depressivität oder Reizbarkeit, wenn versucht wird, den Internetgebrauch zu reduzieren oder zu stoppen.
Längere Aufenthaltszeiten im Internet als ursprünglich intendiert.
Aufs-Spiel-Setzen oder Riskieren einer engen Beziehung, einer Arbeitsstelle oder eines beruflichen Angebots wegen des Internets.
Belügen von Familienmitgliedern, Therapeuten oder anderen, um das Ausmaß und die Verstrickung mit dem Internet zu verbergen.
Internetgebrauch als ein Weg, Problemen auszuweichen oder dysphorische Stimmungen zu erleichtern (z.B. Hilflosigkeit, Schuld, Angst, Depression).
Die Young-Kriterien haben sich in der Diagnostik von Internetabhängigkeit weltweit etabliert. Sie bildeten den Ausgangspunkt für viele weitere Versuche, das Krankheitsbild möglichst treffend zu charakterisieren und damit eine relativ große Sicherheit für die Diagnosestellung zu liefern. Für Menschen, die ausschließlich von einer Abhängigkeit von Computerspielen betroffen sind, bietet das Diagnostische Statistische Manual (DSM-V) neue Kriterien, die sich in einigen wenigen Punkten von denen der allgemeinen Young-Kriterien unterscheiden.
Das US-amerikanische Diagnostische Statistische Manual, das 2013 in der fünften Auflage erschienen ist (DSM-V),[10] ist einer der einflussreichsten Kriterienkataloge für psychische Erkrankungen überhaupt. Darin werden erstmals Verhaltenssüchte wie das pathologische Glücksspiel gemeinsam mit der Alkoholsucht als Abhängigkeitserkrankungen erfasst. Internetabhängigkeit ist in diesem Kapitel jedoch noch nicht als offizielle Diagnose aufgeführt. Als Forschungsdiagnose ist die spezifische Abhängigkeit von Online-Spielen, im Englischen »Internet Gaming Disorder«, allerdings im Anhang aufgenommen worden.
Bislang ist lediglich diese Variante der Internetabhängigkeit als Forschungsdiagnose berücksichtigt, weil sie am häufigsten auftritt und am besten erforscht ist. Von einer Abhängigkeit von Online-Spielen kann dann ausgegangen werden, wenn mindestens fünf der neun beschriebenen Symptome vorliegen.[11]
Kriterien für die Abhängigkeit von Online-Spielen gemäß dem DSM-V, 2013
Für eine Diagnose müssen mindestens fünf der folgenden Fragen mit »Ja« beantwortet werden:
Sind Sie so in Ihre Online-Spielnutzung vertieft, dass Sie über frühere Internet-Aktivitäten nachdenken, Ihre nächsten kaum erwarten können und sie zur dominanten Aktivität des täglichen Lebens werden?
Leiden Sie unter Entzugssymptomen, wenn Sie nicht zum Spielen ins Internet gehen können?
Ist der Bedarf gestiegen, die Zeiträume der Online-Spielaktivität zunehmend auszudehnen?
Haben Sie schon erfolglos versucht, Ihre Online-Spielnutzung zu kontrollieren?
Besteht wegen Ihrer Nutzung von Online-Spielen ein Interessenverlust an früheren Hobbys und Aktivitäten?
Setzen Sie Ihr exzessives Online-Spielen fort, obwohl Ihnen die daraus resultierenden psychischen und sozialen Probleme bewusst sind?
Haben Sie schon Familienmitglieder, Therapeuten oder andere Menschen in Ihrem Umfeld über das Ausmaß Ihrer Online-Spielnutzung getäuscht?
Gebrauchen Sie Online-Spiele, um negativen Stimmungen – z.B. Gefühlen von Hilflosigkeit, Schuld oder Angst – zu entkommen oder sie zu lindern?
Haben Sie wegen Ihrer exzessiven Online-Spielnutzung schon einmal eine bedeutsame Beziehung, eine Arbeitsstelle, eine Bildungs- oder Karrierechance gefährdet oder verloren?
Die neun Fragen decken die entscheidenden Symptombereiche dieser häufigen Variante von Internetabhängigkeit ab. Der DSM-V sieht vor, dass eine Diagnose nur für exzessive Nutzer von Online-Spielen gestellt werden kann, und dies nur dann, wenn fünf oder mehr Symptome vorliegen.[12]
Die ersten vier Fragen zielen auf das eigentliche Suchtverhalten ab. Die letzten fünf Fragen gehen auf die negativen Folgen ein. So ist gesichert, dass eine Internetabhängigkeit nur dann festgestellt werden kann, wenn mindestens ein Lebensbereich von den Folgen der Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen ist. Dies entspricht dem Vorgehen bei der Abhängigkeit von Suchtstoffen wie Alkohol oder Kokain.
Werden weniger als fünf Fragen bejaht, kann zumindest ein Internetmissbrauch vorliegen. Eine Behandlung kann dann wichtig sein, insbesondere, wenn die Betroffenen noch unter anderen psychischen Erkrankungen leiden.
In einem solchen Fall kann der Einsatz ausführlicherer psychologischer Tests hilfreich sein, mit denen das Ausmaß der Abhängigkeit ermitteln kann. Anhand von Grenzwerten bekommt man einen Eindruck, ob die Testergebnisse der Untersuchten im Bereich eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit liegen.
Auch hierbei war es Kimberly Young, die den ersten Fragebogen vorlegte, den sogenannten Internet-Addiction-Test (IAT). Matthias Brand, Psychologie-Professor an der Universität Duisburg-Essen, der sich ebenfalls mit der Erforschung von Internetabhängigkeit einen Namen gemacht hat, entwickelte gemeinsam mit Kimberly Young anhand einer großen allgemeinen Stichprobe von Probanden eine Kurzversion des Fragebogens, eine deutsche Short Version namens sIAT.[13]
In Kooperation mit Prof. Brand und seinem Team wird dieses Testinstrument gerade in unserer Klinik an einer Gruppe von internetabhängigen Patienten einer Validierung unterzogen. Es gibt mittlerweile eine handvoll gut validierter Fragebögen, die zum Teil unterschiedliche Varianten der Internetabhängigkeit und Altersgruppen berücksichtigen. Die Entwicklung und Erprobung solcher psychologischer Instrumente ist für Forschung und Praxis gleichermaßen wichtig, um die Qualität der Diagnosestellung weiter zu verbessern. Bis zu einer umfassenden Anerkennung der Internetabhängigkeit als eigenständiges Störungsbild ist noch viel zu klären.[14]
Wenig Einigkeit herrscht beispielsweise noch im Hinblick auf die Frage, wie lange die Symptomatik schon bestanden haben muss, bevor eine sichere Diagnose gestellt werden kann. Der DSM-V sieht dafür einen ausgesprochen langen Zeitraum von mindestens 12 Monaten vor. Der Fachverband Medienabhängigkeit dagegen empfiehlt, bereits ab einem Zeitraum von drei Monaten kontinuierlich bestehender Symptomatik eine Diagnose zu stellen.[15]
Wenngleich sich bislang die meisten Internetabhängigen bedauerlicherweise häufig erst nach einer sehr langen Leidenszeit bei uns vorstellen, kann in Einzelfällen aber schon deutlich früher von einer Internetabhängigkeit ausgegangen werden. Im Grunde kann sie sich auch innerhalb von wenigen Wochen in einem Ausmaß entwickeln, dass an ihrem Vorliegen aus klinischer Sicht kein Zweifel besteht. Das Problem ist momentan ja auch nicht, dass sich die Betroffenen zu früh vorstellen, sondern dass sie es viel zu spät oder gar nicht tun. Je früher sich die Betroffenen aber behandeln lassen, desto besser ist die Prognose. In jedem Fall ist eine sorgfältige Diagnosestellung der Ausgangspunkt für eine gute Behandlung. Und ohne Diagnose gibt es keine Therapie.
Damit die Anzeichen einer Abhängigkeitsentwicklung frühzeitig erkannt werden können, werden im Folgenden die charakteristischen Symptome einer Abhängigkeit anhand von Beispielen ausführlich erläutert. Man unterscheidet sinnvollerweise zwischen den Symptomen des eigentlichen Suchtverhaltens und den typischen Folgen der Internetabhängigkeit.
1.2 Suchtverhalten: von gedanklicher Einengung bis zur Überdosis
Einmal stellte sich ein verzweifeltes Elternpaar in unserer Sprechstunde vor. Sie fühlten sich völlig hilflos, weil ihr erwachsener Sohn ins Internet abgeglitten war. Der 20-Jährige lebte noch in der elterlichen Wohnung, nachdem er zwei Jahre zuvor die Schule abgebrochen hatte. Nun verließ er kaum mehr das Zimmer und war auch nicht bereit, sich in unserer Ambulanz vorzustellen. Wir berieten die Eltern im Sinne einer systemischen Familientherapie. Dadurch waren sie wieder in der Lage, im Umgang mit dem Sohn an einem Strang zu ziehen und ihm Grenzen aufzuzeigen. Schließlich erklärte er sich dazu bereit, sich bei uns selbst vorzustellen.
In den ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass der junge Mann seit etwa zwei Jahren dem Online-Rollenspiel »World of Warcraft« verfallen war. Er berichtete, dass er von dem Spiel derart fasziniert gewesen sei, dass er innerhalb weniger Wochen voll und ganz darin aufgegangen war. Nach dem Schulabbruch und einem gescheiterten Arbeitsversuch habe er nichts anderes zu tun gehabt. Außerdem habe er darin die Anerkennung gefunden, die er in der realen Welt nicht erhalten habe. In seinem Spielrausch habe er völlig die Kontrolle über sein Leben verloren. Meist habe er von zwei Uhr mittags bis sechs Uhr morgens durchgespielt, sodass sich sein Tag-Nacht-Rhythmus völlig umgekehrt habe. Bald habe er an nichts anderes mehr denken können und das Zimmer nur verlassen, um sich in der Küche etwas zu essen zu holen oder um auf die Toilette zu gehen. Zu dem Zeitpunkt, als er sich bei mir vorstellte, hatte er noch niemals versucht, seinen Internetkonsum zu reduzieren oder das Spiel ganz aufzugeben. Deshalb hatte er auch noch keinerlei Erfahrung mit dem Entzug und wusste folglich nicht, wie sich Entzugserscheinungen zeigen.
Es brauchte mehrere Monate, um ihn davon zu überzeugen, sich stationär in unserer Klinik behandeln zu lassen. Dies hielt er jedoch nur eine Nacht lang aus. Als er die Station am nächsten Morgen fluchtartig verließ, begegnete ich ihm auf dem Flur. Den Anblick seiner angsterfüllten Augen werde ich nicht vergessen. Ich sah die typische Panik eines Menschen, der auf Entzug ist. Es brauchte dann noch mehr als ein Jahr an ambulanter Einzeltherapie, bis er sich erneut dazu entschließen konnte, dem Spiel voll und ganz den Rücken zu kehren und sich von seiner Fixierung auf das Internet zu lösen.
Menschen, die schon einmal von Nikotin oder Alkohol abhängig waren, kennen den unwiderstehlichen Drang nach dem Suchtmittel. Der abhängige Raucher hat zum Beispiel gedanklich stets im Kopf, wann die nächste Zigarettenpause eingelegt werden kann. Auch der Alkoholabhängige richtet seinen Tagesablauf danach aus, dass die Konzentration des Suchtmittels im Blut nicht unter einen bestimmten Spiegel sinkt.
Der Süchtige ist in Gedanken und in der konkreten Wirklichkeit immer möglichst nah bei seinem Stoff, um nicht auf Entzug zu kommen. Aus der Perspektive der Abhängigkeit folgt das einer zwingenden Logik. Die Sucht ist wie ein gefräßiges Tier, das regelmäßig gefüttert werden muss, um nicht gefährlich zu werden. Das ist bei den Internetabhängigen nicht anders. Einem Außenstehenden mag das wie eine fixe Idee vorkommen. Die ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Internet, auch und gerade wenn man nicht online ist, ist in der Tat ein charakteristisches Symptom, wenn es darum geht, eine Diagnose zu stellen.
Wenn Internetabhängige zu uns kommen, um sich auf eine Internetabhängigkeit untersuchen zu lassen, fragen wir, ob sie im Wartezimmer über das Internet nachgedacht haben. Meist denken sie über das nach, was sie dort zuletzt getan haben oder was sie als Nächstes im Internet tun werden. Sie empfinden es als eine Art innerliche Nach- und Vorbereitung ihrer digitalen Lieblingsbeschäftigungen.
Aus der medizinischen Perspektive sind dies die typischen Zeichen eines Suchtverhaltens. Das Denken ist in Beschlag genommen von der Sucht und steht im Dienste der kontinuierlichen und regelmäßigen Beschaffung des Suchtmittels. Der Internetabhängige hat sklavisch stets im Blick, wann, wo und wie er möglichst ohne Unterbrechungen mit dem Internet verbunden bleiben kann. Deswegen fällt es ihm oder ihr im fortgeschrittenen Stadium so schwer, überhaupt das Haus zu verlassen.
Das hat Folgen für den Alltag der Betroffenen. Dies gilt auch für Cybersexsüchtige, die es ständig nach neuen pornografischen Kicks verlangt. Die permanente Beschäftigung mit dem Suchtmittel kann einem gelingenden Alltagsleben massiv im Wege stehen. Wie soll man sich in einem Zustand permanenter körperlicher Erregung auf etwas konzentrieren können? Wenn man wie besessen ständig darüber nachdenkt, wie, wann und wo man wieder eine Situation herstellen kann, in der man allein vor einem Computer sitzt? Gerade die Heimlichtuerei, die unbedingte Notwendigkeit, das Suchtverhalten vor Arbeitgeber und Ehefrau zu verstecken, kann für die Betroffenen zu enormem Stress führen. Die gedankliche Einengung auf das Suchtmittel kann dann in einem nächsten Schritt eine grobe Vernachlässigung der beruflichen und zwischenmenschlichen Verpflichtungen nach sich ziehen. Der Internetabhängige ist in Gedanken immer woanders. Dies gilt für Cybersex genauso wie für Online-Spiele und soziale Netzwerke.
Die Steigerung der Dosis und der Verlust der Kontrolle über das Suchtmittel gehören zu jeder Abhängigkeitserkrankung dazu. Ohne sich dem widersetzen zu können, braucht der Abhängige immer mehr von dem, was ihn kurzfristig beruhigt und langfristig kaputtmacht. Dies gilt ebenso für digitale Medien.
In geringerem Ausmaß kann das eigentlich jeder nachempfinden. Wer hat noch nicht einmal völlig den Überblick über die im Internet verbrachte Zeit verloren? Man will eigentlich nur eben seine E-Mails bearbeiten oder etwas im Internet recherchieren, lässt sich aber immer wieder auf andere Internetseiten locken. Man nimmt sich noch vor, dass um zehn Uhr abends endgültig Schluss sei, und sitzt um Mitternacht immer noch vor dem Rechner.
Ein solcher Exzess kann natürlich etwas mit einem ureigenen Interesse zu tun haben, das uns ursprünglich an den Rechner gezogen hat, und muss nicht unbedingt rauschhaft, sondern kann auch einfach nur schön und spannend sein. Aber eine Ahnung davon, wie einen das Internet über die Maßen in seinen Bann schlagen kann, hat wohl jeder.
Ein Suchtpotenzial bergen in erster Linie Internetseiten, auf denen es um Computerspiele, Sex und soziale Netzwerke geht. Dies sind die Seiten, die auch in der Allgemeinbevölkerung besonders erfolgreich sind und dafür sorgen, dass sich die durchschnittliche Tagesdosis Internet pro Kopf Jahr für Jahr steigert.
Die Dosissteigerung ist ein wichtiges Symptom, mit dessen Hilfe man eine Internetabhängigkeit diagnostizieren kann. Die Internetabhängigen verbringen immer mehr Zeit im Internet, um noch eine Befriedigung zu erlangen. Die digitalen Suchtmittel sprechen das Belohnungssystem auf unterschiedliche Weise an (siehe Kapitel 2). Die Suche nach noch mehr Erfolg im Spiel, nach einem noch größeren sexuellen Kick oder nach noch mehr virtuellen Freunden wird in der Suchtentwicklung zum Selbstzweck. Das Tragische an der Sucht ist stets, dass diese Suche nie wirklich zu einem Ziel führt. Die unendlichen Weiten des Cyberspace verführen uns mit dem Versprechen einer grenzenlosen Befriedigung unserer Bedürfnisse, ohne dieses Versprechen wirklich je einzulösen.
Die Dosissteigerung hat allerdings ihre zeitlichen Grenzen. Wenngleich der Tag-Nacht-Rhythmus bei ihnen häufig aufgehoben ist, hat auch bei Internetabhängigen der Tag nur 24 Stunden. Wenn sie aber durch ihre Abhängigkeit schon keiner geregelten Tätigkeit in Schule, Ausbildung oder Beruf mehr nachgehen, liegt die Grenze ungefähr bei 16 Stunden Internetnutzungszeit. Manche Patienten berichten auch davon, dass sie ähnlich wie beim »Komasaufen« bisweilen mit dem Leben kaum noch vereinbare Internetexzesse ausleben. Da wir langfristig aber nicht auf Schlaf verzichten und uns bei der Überschreitung dieser Grenze sogar in Lebensgefahr bringen können, sind 16 Stunden in der Regel die Höchstdosis. Es kommt nicht selten vor, dass diese von Patienten in unseren Spezialambulanzen tatsächlich erreicht wird.
Der Kontrollverlust ist ein weiteres wichtiges Symptom zur Diagnosestellung einer Abhängigkeitserkrankung. Selbst wenn sie es sich vornehmen würden, können Internetabhängige ihre Online-Zeiten nicht auf ein gesundes Maß reduzieren. Nicht selten versuchen sie ihr Umfeld glauben zu lassen, dass sie es könnten, wenn sie es wollten. Sie glauben es manchmal sogar selbst. In Wirklichkeit ist dies aber eine Schutzbehauptung. Sie dient einzig und allein dazu, die eigene Sucht nicht erkennen und einräumen zu müssen.
Die Angst des Abhängigen davor, sein Suchtmittel zu verlieren, ist immer groß. Sie führt nicht selten dazu, dass der Süchtige sich selbst und sein Umfeld belügt. Dies ist in aller Regel ein weiteres Zeichen für den so typischen Verlust der Kontrolle über die Internetnutzung. Das Symptom des Kontrollverlusts könnte man aber genauso gut auf das Leben in der konkret-realen Welt beziehen. Wer die meiste Zeit in der virtuellen Welt verbringt, hat in der Regel jegliche Kontrolle über sein wirkliches Leben verloren.
Manche Menschen, die ihre gesamte Wachzeit im Cyberspace verbringen, erklären, dass dies genau das sei, was sie tun wollen und wie sie leben möchten. Wenn es kaum Druck von ihrer Umwelt gibt, zum Beispiel von Arbeitsämtern, Eltern, Partnerinnen oder Partnern, dann besteht für sie unter Umständen gar keine Notwendigkeit, etwas an ihrer Situation zu ändern. Sie geben auch an, dass sich die Zeiträume, die sie im Internet verbracht haben, nach relativ kurzer Zeit so weit ausgedehnt haben, dass gar keine Steigerung mehr möglich sei. Wenn sie aber selbst überhaupt kein Problembewusstsein für ihre Sucht haben und dementsprechend keinen Versuch unternommen haben, ihren Internetkonsum zu begrenzen, sind es nicht selten die Angehörigen, die den Kontrollverlust schmerzhaft zu spüren bekommen. Vergeblich versuchen sie, die betroffenen Kinder, Partner oder Freunde von ihren Rechnern wegzulocken. Ihre Beobachtungen sind in solchen Fällen für eine realistische diagnostische Einschätzung wichtig und hilfreich.
Jeder kennt das: Man hat morgens sein Mobiltelefon zu Hause vergessen und ist den ganzen Tag über nervös. Wir verhalten uns gegenüber unseren elektronischen Spielzeugen so, als wären sie überlebensnotwendig. Nicht ständig über die Hosen- oder Handtasche mit dem Internet verbunden zu sein könnte befreiend sein, für die meisten von uns ist es aber kaum auszuhalten. Man könnte ja schließlich etwas verpassen und fühlt sich wie abgeschnitten von der Welt.
Dabei kann es so erleichternd sein, einmal versehentlich ohne jegliches elektronisches Spielzeug aus dem Haus zu gehen, ganz unabhängig zu sein von all den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Eine solche Situation liefert die ideale Vorlage dafür, einmal für einen Moment innezuhalten.
Ruhe aber scheint immer mehr Menschen zu beunruhigen. Viele werden schon nervös, wenn sie nicht ununterbrochen auf einem Gerät herumtippen können, wenn sie in einem Wartezimmer einer Arztpraxis, auf dem Beifahrersitz eines Autos oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzen. Einfach mal abschalten und hierfür alle Geräte ausschalten, wer kann das überhaupt noch? Insofern können wir alle zumindest ansatzweise nachvollziehen, was es heißt, auf Medienentzug zu sein.
Für Menschen, die unter einer Internetabhängigkeit im engeren Sinne leiden, kann ein Entzug allerdings mit weitaus heftigeren Entzugserscheinungen als Nervosität und schlechter Laune einhergehen. Allein der Gedanke an eine Internetabstinenz kann die Betroffenen in blanke Panik versetzen. Tatsächlich ist bei einem kalten Entzug vom Internet mit ausgeprägten emotionalen Krisen zu rechnen. Auf die eine oder andere Art und Weise spielen dann bei den meisten die Gefühle verrückt. Neben der Angst können vor allem Gefühle von tiefer Traurigkeit und unbändiger Wut Anlass zur Sorge geben. Die einen reagieren eher depressiv, die anderen eher aggressiv. Panik oder zumindest eine ausgeprägte Nervosität erleben im Grunde alle. Eine solche Ängstlichkeit kann auch mit körperlichen Symptomen wie beschleunigter Atmung, Herzrasen, Bluthochdruck und Schwitzen einhergehen. Diese Symptome kommen denen eines körperlichen Entzugs von einem Suchtstoff doch recht nahe.
Manche Patienten laufen in dieser Phase auch Gefahr, besonders viele Zigaretten zu rauchen oder Alkohol im Übermaß zu trinken, weil sie keine andere Möglichkeit finden, sich zu beruhigen.
Wenn die Betroffenen mit dem Verlust des digitalen Suchtmittels völlig den seelischen Halt verlieren und ins Bodenlose zu fallen drohen, kann es gefährlich werden. Dann sind die Entzugserscheinungen so intensiv, dass es zu existenziell bedrohlichen Impulsdurchbrüchen kommen kann.
Akute Zuspitzungen im Entzug erleben wir in den Spezialambulanzen nicht selten. Beispielsweise mussten wir einmal einen jungen Internetabhängigen auf eine psychiatrische Station aufnehmen, weil er im Entzug in suizidaler Absicht versucht hatte, vor ein Auto zu laufen. Nur mit Mühe konnte er von Passanten davon abgehalten werden. Ebenso freiwillig, wie er gemeinsam mit seinem Vater den Computer aus seinem Zimmer entfernt hatte, um nicht mehr spielen zu können, begab er sich notfallmäßig zu seinem eigenen Schutz und aus freien Stücken in stationäre Behandlung.
Einen anderen jungen Mann nahm ich per Betreuungsbeschluss gegen seinen Willen auf eine geschlossene psychiatrische Station auf. Er hatte seine Mutter angegriffen und bedroht, nachdem sie ihm den Internetzugang gesperrt hatte. Als damaliger Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes musste ich mir vor Ort über die Gefahrensituation selbst ein Bild machen, um für das Amtsgericht eine ärztliche Stellungnahme formulieren zu können.
Dramatisch war auch der Fall eines Jugendlichen, der mit einem Gerichtsbeschluss notfallmäßig zur Zwangsbehandlung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht wurde, weil er seinen Stiefvater angegriffen hatte. Aus Verzweiflung und Wut darüber, dass sich der 17-Jährige nicht behandeln lassen wollte, hatte er die Kabel seines Rechners durchgeschnitten. Daraufhin hatte ihn der Jugendliche gewürgt.
Gerade in einem unfreiwilligen Entzug können Internetabhängige für sich und andere zur Gefahr werden.[16] Im schlimmsten Fall kann dies fatal ausgehen. Dass es sogar zum Totschlag und zur Selbsttötung kommen kann, zeigen zwei Beispiele, die weltweit für Aufsehen gesorgt haben.
Daniel P. aus Ohio war 16 Jahre alt, als er mit einem Jetski verunglückte.[17] Aufgrund von Komplikationen verzögerte sich die Heilung seiner Verletzungen, so dass er lange Zeit nicht zur Schule gehen konnte und zu Hause bleiben musste. Hier spielte er stundenlang »Halo«, ein damals in den USA enorm erfolgreiches Shooter-Spiel, was seine Eltern aber aus religiösen Gründen ablehnten. Trotzdem gelang es ihm, heimlich bis zu 18 Stunden ununterbrochen zu spielen. Er war davon abhängig geworden.
Als ihn seine Eltern dabei erwischten, nahmen sie ihm das Spiel weg. Wenig später, am 20. Oktober 2009, trat Daniel von hinten an seine Eltern heran und sagte: »Würdet ihr die Augen schließen, ich habe eine Überraschung für euch.« Mit der Handfeuerwaffe seines Vaters schoss er erst diesem und dann der Mutter in den Kopf. Die Mutter starb, der Vater überlebte schwerverletzt. In einem aufsehenerregenden Prozess erhielt der mittlerweile 17-Jährige eine lebenslange Haftstrafe.
Der 13-jährige Xiao Y. aus der chinesischen Provinz Tianjin war ein guter Schüler, bis er damit begann, exzessiv Online-Rollenspiele zu spielen.[18] Seine Eltern fühlten und verhielten sich hilflos gegenüber seiner Internetabhängigkeit. Der Vater sagte: »Seine Mutter und ich machten uns Sorgen um ihn. Aber wir wussten nur wenig über das Internet und wussten nicht, wie wir ihn hätten retten sollen.« Manchmal sei der Junge über Nacht verschwunden, um stundenlang in Internetcafés zu spielen. Als ihn der Vater im Mai 2005 das letzte Mal aus einer solchen Spielhölle abholte, habe der Junge unter Tränen zugegeben, dass er von den Spielen »vergiftet« worden sei und sich nicht mehr unter Kontrolle habe. Wenig später sprang Xiao von einem 24-stöckigen Hochhaus in den Tod. In seinem Abschiedsbrief äußerte er die Hoffnung, dass er das Spiel im Paradies mit seinen drei Freunden weiterspielen könne.
Derartig extreme Krankheitsverläufe sind keine Einzelfälle, aber erfreulicherweise bislang noch selten. Wirklich wundern dürften sie uns nicht mehr, zumal auch bei stoffgebundenen Suchterkrankungen die Eigen- und Fremdgefährdung im Entzug deutlich erhöht ist. Ähnlich wie ein Alkoholentzug körperlich lebensbedrohlich sein kann, kann ein Internetentzug Menschen aufgrund seelischer Not in Lebensgefahr bringen.
Tödliche Überdosis aufgrund seelischer Not
Dass Internetabhängigkeit eine ernstzunehmende Suchterkrankung darstellt, zeigt sich an einer weiteren lebensgefährlichen Komplikation. Ich konnte es zunächst selbst kaum fassen, dass es wie bei einer Überdosis von Suchtmitteln wie Alkohol oder Heroin tatsächlich zu Todesfällen kommen kann. Es ist traurig, aber wahr: Den goldenen Schuss gibt es auch bei der Internetabhängigkeit. Allein in Südkorea, dem Land, in dem Internetabhängigkeit als Erstes zu einem gravierenden Massenphänomen wurde, sind mindestens zehn Personen an den körperlichen Folgen einer Internetabhängigkeit verstorben (siehe hierzu Kapitel 2). – Wie ist das zu verstehen?
Manche Menschen werden so abhängig vom Internet – und hier geht es bislang ausschließlich um Online-Spiele –, dass sie überhaupt nicht mehr damit aufhören können. Manche vernachlässigen dabei so lange ihre lebensnotwendigen körperlichen Bedürfnisse, bis sie vor dem Rechner zusammenbrechen. Harmlos – wenn auch ziemlich abstoßend – ist es, wenn sich besonders schwer Betroffene einen Eimer unter den Schreibtisch stellen oder einen Katheter legen, um das Spiel für einen Toilettengang nicht unterbrechen zu müssen.
Gefährlich wird es, wenn Internetabhängige nicht mehr essen, trinken und schlafen. Manche putschen sich mit Kaffee, Cola oder Energydrinks und zum Teil auch mit Medikamenten und synthetischen Drogen auf, um stundenlang wach bleiben zu können. Dies geht bisweilen mehr als 24 Stunden, manchmal sogar mehr als 48 Stunden so. In diesem Zusammenhang spricht man in Analogie zu den sich mehrenden Alkoholexzessen von Jugendlichen auch von »Binge-Gaming« (Komaspielen).
Im Jahr 2005 beispielsweise brach in Südkorea ein 28-Jähriger tot zusammen, nachdem er in einem Internetcafé 50 Stunden am Stück ohne Essen, Trinken und Schlafen gespielt hatte.[19] Nach einem solchen Zeitraum ist es kein Wunder, dass der Kreislauf irgendwann zusammenbricht.
Da Todesfälle im Zusammenhang mit exzessiver Internetnutzung bislang noch selten sind, gibt es hierzu keine Forschungsergebnisse. Was man aber weiß, ist, dass der Mensch in der Regel nach mehr als drei Wochen ohne Nahrung, nach etwa zehn Tagen ohne Schlaf und nach drei Tagen ohne Flüssigkeit an einem Herz-Kreislauf-Versagen stirbt. Wenn Nahrung, Schlaf und Flüssigkeit gleichzeitig fehlen, können sich die Zeiträume bis zu einem lebensgefährlichen Zustand deutlich verkürzen. Die Verläufe sind dann sehr individuell.
Bei den dokumentierten Todesfällen unter Internetabhängigen dürfte es sich zumeist um einen Kreislaufstillstand aufgrund von Flüssigkeitsmangel gehandelt haben. Die übermäßige Zufuhr von koffeinhaltigen Getränken und der dadurch künstlich hervorgerufene Schlafmangel können lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen hervorrufen. Zudem gab es Todesfälle, bei denen es wegen des Bewegungsmangels zu Thrombosen in den Beinvenen gekommen war, die wiederum zu tödlichen Lungenembolien führten.
Während die Todesopfer von Internetabhängigkeit in ihren Online-Aktivitäten psychisch ständig in Bewegung waren, kam ihre körperliche Existenz zum ultimativen Stillstand: keine Bewegung, kein Herzschlag, kein Blutfluss, bis nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Ihre Körper dienten dazu, über Augen, Ohren und Hände eine Verbindung zum Computer und damit zum Internet herzustellen. Der Rest des Körpers wurde nur noch als Ballast wahrgenommen und vollkommen vernachlässigt.
Es mag wie eine Binsenweisheit klingen, aber wir Menschen können eben nicht ohne unseren Körper leben. Er ist und bleibt unsere physische Basisstation. Internetabhängige, die ihren Körper völlig vernachlässigen, betreiben eine Extremvariante von Weltflucht.
Wenn in den asiatischen Internetcafés wieder einmal ein Mensch vor einem Computer zusammenbricht, läuft der Betrieb in der Regel erst einmal ungestört weiter. Vor dem Computer einzuschlafen ist dort nichts Ungewöhnliches. Nur so lässt sich erklären, warum der Tod eines 23-jährigen exzessiven Online-Rollenspielers in einem taiwanesischen Internetcafé ungefähr neun Stunden lang unbemerkt blieb.[20]