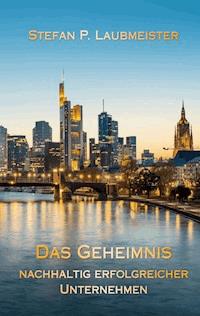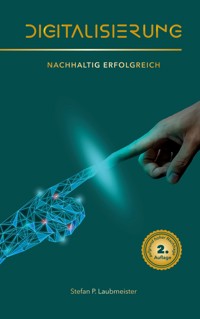
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die digitale Transformation ist definiert als ein Prozess der stetigen Weiterentwicklung digitaler Technologien, welche unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig prägen. Es entstehen neue Gewohnheiten und Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die digitale Transformation reicht somit weiter als die Automatisierung und Flexibilisierung bestehender Geschäftsprozesse. Digitalisierung verändert Wertschöpfungskette und Strukturen sowohl von Unternehmen als auch in der gesamten Gesellschaft grundlegend. Angesichts dieser radikalen Veränderungen bei Technologien, Kundenanforderungen und einer neuen Wertschöpfungslogik müssen Unternehmen ihre Chancen im digitalen Wandel erkennen und ergreifen, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Denn nur wer die digitale Transformation im eigenen Unternehmen jetzt nachhaltig vorantreibt, kann auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben. Doch was bedeutet das für Unternehmen konkret? Dieses Buch beleuchtet Erfolgsfaktoren des digitalen Wandels und zeigt auf, wie dieser nachhaltig erfolgreich gestaltet werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
2. Auflage
Alle Rechte vorbehalten: Stefan Laubmeister in 2023
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Agile Führungsqualitäte
1.1. Risiken für Beziehungen
1.2. Lob wem Lob gebührt – von Wertschätzung und Kritik!
1.3. Der Schlüssel zur erfolgreichen Führung
2. Agile Grundprinzipien
2.1. Die 4 Leitsätze des Agilen Manifests
2.2. Die 12 agilen Prinzipien
3. Agile Methoden
3.1. Änderungen meistern
3.2. Agile vs. klassische Methoden
3.3. Agile Methoden und ihre Eignungen
3.4. Fazit agiler Methoden
4. Agile Organisationsstrukturen
5. Agile Werte
5.1. Individuen und Interaktionen – mit Prozessen und Werkzeugen
5.2. Funktionierende Software – mit aufwändiger Dokumentation
5.3. Zusammenarbeit mit dem Kunden – mit Vertragsverhandlungen
5.4. Offen für Änderungen – Plänen folgen
5.5. Agile Prinzipien
5.6. Vom Wasserfall zur Agilität
5.6.1. Die agile Evolution
5.6.2. Definierte und empirische Modelle
5.6.3. Inspiration und Anpassungen
5.6.4. Das magische Dreieck der Beschränkungen
6. Augmented Reality
7. Blockchain und DLT
8. Change Management – Dimensionen des Widerstands
9. Design Thinking
10. Digitale Geschäftsmodelle
11. Digitalstrategie – der Traum vom langfristigen Florieren in der digitalen Welt
11.1. Von wo nach wo?
11.2. Strategie und Taktik
11.3. Zentrale Konflikte
11.4. „Allem Neuen wohnt ein Zauber inne“
11.5. Fazit
12. Fachkräftemangel und Humankapital
13. KANBAN
14. Künstliche Intelligenz
15. Robotik Process Automation
15.1. Merkmale der RPA
15.2. Ursprünge der RPA
15.3. RPA-Visionen
15.4. Vergleich Prozessautomation vs. RPA
15.5. Voraussetzungen für RPA
15.6. Automationsgrade
15.7. Anwendungsbeispiele für RPA
15.8. Vor- und Nachteile
15.9. Implementierung von RPA
16. SCRUM
16.1. Wie funktioniert SCRUM
16.2. Vor- und Nachteile von SCRUM
17. SCRUMBAN
17.1. Vor- und Nachteile von SCRUMBAN
17.2. Scrumban vs. Scrum vs. Kanban
18. VUKA-Logik
18.1. Herausforderungen für die Arbeitswelt
18.2. Die Antwort auf VUKA heißt VUCA
Über den Autor
Stefan Peter Laubmeister, geboren 1966, beendete nach der 11.Klasse das Wirtschaftsgymnasium mit dem Abschluss der Höheren Handelsschule ab und absolvierte eine Banklehre. Bald nach seiner Ausbildung spezialisierte er sich auf das Transaktionsbanking bei einer Zentralbank und studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt, das er 1994 mit Auszeichnung als „Betriebswirt VWA“ abschloss. In einer Nachwuchs-Führungsposition fand er den Einstieg in die Projektarbeit. Später war er bei internationalen Großbanken als Inhouse Consultant und Projektleiter tätig bevor er zu einem renommierten Systemhaus wechselte. 2004 wurde er im Bereich Supply-Chain-Management (SCM), also zur Gestaltung der Wertschöpfungskette, von SAP zertifiziert und erwarb 2005 mit dem „Master Personal Business Skills“ ebenfalls mit Prädikat eine zusätzliche Qualifikation, welche Managementtechniken zum Schwerpunkt hat. In 2006 folgte vom Internationalen Project Management Institute (PMI) die Ernennung zum „Project Management Professional“ (PMP) sowie Zertifizierungen in Six Sigma Lean. In 2011 folgte eine weitere Qualifikation zum Datenschutzbeauftragten, 2014 folgte die „Theorie of Constraints“. Ab 2018 folgten weitere Zertifikate zu IT-Sicherheit sowie Qualifikationen als Auditor, ab 2020 als SCRUM Master und Product Owner sowie als zertifizierter Digitalisierungsmanager.
Seit 2004 ist Stefan Laubmeister für Unternehmensberatungen tätig. Mit dem Schwerpunkt nachhaltig erfolgreiche Digitalisierung von Unternehmensstrukturen im Einklang mit der nötigen IT- und Datensicherheit sowie verschiedenen Mandaten als Datenschutz-und IT-Sicherheitsbeauftragter sorgt er direkt für die Datensicherheit in Unternehmen. Hierzu war er auch als Honorardozent aktiv. Dabei war und ist Stefan Laubmeister in unterschiedlichen Branchen aktiv, vom Mittelständler, öffentlichen KRITIS-Organisationen bis zu börsennotierten Konzernen. Weitere Informationen erhält der interessierte Leser über www.Laubmeister.de.
Einleitung
Die digitale Transformation von öffentlichen Strukturen, Unternehmen, ja sogar unserer Gesellschaft ist in aller Munde und längst mehr als nur ein Trend. Es handelt sich um eine unaufhaltsame, tiefgreifende Veränderung, so wie sie einst mit anderen Revolutionen einher ging, etwa mit der Dampfmaschine, der Elektrizität und zuletzt mit der EDV. Nun also eine digitale Revolution. Doch was geschieht da und wie?
„Digital ist, wenn das System läuft!“
Zitat eines Bankmanagers, den ich besser nicht näher nennen möchte.
Die digitale Transformation ist definiert als ein Prozess der stetigen Weiterentwicklung digitaler Technologien, welche unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig prägen. Es entstehen neue Gewohnheiten und Bedürfnisse des täglichen Lebens sowohl bei Jung und Alt, als auch im Privat- und Geschäftsleben. Beispiele der digitalen Transformation umfassen Social Media, Big Data, Cloud Services, Smart Devices, Internet of Things oder Blockchain, die unser Leben nicht nur begleiten, sondern auch beeinflussen – und verändern.
Im Zuge der digitalen Transformation ändern sich auch die Erwartungen potentieller Kunden. Somit werden Unternehmen gezwungen, bestehende Prozesse anzupassen und durch wesentlich effizientere, digitale Prozesse abzulösen. Es entstehen innovative Geschäftsmodelle (Amazon, Ebay, Uber, Spotify,…), welche neue Wünsche unserer Gesellschaft erfüllen und auch alteingesessene Geschäftsmodelle ins Wanken bringen können.
Digitale Transformation wird häufig als Synonym für Digitalisierung verwendet, sie reicht jedoch weiter als die die Automatisierung und Flexibilisierung bestehender Geschäftsprozesse. Digitalisierung verändert Wertschöpfungskette und Strukturen sowohl von Unternehmen als auch in der gesamten Gesellschaft grundlegend. Angesichts dieser radikalen Veränderungen bei Technologien, Kundenanforderungen und einer neuen Wertschöpfungslogik müssen Unternehmen ihre Chancen im digitalen Wandel erkennen und ergreifen, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Denn nur wer die digitale Transformation im eigenen Unternehmen jetzt nachhaltig vorantreibt, kann auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben. Doch was bedeutet das für Unternehmen konkret?
Bei der digitalen Transformation gilt es, einige wichtige Maßnahmen zu berücksichtigen. Werden diese erfolgreich umgesetzt, zahlt die digitale Transformation schnell und sichtbar auf den Unternehmenserfolg ein. Wie das nicht nur gelingen kann, sondern auch auf eine nachhaltig erfolgreiche Weise, dazu gibt dieses Werk sicher einige wertvolle Hinweise.
Einerseits ist es leider häufig so, dass gewisse Begriffe in falschem Kontext verwendet werden. Dann braucht es keinen wundern, wenn das Ergebnis der Veränderung nicht den gewünschten Erwartungen entspricht. Andererseits ist es aber auch so, dass mit Digitalisierung das „Überstülpen“ von allerlei elektronischer Maßnahmen verstanden wird, denen man sich nun mal anzupassen habe. Friss, Vogel, oder stirb! Doch kann so die Digitalisierung nachhaltig und langfristig erfolgreich gelingen? Darum erklärt dieses Buch, was es mit einigen Kernelementen der Digitalisierung wirklich auf sich hat und wir diese sinnvoll genutzt werden können.
Als erfahrener Praktiker erspare ich dem werten Leser auch in diesem Buch im Sinne einer besseren Verständlichkeit unnötige Anglizismen. Es ist jedoch leider so, dass es für so manchen etablierten Begriff kein Pendant in der deutschen Sprache gibt. Dennoch denke ich, dass es mir wohl gelungen ist, die Inhalte klar, verständlich und unterhaltsam darzustellen. Für weiterführende Informationen lade ich Sie auf www.Laubmeister.de
Nachfolgend werden nun verschiedene Elemente der Digitalisierung im Licht eines nachhaltigen Erfolgs in alphabetischer Folge beleuchtet. Hiermit soll nicht nur ein einheitliches Verständnis von allerlei Begriffen, die rund um die Digitalisierung kursieren, geschaffen werden. Ein solches einheitliches Verständnis des Ziel Digitalisierung ist eine Grundvoraussetzung für deren Erfolg. Wie dieser Erfolg nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig gestaltet werden kann, ergibt sich aus der Betrachtung der jeweiligen Elemente.
1. Agile Führungsqualitäten
Häufig bezeichnen sich ausgerechnet jene Führungskräfte als führungsstark, welche als Führung den möglichst harten Umgang mit der Peitsche verstehen. Solche Führungskräfte wären vielleicht ehemals gute Sklaventreiber gewesen, mit Führung hat deren Verhalten jedenfalls Nichts zu tun. Zentrale Fragen dazu sind:
wer sich wie lange mit einem unangemessenen Führungsstil führen lässt? Hier sind Konflikte sowie Verlust von Respekt und (guten) Mitarbeitern vorprogrammiert.
Wie viele Menschen mit dem Ziel zur Arbeit gehen, ein schlechtes Werk abzuliefern? Die Annahme, dass Jeder sein Bestes geben will, scheint viel wahrscheinlicher.
Entstehen Konflikte zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht gerade dadurch, weil Jeder sein Bestes geben will?
Denkt man hierüber nach, sollte schnell die Überzeugung folgen, dass jedes Verhalten einer positiven Ausrichtung unterliegt. Jeder meint es im eigenen Interesse irgendwie gut mit seinem Tun. Jeder Mensch trifft also unter den gegebenen Umständen die für ihn bestmögliche Entscheidung – aufgrund ihrer individuellen Sicht der Realität – also nicht aufgrund der Realität an sich. Somit kann es also kein Scheitern geben, sondern nur positives oder negatives, aber auf jeden Fall konstruktives Feedback.
Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn oft fühlt sich der Ideengeber durch die Kritik seines Chefs angegriffen oder abgewertet. Umgekehrt wird der Chef dies empfinden, wenn der Ideengeber seinen Vorschlag wiederholt oder mehrfach erklärt. Schnell sind weitere, also künftige Konflikte vorprogrammiert und die Zusammenarbeit leidet weiter. Doch wie kann man das Dilemma auflösen und dabei dennoch guter Chef oder guter Mitarbeiter sein? Und das gerade in einem volatilen Umfeld, in dem sich agile Teams immer wieder rasch neu finden und schnell produktiv werden sollen?
1.1. Risiken für Beziehungen
Als Führungskraft ist man auf ein gesundes Miteinander mit seinem Team angewiesen. Für kreative Ideen sollte sie sich froh und dankbar zeigen, denn sie sind stets ein Zeichen engagierter Mitarbeiter. Drum kann die Annahme getroffen werden, dass eine gute Führungskraft eine bestmögliche Reaktion auf Ideen und Anliegen zeigen will – was gar nicht so einfach ist:
Einerseits will die Führungskraft also sicherstellen, dass die (ggfs. ablehnende) Reaktion das Verhältnis zu dieser Person nicht beschädigt. Andererseits will sie sicherstellen, dass die Idee oder das Anliegen nicht zu negativen Nebeneffekten führt. Gute Reaktionen stellen Beides sicher!
Beispiel:
von einem Mitarbeiter wird begeistert eine Idee vorgebracht. Negative Nebeneffekte sieht er nicht, aber sein Chef.
Die Konflikte des Chefs:
Ideen verdienen Lob und Anerkennungen, auch wenn der Chef berechtigte Einwände hat
Die Beziehung nicht belasten aber andererseits negative Nebeneffekte abwenden.
Die guten Reaktionen des Chefs:
Gute Beziehung nicht belasten
Umsetzung der Idee darf nicht zu anderen Verschlechterungen führen
Dennoch eine gute Reaktion zeigen
Das Dilemma des Chefs wird hier deutlich. Umgekehrt befindet sich auch der Ideengeber in einem ähnlichen Dilemma. Er hat sich Gedanken gemacht, doch seine Ideen werden möglicherweise abgeblockt. Ist die Kritik gerechtfertigt? Hat der Chef nur nicht Alles verstanden? Nervt er den Chef schon mit seiner Idee? Auch aus dieser Richtung droht der Beziehung zwischen beiden Personen Gefahr.
1.2. Lob wem Lob gebührt – von Wertschätzung und Kritik!
…und das gebührt dem Ideengeber zweifellos, selbst wenn die Idee für den Chef nicht so vorteilhaft sein mag. Immerhin hat sich der Ideengeber die Mühe gemacht sich für sein Team zu engagieren. Der Ideengeber erwartet Lob und Anerkennung durch Vorgesetzte und all jene, die von der Idee profitieren.
Warum also mit Lob geizen? Der beste Weg des Lobes ist, die positiven Auswirkungen der Idee hervorzuheben. Doch auch mögliche Schwierigkeiten müssen betont werden schon bevor die Idee umgesetzt wird. Hier kommt es besonders darauf an eingehend zu begründen, warum diese Schwierigkeiten bestehen können. Erst wenn dies getan ist, ist die Führungskraft „berechtigt", dem Ideengeber seine Vorbehalte mitzuteilen. Aber wie?
Das bedeutet natürlich auch, dass Kritik sorgfältig vorbereitet werden muss um wohl dosiert serviert werden zu können. Empfehlenswert ist dabei ein sehr sensibles Vorgehen wie
1. zunächst präzise aufschreiben, welche negative Auswirkungen zu befürchten sind und welcher Aspekt der Idee diese negative Auswirkung verursacht. (Wenn …, dann …, weil ...).
2. prüfen, ob die gefundenen positiven und negativen Aspekte bereits in der Realität existieren.
- Falls nein: die Aussage in eine Ursache-Wirkungs-Kette einfügen
- Falls ja: die Aussage als zusätzliche Ursache hinzufügen
3. den Vorgang wiederholen, bis es keinen verbalen Erklärungsbedarf mehr gibt.
4. Abschließend jeden einzelnen Satz sich selbst laut vorlesen, wobei auf angemessene Stimme und Tonfall zu achten ist. Da bekanntlich der Ton die Musik macht, ist dieser ebenso wichtig wie der Text selbst.
Mit diesem Vorgehen brauchen sich Führungskräfte nicht länger zu scheuen Verantwortung zu delegieren, denn Vertrauen bedeutet für die Mitarbeiter Wertschätzung. Mangelnde Wertschätzung bedeutet jedoch mangelnden Respekt!
Ermächtigungen zu bestimmten Handlungen bedeuten, die Entscheidungsmacht in einer Organisation dorthin zu verlagern, wo sie hingehören, weil nur dort die entsprechenden Tätigkeiten anfallen. Ziel dabei ist, eine Kongruenz von Verantwortung und Kompetenz herstellen und Entscheidungen konsequent dort zuzulassen, wo sie der Sache nach hingehören. Damit konzentriert sich dort, an Ort und Stelle, auch das Bewusstsein für die damit verbundene Verantwortung. Ein Übermaß von Verantwortung an der Führungsspitze entfällt. Führungskräfte, die vertrauen können, schlafen besser, sind gesünder und leistungsfähiger.
Nun könnte man argumentieren, doch die Verantwortung für bestimmte Ergebnisse dennoch inne zu haben, jedoch Einfluss auf diese zu verlieren. Die Frage wird dann viel mehr sein, ob neben der Verantwortung dort, wo sie hingehört, auch dir nötigen Kompetenzen vorhanden sind. So lange also zugelassen wird, dass es Unterschiede zwischen Verantwortung und Kompetenz gibt, sind solche Ermächtigungen bzw. Delegationen von Verantwortung nur ein schlechter Witz, nur eine Alibi-Aktionen. Mitarbeiter werden dies schnell durchschauen und ihre Schlüsse ziehen. Doch wie
…lässt sich erkennen, dass es Unterschiede zwischen Verantwortungen und Kompetenzen gibt?
… können diese Probleme dann gelöst werden ohne eine Veränderung der
Stellenbeschreibung bzw. der Gehaltsstruktur zu erzeugen?
Ein solches Feuer kann auf verschiedene Arten gelöscht werden. Auch hier hilft eine Ursache-Wirkungs-Analyse:
Wird eine Regelung aufgelöst, die dem Mitarbeiter verbietet, seine Aufgabe gut zu erledigen, so wir das Feuer nachhaltig gelöscht und damit Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen in Übereinstimmung gebracht. Konkret sollte also die Führungskraft
die geforderte Entscheidung treffen (ggfs. nach einer Simulation),
auch Ausnahmen, Informations- und Entscheidungsbedarf klar definieren
Beides ausreichend kommunizieren und dokumentieren
… so stellt dies eine Win-win-Lösung für alle Beteiligten dar. Mitarbeiter werden sich über ihre erweiterte Verantwortung freuen, weil sie dies als Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen werten. Auf gesteigerte Vergütung werden sie dabei gern verzichten, wenn
die Arbeitsbelastung des Einzelnen gleich bleibt
keine Sanktionen bei auftretenden Fehlern zu befürchten sind.
1.3. Der Schlüssel zur erfolgreichen Führung
Quasi als Fazit dieses Kapitels lässt sich sagen, dass
der Schlüssel für erfolgreiche Mitarbeiterführung Wertschätzung ist
Unternehmen profitieren grundsätzlich von über alle Ebenen hinweg gelebter Wertschätzung
Wertschätzung funktioniert besonders von „oben“ nach „unten“
Wertschätzung geben ist gleichbedeutend mit Arbeit und Vertrauen geben
2. Agile Grundprinzipien
Alle agile Arbeitsweisen basieren auf dem „Agilen Manifest“, welches vier agile Leitsätze enthält, aus denen die zwölf agilen Prinzipien resultieren, mit denen erfolgreich Produkte entwickelt werden können. Ausgehend von der Softwareentwicklung ist das Agile Manifest derweil in vielen anderen Industrien angekommen und etabliert sich weiter.
Bei der Darstellung dieser agilen Leitwerte bemühe ich die Darstellung des „Agilen Weges“ von Patrick Eißler, da dort diese Prinzipien dankenswerter Weise simpel und klar verständlich beschrieben wurden. Jede agile Methodik wendet die vier Werte auf unterschiedliche Weise an, aber alle stützen sich auf sie, um die Entwicklung und Lieferung von qualitativ hochwertiger, funktionierender Software zu leiten.
2.1. Die 4 Leitsätze des Agilen Manifests
Diese Leitsätze bedeuten, dass, obwohl die Punkte auf der rechten Seite einen Wert haben, jene Elemente auf der linken Seite höher priorisiert sind:
1. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge
2. Funktionierende Produkte
sind wichtiger als
umfassende Dokumentation
3. Zusammenarbeit mit dem Kunden
ist wichtiger als
Vertragsverhandlungen
4. Reagieren auf Veränderungen
ist wichtiger als
das Befolgen eines Plans
Im Einzelnen bedeutet das Folgendes:
Leitsatz 1: Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Tools
Der erste Wert im Agilen Manifest ist „Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge“. Menschen höher zu bewerten als Prozesse oder Tools ist leicht zu verstehen, denn es sind die Menschen, die auf die Geschäftsanforderungen reagieren und den Entwicklungsprozess vorantreiben. Wenn der Prozess oder die Tools die Entwicklung vorantreiben, ist das Team weniger reaktionsfähig auf Veränderungen und erfüllt weniger wahrscheinlich die Kundenanforderungen. Die Kommunikation ist ein Beispiel für den Unterschied zwischen der Bewertung von Personen und Prozessen. Im Falle von Einzelpersonen ist die Kommunikation fließend und erfolgt, wenn ein Bedarf entsteht. Im Falle eines Prozesses ist die Kommunikation geplant und erfordert bestimmte Inhalte.
Leitsatz 2: Arbeitssoftware statt umfassender Dokumentation
In der Vergangenheit wurden enorme Mengen an Zeit auf die Dokumentation für die Entwicklung und die endgültige Auslieferung des Produkts verwendet. Technische Spezifikationen, technische Anforderungen, technische Prospekte, Schnittstellendesign-Dokumente,
Testpläne, Dokumentationen und die jeweils erforderlichen Freigaben. Die Liste war umfangreich und eine Ursache für die langen Verzögerungen in der Entwicklung. „Agil“ schafft die Dokumentation nicht ab, sie wird in einer Form gestrafft, die dem Entwickler das gibt, was er für seine Arbeit braucht, ohne sich in Kleinigkeiten zu verzetteln. Agile dokumentiert Anforderungen als “User Stories“, die für einen Softwareentwickler ausreichen, um mit der Erstellung einer neuen Funktion zu beginnen. Das Agile Manifest schätzt die Dokumentation, aber es schätzt funktionierende Software mehr.
Leitsatz 3: Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlung
Die Verhandlung ist der Zeitraum, in dem der Kunde und der Produktmanager die Details einer Lieferung ausarbeiten, mit Zeitpunkten auf dem Weg, an denen diese neu verhandelt werden können. Kollaboration ist etwas ganz anderes. Bei Entwicklungsmodellen wie dem Wasserfall verhandeln die Kunden die Anforderungen an das Produkt, oft sehr detailliert, bevor die Arbeit beginnt. Das bedeutete, dass der Kunde in den Entwicklungsprozess einbezogen wurde, bevor die Entwicklung begann und nachdem sie abgeschlossen war, aber nicht während des Prozesses. Das Agile Manifest beschreibt einen Kunden, der während des gesamten Entwicklungsprozesses eingebunden ist und mitarbeitet. Das macht es für die Entwicklung viel einfacher, die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Agile Methoden können den Kunden in Intervallen für periodische Demos einbeziehen, aber ein Projekt könnte genauso gut einen Endbenutzer haben, der täglich Teil des Teams ist und an allen Meetings teilnimmt, um sicherzustellen, dass das Produkt die Geschäftsanforderungen des Kunden erfüllt.
Leitsatz 4: Reagieren auf Änderungen statt Befolgen eines Plans
In der traditionellen Softwareentwicklung wurden Änderungen als Kosten betrachtet und sollten daher vermieden werden. Man wollte detaillierte, ausgefeilte Pläne entwickeln, mit einem definierten Satz von Funktionen und mit der Regel, dass das Eine ein ebenso hohe Priorität hat wie alles Andere, und mit einer großen Anzahl von vielen Abhängigkeiten, die in einer bestimmten Reihenfolge geliefert werden müssen, damit das Team am nächsten Puzzleteil arbeiten kann.
Bei Agil bedeutet die Kürze einer Iteration, dass Prioritäten von Iteration zu Iteration verschoben werden und neue Funktionen in der nächsten Iteration hinzugefügt werden können. Agile vertritt die Ansicht, dass Änderungen immer ein Projekt verbessern; Änderungen bieten einen zusätzlichen Wert. Die agilen Werte bilden die Basis für agiles Arbeiten und den Prinzipen sind das Gerüst dafür. Während die Werte allgemein formuliert sind, stellen die Prinzipien infolgedessen eher konkrete Handlungsempfehlungen dar.
Aus diesen vier Leitlinien resultieren die zwölf agilen Prinzipien, die all Jenen, die in agilen Strukturen arbeiten wollen, vertraut sein sollen. Da diese Prinzipien wie Handlungsaufforderungen formuliert sind, erleichtert sich deren Umsetzung.
2.2. Die 12 agilen Prinzipien
Bei der Beschreibung dieser Prinzipien ist deutlich zu erkennen, worin zunächst der Fokus agilen Manifests lag: Softwareentwicklung. Um allerdings die Prinzipen -wie auch schon die Werte- in einem branchenunspezifischen Licht zu betrachten, ersetzt man Software einfach durch Leistung.