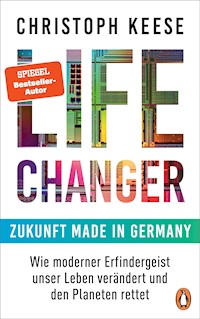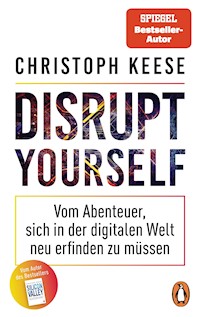
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie uns unser persönlicher digitaler Wandel gelingt
Wir spüren alle, dass der Boden, auf dem wir stehen, zittert. Lähmt uns der Gedanke, dass rund die Hälfte aller Berufe aussterben wird? Oder elektrisiert uns die Aussicht auf eine glanzvolle digitale Zukunft? Christoph Keese, einer der führenden Digitalisierungsexperten Deutschlands, ist immer am Puls der Veränderungen. Er fordert uns auf, unsere persönlichen Stärken zu erkennen und zu nutzen, um uns radikal neu zu erfinden. Zeigt, wie wir es schaffen, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. In »Disrupt yourself« steckt ein Versprechen: Wir können alle zu Digitalisierungsgewinnern werden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
CHRISTOPH KEESE ist Geschäftsführender Gesellschafter von hy und begleitet namhafte Unternehmen und Regierungsinstitutionen bei Fragen der digitalen Transformation und technologischen Innovation. Der Publizist, Wirtschaftswissenschaftler, Verlagsmanager und Bestsellerautor arbeitet seit Anfang der 1990er Jahre an der Digitalisierung von Geschäftsmodellen und ist einer der führenden Beobachter von Innovation und Erneuerung. Er gehört zu den Mitgründern der Financial Times Deutschland, leitete als Chefredakteur die Welt am Sonntag und Welt Online und trieb, zuletzt als Executive Vice President, die Digitalisierung bei Axel Springer voran. Christoph Keese ist Autor der Bestseller Silicon Valley und Silicon Germany, für das er mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2016 ausgezeichnet wurde. 2022 erscheint sein neues Buch Life Changer – Zukunft made in Germany.
Christoph Keese in der Presse:
»Die Mischung aus Reportage und Analyse macht das Buch leicht lesbar und trotzdem profund.« Handelsblatt über Silicon Germany
»Den originellen Einblicken folgt ein solides Kompendium des Change-Managements.« Die Zeit über Silicon Germany
Außerdem von Christoph Keese lieferbar:
Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt
Silicon Germany. Wie wir die digitale Transformation schaffen
Life Changer – Zukunft made in Germany. Wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und unseren Planeten rettet
Christoph Keese
Disrupt Yourself
Vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Penguin Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2018 der Originalausgabe by Penguin Verlag
Umschlaggestaltung: total italic / Thierry Wijnberg
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22991-7V005
Für Jasmin, Caspar, Nathan und Camilla
Inhalt
Mein Job verschwindet, und ich kann nichts dagegen tun
Das Lexikon der aussterbenden Berufe
»DAS KÖNNTE SEIN, ABER DAS WIRD NICHT PASSIEREN.« Die Psychologie der Betroffenen
Sorglosigkeit trotz guten Grunds zur Sorge
Die Verteidigung unserer Grundbedürfnisse
»JUST DO IT!« Die Psychologie der Erneuerer
Geborgen im Selbstvertrauen
Das Neue in die Welt bringen
Anleitung für die folgenden Kapitel
»ICH KANN AUCH ANDERS!« Selbst zum Erneuerer werden
Den eigenen Berufswunsch hinterfragen
Die Geschichte unseres Lebens neu erzählen
Sich von Angst nicht lähmen lassen
Konsequent sein
»DA GEHT MEHR!« Chancen für den Wandel erkennen
Eine Formel für den Disruptionspunkt
Verborgene Kundenwünsche erfüllen
Nervenaufreibende Situationen abschaffen
Das Angebot auf die Gegenseite optimieren
Die Kunst, sich Anachronismen einzubilden
Den eigenen Wert probeweise auf null setzen
Daten systematisch auswerten und naive Fragen stellen
Ein Wertschöpfungssystem neu erfinden
»BAUEN, PARTNERN, INVESTIEREN.« Selbstdisruption von Unternehmen
Methodik: Neue Industrien rechtzeitig erkennen
Organisation: Bekenntnis zum Leben in zwei Welten
Führung: Aus den Helden von gestern die Helden von morgen machen
»DISRUPT YOURSELVES!« Ein Weckruf an die Politik
Dank und Kontakt
Lesehinweise
Mein Job verschwindet, und ich kann nichts dagegen tun
Eine Einführung
Ein sonniger Nachmittag im Spätsommer 1997. Der große Saal in der Kalkscheune, einem alternativen Veranstaltungszentrum gleich hinter dem Friedrichstadt-Palast in Berlin-Mitte, ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Thema des Kongresses, zu dem ich als Diskutant eingeladen bin, ist die Veränderung der Medien durch Weblogs, kurz Blogs, damals noch ein weithin unbekanntes Medium. Ich soll die Position der Journalisten vertreten. Meine Gesprächspartner sind drei Aktivisten der Blogger-Szene. Im Publikum versammelt sich die digitale Avantgarde Berlins: Leute in T-Shirts, Rollkragen, Jeans und Turnschuhen, meist mit Laptops auf dem Schoß, seinerzeit noch klobige Geräte. Einige Gäste schießen Fotos mit Spiegelreflexkameras; das iPhone wird erst zehn Jahre später erfunden werden. Die Atmosphäre wirkt familiär. Man kennt sich.
Der Moderator räuspert sich ins Mikrofon: »Herzlich willkommen allerseits. Wir beginnen mit den Eingangsstatements der Panelisten.« Das Gemurmel ebbt ab, gespannte Ruhe kehrt ein. Meine Mit-Diskutanten sind vor mir an der Reihe. Der Blogger zu meiner Rechten ergreift das Mikro und eröffnet die Debatte mit einem Frontalangriff auf Journalisten: »Information ist nur frei, wenn der Zugang zu ihr frei ist«, behauptet er. »Die Gesellschaft kann nur frei sein, wenn die Auswahl der veröffentlichten Informationen nicht mehr ausschließlich in den Händen der kleinen Kaste von Journalisten liegt. Nachrichten müssen aus dem Klammergriff dieser Hohepriester befreit werden. Es ist Zeit für mehr Demokratie.« Diese These hat es in sich; der Saal klatscht laut Beifall. Da ergreift schon der zweite Blogger das Wort und schlägt in dieselbe Kerbe: »Journalisten sind Torhüter, die niemand mehr braucht«, findet er. »Sie stehen der demokratischen Ausbreitung von Informationen im Wege. Die digitale Gesellschaft braucht keine Wächter mehr, die darüber entscheiden, was die Öffentlichkeit zu sehen bekommt und was nicht.« Wieder ertönt reger Beifall. Ich möchte dringend widersprechen, doch zuerst ist der dritte Blogger an der Reihe: »Bürgerjournalismus ist die Zukunft. Journalisten leisten nichts, was elektronisch vernetzte Bürger nicht auch leisten können«, sagt er und zitiert erste Erfolge einer Bürgerplattform in Südkorea. Dann bläst er zum Sturm: »Die Nachrichten der Zukunft kommen von unten. Das Ende des Informationsmonopols der Journalisten ist gekommen.« Auch er erntet lauten Applaus.
Nun bin ich an der Reihe. Ich bemühe mich um eine ruhige Stimme, obwohl ich reichlich aufgebracht bin. Hier geht es um nichts weniger als meinen Beruf. Die Mehrheit der Menschen im Saal möchte ihn offenkundig abschaffen. Ich fühle mich angegriffen. »Nur professionelle Medien sind in der Lage, das schwierige Geschäft mit Nachrichten und Einordnung seriös zu betreiben«, sage ich. »Nur Journalisten besitzen die Ausbildung, das Geld und die Zeit, Wirtschaft und Staat wirksam zu kontrollieren und der Wahrheit auf den Grund zu gehen.« Bislang dachte ich, das sei eine Selbstverständlichkeit, doch als ich diese These vorbringe, herrscht im Saal betretenes Schweigen, so als hätte ich mir einen peinlichen Fauxpas geleistet. Ich setze nach: »Die arbeitsteilige Gesellschaft beruht auf den besonderen Fähigkeiten von Spezialisten. Es gibt Piloten, Gehirnchirurgen, Anwälte, Bäcker, Metzger, Pharmazeuten, Chemiker, Richter, Elektriker, Brückenbau-Ingenieure und eben Journalisten – sie alle steuern ihr Spezialwissen zum Wohle der Allgemeinheit bei.« Journalisten sind die Spezialkräfte für den Umgang mit Wahrheit und Einordnung, argumentiere ich. Sie greifen auf eine anspruchsvolle Ausbildung zurück, und ihr Gewerbe ist diffizil. »Man kann die Wahrheit niemals ganz erreichen, ihr aber doch ein gutes Stück näher kommen, wenn man genug Zeit und Geld für Recherche hat.« Die meisten Blogger arbeiten im Nebenberuf. Sie können gar nicht so viel Zeit aufwenden wie Profis. »Bloggen ist Hobby, Journalismus ist Beruf«, sage ich. »Die Wahrheit braucht Journalisten. Die Gesellschaft legt das kostbare Gut Information am besten in die Hände von Profis. Deswegen werden Blogs die traditionellen Medien niemals verdrängen.«
Aus dem Saal ertönt Lachen. Irritiert schaue ich mich um. Hat jemand hinter meinem Rücken einen Witz gemacht? Nein, alle Diskutanten schauen ernst. Doch das Publikum kichert. Es dauert einen Moment, bis ich begreife: Die Leute lachen nicht über einen Witz. Sie lachen über mich. Sie finden komisch, was ich gerade gesagt habe. In ihren Ohren muss ich klingen wie jemand, der im Wald pfeift und die Gefahr nicht erkennt, die ihn bedroht. Blogs werden die traditionellen Medien niemals verdrängen? Das finden die Leute hier lächerlich. Für sie wirkt das so, wie wenn ein Heizer auf der Dampflok vor hundert Jahren gesagt hätte: »Mein Job ist sicher. Elektrizität ist eine Mode. Sie geht vorbei.«
Der Moderator wendet sich an das Publikum: »Offenbar gibt es Redebedarf. Wer möchte den Anfang machen?« Eine junge Frau drängelt sich durch die vierte Reihe zum Mikrofon: »Medien sind arrogant«, ruft sie mir zu. »Es ist bezeichnend, wie sehr Sie auf dem Schlauch stehen. Sie merken gar nicht, was sich um Sie herum alles verändert. Die Welt braucht Sie nicht mehr, und Sie wollen das nicht verstehen. Sie ignorieren den Trend so lange, bis Sie ausgestorben sind. Wie ein Dinosaurier verhalten Sie sich. Natürlich lösen User die alten Gatekeeper ab. Das ist gar nicht mehr aufzuhalten. Sie haben es nur noch nicht mitbekommen.«
Ich bin verblüfft über so viel Aggressivität. »Nein, die Gesellschaft braucht uns«, gebe ich zurück. »Medien stehen für Qualität. Wir sind nicht arrogant. Wir geben auch den Meinungen unserer Leserinnen und Leser Raum.« – »Ja, auf einer halben Leserbriefseite hinten in der Zeitung und in den Foren unterhalb der Artikel auf der Webseite«, antwortet die Frau. »Die User wollen aber nicht länger unter die Artikel verbannt werden. Sie wollen die Artikel selbst schreiben. Sie lassen sich nicht mehr wegmoderieren.« Mir fällt der alte Spontispruch ein: »Wir wollen kein Stück vom Kuchen. Wir wollen die ganze Bäckerei.« So ähnlich klingt das jetzt auch hier. Diese Leute halten uns für gefährlich und fordern eine neue Medienordnung. Sie bekämpfen das Establishment, zu dem in ihren Augen auch ich gehöre. Ich fühle mich in die Rolle des erzkonservativen Bewahrers gedrängt, in der ich mich unter normalen Umständen unwohl fühle. Trotzdem nehme ich die Rolle unreflektiert an.
»Wer bürgt denn für Qualität, wenn alle selbst schreiben?«, frage ich die Frau. – »Niemand«, sagt sie. »Das regelt der Markt. Millionen Stimmen erheben sich, und die LeserInnen entscheiden selbst, wem sie vertrauen.« – »Und wer redigiert die Blogger?«, hake ich nach. »Ohne Redakteur ist kein Autor gut, egal, wie begabt und aufrichtig er sein mag.« – »Niemand redigiert die Blogger«, sagt sie. »Die Blogger redigieren sich selbst. Es braucht keine Redakteure. Redigatur ist Zensur.« Das ist leichtfertiger Unsinn, finde ich und werde etwas lauter: »Nein, Redigatur ist keine Zensur. Sie ist Qualitätskontrolle. Niemand schreibt perfekt. Autoren und Redakteure arbeiten Hand in Hand. Nur so entsteht Qualität«, rufe ich. »Bevor ein Text bei uns erscheint, geht er durch sechs Stufen der Qualitätssicherung. Nichts ist gut genug, um ungeprüft gedruckt zu werden. Und bei den Bloggern übernimmt diese Aufgabe niemand?« – »Niemand«, wiederholt die Frau, »genau darin liegt die Freiheit der digitalen Welt. Autoren und Leser treten in direkten Dialog miteinander. Wenn sich ein Fehler einschleicht, wird er online sofort korrigiert. Die Summe der Leser hat mehr Augen als alle Redakteure der Welt zusammen. Blogs kommen der Wahrheit viel näher als Redaktionen.« Ich schüttele den Kopf. Für mich klingt das gemeingefährlich.
Die Diskussion dauert noch eine Stunde und wird immer hitziger. Ich mache mich beim Publikum gründlich unbeliebt und gebe ein ziemlich gutes Feindbild ab. Ich bin es nicht gewohnt, für Werte der freien Presse verlacht zu werden. Disruption tut weh, und sie verletzt, merke ich. Meine Identifikation mit meinem Beruf ist so stark, dass mich diese aggressive Missachtung ganz persönlich trifft. Es bleibt ein Gefühl der Frustration, Enttäuschung und Verärgerung.
Nach dem Ende der Debatte kommt ein Freund zur Bühne und klopft mir auf die Schulter: »Du hast dich tapfer geschlagen«, behauptet er. – »Na ja«, lächle ich etwas gequält. »Überzeugt habe ich wohl niemanden.« Er nickt: »Tja, das mag sein.« Dann zeigt er auf das Publikum, das zur Kaffeepause drängt: »Weißt du, wen du hier vor dir hast? Das sind moderne Verleger«, sagt er. »Verleger eines neuen Typs.« Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Bisher hielt ich Blogger nur für Autoren. Doch er hat recht, in Wahrheit sind sie Autoren und Verleger in einer Person. Blogger sind die Eigentümer ihrer Publikationen, und damit sind sie nach der gängigen Definition auch Verleger. Das macht die Sache noch schlimmer, denke ich, denn dann zerstören sie zwei Berufe auf einmal: Journalisten und Verleger, also meinen eigenen Berufsstand und dessen Arbeitgeber gleich mit. »Genau«, sagt mein Freund. »Früher brauchte man Millionen, um einen Verlag zu gründen. Druckerei und Vertrieb verschlangen viel Geld. Heute geht das fast kostenlos. Bloggen wird gewaltige Kräfte entfesseln und zu einem Massenphänomen anschwellen. Die Möglichkeit, sich ungefiltert und fast kostenlos Gehör zu verschaffen, birgt enormen Reiz. Das ist eine Revolution.« Ich ertappe mich dabei, wie ich denke: »Hoffentlich passiert das nicht. Hoffentlich scheitern diese Blogger.« Im Handumdrehen bin ich zu einem Fortschrittsgegner geworden. Dass wir den Angreifern zuvorkommen könnten, kommt mir nicht in den Sinn. Ich betrachte die neue Bewegung als Feind.
Erst Jahre danach fange ich selbst mit dem Bloggen an und entdecke seine guten Seiten. Doch da ist es schon zu spät. Eigentlich mag ich Technik, Aufbrüche und Herausforderungen. Ich finde es gut, wenn bestehende Strukturen hinterfragt werden. Doch als mein Beruf für wertlos erklärt wird, schalte ich auf stur. Ich halte am Erreichten fest. In meinem Kopf türmen sich die guten Argumente, warum ich recht habe und die Blogger unrecht. Offenheit für Erneuerung endet meist dort, wo das Selbstwertgefühl beginnt.
Seit diesem Nachmittag im Jahr 1997 sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen. Die Vorhersage meines Freundes ist mit voller Wucht eingetreten. Bloggen mit all seinen Folgeerscheinungen hat den Journalismus in eine Sinnkrise gestürzt. Am 13. November 1990 war der weltweit erste Blog ins Netz gegangen. Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web, hatte ihn zum Informationsaustausch zwischen Wissenschaftlern am europäischen Kernforschungszentrum CERN eröffnet. Der Start verlief langsam, doch Ende der 1990er-Jahre nahm das Selbstverlegen Schwung auf. Heute, nur ein halbes Berufsleben später, ist aus der Idee des Bloggens ein globales Massenphänomen geworden. Jeder Benutzer eines digitalen Geräts ist gleichzeitig Konsument und Produzent. Milliarden von Texten, Fotos, Audios und Videos landen jeden Tag im Netz. Die traditionelle Einbahnstraße vom Produzenten zum Konsumenten hat sich in einen turbulenten Marktplatz verwandelt. Heute gibt es weltweit Hunderte Millionen Blogger, Podcaster, YouTuber, Instagrammer, Pinterester und sonstige Influencer. Aus dem Hobby einer Subkultur ist für viele ein Hauptberuf geworden. Dies hat enormen Einfluss auf die traditionellen Medien. Denn viele Leserinnen und Leser fragen sich, warum sie für professionelle Medienprodukte noch bezahlen sollen, wenn sie die Informationen und Unterhaltung auch kostenlos bekommen.
Plattform: Digitales Geschäftsmodell, bei dem die angebotene Leistung nicht selbst erbracht, sondern gegen eine Provision vermittelt wird. Die Kapitalintensität ist gering, weil keine Infrastruktur zur Erbringung der eigentlichen Leistung finanziert werden muss. Entsprechend hoch ist die Kapitalproduktivität. Die Grenzkosten, also die Kosten für einen zusätzlichen Kunden, gehen gegen null, da die technische Ausrüstung für die Erbringung der Vermittlungsleistung aufgrund des technischen Fortschritts rapide im Preis verfällt. Große Teile der Ausrüstung wie beispielsweise Cloud-Server werden nicht gekauft, sondern nach Bedarf gemietet. Damit fallen die Fixkosten im Vergleich zu traditionellen Geschäftsmodellen niedrig aus, was massives Wachstum auch mit geringer Finanzausstattung ermöglicht. Plattformen konvergieren aufgrund des Netzwerkeffekts zu marktbeherrschenden Stellungen oder sogar zu Monopolen. Gestärkt werden Plattformen überdies durch den Feedback-Effekt. Je intensiver sie genutzt werden, desto besser werden sie inhaltlich und desto mehr geraten Wettbewerber ins Abseits. Suchmaschinen oder selbstfahrende Autos lernen mit jeder Nutzung dazu. Auch dieser Feedback-Effekt digitaler Güter ist grundlegend neu, da analoge Produkte durch Nutzung verschleißen, anstatt sich zu verbessern. Sechs der zehn derzeit wertvollsten Unternehmen der Welt sind Plattform-Unternehmen: Apple, Microsoft, Alphabet (vormals Google), Amazon, Meta (vormals Facebook) und Tencent. Andere typische Plattformen sind Uber, AirBnB, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Booking oder HRS.
Geahnt haben die wenigsten, was passieren würde. Dass Blogs (und in ihrer Folge die vielen anderen Formen von Posts) eines Tages Social-Media- und Suchmaschinenmonopole wie Facebook, Google und YouTube heranzüchten würden, die Fake News verbreiten, intime Daten von Abermillionen Menschen verkaufen, Wahlen manipulieren, Donald Trump ins Weiße Haus verhelfen, alternative Fakten, sprich: Lügen, gesellschaftsfähig machen und das postfaktische Zeitalter einleiten – das hat kaum jemand vorausgesehen. Niemand ahnte, dass Trump zum Ende seiner Amtszeit den Verlust der Wahl leugnen und seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufrufen würde. Auch war unvorstellbar, dass digitale Plattformen sieben der zehn wertvollsten Firmen der Welt stellen würden. Undenkbar, dass Plattformen die allermeisten Produzenten von Inhalten nicht bezahlen und trotzdem damit durchkommen könnten. Niemand malte sich aus, dass Lügen und Verschwörungstheorien eines Tages gesellschaftsfähig werden und das Ergebnis einer Impfkampagne gegen ein tödliches Virus unterwandern könnten. Kein Finanzminister hätte erwartet, dass die reichsten Firmen der Welt einmal nahezu keine Steuern mehr entrichten würden. Vor allem aber hatte kein Journalist damit gerechnet, vom respektierten, oft gefürchteten Status des Agenda Setters zum Nischenkommentator am Spielfeldrand abzusteigen. Früher teilten Journalisten den Vorgängern von Scholz, Macron und Biden die Sendezeit und die Zeitungsspalten zu. Wenn John F. Kennedy in der Kuba-Krise zum amerikanischen Volk sprechen wollte, musste er die drei Senderketten ABC, NBC und CBS höflich um Erlaubnis bitten. Heute erreichen Regierungschefs mehr Menschen über ihre Twitter-Feeds als über Zeitungsinterviews. Barack Obama hat unglaubliche 130 Millionen Follower bei Twitter. Donald Trump nahm sich im Wahlkampf als erster Kandidat der US-Geschichte die Freiheit heraus, systematisch nicht mehr an Bord des offiziellen Flugzeugs zu reisen, sondern bequem im eigenen Jet vorauszufliegen – sein Twitter-Millionenpublikum per Smartphone immer in der Hand dabei. Er heuerte Wachleute an, um Journalisten von seinen Wahlkampfauftritten fernzuhalten und notfalls handgreiflich aus dem Saal zu drängen. Eine halbe Generation zuvor hatten Präsidentschaftskandidaten noch Mitarbeiter beschäftigt, um das Gegenteil zu erreichen, nämlich möglichst viele Journalisten in das Publikum hineinzulocken.
Bei der Diskussion in der Kalkscheune hätte ich mich fragen müssen: »Was ist dran an den Argumenten der Blogger?« Dann hätte ich sofort mit dem Experimentieren beginnen sollen. So wäre ich auf Augenhöhe mit den Angreifern gekommen. Auch sie wussten damals nicht, ob ihre Thesen stimmten. Sie formulierten lediglich ein Programm. Vor ihnen lag eine lange Strecke des Lernens. Auf diese Lernreise hätte auch ich mich einlassen können. Dann wäre ich in den Besitz der gleichen Informationen gekommen. Meine Mitarbeiter, Arbeitgeber und ich selbst hätten davon profitiert. Wir hätten dann früher versucht, das Beste aus der alten und der neuen Welt miteinander zu kombinieren. Wahrscheinlich hätten wir beschlossen, uns selbst frontal anzugreifen. Aus vielen der kleinen Blogs von damals sind inzwischen große Medienunternehmen geworden. Einige von ihnen hätten uns gehören können, wenn wir mitgemacht hätten. Doch ich war leider zu sehr gefangen in meinem traditionellen Denken.
Heute ist Journalismus zwar nötiger denn je. Die vielen ungeprüften, frei erfundenen, erlogenen, fahrlässig recherchierten und von Einzelinteressen geprägten Fehl- und Halbinformationen in den sozialen Medien machen Journalismus noch unverzichtbarer als früher. Dennoch lag die Bloggerin von damals weitgehend richtig. Influencer haben den Journalisten die Masse des Publikums abgejagt. Sie haben – gemessen an der Reichweite – klar gewonnen. Sascha Lobo hat doppelt so viele Follower auf Twitter wie Bundeskanzler Olaf Scholz und siebenmal mehr als Außenministerin Annalena Baerbock. YouTube-Stars wie Dner, Paluten und Julien Bam bringen weit mehr Publikum vor den Bildschirm als die einschlägigen Fernsehsender. Katy Perry hat 109 Millionen und Justin Bieber 114 Millionen Twitter-Fans, während MTV eine Randexistenz führt. Die Technologie-Blogs Heise, TechCrunch, Re/Code und The Verge geben den Ton in der Technologie-Szene an, während Popular Mechanics, dasTechnik-Leitmedium des 20. Jahrhunderts, eine Reihe von Nahtod-Erfahrungen durchlebt.
Kim Kardashian nennt 70 Millionen Follower ihr Eigen, Elon Musk 68 Millionen. CNN Breaking News als erfolgreichstes Medium bei Twitter erreicht mit 62 Millionen Followern nur Platz 15 der Weltrangliste. Die Gegenstände der Berichterstattung versammeln heutzutage auf direktem Wege ein größeres Publikum als die Berichterstatter. Cristiano Ronaldo beschäftigt mehr Sportredakteure als die meisten Zeitungsredaktionen. 20 Journalisten schreiben in seinem Auftrag über sein Leben. Der FC Bayern München kommt bei Twitter auf 5,8 Millionen Fans, Sportbild nur auf 400 000 und Kicker mit seinem Bundesliga-Account lediglich auf 210 000. Früher war der FC Bayern existentiell auf die Sportpresse angewiesen. Heute erreicht er selbst zehn- bis zwanzigmal so viele Menschen wie die Medien, die über ihn schreiben.
Natürlich ist dieser Vergleich nicht ganz fair. New York Times, Welt, Spiegel, Zeit, FAZ, Sportbild oder Kicker sind als unabhängige Stimmen ungleich einflussreicher und glaubwürdiger als direkte Absender. Trotzdem geraten sie in Bedrängnis. Viele Musiker, Sportler, Vereine, Ligen, Parteien und Politiker bauen Multikanal-Imperien auf, die traditionelle Medien an den Rand drängen. Der Mangel an Unabhängigkeit ist eigentlich ein gravierender Nachteil. Doch die scheinbare Authentizität der Information wirkt verführerisch auf das Publikum. Viele Zuschauer verzichten gern auf geprüfte Fakten, wenn sie vermeintliche Nähe dafür bekommen. Man sollte diesen Mangel an Unabhängigkeit kritisieren, doch man muss ihn zur Kenntnis nehmen. Die Neutralität des Berichterstatters scheint vielen Leserinnen und Lesern heute nicht mehr so wichtig wie früher. Das ist bedauerlich und vielleicht sogar gefährlich, doch es gehört zur Wirklichkeit dazu.
Mit dem Verlust von Aufmerksamkeit ging eine Erosion der wirtschaftlichen Grundlagen des Journalismus einher. Plattformen wie Google, Twitter oder TikTok schöpfen den größten Teil der geschaffenen Werte ab und entschädigen die Produzenten nicht angemessen für die Leistungen, mit denen diese zum Erfolg der Plattformen beitragen. Plattformen drängen sich zwischen Journalisten und ihre Leser, inzwischen aber auch zwischen Verlage und deren Anzeigenkunden. Vier Fünftel der Anzeigenumsätze auf Verlagswebseiten in den USA kommen schon über automatische Algorithmen, ohne dass Menschen eingreifen müssen. Hinter fast jedem Algorithmus steht eine Plattform. Die Preise erodieren. Plattformen streichen Provisionen ein und drängen die Medien von den Kunden ab. So kommt immer weniger Geld bei den Kreativen und ihren Produzenten an.
Alles in allem hat die Digitalisierung der Medienbranche übel mitgespielt. Einen wichtigen Teil der Schuld daran trägt die Branche selbst, weil sie zu spät gehandelt hat. Andere Branchen haben die Chance, aus diesem Beispiel zu lernen und den sie angreifenden Kräften zuvorzukommen.
Mein Beruf ist disruptiert worden, ich bin disruptiert worden. Ihnen muss es nicht genauso gehen wie mir, wenn Sie die Gefahr früh genug erkennen. Disrupt Yourself bedeutet: Erfinden Sie sich neu, bevor es jemand anders für Sie tut. Das gilt für individuelle Menschen genauso wie für Unternehmen.
Kann man morgen jemand anders sein als gestern? Die Digitalisierung setzt uns unter Zugzwang, denn ungefähr die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze und ein Großteil der gegenwärtigen Firmen werden verschwinden. Nicht im Laufe eines Jahrhunderts, wie damals bei der Einführung der Dampfkraft oder der Elektrizität, sondern im Laufe der nächsten 5 bis 15 Jahre. Wir müssen uns verändern, ob wir es wollen oder nicht.
Disruption steht für »disruptive Innovation«. Sie ist das Gegenteil der erhaltenden Innovation, die Erneuerung bringt, ohne die bestehenden Strukturen und Teilnehmer am Markt zu gefährden. Disruptive Innovation verdrängt Teilnehmer vom Markt, weil die von ihnen erfüllte Funktion durch den Fortschritt entfällt. Ganze Geschäftszweige werden überflüssig. Stellte beispielsweise die CD eine erhaltende Innovation dar, weil traditionelle Hersteller von Vinyl-Schallplatten weiterhin die Fäden in der Hand hielten und durch die steigenden Preise pro Tonträger sogar von der Einführung der CD profitierten, wirken Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer oder Apple Music disruptiv. Presswerke und Plattengeschäfte werden überflüssig; der Preis pro Song sinkt auf einen Bruchteil seiner bisherigen Höhe. Kein Teilnehmer der traditionellen Tonträgerindustrie hat es geschafft, einen erfolgreichen Streaming-Dienst aufzubauen. Alle Disruptoren kamen von außerhalb der Branche.
Doch Selbstdisruption ist möglich. Indem man selbst den eigenen Beruf oder das eigene Geschäftsmodell angreift und demontiert, kann man der Veränderung durch Dritte zuvorkommen und selbst vom Disruptionsertrag profitieren, anstatt ihn anderen zu überlassen. Disruption bedeutet also grundlegende Veränderung, Neuerfindung und Neuanfang. Im engsten Wortsinn meint Disruption »Zerrüttung, Zusammenbruch«, alles auf null setzen, zurück auf Los. Selbstdisruption heißt folgerichtig, die eigene Existenz grundlegend in Frage zu stellen, sie über den Haufen zu werfen und mit einem neuen Konzept neu aufzubauen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden Sie als Individuum früher oder später damit konfrontiert werden, ein neues Bild Ihrer Existenz zeichnen zu müssen, weil die Digitalisierung Ihren Beruf grundlegend verändert oder sogar abschafft. Ob Sie Bankangestellte sind, selbständiger Buchhalter oder als Führungskraft Verantwortung in einem Unternehmen tragen – dieses Buch steht Ihnen beim Bewältigen Ihrer eigenen digitalen Neuerfindung zur Seite. Selbstdisruption fällt deshalb so schwer, weil man sich nicht neu erfinden kann, ohne Fragen nach dem eigenen Ich zu stellen: Wer bin ich? Was möchte ich tun? Wofür werde ich anerkannt? Solche Fragen haben sich viele zuletzt in der Pubertät gestellt. Seitdem sind wir froh, keine quälende Selbstbestimmung mehr betreiben zu müssen. Nun aber verschwinden mit der Digitalisierung viele Gewissheiten, die uns durch die Jahrzehnte getragen haben. Die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt geht von vorne los. Das ist zwar eine Zumutung, doch sie kann auch neue Chancen eröffnen. Deswegen sehe ich Selbstdisruption nicht als unangenehme Pflicht, sondern als Bereicherung an. Ich bin ausgesprochen zuversichtlich, auch wenn die Fakten zunächst bedrückend klingen.
Das meiste Faktenwissen, das wir erworben haben, wird in absehbarer Zeit unbrauchbar werden. Bisher fand Digitalisierung auf unseren Schreibtischen, in unseren Händen und mit unseren tippenden Daumen statt. Sie spielte an der Peripherie – in der äußeren Welt. Jetzt erreicht sie unseren Kern. Es geht uns wie Goethes Zauberlehrling, dem die eigene Magie über den Kopf wächst: »Ach, da kommt der Meister! / Herr, die Not ist groß! / Die ich rief, die Geister / werd ich nun nicht los.«
Dieses Buch ist für Leute geschrieben, die den Takt ihres Wandels selbst vorgeben möchten. Das geht nur, wenn man rechtzeitig lernt, wie das Spiel läuft. Man kann einen geordneten Übergang organisieren, wenn man beizeiten damit anfängt. Von den digitalen Veränderungen sind Berufe und Branchen betroffen, von denen man es bisher nicht gedacht hätte. Die revolutionären Fortschritte in der Computertechnik und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz verändern Domänen, die bislang als sicher galten, wie die Berufsbilder von Buchhaltern, Versicherungsmathematikern, Radiologen, Steuerberatern, Sportredakteuren, Lastwagenfahrern, Kassierern oder Einkäufern. Zwar herrscht heute bedrohlicher Mangel an LKW-Fahrern. In vielen Ländern werden sie verzweifelt gesucht. Doch das darf uns nicht in die Irre führen. Der Mangel von heute schafft noch mehr Anreize, Lastwagen möglichst bald von Computern steuern zu lassen. Die Sterne dieser Berufe sinken. Wer heute 30 ist, erlebt die Entwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit komplett mit. Wer 50 ist, den ereilt der galoppierende Bedeutungsverlust seines Gewerbes noch vor der Rente. Man kann etwas Besseres für sich finden, wenn man sich rechtzeitig vom Gewohnten löst. Disrupt Yourself ist eine vorbeugende Maßnahme, keine Erste Hilfe, nachdem der Schaden bereits eingetreten ist. Wenn man erst einmal von der digitalen Revolution überrollt wurde, bleibt keine Zeit mehr für Wandel in Eigenregie. Es ist besser, vor der Welle zu surfen, anstatt sie über sich zusammenschlagen zu sehen.
Beim Geburtstagsfest meiner Mutter diskutierten meine Nichten, Neffen und Kinder kürzlich über ihre Berufswünsche. Sie fragten mich, zu welchem Job ich ihnen raten würde. Doch mir fiel kein einziger Beruf ein, der mit Blick auf 60 Jahre nicht von Maschinen ersetzt werden oder einem neuartigen Geschäftsmodell zum Opfer fallen kann. Wir entlassen unsere Kinder in unsichere Zeiten. Noch eine Generation zuvor konnten Eltern mit einiger Gewissheit Berufe empfehlen, die zu Lebzeiten ihrer Kinder nicht obsolet werden würden: Arzt, Pilot, Fernfahrer oder Automechaniker zum Beispiel. Heute erscheint, was dieses Thema betrifft, keine Option mehr sicher. Also müssen wir unseren Kindern beibringen, sich von Zeit zu Zeit neu zu erfinden. Doch wie geht das? Für diese Kunst gibt es keine inkompetenteren Lehrer als uns selbst. Den meisten von uns wurde das bisher nicht abverlangt.
Ehrlichkeit ist in diesem Prozess besonders wichtig. Erfolge schaffen Distanz. Wenn wir einander nur von Erfolgen berichten, denken wir, bei den anderen liefe alles gut und nur bei uns häuften sich die Probleme. Was wir brauchen, ist Nähe. Und Nähe entsteht durch Ehrlichkeit. Nur so überstehen wir die nächste Phase der Digitalisierung. Nur so können wir von den Erfahrungen anderer Menschen lernen. Mir ist das vor einiger Zeit besonders deutlich bei einem Abendempfang eines Medienunternehmens aufgefallen. Ich traf Kollegen wieder, die ich lange nicht gesehen hatte. Wir fragten einander, wie es uns geht, und alle antworteten nur mit »Ausgezeichnet«, »Läuft prima« oder »Blendend«. Dass mir in Wirklichkeit die unterschiedlichsten Sorgen durch den Kopf geisterten, dass ich mich mit einer Nachforderung des Finanzamts beschäftigen musste, die rechtzeitige Buchung des Sommerurlaubs verpasst hatte und meine Tochter mit Fieber im Bett lag, verriet ich nicht. Einer der Kollegen war gerade zum dritten Mal hintereinander entlassen worden. Seine Antwort auf die Frage nach seinem Befinden lautete: »Mir geht es super. Wenn die das nicht für mich entschieden hätten, wäre ich selbst gegangen. Endlich bin ich da raus. Jetzt bin ich frei für die Zukunft.« Ich malte mir aus, wie viel Kraft es ihn kosten musste, trotz seiner Niederlagen die Haltung zu bewahren. Wir waren Kollegen, doch wir sprachen nicht ehrlich miteinander. Mit dem Verbergen von Gefühlen kommen wir in der Bewältigung großer Umbrüche wie der Digitalisierung aber nicht weiter. Bei den Recherchen zu diesem Buch habe ich meine Interviewpartner um größtmögliche Ehrlichkeit gebeten. Mehr als 100 Einzelgespräche habe ich geführt.
Der Wandel, der vor uns liegt, verläuft schnell und unübersichtlich. Dieses Buch verschafft einen ersten systematischen Zugang zum Thema. Betrachten Sie es also als eine Art Antrittsticket für eine längere Reise. Wir können unseren Beruf und unsere Firma ändern, ohne uns selbst aufzugeben. Wir können zu den Gewinnern der Digitalisierung gehören. Deswegen bin ich besten Mutes. Zwar geben Pandemie und Ukraine-Krieg uns wenig Anlass zu Optimismus. Diese furchtbaren Entwicklungen erfüllen uns alle mit tiefer Sorge. Das Virus wird weiter mutieren und vielleicht noch ansteckender und gefährlicher werden. Russlands Überfall auf sein Nachbarland könnte der Beginn eines Flächenbrands, eines Atomkriegs oder eines Rückfalls in die fatalen Fehler des 19. und 20. Jahrhunderts sein. Doch an all dem können wir nur begrenzt viel ändern. Handlungsfähig hingegen bleiben wir bei unserer Reaktion auf Technologie. Bei aller Sorge über Seuchen und Krieg bietet sich hier ein Handlungsfeld, auf dem wir mit Aussicht auf Erfolg gestalten können.
Geschrieben worden ist dieses Buch vor einigen Jahren. Hiermit liegt es nun in einer Taschenbuchausgabe vor. Bei der Durchsicht des Textes habe ich ihn behutsam an aktuelle Daten und Entwicklungen angepasst. Allerdings habe ich das Buch in seinen Grundzügen unverändert gelassen. Neuauflagen sollten – so meine Überzeugung – immer auch einen Einblick in das Denken des Autors zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung gewähren. Dies soll auch hier bei allen notwendigen Aktualisierungen versucht werden.
Christoph Keese
Berlin, im Frühjahr 2022
Das Lexikon der aussterbenden Berufe
Über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt streitet die Wissenschaft. Studien kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Als gesichert gilt jedoch, dass etwa die Hälfte der Jobs infrage steht. Der Wandel betrifft auch hoch qualifizierte Berufe. Vor Arbeitslosigkeit schützt am besten die Bereitschaft, sich auf die Veränderungen einzulassen und entsprechend umzudenken.
Eine Studie sorgte 2013 weltweit für Schlagzeilen: »Die Zukunft der Arbeit: Wie anfällig sind Jobs für die Computerisierung?«, vorgelegt von Carl Benedikt Frey, einem deutsch-schwedischen Wirtschaftshistoriker. Er ist Professor an der Oxford University und Direktor des Programms zur Erforschung der Auswirkungen von Technologie auf den Arbeitsmarkt.
Ein einziger Satz im Vorspann der Studie katapultierte Frey auf die Bühnen der wichtigsten Kongresse, in Talkshows und in die Beraterzirkel von Regierungen: »Nach unseren Schätzungen sind ungefähr 47 Prozent der US-Arbeitsplätze in Gefahr.« Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Die Hälfte aller Erwerbsmöglichkeiten bedroht? Das wirtschaftliche Aus für Hunderte von Millionen Menschen statistisch gewissenhaft vorgerechnet von der Oxford University? Das musste entweder falsch sein oder eine der größten Sensationen in den Wirtschaftswissenschaften seit Karl Marx. Frey und sein Co-Autor Michael A. Osborne hatten sich aus methodischen Gründen zwar auf die USA konzentriert. Doch die Ergebnisse ließen sich mühelos auf andere Industrieländer wie Deutschland, Frankreich oder Japan übertragen. Die beiden Forscher waren die ersten Wissenschaftler, die systematisch der naheliegenden Fragestellung nachgingen, wie Digitalisierung und einzelne Berufsbilder zusammenhängen. Sie trauten sich als Erste, konkrete Zahlen abzuschätzen, genaue Tätigkeitsfelder zu benennen und präzise Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Ihre Arbeit löste eine Flut weiterer Studien aus. Viele davon widersprechen den Ergebnissen, andere stützen sie; eine heftige wissenschaftliche und politische Debatte entbrannte. Nachfolgende Studien wie die von Arntz, Zierhan und Gregory (2016) schätzten den Jobverlust auf nur 9 Prozent ein, wieder andere sprachen von 20 oder 30 Prozent.
Im Anhang der Frey-Studie wurden die Ergebnisse noch brisanter. Dort findet sich eine Liste mit 702 detailliert aufgezählten Berufen.* Sie enthält jede erdenkliche Beschäftigungsart und entstammt dem allgemein anerkannten sozialwissenschaftlichen Register beruflicher Tätigkeiten. Frey und Osborne haben für jede Tätigkeit aus diesem Register sorgsam kalkuliert, wie hoch der Anteil der Fertigkeiten ist, die moderne Computer, Programme und Roboter preiswerter und hochwertiger ausführen können. Sie gingen dabei von einer zentralen Annahme aus: dass alle menschlichen Tätigkeiten zu automatisieren sein werden, die auf Mustererkennung und Reiz-Reaktions-Schemata beruhen, dass andererseits aber alle Aufgaben weitgehend unberührt bleiben, die auf Empathie und sozialer Interaktion basieren. Ausgehend von dieser Hypothese, listen Frey und Osborne die 702 verschiedenen Berufe nach der Wahrscheinlichkeit ihrer Abschaffung durch Computer auf. Auf Platz 1, also dem Rang mit der geringsten Wahrscheinlichkeit, steht der Beruf des Erholungstherapeuten, also das Tätigkeitsfeld der Entspannungsmasseure, Wellnesstrainer und Yogalehrer. Dieses Berufsbild gilt als ausgesprochen sicher. Es ist der Champion unter den sicheren Jobs. Den Grund dafür kann man sich leicht vorstellen. Menschen besuchen Masseure und Therapeuten vor allem wegen der sozialen Interaktion. Sie wollen von Menschen berührt werden und mit Menschen sprechen. Kein Massagesitz im Auto oder in der Flughafenhalle wird meine freundliche Masseurin Suzanna jemals ersetzen können. Kein Roboter heitert meine Stimmung so treffsicher auf wie der kernige Kneter Igor mit seinen Muskelpaketen. Ein Schlag seiner Pranke auf meine Schulter und sein geknurrtes »Alles gut?« reichen mir als Stimulus für einen ganzen Tag.
Die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens von Erholungstherapeuten hat Frey mit 0,28 Prozent berechnet– der niedrigste Wert auf der ganzen Liste. Vermutlich ist Erholungstherapeut also der Beruf, den man seinen Kindern raten sollte, wenn man sie absolut sicher vor Arbeitslosigkeit schützen möchte. Drogentherapeuten und Sozialarbeiter folgen gleich im Anschluss, ebenso wie Psychologen und Grundschullehrer. Auch das ist leicht zu verstehen. Erfolgreiche Entzugsprogramme per Computer werden wohl eine Randerscheinung bleiben. Bandenkriege in sozialen Brennpunkten schlichtet kein Roboter so gekonnt wie ein Mensch, und Kindheitstraumata lassen sich nicht so leicht von Amazons freundlicher Alexa-Computerstimme behandeln. Auch die Vorherrschaft des Menschen im Grundschulwesen beruht auf handfesten Tatsachen. Zwar kann man Erwachsenenbildung recht gut per Computer vermitteln, weil der Wissenserwerb im Vordergrund steht. I-Dötzchen jedoch erwerben in der Grundschule weit mehr als nur Sachwissen. Sie erleben Eingliederung in eine Gruppe, Konflikte mit Klassenkameraden, Entstehen und Zerbrechen von Freundschaften und das Entwickeln eines Gefühls für den eigenen Wert, vielleicht sogar die erste Liebe und den ersten Liebeskummer. Solange wir leben, werden solche komplizierten sozialen Prozesse wahrscheinlich nur von Menschen begleitet werden können. Maschinen damit zu beauftragen, gilt als so hoffnungslos, dass die meisten Geldgeber erst gar kein Kapital und die meisten Gründer keine Zeit darauf verschwenden. Entsprechend wenig wird dazu geforscht. Deswegen steht die Grundschullehrerin auf Freys Liste um 50 Plätze sicherer da als die Vorstandsvorsitzende oder die Geschäftsführerin eines Unternehmens. Investitions- oder Personalentscheidungen zu treffen, lässt sich leichter in Algorithmen fassen, als die vertrackte soziale Interaktion in einer 3. Klasse in zivilisierte Bahnen zu lenken.
Wie sieht es nun am anderen Ende der Frey’schen Liste aus, also in der brenzligen Gefahrenzone? Auf Nummer 702, auf dem gefährlichsten Platz, stehen Telefonvermarkter. Warum? Weil die meisten Konsumentscheidungen ins Internet abwandern und Menschen von Werbung per Web oder App effizienter erreicht werden als per Telefon. Ganz unabhängig davon, wie geschickt ein Telefonvermarkter vorgeht, mit dem Medienbruch vom Telefon zum Computer steht er vor einer schier unüberwindbaren Hürde. Er bleibt immer öfter hängen, weil sein Medium– das Telefon– als Ort der Konsumentscheidung rapide an Bedeutung verliert oder schon verloren hat.
In der Nähe des Telefonvermarkters stehen auf Freys Liste Näherinnen, Buchhalter, Versicherungsvertreter, Schadensregulierer, Kreditprüfer, Bankschalterangestellte, Fahrer, Kassierer und Zahntechniker. Das überrascht zunächst. Doch auf den zweiten Blick leuchtet auch dieses Szenario ein. Um ihr Risiko zu begrenzen, müssen Versicherungen und Banken genau bewerten, auf welche Kunden sie sich einlassen. Dafür betreiben sie aufwendige Scoring-Modelle. Die Schufa zum Beispiel ist ein Anbieter solcher Modelle. Versicherungsvertreter und Kundenberater können dem Antragsteller in die Augen schauen. Sie kennen seinen Ruf, hören im Sportverein Geschichten über ihn, riechen eine Alkoholfahne und bemerken nervös verschwitzte Hände. Doch auch beim Aufspüren solcher subtilen Signale machen sich schnell die Computer breit. Sie sind dem Menschen oft schon allein deswegen überlegen, weil sie viel mehr Daten über uns sammeln, als der Versicherungsvertreter oder Kreditberater jemals auftreiben könnte. Eine Alkoholfahne? Das Smartphone weiß, ob der potenzielle Kunde jeden Abend bis nachts um drei in seiner Stammkneipe zecht, oder ob er beim Firmenjubiläum mal eben an einem Gläschen Sekt genippt hat.
Nervös verschwitzte Hände? Die Smartwatch meldet eine harmlose fiebrige Erkältung genauso wie den erhöhten Pulsschlag eines lügenden Kreditbetrügers. Apples Watch – Marktführerin unter den vernetzten elektronischen Uhren – bietet neuerdings sogar eine echte EKG-Funktion – Technik also, für die man bis vor Kurzem den Arzt aufsuchen musste. Der Computer kann die unterschiedlichen Fallarten treffsicherer unterscheiden als der Mensch, der Milliarden Datensätze nicht auszuwerten vermag. Viele von uns tragen den Lügendetektor bereits heute freiwillig und auf eigene Kosten am Arm mit uns herum. Schon bald werden Sensoren in T-Shirts, Blusen und Hemden eingewoben sein. Spätestens dann wird datengestützte Risikoanalyse für Versicherungen und Banken zum besseren Maßstab für Entscheidungen werden als das menschliche Urteil der Vertriebsmitarbeiter. Solche Visionen lösen zwangsläufig Sorgen um Datenschutz aus.
Andererseits werden sich Menschen auch freuen, wenn ihr wachsames Smartphone ihnen zu einem Darlehen verhilft, das sie sonst nicht bekommen hätten. Studenten zum Beispiel bekommen schwer Kredit. Fleißige Studenten werden dankbar sein, wenn ihr Smartphone ihren permanenten Aufenthalt in Seminar und Bibliothek verschlüsselt an die Bank weitermeldet und sie deswegen leichter ein Darlehen erhalten als Kommilitonen mit ausgeprägter Freude am Nachtleben. Menschliche Urteile sind wichtig. Doch sie können auch unfair sein. Computer helfen womöglich, Vorurteile durch Empirie zu ersetzen. Diese Eigenschaft wird Computer zu Stars in allen Disziplinen machen, in denen es um die Analyse menschlicher Verhaltensweisen geht. Werden Computer eines Tages die besseren Menschenversteher sein? Auf eine gewisse Art und Weise sind sie es vielleicht heute schon.
Die Frey’sche Liste besagt, dass Bildung nicht mehr vor Arbeitslosigkeit schützt. Das ist sozialer Sprengstoff. Auf der Roten Liste stehen nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, die es bei technologischen Revolutionen leider immer am härtesten trifft, nämlich diejenigen, die sich am wenigsten wehren und die am schlechtesten ausweichen können: die schlecht Qualifizierten, die gering Bezahlten und die wenig Motivierten. Diese zählen leider auch in der Digitalisierung zu den Betroffenen. Diesmal kommen jedoch neue Gruppen hinzu. In der Digitalisierung trifft es nun auch die gut situierte Mittel- und Oberschicht der Gesellschaft.
Zur Hochrisikogruppe gehören reputierliche Berufe, die noch vor wenigen Jahren als Horte von Wohlstand und Sicherheit galten. Zum Beispiel die Clerks, wörtlich: die »Schreiber«. Kein Wort kommt in Freys Gefahrenzone häufiger vor als Clerk. Gemeint sind alle Formen von Registraturfunktionen, ob am Schalter einer Bank, an der Rezeption eines Hotels oder in den Kanzleien von Anwälten und Steuerberatern. Einkäufer verschwinden laut Frey ebenso wie Makler, Aktuare und Börsenhändler. Ihre Tätigkeiten werden durch Algorithmen ersetzt, die per massenhafter Datenanalyse besser und billiger zu genaueren Ergebnissen kommen als Menschen. »Bildung sichert Arbeit« gilt nicht mehr. Jetzt heißt es: »Umlernen sichert Arbeit.« Wir müssen lernen, Schritt zu halten mit unseren eigenen Werkzeugen.
Carl Benedikt Frey ist ein jugendlich aussehender, schlanker Mann mittleren Alters. Sein offizielles Bild bei der Oxford University zeigt ihn in rotem Pullover unter braunem Cord-Jackett auf einer hölzernen Wendeltreppe, die rechte Hand in die Hüfte gestemmt, die linke um den Handlauf gelegt. Er trägt eine elegante Brille mit schmalen Stegen im Farbton Honig. Seine braunen Haare sind nach rechts gekämmt und bilden widerspenstig eine Tolle. Auf dem Bild hat er etwas von Mahler oder Beethoven. Am auffälligsten sind seine Augen. Adleraugen, könnte man sagen, aber sein Blick wirkt noch schärfer als der eines Adlers. Er fixiert die Kamera streng und ringt sich ein Lächeln ab.
Als ich Carl zum ersten Mal treffe, diskutieren wir auf der Audi-Konferenz Beyond in München über die Folgen der künstlichen Intelligenz. Auch dort fällt mir sein scharfer Blick gleich auf. Er enthält eine Mischung aus Skepsis und Neugierde, aus Misstrauen und Herausforderung. Seine Körpersprache drückt Selbstbeherrschung und Disziplin aus. Er spricht leise und in präzise formulierten englischen Sätzen mit leichtem schwedischen Akzent. Sein ganzer Habitus ist der eines europäischen Intellektuellen, der sein Leben in den Dienst der Empirie gestellt hat. Meinungen, die nicht mit Zahlen belegt werden können, stoßen ihn ab. Er drückt sich auf seinem Sofa dann ein Stückchen näher an die Lehne, streckt unmerklich seinen Rücken durch und schlägt die Beine noch fester übereinander. Das ist seine Art, Abscheu zum Ausdruck zu bringen. Frey ist für seine Studie heftig kritisiert, ja angefeindet und verhöhnt worden. Ebenso laut empfing er tosenden Beifall. Die politische Linke erkor ihn zu einem Kronzeugen, weil seine Ergebnisse auf das Klischee einzahlen, dass Technologie und Kapitalismus auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden. Beides lässt Frey äußerlich kalt. Kritik und Beifall scheinen ihn nicht zu interessieren. Was ihn interessiert, sind volkswirtschaftliche Daten und Analysen.
Als ich meinem Verleger von Carl Benedikt Freys Arbeit berichte, schlägt er vor, aus diesen Daten ein Lexikon der aussterbenden Berufe zu schreiben, angelehnt an Walter Krämers Lexikon der populären Irrtümer. Geworden ist aus der Idee das vorliegende Buch. In der Tat ist es spannend, das Schicksal verschiedener Berufe miteinander zu vergleichen. Interessanterweise liegt das heftig erschütterte Berufsfeld der Medienschaffenden bei Frey auf vergleichsweise sicheren Plätzen. Multimediakünstler und Animatoren stehen mit nur 1,5 Prozent Abschaffungswahrscheinlichkeit unter den Gewinnern, Schriftsteller und Autoren liegen bei 3,8 Prozent und Redakteure bei milden 5,5 Prozent. Alle Facetten meiner Berufsgruppe stehen besser da als Buchhalter und Steuerprüfer, die mit 98 Prozent dem Untergang geweiht zu sein scheinen. Das legt den Schluss nahe, dass die Medien nur einen leichten Vorgeschmack auf die Veränderungen bekommen haben, die anderen Branchen demnächst bevorstehen.
Nehmen wir als Beispiel den Beruf des Versicherungsmathematikers, auch Aktuar genannt. Es handelt sich um einen hochqualifizierten Beruf mit anspruchsvollem Studium. Weltweit gibt es rund 100 000 Versicherungsmathematiker. Ihr Beruf wird weitgehend von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Wer Aktuar bleiben möchte, verlegt sich auf das Trainieren von künstlicher Intelligenz, das Entwerfen von Algorithmen oder das Erschließen neuer Datenquellen. Hierfür werden aber längst nicht alle heutigen Aktuare gebraucht. Das heutige System läuft noch vergleichsweise stabil, weil es machtvolle Strukturen wie Versicherungsvertriebe, bestehende Policen und Assekuranzkonzerne gibt. Diese Strukturen gewähren für eine bestimmte Zeit Schutz. In zehn Jahren aber wird die Technik so weit fortgeschritten sein, dass die Kosten der Ineffizienz heutiger Versicherungen grell zutage treten. Konsumenten werden nicht mehr länger bereit sein, sie zu finanzieren, und daher zu immer radikaleren digitalen Alternativen wechseln. Der kluge Versicherungsmathematiker ahnt das voraus und sattelt rechtzeitig um.
Mit welchen Auswirkungen der Digitalisierung muss speziell Deutschland rechnen? Hierzu hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit im Frühjahr 2018 eine Studie veröffentlicht. Dort heißt es: »Die Digitalisierung hat kaum Auswirkungen auf das Gesamtniveau der Beschäftigung, führt aber zu größeren Verschiebungen zwischen Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus.« Bis 2035 schätzt das Institut den Verlust auf 1,46 Millionen Arbeitsplätze ein, den Zugewinn auf 1,4 Millionen. Zwar bleibt der Saldo fast unverändert, doch für die betroffenen Menschen und Firmen bringt dieser Wandel tiefe Einschnitte mit sich. Laut IAB wird es Jobverluste vor allem bei produzierenden Berufen wie im Metall- und Anlagenbau geben. Auch Monteure, Elektroberufe, Installateure und Maschinenbediener sind betroffen.
Vermutlich schätzt die Bundesanstalt die Gesamtzahl der betroffenen Arbeitsplätze zu niedrig ein. Sie untersucht hauptsächlich erhaltende Innovationen. Auf Disruption legt sie wenig Gewicht. Deswegen weichen ihre Zahlen stark von Freys Ergebnissen ab. Als Gegenprobe kann eine sehr solide Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem März 2018 dienen. Sie kommt zu dem Schluss, dass im Schnitt aller 32 OECD-Mitgliedsländer 14 Prozent aller gegenwärtigen Berufe hochgradig automatisierbar sind und deswegen wahrscheinlich weitgehend verschwinden werden. Weitere 32 Prozent der Berufe weisen ein Risiko zwischen 50 und 70 Prozent auf. Deutschland liegt im internationalen Vergleich auf Platz 6 der Gefährdungsrangliste. Noch stärker gefährdet sind nur Japan, Griechenland, die Türkei, Litauen und die Slowakei. Auf den am wenigsten gefährdeten Plätzen liegen Norwegen, Neuseeland und Finnland. Auch wenn die OECD-Studie zu etwas anderen Werten gelangt als Frey und Osborne, so liegen die Ergebnisse doch nah genug beieinander, um die Beschäftigung mit ihren Folgen dringend erscheinen zu lassen. Im Kern sagt auch die OECD-Studie, dass etwa die Hälfte der Gesellschaft vom digitalen Wandel betroffen sein wird. Das ist Anlass genug, sich dem Thema zu widmen. Hören wir also den Tenor heraus: Der Wandel steht bevor, und er zeitigt eine gewissenhafte Auseinandersetzung.
Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, mit welchen psychologischen Mustern wir auf Wandel reagieren. Das ist wichtig, um den vielen Unsicherheiten, die uns derzeit bedrängen, robust und wirkungsvoll begegnen zu können.
Aus diesem Kapitel halten wir fest:
Deutschland gehört zur Hochrisikogruppe der OECD-Länder hinsichtlich des Risikos des Arbeitsplatzverlustes durch Digitalisierung.Nach anerkannten Studien wie Frey und OECD sind über 40 Prozent aller Berufe betroffen, wobei die Gruppe mit dem höchsten Risiko etwa 14 Prozent der Berufe umfasst.Menschen mit mittleren und hohen Qualifikationen sind von dem Wandel ebenso betroffen wie Menschen mit niedrigen Qualifikationen.Tätigkeiten mit Schwerpunkt auf Mustererkennung und Reiz-Reaktions-Schemata sind in erster Linie von dieser Entwicklung betroffen, während Berufe, die Empathie und soziale Interaktion erfordern, als weitgehend sicher gelten.Über den Zeithorizont des Wandels liegen keine präzisen Daten vor. Auszugehen ist von einem Zeitraum zwischen 5 und 20 Jahren.* Zu finden unter: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
»DAS KÖNNTE SEIN, ABER DAS WIRD NICHT PASSIEREN.« Die Psychologie der Betroffenen
Sorglosigkeit trotz guten Grunds zur Sorge
Trotz oder gerade wegen der aktuellen, pandemisch wie weltpolitisch begründeten Unsicherheiten: Viele Menschen blenden den digitalen Wandel aus. Sie denken nicht darüber nach, was er für sie und ihr Unternehmen bedeutet. Die notwendige Debatte in den Unternehmen unterbleibt.
Sabrina Krollnik ist eine Buchhalterin, die mir beim Zusammenstellen meiner Unterlagen für das Finanzamt hilft. Sie ist 41 Jahre alt, lebt in Berlin, arbeitet in einem Steuerbüro und hat einen zwölfjährigen Sohn namens Malte. Ihr Mann ist Installateur. Es sind kleinere Betriebe und Freiberufler, die auf Krollniks Dienste zurückgreifen. Zu ihren Klienten gehören Handwerker, Taxifahrer, freie Journalisten, Fotografen, Illustratoren und Übersetzer. Krollnik sortiert Quittungen, kontiert Belege, gibt Daten bei der Datev ein, verschickt Monatsberichte, füllt Umsatzsteuervoranmeldungen aus, kontrolliert Kontoeingänge, mahnt Gläubiger an und sorgt für das zügige Bezahlen von Rechnungen. Sie verdient, als ich sie das erste Mal treffe, 42 800 Euro im Jahr; netto bekommt sie monatlich 2462 Euro heraus.
Ich spreche mit Sabrina Krollnik, weil ich erfahren möchte, wie sie den digitalen Wandel einschätzt. Laut Studien gehört sie zu einer Hochrisikogruppe: Carl Benedikt Frey hat die Wahrscheinlichkeit des Jobverlusts für Buchhalter mit 98 Prozent berechnet. Fast alles, was Sabrina Krollnik erledigt, werden Computer bald besser und billiger bewältigen können.
»Glauben Sie, dass Computer Ihnen die Arbeit wegnehmen könnten?«, frage ich. Sie schaut mich erstaunt an: »Wissen Sie, was bei mir los ist?«, antwortet sie. »Die Leute stellen mir ganze Schuhkartons voller Belege auf den Tisch. Zerknittert, gefaltet, zerknüllt. Nichts ist ausgefüllt. Ich darf es dann sortieren. Ich darf in den Kalendern der Kunden nachschauen, wen sie zum Mittagessen eingeladen hatten. Da ist überhaupt nichts mit Digitalisierung. Mein Beruf wird nicht verschwinden, solange meine Kunden so chaotisch bleiben, wie sie nun einmal sind. Ordnung werde ich in sie nicht mehr hineinbekommen, das dürfen Sie mir glauben.«
»Aber es könnte doch sein, dass Ihre Kunden die Belege künftig per App einscannen«, halte ich entgegen. »Oder dass Restaurants elektronische Rechnungen verschicken, die in Kopie direkt ans Finanzamt gehen. In Brasilien gibt es das schon. Der Computer des Restaurants trägt automatisch die Namen und Steuernummern der Gäste ein. Er bezieht diese Daten aus dem Reservierungssystem. Wenn das auch bei uns eingeführt wird, braucht man dafür keine Buchhalter mehr.« – »Ja, das könnte sein, aber das wird nicht passieren«, antwortet sie resolut. »Meine Kunden hassen Belege und werden sie ganz bestimmt nicht einscannen. Sicher möchten sie auch nicht, dass ihr Lieblingsrestaurant direkt mit dem Finanzamt über sie spricht. Und selbst wenn das eines Tages kommen sollte, ist damit ja noch nichts kontiert und gebucht. Das muss dann immer noch ich machen.«
»Kontieren und Buchen kann von Algorithmen erledigt werden«, sage ich. »Das ist ziemlich einfach. Der Buchungssatz für Bewirtungen ist immer der gleiche. Das lernt ein Computer in Windeseile.« Sie zuckt mit den Schultern: »Mag sein. Aber Beratung brauchen die Menschen immer. Ich glaube, die Leute werden immer lieber zu uns kommen als zu einer Maschine. Bei uns können sie die vielen Fragen stellen, die sie auf dem Herzen haben.« – »Zum Beispiel?« – »Zum Beispiel heute Morgen«, sagt sie. »Ein Kunde ruft an und möchte wissen: Kann er den Seat-Leon-Jahreswagen, den er kaufen möchte, über seine Firma laufen lassen und in fünf Jahren abschreiben, wenn er jetzt 5000 Euro Anzahlung auf den Leasingvertrag leistet?« Sie schaut mir etwas schnippisch in die Augen: »Und, kennen Sie die Antwort? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kenne sie. Kein Computer kommt so schnell an meine Erfahrung heran. Probieren Sie es einmal aus. Fragen Sie Amazons Alexa. Ich habe es aus Spaß kürzlich ausprobiert. Alexa hat keine Ahnung von Steuern. Da ist Alexa blank. Aber nur einmal angenommen, das Gerät gibt irgendwann eine vernünftige Antwort: Was passiert denn, wenn das Finanzamt hinterher eine andere Meinung als Alexa vertritt? Angenommen, das Finanzamt schickt meinem Mandanten trotzdem eine Nachforderung. Dann kann ihn nur noch ein guter Steuerberater retten. Wenn das passiert, steht mein Kunde von heute Morgen sofort wieder auf der Matte.«
»Und wenn eines Tages auch das Finanzamt voll digital läuft?«, frage ich weiter. »Wenn da gar keine Fehler mehr passieren und die Algorithmen dort auf genau demselben Stand sind wie Alexa? Wenn zwei Roboter untereinander die Steuern Ihres Mandanten ausrechnen und der Kunde weiß, dass sein Roboter genauso hartnäckig für ihn kämpft wie Sie, bloß für 3 Euro im Jahr statt für 1800 Euro?« Nun schaut Frau Krollnik mich fast strafend an.