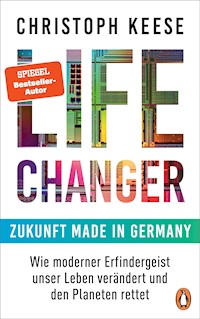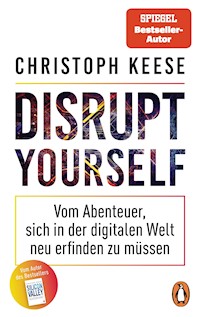2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die schonungslose Bestandsaufnahme unserer Wirtschaft: Wir können alles - außer digital!
Was kann Google, was Volkswagen und Bosch nicht können? Unsere Maschinenbauer, Autoindustrie, Energieversorger, unser Handel, unsere Banken und Dienstleister, aber auch unsere Politiker – Deutschland hat das 21. Jahrhundert mit einem Fehlstart begonnen. Werden wir digitale Provinz oder gelingt uns die Wende zum "Silicon Germany"? In seinem neuen Buch unterzieht Christoph Keese, Autor des Bestsellers „Silicon Valley“, die deutsche Wirtschaft einem Praxistest in Sachen Digitalisierung. Konkret und anschaulich zeigt er, wo die Schwachstellen sind und wie wir den Rückstand aufholen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
WIR KÖNNEN ALLES, AUSSER DIGITAL – DIE SCHONUNGSLOSE BESTANDSAUFNAHME UNSERER WIRTSCHAFT
Unsere Maschinen- und Autobauer, unsere Energieversorger, unser Handel, unsere Banken und Dienstleister, aber auch unsere Politiker – Deutschland hat das 21. Jahrhundert mit einem Fehlstart begonnen. Werden wir digitale Provinz oder gelingt uns die Wende zum »Silicon Germany«? Christoph Keese unterzieht die deutsche Wirtschaft einem Praxistest in Sachen digitale Transformation. Konkret und anschaulich zeigt er, wo die Schwachstellen sind und wie wir den Rückstand vielleicht doch noch aufholen können.
Der Autor
Christoph Keese, Jahrgang 1964, studierte Wirtschaftswissenschaften und absolvierte die Henri-Nannen-Journalistenschule. Für Axel Springer war er 2013 ein halbes Jahr in Palo Alto. Er ist einer der maßgeblichen Digitalisierungsexperten und ein gefragter Vortragsredner. Sein Buch »Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt« wurde ein Bestseller.
Weitere Informationen zu unserem Programm unter www.knaus-verlag.de
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Christoph Keese
Silicon Germany
Wie wir die digitale Transformation schaffen
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2016
beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Jonas Wegerer
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-19583-0V004
www.knaus-verlag.de
Für Caspar, Nathan und CamillaIn Erinnerung an meinen Vater
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
DIELAGE
Im Land des digitalen Defizits
DIEGRÜNDE
Vernetzung: Wir verbinden Systeme nicht
Produktion: Wir verlassen uns zu sehr auf alte Stärken
Spezialisierung: Wir denken in Fachgebieten und meiden Risiken
Management: Wir belohnen Perfektion und bestrafen Fehler
DIEHERAUSFORDERUNGEN
Technologie: Durchbrüche revolutionieren die Wirtschaft
Plattformen: Produzenten werden an den Rand gedrängt
Disruption: Alte Märkte kollabieren, neue springen hervor
Geschäftsmodelle: Das Wie entscheidet über den Erfolg
DIESZENARIEN
Automobil
Banken
Versicherungen
Telekommunikation
Energie
Wohnen
Handel
Logistik
Gesundheit
WASUNTERNEHMENTUNSOLLTEN
Strategie: In die eigenen Kannibalen investieren
Führung: Vom Anspruch auf Allwissen verabschieden
Innovation: Großes denken, Neues wagen
Standort: Dorthin gehen, wo die Talente sind
Transformation: Kritische Masse durch Lernen schaffen
Integration: Freiheit lassen und nicht erdrosseln
Organisation: Netze flechten und Pyramiden verkleinern
WASPOLITIKUNDGESELLSCHAFTTUNSOLLTEN
Regierung: Ein Digitalministerium gründen und Kommunikationsnetze ausbauen
Regulierung: Freiräume für Innovationen schaffen
Finanzierung: 30 Milliarden pro Jahr für Start-ups organisieren
Justiz: Schnell eintragen, kompetent Recht sprechen
Bildung: Wissenschaft stärken, Universitäten reformieren
Werte: Eine Charta der digitalen Rechte und Chancen schreiben
DIEZUKUNFT
Technikmuseum oder Silicon Germany?
ANHANG
Dank und Kontakt
Literatur und Quellen
Index
Vorwort
»Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt.«
William Ford Gibson,Science-Fiction-Autor,Erfinder des Worts Cyberspace
Dieses Buch geht zwei Fragen nach, die mich beschäftigen, seitdem ich im Sommer 2013 von einem halbjährigen Arbeitsaufenthalt im Silicon Valley nach Berlin zurückgekehrt bin: Wie konnte es passieren, dass Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung so gründlich verpasst hat? Und was können wir tun, um den Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen? Mir sind diese beiden Fragen als Bürger wichtig, aber auch aus persönlichen Gründen. Die Rückkehr aus Palo Alto ist mir schwergefallen. Schon einmal, im Sommer 1981, hatte ich das Silicon Valley nach einem Jahr als Austauschschüler verlassen und dadurch das Goldene Zeitalter des Computers verpasst, das ich in seinem Zentrum hätte miterleben können. Jetzt, im Jahr 2013, fürchtete ich, wieder aus der Mitte der Welt abzureisen, diesmal im Goldenen Zeitalter des Netzes. Meine Familie war mit mir nach Palo Alto gezogen. Unsere Kinder Caspar, Nathan und Camilla liebten die Stadt, mochten die Schule und hatten Freunde gefunden. Schon auf dem Rückflug bereute ich die Heimkehr. Warum führte ich die Kinder fort aus dem Land der Inspiration, des Erfindungsgeists, des andauernden Aufbruchs, der glänzenden Bildung und der sicheren Arbeitsplätze? Ich redete mir ein: weil Deutschland aufholen sollte und ich dazu beitragen kann. Mit diesem Gedanken rechtfertigte ich unsere Rückkehr vor mir selbst. Und mit diesem Gedanken endete auch das Buch, das ich über unsere Zeit in Palo Alto geschrieben habe: Silicon Valley– Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt (Knaus, 2014).
Mein neues Buch beschreibt nun, was nach der Rückkehr geschah. Kaum in Deutschland angekommen, begann ich mit der Suche nach Antworten auf die beiden Fragen. In meinem Beruf habe ich es tagein, tagaus mit digitaler Transformation zu tun, innerhalb unseres Unternehmens und darüber hinaus. So konnte ich berufsbedingt mit Hunderten von Menschen über das Thema sprechen, unter vier Augen, auf Kongressen, bei Vorträgen, in Firmen und Ministerien, in Berlin und fast allen Regionen Deutschlands, in Brüssel und in anderen europäischen Hauptstädten. Dabei entstand ein Bild mit vielen Details. Meine ursprüngliche Ungeduld mit Deutschlands Rückständigkeit wich einem tieferen Verständnis für seine Psychologie. Für seine Ängste, seine Sorgen, seinen Stolz und seine Hoffnungen. Es wäre leicht, unserem Land vorzuwerfen, dass es das Internet nicht versteht, satt und zufrieden am Erreichten festhält, in starren Strukturen festsitzt und seinen Höhepunkt überschritten hat. Ganz so leicht möchte ich es mir aber nicht machen. Denn wenn alles schlecht wäre, woher kämen dann die großen Erfolge unserer Industrie?
Im Laufe meiner Recherche verstand ich, dass Stärken und Schwächen eng miteinander zusammenhängen. Man kann nicht so einfach stark in der Produktion und gleichzeitig stark in der Digitalisierung sein. Beide Fähigkeiten sind schwer miteinander zu vereinbaren. Also sollten wir verständnisvoll mit uns selbst umgehen. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben uns lediglich auf andere Aufgaben konzentriert als das Silicon Valley. Deswegen sind wir weder besser noch schlechter als die Kalifornier. Nun aber ist die Zeit gekommen, das Digitalzeitalter auch in Deutschland einzuläuten. Wir kommen nicht darum herum, denn die Digitalisierung dringt tief in unsere Schwerpunktbranchen vor. Ja, wir kommen spät, aber nicht zu spät. Noch können wir die digitale Transformation schaffen. Im Angesicht der Niederlage wachsen wir über uns hinaus. Ermutigende Anzeichen gibt es zuhauf. Ich habe Beispiele gesammelt und rege dazu an, sie nachzuahmen. Es könnte sich lohnen. Wir haben die Chance, Arbeit und Wohlstand zu schaffen, die Umwelt zu schützen, Gerechtigkeit herzustellen und sogar unsere Angst vor Daten zu überwinden. Von beidem handelt dieses Buch: von den Gründen des Abstiegs und den Chancen des Aufstiegs.
Im ersten Teil des Buchs beschreibe ich die gegenwärtige Lage, suche dann nach den Gründen für das bisherige Scheitern an der Digitalisierung, schildere die wichtigsten Herausforderungen, beschreibe deren Wirkungen auf einige wichtige Branchen und zeige schließlich, was Unternehmen, Politik und Gesellschaft tun können, um den Wandel zu meistern. Wie schon im letzten Buch berichte ich in einer Mischform aus Reportage, Analyse und politischer Streitschrift. Fast alles, was ich beschreibe, habe ich selbst erlebt. Literatur spielte bei meiner Recherche keine große Rolle. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was um uns herum geschieht. Außerdem gibt es über die meisten Aspekte noch keine Bücher. Dafür ist die Entwicklung zu neu.
Anders als im vorherigen Buch berichte ich dieses Mal auch aus meinem eigenen Unternehmen. Manche Leser werden mir das vielleicht als Befangenheit oder Werbeversuch auslegen. So ist es aber nicht gemeint. Ich halte es lediglich für ratsam, neben vielen anderen Erfahrungen auch jene bei Axel Springer zu schildern. Das Unternehmen ist so stark digitalisiert wie kaum ein anderes in Deutschland: Zwei Drittel des Umsatzes und drei Viertel des operativen Gewinns kommen aus dem Netz. Ein Buch über digitale Transformation wäre unvollständig ohne den Fall Axel Springer. Deswegen hat auch er hier seinen Platz.
Ein Schlüsselerlebnis gab den letzten Ausschlag zum Schreiben. Anfang 2015 erlebte ich einen Schlagabtausch zwischen Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, und einem Unternehmer mit. Es ging um Digitalisierung. Kretschmann schlug einen zuversichtlichen Ton an: »Ich habe den Eindruck, dass die deutsche Industrie die Herausforderung gut und erfolgreich annimmt«, sagte er. »Bei vielen Besuchen in großen und kleinen Unternehmen sehe ich, wie entschlossen digitalisiert wird. Selbst kleine mittelständische Betriebe im Schwarzwald tun das. Ich kann den verbreiteten Pessimismus nicht teilen, dass Deutschland den Anschluss an die Digitalwirtschaft verpasst hat. Natürlich können alle noch viel besser werden. Doch den Abstand zum Silicon Valley holen wir auf.« Auch die deutschen Autofirmen seien gut gerüstet für die Zukunft, meinte Kretschmann: »Sie werden die Wertschöpfungsprozesse rund um das Automobil weiter dominieren. Deutschland ist gut vorbereitet auf die digitale Zukunft.« Kaum hatte Kretschmann geendet, meldet sich der Unternehmer zu Wort. Er widersprach ihm in aller Deutlichkeit: »Deutschland läuft Gefahr, nicht ein neues Silicon Valley, sondern ein deutsches Shenzhen zu werden. Eine verlängerte Werkbank, die von Kalifornien ferngesteuert wird und an der Wohlstandsmehrung der nächsten Jahrzehnte nicht mehr teilnimmt.« Dieser Wortwechsel brachte meine beiden Fragen auf den Punkt: Werden wir ein zweites Silicon Valley oder ein zweites Shenzhen? Und haben wir überhaupt eine Chance, ein zweites Shenzhen zu werden? Schließlich ist diese Sonderwirtschaftszone vor den Toren Hongkongs ein außergewöhnlich großer Erfolg. Erst 1980 auf dem Reißbrett entworfen, leben dort inzwischen mehr als 13Millionen Menschen. Shenzhen ist eine der dynamischsten Städte Asiens. Foxconn sitzt da, Hauptproduzent des iPhones,Arbeitgeber von 300 000Menschen. Müssen wir uns vielleicht sogar glücklich schätzen, wenn wir künftig in der Liga von Shenzhen mitspielen dürfen– als eine der vielen Werkbänke Kaliforniens? Oder gelingt uns noch nicht einmal das, weil das Silicon Valley und Shenzhen einen Pakt bilden, der alles ignoriert, was geografisch zwischen ihnen liegt? Sind wir bald nur noch die Konsumenten dessen, was die USA und Asien entwerfen und bauen? Und wenn ja: Müssen wir uns diesem Schicksal beugen, oder können wir etwas dagegen tun? Ich denke: Nein, wir sollten uns diesem Schicksal nicht beugen, und ja, wir können etwas dagegen tun. Wenn wir jetzt entschlossen handeln, dann schaffen wir das.
Christoph Keese
Berlin, im Sommer 2016
DIELAGE
Im Land des digitalen Defizits
Deutschland hat die Digitalisierung verpasst. Unsere Firmen produzieren vor allem mechanisch erstklassige Maschinen, die elektronisch aber den Anschluss an die Weltspitze verloren haben. Dominiert werden die Industrien des 21.Jahrhunderts von Asien, Israel und den USA.
Während in den USA vollautomatische Google-Autos unfallfrei Millionen von Kilometern über Landstraßen und durch dichten Stadtverkehr rollen, rutsche ich tagelang auf Knien durch den Garten und verlege Begrenzungsdrähte für meinen vollautomatischen Rasenmäher von Bosch. Ich habe mir den neuesten Schrei des schwäbischen Weltkonzerns zugelegt, ein Gerät, von dem Bosch behauptet, es könne ohne menschliches Zutun mähen und per App von unterwegs gesteuert werden. Leider stimmt das nicht. Der Indego Connect, erstanden für 1200 Euro, liefert ein anschauliches Muster für das Unvermögen der deutschen Industrie, den kalifornischen Unternehmen kinderleicht bedienbare Produkte entgegenzusetzen, die sich störungsfrei mit ihrer Umwelt vernetzen. Willkommen im Land des digitalen Defizits. Der Mähroboter ist alles andere als autonom. Zuerst soll ich einen Graben entlang der Rasenkante ziehen und einen Draht darin versenken. So merkt der Roboter, wann Schluss ist. Eine Geduldsprobe. Mal liegt der Draht zu dicht an der Kante, und der Roboter rauscht in die Hecke. Oder zu weit weg – dann bleiben beim Mähen Grasbüschel stehen. Fünfmal ziehe in den Draht wieder heraus, verschließe die Rinne und grabe eine neue. Als der Draht endlich richtig verlegt ist, stürzt sich der Roboter die Kellertreppe hinunter. Nach langwieriger Fehlersuche kommt heraus: Auf die Polung des Kabels kommt es an. Die ganze Anlage steht spiegelverkehrt; ein erneuter Umbau ist nötig. Beim nächsten Versuch bleibt der Roboter an der Ladestation hängen – zu wenig Manövrierraum, obwohl ich die Route vorschriftsgemäß abgezirkelt hatte. Das heißt, wieder abbauen und neu verlegen. Dann geben die Lüsterklemmen an den Kabelenden nach. Ich muss wasserdichte Kupplungen aus Klebeband basteln. Auch das dauert eine Weile.
Nun endlich legt der Roboter los. Zuerst irrt er mehrere Stunden lang ohne Mähen durch den Garten und speichert eine Karte des Geländes in der Cloud. Dann schaltet er seinen Rotor an und mäht tatsächlich Gras. Doch die Verbindung mit dem Smartphone klappt nicht. Beim Starten der App erscheint minutenlang das Wartezeichen. Als schließlich eine Karte des Gartens angezeigt wird, markiert ein Punkt den Standort des Roboters falsch. Er steht nie dort, wo die App behauptet. Auch in seinem Hauptjob macht der Indego keine gute Figur. Auf gerader Strecke verpasst er die Spur, am Hang hackt er Löcher in das Gras, auf weichem Grund pflügt er den Boden um. Das kleine Schwarz-Weiß-Flüssigkristall-Display spricht in rätselhaften Fehlercodes und schickt mich zum Handbuch. Das Buch, geschrieben in einem Dutzend Sprachen und gespickt mit Piktogrammen, warnt seitenlang vor Selbstverständlichkeiten: nicht ins laufende Messer greifen, nicht mit dem Trafo baden gehen, nicht über Kleinkinder fahren. Nirgendwo aber steht, wie man dem Roboter fehlerfreies Mähen beibringen und die App sinnvoll nutzen kann. Nach einigen Wochen des Experimentierens gebe ich enttäuscht auf. Heute steht der Indego unbenutzt im Keller, und ich mähe wieder von Hand. Es bleibt die Frage: Warum kann Bosch nicht, was Google kann? Warum liefern Samsung, Apple und Huawei intuitiv bedienbare, rundum charmante Produkte, nicht aber die deutschen Maschinenbauer?
Boschs Rasenmäher ist nur ein kleines Beispiel für die Unfähigkeit vieler deutscher Firmen, so elegante Systeme zu bauen wie das Silicon Valley oder seine asiatischen Wettbewerber. Nach wie vor laden sie lästige Aufgaben beim Kunden ab. Aufgaben, die anderswo längst von Algorithmen erledigt werden. Noch immer schaffen sie kryptische Oberflächen, die eine intuitive Bedienung unmöglich machen. 30Jahre nach der Erfindung des Apple Macintosh bringen hiesige Unternehmen Geräte heraus, die nichts von dessen grafischer Steuerung gelernt haben, 25Jahre nach Erfindung des World Wide Web kommen Produkte auf den Markt, die im Netz nur stottern. Versäumnisse, die zum Verlust von erheblichen Marktanteilen geführt haben. Wir haben die Chancen nicht ergriffen, die vor uns lagen. Statistiken verkünden Unheil, und die Politik ist besorgt. Fünf der zehn wertvollsten Firmen der Welt kommen inzwischen aus der Digitalwirtschaft. Alle stammen aus den USA, keine aus Deutschland, keine aus Europa. Die zehn wertvollsten Aktiengesellschaften der Welt sind amerikanisch.
Wir Deutschen spielen nicht mehr in der Spitzenliga. Mit jedem Jahr, das ungenutzt vergeht, fallen wir weiter zurück. Der digitale Wandel vollzieht sich mit rasender Geschwindigkeit, auch innerhalb der USA. »Die Überschneidung zwischen den Fortune 500-Firmen heute und von vor 50Jahren beträgt nur zehn Prozent«, sagt Wettbewerbsforscher Justus Haucap von der Universität Düsseldorf. In nur einem halben Jahrhundert hat es 90Prozent der damaligen Stars dahingerafft. So unerbittlich wird die Auswahl weitergehen. Die Anzeichen sind nicht zu übersehen. Deutschlands teuerste Firma (Bayer) ist abgerutscht auf Platz 66 der Weltrangliste, Siemens auf Platz88. »Tech Giants, Manufacturing Midgets« sagt ein inzwischen geflügeltes Wort: Technologie-Giganten und Produktions-Zwerge. PayPals Marktkapitalisierung übersteigt den Wert der fünf größten börsennotierten deutschen Banken. Tesla verkauft vom Model S in Kalifornien und der Schweiz mehr als BMW von seiner 7er-Reihe und Mercedes von seiner S-Klasse. Apple erlöst mit seiner Kombination aus Soft- und Hardware mehr als das Fünffache von dem, was Nokia vor zehn Jahren erwirtschaftete, als die Finnen noch Marktführer auf dem Handymarkt waren. Vernetzte Systeme, eng verbunden mit ihrer Umgebung, haben Einzellösungen vom Markt gefegt. 9500FinTech-Start-ups erfinden die Finanzbranche gerade neu; die wenigsten davon in Deutschland. Über 1000 neu gegründete Firmen befassen sich mit der Erforschung und Anwendung Künstlicher Intelligenz und arbeiten an der nächsten industriellen Revolution. Davon sitzen 500 in den USA, 60 in Großbritannien und nur eine Handvoll in Deutschland. Vor 75Jahren stellte Konrad Zuse den ersten funktionsfähigen Computer in Berlin vor: den Z3. Aus dem Pionierland von einst ist heute ein Nachläufer geworden. Wir leiden unter Neophobie– der Angst vor dem Neuen.
EU-Digitalkommissar Günther Oettinger hat recht, wenn er warnt: »Wir haben den Anschluss verloren.« Er führt ein anschauliches Beispiel an: »Auf der Hannover Messe stellen die deutschen Industrielegenden aus. Festo, Trumpf, Siemens. Sie digitalisieren eifrig. Doch es bleiben digitalisierte Maschinen.« In den USA sei das anders, dort habe man die Zeichen der Zeit erkannt: »Als Präsident Obama nach Hannover kam, hatte er 500Leute im Gefolge: Apple, Google, Facebook. Die bauen keine Maschinen, sondern nur Plattformen und Software. Die machen heute das Rennen.« Leider sieht es nicht so aus, als könnten wir ihnen viel entgegensetzen. Dafür fehlen uns die Qualifikationen– eine Folge jahrzehntelanger Vernachlässigung. Nach einer Studie der EU-Kommission verfügen 41Prozent der europäischen Arbeitnehmer über keine oder geringe digitale Fähigkeiten. Für das Jahr 2020 rechnet die Kommission mit 756 000 unbesetzten Stellen in Europas Digitalindustrie. Diese Stellen können von Einheimischen mangels Qualifikation nicht gefüllt werden. »Zwar benutzen viele junge Leute täglich das Internet, doch ihnen fehlen die Qualifikationen, dieses Hobby in einen Beruf zu verwandeln«, sagt Oettinger. Surfen allein reicht eben nicht. Wer in der Digitalisierung mitspielen möchte, braucht eine handfeste Ausbildung.
Woher sollen die Impulse kommen? Eigentlich von den jungen Unternehmen. Doch Gründer sind in Deutschland immer noch eine rare Spezies. Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland ist seit dem Jahr 2000 um rund ein Drittel gefallen. Bei Gründungen in der Spitzentechnologie lag die Verlustrate bei 40Prozent, bei Informations- und Kommunikationsdienstleistungen hat sich die Zahl sogar halbiert. Spin-offs von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, im Jahr 2000 mit rund 3000 pro Jahr beziffert, haben um ein Drittel auf etwa 1900 abgenommen. Auf der Rangliste des schweizerischen IMD World Competitiveness Centers ist Deutschland aus den Top 10 abgestiegen und auf Platz 12 gerutscht. An der Spitze der Liste stehen Hongkong, Schweiz, USA und Singapur. Uns sollten solche Zahlen nicht gleichgültig sein. Sie zeichnen vor, was künftig in diesem Land geschieht. Mich wundert, warum so wenige Menschen in Alarmstimmung geraten, wenn sie die schlechten Zeugnisse in Sachen Digitalisierung lesen. Was wir brauchen, ist ein neuer Sputnik-Schock. Für ihn gibt es triftige Gründe. Eine Studie von Roland Berger im Auftrag des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) beziffert das Verlustpotenzial durch Digitalisierung bis zum Jahr 2025 in acht Kernbranchen auf 220Milliarden Euro für Deutschland und 605Milliarden Euro für Europa. Getrieben fast allein durch den steigenden Anteil des Digitalen an der Wertschöpfung. Auto und Logistik sind die nächsten Branchen, die es laut BDI trifft. Medizintechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Energietechnik werden folgen, dann Chemie, Luft- und Raumfahrt. Schlimmer noch: Nur rund ein Drittel der deutschen Manager schätzt die eigene digitale Reife als hoch oder sehr hoch ein, sagt eine Studie des Berliner Unternehmens Etventure. Der Rest sieht klare Defizite, tut aber zu wenig dagegen. Nur in sechs Prozent der Großunternehmen ist Digitalisierung das wichtigste Thema. In weniger als der Hälfte der Firmen haben Vorstand oder Geschäftsführung die Transformation zur Chefsache gemacht. Manchmal, weil sie die Bedrohung nicht erkennen, manchmal, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen.
Diese Saumseligkeit bedroht den Standort. »Wir haben die Möglichkeiten für ein digitales Wirtschaftswunder«, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel und schiebt gleich hinterher: »Die Frage ist nur, ob es in Deutschland stattfindet.« Sie beobachtet: »Viele denken: Das selbstfahrende Auto mag ja kommen, aber das ist nichts mehr für mich und mein Berufsleben.«SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel fürchtet, dass wir den wichtigsten Metatrend der nächsten Jahre verpassen: »2015 waren etwa 20Milliarden Geräte und Maschinen über das Internet verbunden, bis 2030 wird sich die Zahl schätzungsweise auf eine halbe Billion erhöhen.« Und er gibt offen zu: »Am meisten Sorgen macht mir die Selbstgewissheit unseres Landes.« Damit kommt er der Wahrheit ziemlich nahe. Einsicht in den Ernst der Lage ist dünn gesät. Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach rechnet nur jeder fünfte angelernte Arbeiter damit, dass die Anforderungen an den eigenen Job in den nächsten fünf bis zehn Jahren steigen werden. »Dabei wird gerade die Arbeiterebene die gravierendsten Änderungen erleben«, sagt Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts. Eine Kluft der Erkenntnis tut sich auf: Arbeiter fühlen sich mehrheitlich sicher, während immerhin 56Prozent der Angestellten einen Wandel auf sich zukommen sehen. Je höher das Amt, desto größer die Sorge. »Unter den Aufsichtsräten und Vorständen herrscht das Gefühl, an der Schwelle einer völlig neuen Zeit zu stehen«, so Köcher. Doch das reicht noch nicht, um einen Wandel herbeizuführen. EU-Digital-Kommissar Günther Oettinger diagnostiziert großen Rückstand und kleinmütiges Denken: »Wir brauchen keine Megabit-, sondern eine Gigabit-Gesellschaft.« Ana Patricia Botín, Aufsichtsratsvorsitzende der spanischen Banco Santander und Europas erfolgreichste Bankerin, stellt fest: »Disruption erfasst jeden einzelnen Sektor der Wirtschaft. Nicht ein einziger Spieler der Cloudindustrie kommt aus Europa. Das sollte uns ernsthaft zu denken geben.« Mit Disruption meint sie die Zerstörung ganzer Branchen durch grundlegende Innovationen. Unbekümmert schaut Deutschland der Erosion seiner wirtschaftlichen Basis zu. Ganze Industrien verschwinden, und niemand weint ihnen nach. Computerindustrie? Fort. Telefone? Verschwunden. Fernseher? Vergangenheit. Batterie? Kurz vor der Bedeutungslosigkeit. Der Aufschrei der Empörung bleibt aus.
Deutschlands Firmen nehmen Technik nicht ernst genug. Nach einem Bericht der Weltbank investieren die Briten gemessen am Anteil des Bruttoinlandsprodukts doppelt so viel in Digitalisierung wie die Deutschen, die USA anderthalb mal so viel. Dabei gäbe es allen Grund, die Digitalisierung ernst zu nehmen, denn das Internet wächst stürmisch weiter. Vor 20Jahren waren weltweit 35Millionen Menschen im Netz, heute sind es 3,4Milliarden. 1995 gab es 80Millionen Nutzer von Mobiltelefonen, heute sind es 5,3Milliarden. In einer gemeinsamen Anzeige mit Gewerkschaften und Verbänden, die mir in einer Zeitung ins Auge stach, frohlockte das Bundeswirtschaftsministerium: »Unsere Zukunft ist digital– entdecke das DE in Industrie«, um dann zu verkünden: »40Milliarden Euro investiert die Industrie pro Jahr bis 2020 in die Digitalisierung ihrer Prozesse.« Unversehens gibt das Ministerium damit zu Protokoll, was die meisten Unternehmen unter Digitalisierung verstehen– die Umstellung ihrer analogen Verfahren auf digital. Mehr nicht. Doch dieses Verständnis von Digitalisierung greift zu kurz. Bestellungen von Fax auf E-Mail zu ändern, wie ein Mittelständler mir kürzlich stolz berichtete, hat wenig mit der Revolution zu tun, die um uns herum geschieht. Alles ändert sich: Technologien, Geschäftsmodelle, Preisraster, Entwicklungsverfahren, Abläufe, Wertschöpfungsketten, Hierarchiestrukturen, Stellenbeschreibungen, Qualifikationsprofile, Karrierewege und Berichtslinien. Mit erheblichen Auswirkungen für die betroffenen Menschen. Laut Weltbank nimmt die Einkommensspreizung in allen entwickelten Ländern zu, und der Anteil der Lohnarbeit am Bruttosozialprodukt sinkt– Maschinen erledigen immer größere Teile der Arbeit, und die Menschen profitieren unterschiedlich stark vom Mehrwert der Maschinen. Viele werden gar nichts davon haben und als Verlierer enden.
Die technische Revolution zieht eine soziale Revolution nach sich. Je langsamer ein Land seine Wirtschaft digitalisiert, desto größer die Gefahr, in diesen Umbrüchen unterzugehen. Nicht nur die deutsche Wirtschaft nimmt die Digitalisierung auf die leichte Schulter, auch die Bürger tun es. Dabei hätten auch sie allen Grund zur Sorge. Zwar ist unter Ökonomen umstritten, wie viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung in den kommenden Jahrzehnten verloren gehen. Doch dass es zu Umwälzungen kommt, gilt als ausgemachte Tatsache. Viel Zustimmung haben Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne von der Universität Oxford für ihre im September 2013 erschienene Studie erhalten. Sie untersuchten 702Berufsgruppen und attestierten den USA, dass 47Prozent aller Arbeitsplätze in diesen Gruppen durch Digitalisierung bedroht sind. Für andere Industrieländer gelten vergleichbare Werte. Im Sommer 2016 treffe ich Carl Benedikt Frey bei einer Konferenz in Berlin. Seine Thesen klingen durch die jüngsten Entwicklungen auf den Märkten noch überzeugender als vor drei Jahren: »Kassierer in Supermärkten, Bankangestellte hinter den Schaltern, Versicherungsmakler, Taxifahrer, Lastwagenfahrer, Kurierboten sind allesamt akut von Digitalisierung betroffen«, sagt er. »Und das sind nur einige Beispiele. Sicherlich kann man mit Fortbildung und Umschulung gegen einen Teil der Arbeitslosigkeit angehen. Aber fraglich ist, ob wir uns so schnell neue Jobs ausdenken können, wie alte verschwinden.« Ich finde das beunruhigend. Jeder Arbeitnehmer hätte guten Grund, sich brennend für Digitalisierung zu interessieren und beizeiten fortzubilden, um vor der großen Welle fit für Veränderung zu sein. Doch davon ist weit und breit nichts zu sehen. Die meisten Deutschen tun so, als werde es nie wieder regnen, bloß weil jetzt die Sonne scheint. Vom Netz verstehen sie wenig, und es ist ihnen herzlich egal. Ein Irrtum: Internet-Philosoph Evgeny Morozov hat recht, wenn er sagt: »Die digitalen Technologien sind unsere beste Hoffnung, aber auch unser schlimmster Feind.« Auch US-Politikwissenschaftler Ian Bremmer macht einen wichtigen Punkt mit seiner Wortschöpfung von der Zero Gravity World: Alles fliegt durcheinander, und jeder muss sich seinen Platz neu suchen. »Alle, die nicht schnell genug denken und adaptieren, werden Verlierer sein«, ergänzt Klaus Kleinfeld, Chef des Aluminium-Konzerns Alcoa, im Interview mit dem Handelsblatt.»Schon vor zwei Jahren hat McKinsey 12 disruptive Technologien identifiziert. Im Laufe der Zeit erkannte ich, dass selbst für Alcoa nicht nur ein paar davon, sondern alle relevant sind.« Über die Studie von McKinsey werden wir später noch zu sprechen haben. Theodor Weiner, Chef der Münchner HypoVereinsbank, warnt in der FAZ:»Die digitale Revolution ist kein Trend mehr, sondern eine fundamentale Umwälzung. Wie wir im 19.Jahrhundert eine Veränderung durch die industrielle Revolution hatten, haben wir jetzt eine Veränderung durch die Digitalisierung.« All diese Äußerungen setzen in Deutschland bisher wenig in Gang. Sie werden nicht ernst genommen. Wir Deutschen lieben Crash-Propheten, wenn es um Waldsterben, Kurseinbrüche, Datenschutz und Hühnergrippe geht. Die Ruhe selbst aber sind wir beim Thema Digitalisierung, obwohl die Gefahren dort wesentlich realer sind.
Die schleppende Debatte wird zusätzlich erschwert durch unklare Bestimmungen des Begriffs Digitalisierung. Nach meinem Eindruck sind fünf unterschiedliche Gebiete gemeint, wenn wir von Digtalisierung sprechen:
Der Grad, zu dem ein Produkt auf analoge oder digitale Methoden zugreift. Ein Beispiel: Der schwarze Stromzähler mit dem drehenden Messrad arbeitet analog, Yellos Sparzähler dagegen digital. Er zeigt die Ergebnisse auf einem Display an und kann sie per Internet übertragen.Der Grad der Vernetzung eines Produkts mit seiner Umwelt. Navigationssysteme in Autos rechnen digital, doch mit ihrer Außenwelt stehen sie kaum in Kontakt.Die Art und Weise, wie Produkte mit ihren Bedienern kommunizieren.Der Grad, zu dem Prozesse an die digitalen Möglichkeiten angepasst worden ist. Webseiten und Apps von Banken funktionieren zwar digital, doch die langen Banklaufzeiten stammen aus Zeiten, als Überweisungsaufträge in Filialen eingesammelt und in der Zentrale verarbeitet werden mussten. Diese Prozesse wurden digitalisiert, ohne von den heutigen Möglichkeiten einer sofortigen Gutschrift Gebrauch zu machen.Der Grad, zu dem neue Geschäftsmodelle aufgegriffen werden, die nur mit digitalen Mitteln umsetzbar sind und früher schlicht unmöglich waren. Banken bieten zwar Kredite online an, ermöglichen aber nicht die Geldleihe zwischen Privatleuten, so wie LendingClub oder AuxMoney das tun.Alle fünf genannten Bedeutungen der Digitalisierung sind von Belang, denn bei allen fünf hinkt Deutschland hinterher. Beispiele begegnen uns auf Schritt und Tritt. Banken schreiben Überweisungen, wie gesagt, erst am nächsten Arbeitstag gut, obwohl das technisch schon in der nächsten Sekunde machbar wäre. Geld, das man am Donnerstagabend nach 17Uhr losschickt, kommt wegen des Wochenendes erst am Montag an. Komplizierte 22-stellige IBAN-Nummern sind Pflicht bei jeder Überweisung. E-Mail-Adressen für den Adressaten erkennen Banken nicht an, obwohl PayPal das schon lange tut. Geld in eine fremde Währung zu überweisen, ist bei Geschäftsbanken langwierig und teuer. 1000Euro in Dollar nach New York zu schicken, kosten 30Euro beim Sender und 20Dollar beim Empfänger. Das Start-up TransferWise erledigt denselben Auftrag schneller und für nur 4,98Euro– ein Zehntel des bisherigen Preises. Apple Pay erlaubt das Zahlen per Auflegen des Fingers auf das iPhone. Es ist keine Geheimzahl mehr nötig. Deutsche Antworten auf technische Lösungen wie diese gibt es entweder gar nicht oder nur zaghaft.
Finanzämter nehmen Steuerklärungen zwar elektronisch entgegen, doch Belege müssen per Post hinterhergeschickt werden. Im elektronischen Elster-Portal der Finanzverwaltung gibt es keine Statusmeldungen. Man muss beim Amt anrufen, um zu erfahren, wie weit die Bearbeitung gediehen ist. Einwohnermeldeamt, Ausweis-Stelle und Autozulassung fordern uns zu persönlichem Erscheinen auf, obwohl andere Länder wie Estland ihre Bürgerämter schon vor zehn Jahren ins Netz verlegt haben. Esten können jeden Rechtsakt per verbindlicher elektronischer Unterschrift und digitalem Personalausweis vom Küchentisch aus erledigen; Deutsche ziehen dafür Wartemarken und bringen ganze Vormittage auf den Fluren von Ämtern zu. Hotels zwingen ihre Kundschaft, nach langen Arbeitstagen an der Rezeption Schlange zu stehen, obgleich sie ihnen den Zugangscode zum Zimmer per App schicken könnten. Handelsketten bieten funktionsarme Online-Shops an, obwohl ihnen Start-ups seit Jahren vormachen, wie man bequeme und praktische E-Commerce-Portale baut. Die Deutsche Bahn investiert eine Milliarde in neue Anzeigetafeln auf den Bahnsteigen, kann aber nach wie vor nicht verlässlich voraussagen, wann ein Zug am Bahnsteig eintrifft. Die App von Germanwings ist nicht in der Lage, sich die Namen seiner Kunden zu merken und ihre Buchung zu finden, ohne dass sie den komplizierten Buchungscode suchen und eintippen müssen. Strom-, Gas- und Wasserversorger kündigen wie vor 100Jahren per Wurfzettel das Erscheinen des Ablesers für »Montag zwischen 8 und 14Uhr« an, statt elektronische Zähler einzubauen, die sich selbst ablesen können. Apps zum Echtzeit-Auswerten des Energieverbrauchs sind Mangelware, und wenn es sie gibt, dann funktionieren sie meist nicht richtig. Ärzte und Friseure sind online kaum zu buchen. Selbst an den größten deutschen Bahnhöfen und Flughäfen nehmen Taxifahrer keine Kreditkarten an; nur eine Minderheit lässt Zahlungen per MyTaxi oder PayPal zu. Taxi-Innungen setzen gerichtliche Verbote von Transport-Plattformen wie Uber durch, Hausbesitzer und Hoteliers torpedieren Airbnb. Statt an einer Reform überholter Regulierungen mitzuarbeiten und Innovationen zu ermöglichen, zementieren sie alte Vorschriften, um ihre Marktanteile abzusichern. Apotheken beharren auf Berufsprivilegien, Notare und Bürokratie verhindern moderne Firmenregister.
Vier Bundesministerien sind für Digitalisierung zuständig und verlieren sich im Kompetenzwirrwarr; ein zentrales Bundesdigitalministerium gibt es nicht. Der Breitbandausbau kommt schleppend voran. Deutschland surft halb so schnell wie Korea. Eine innovative Regulierung für selbstfahrende Autos und Drohnen ist in Verzug. Datenmonopole werden lax bis gar nicht beaufsichtigt; ihre marktbeherrschenden Stellungen können sie ungehindert ausnutzen. Digitalkompetenz wird an Schulen und Universitäten kaum gelehrt. Start-ups leiden an finanzieller Auszehrung, weil zu wenig Wagniskapital fließt. Börsengänge für Hightechfirmen finden nur vereinzelt statt. Einzig beim Datenschutz nehmen Deutschland und Europa führende Stellungen in der Welt ein, behindern damit aber vor allem das Entstehen von Zukunftsindustrien. Über die Chancen der Digitalisierung wird kaum gesprochen. Fragen anzumelden und seine Stirn in Falten zu legen, hat größere Konjunktur, als die Gelegenheit beim Schopf zu packen und einfach Fakten zu schaffen.
Derweil dringen Unternehmen aus dem Silicon Valley weiter nach Europa vor. Boten sie anfangs nur digitale Produkte an, attackieren sie jetzt klassische Branchen. Ein Beispiel: Googles Mutter Alphabet hält eine Beteiligung an der Firma Nest in Palo Alto. Sie stellt Thermostate und Heizungssteuerungen her, die den Energieverbrauch senken und Daten an Energieversorger liefern. Wo ein Sensor hängt, weiß Nest genau, wann die Bewohner für wie lange im Haus sind, welche Energiezufuhr sie benötigen und wie viel Strom die Kraftwerke erzeugen sollten. Die Prognosen sind bares Geld wert, helfen sie doch, Turbinen besser auszulasten und teure Spitzenkapazitäten abzubauen. Nest-Thermostate drängen sich zwischen die Hersteller von Klimageräten und deren Kunden. Sie reduzieren Thermen auf anspruchslose Brenner, die ihre Befehle von Nest erhalten. Der Nutzen liegt auf der Hand. Im Keller meines Hauses läuft eine Gastherme von Viessmann. Pro Monat verfeuert sie 350Euro, weil sie über eine Zeitschaltung gesteuert wird. Je ein Thermostat innen und außen misst die Temperaturen. Messungen in jedem Raum und an allen Ecken des Hauses, um dem Sonnenverlauf zu folgen, sind nicht vorgesehen. Wenn niemand zu Hause ist, heizt die Maschine trotzdem durch. Umprogrammieren lässt sich der Timer nur mühsam. Wenn zu ungewöhnlichen Zeiten alle zu Hause sind, bleibt es kalt. Eine kleine LCD-Anzeige und ein paar Tasten mit winzigen, kaum leserlichen Beschriftungen bilden die Schnittstelle zum Nutzer. Intuitive Bedienerführung? Unbekannt. Kommuniziert wird mit dem Gerät über numerische Codes. Die Bedienungsanleitung zählt über viele Seiten auf, was diese bedeuten. Eine abstrakte, unverständliche Sprache, der ich nicht folgen kann. Dagegen war Microsofts Disk Operating System (DOS) von Anfang der 1980er-Jahre geradezu bedienerfreundlich.
In der Viessmann-Gebrauchsanweisung lese ich zum Beispiel: Liegt die »Codierung 2« des »Mischerkreises« an, dann bedeutet der Code A6:36:»Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).« Was soll das denn heißen? Ich rätsele über die Worte, während ich im kühlen Keller ungemütlich über der geheimnisvollen Anleitung knie. Beim Lesen erfahre ich: Man kann den Code auf Werte zwischen A6:5 bis A6:35 umstellen, was heißt: »Erweiterte Sparschaltung aktiv, d.h., bei einem variabel einstellbaren Wert von 5 bis 35°C zuzüglich 1°C werden Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet, und der Mischer wird geschlossen.« Grundlage dieser Berechnung, teilt mir das Handbuch mit, ist »die gedämpfte Außentemperatur, die sich zusammensetzt aus tatsächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt«. Nun verstehe ich gar nichts mehr. Mit diesem Kauderwelsch tritt einer der größten Heizungshersteller Europas gegen das kinderleicht bedienbare Nest aus Kalifornien an. Ein aussichtsloses Unterfangen.
Eine App gibt es auch von Viessmann. Doch sie bedarf eines zusätzlichen Steuergeräts am Boiler. Leider lässt sich nicht herausfinden, welches Steuergerät das richtige ist– es gibt gleich mehrere davon. Der von mir hinzugerufene Fachmann, ein von Viessmann zertifizierter Installateur aus Potsdam, winkt ab: »Ihr Heizkessel ist mit der App nicht kompatibel.« Ich muss ihm glauben. Eine andere Informationsquelle steht mir nicht zur Verfügung. Also beginne ich die Suche nach einer Alternative. In Europa gibt es zwei Wettbewerber zu Nest: Netatmo aus Paris und Tado aus München. Ich entscheide mich für Tado. Für 330Euro bekomme ich per Post ein elektronisches Thermostat, eine Steuerbox und ein Funkmodul. Eine leicht verständliche Anleitung zeigt, in welche Klemmen der Viessmann-Therme ich die beiden Ausgangskabel der Box stecken muss. Die Sache ist in fünf Minuten erledigt. Das Gerät nimmt automatisch Kontakt zum Internet auf und liefert Daten an mein Handy. Tado erkennt, wann der letzte Bewohner das Haus verlassen hat, und senkt dann die Temperatur ab. Fährt man später am Tag auf das Haus zu, springt die Heizung rechtzeitig an. Es ist warm, wenn man die Tür aufschließt. Schon im ersten Monat sinken die Gaskosten um ein Drittel. Später kommt das Haus sogar mit der Hälfte des Gases aus. Der Kauf des Tado-Geräts hat sich nach zwei Monaten amortisiert. Die App verrät, wann der Heizkessel angelaufen ist, wie hoch die Heizkosten heute sein werden und wie viel die Sonne zur Erwärmung beigetragen hat. Zur Viessmann-Therme habe ich keinen direkten Kontakt mehr. Tado ist jetzt zuständig für ein warmes Haus– den nächsten Boiler werde ich danach aussuchen, ob er zu Tado passt, nicht umgekehrt. Genauer ausgedrückt: Das hätte ich getan, wenn ich nicht Eigentümer Martin Viessmann und seinen Sohn Maximilian kennengelernt hätte. Sie haben die disruptive Gefahr inzwischen erkannt und verordnen ihrem Familienunternehmen derzeit ein eindrucksvolles Transformationsprogramm, von dem auch andere Firmen lernen können. Davon berichte ich später mehr im Kapitel »Management«.
Heizthermen sind sicher nicht der Kern der deutschen Wirtschaft. Doch auch im Kern gibt es Anlass zur Sorge, besonders in der Autoindustrie. Von ihr hängt jeder fünfte deutsche Arbeitsplatz ab. Nehmen wir zum Beispiel den Elektropionier Tesla. Noch baut Tesla nur kleine Stückzahlen. Vom Model S gingen im Jahr 2015 rund 50 000 Stück in den Markt. Zum Vergleich: BMW setzte im selben Jahr 2,25Millionen Autos ab, Mercedes 2Millionen, Audi 1,8Millionen und Porsche 0,25Millionen. Im Vergleich zu den deutschen Premium-Herstellern ist Tesla ein Zwerg. Aber ein Zwerg, der schnell wächst. Schon 2018 sollen 500 000Autos pro Jahr produziert werden statt wie ursprünglich geplant erst 2020. Außerdem setzen Teslas Elektroautos Maßstäbe: bei Drehmoment, Beschleunigung und Reichweite, aber auch in puncto Bedienbarkeit. In der Mittelkonsole des Tesla prangt ein hochauflösender Retina-Bildschirm, dreimal so groß wie ein iPad. Darauf läuft das Navigationssystem von Google. Es ist immer aktuell, leicht zu durchsuchen und enthält Millionen von Informationen, die man in deutschen Autos nur mit seinem Smartphone abfragen kann. Im Vergleich zum Tesla-Schirm wirken die Displays der meisten deutschen Autos klein, verwaschen und unscharf. Navigationssysteme samt Musik, Radio und Fernsehen schlagen bei BMW, Mercedes, Audi und Porsche leicht mit rund 4300Euro zu Buche. Tablets von Apple oder Samsung kosten ein Zehntel dieses Preises und können deutlich mehr. Anders als die Geräte der deutschen Autos holen sie ihre Daten nicht von CD-ROMs, die schnell veralten, sondern aus dem Netz. Aktualisiert werden die Daten über ein breites Netzwerk von Daten-Zulieferern. Manche bekommen Geld für die Informationen, andere nicht. Deutsche Navigationssysteme verlieren von Tag zu Tag an Aktualität. Jede neue Baustelle, jeder Engpass, jede Sperrung wirft sie weiter zurück. Zwar kann man für einen Aufpreis Connect-Funktionen dazubuchen. Sie versprechen ständige Aktualisierung. Doch so aktuell wie Apple und Google sind sie nie, weil ihnen die breiten Datenströme fehlen, die nur in offenen Systemen fließen. Ein Beispiel: Apple und Google zeigen den Verkehrsfluss auf den Straßen mit roten, gelben und grünen Markierungen an– so überraschend präzise, dass man sich fast blind auf sie verlassen kann. Selbst die besten Live-Updates deutscher Hersteller kommen an diese Datenqualität nicht heran. Kein Wunder, denn geschlossene Systeme können niemals so viel wissen wie offene.
Auch bei der Bedienbarkeit liegen die Navigationssysteme der deutschen Autobauer zurück. Dem iPhone rufe ich am Sonntag einfach »Frühstück« zu. Siri, der Sprachassistent, erkennt aus dem Kontext von Uhrzeit und Wochentag, dass ich ein Frühstückslokal meinen muss. Es zeigt mir Restaurants mit Bildern, Bewertungen und Öffnungszeiten an, sortiert nach Entfernung. Was geschlossen hat oder zu weit entfernt liegt, wird gar nicht erst aufgelistet. Ein Druck auf das ausgewählte Restaurant startet die Navigation. Die Adresse muss ich mir nicht merken. Bei Navigationssystemen in deutschen Autos ist eine solche Suche nicht möglich. Auf »Frühstück« reagiert mein Wagen nicht. Ich muss schon wissen, wohin ich fahren möchte. Auch die Eingabe des Ziels, wenn ich es denn kenne, ist kompliziert. Anders als bei Apple dauert das nicht Sekunden, sondern Minuten. Ich habe nacheinander alle deutschen Premium-Hersteller per Mietwagen getestet und die einzelnen Schritte notiert. Ein typischer Ablauf sieht so aus: Erster Tastendruck: Navigation anschalten. Zweiter Tastendruck: »Zieleingabe« auswählen. Dritter Tastendruck: »Ziel eingeben.« Dann die Stadt auswählen– immer wieder von Neuem. Obwohl die Autos in Berlin standen und vorwiegend in Berlin gefahren wurden, wollten die Geräte ständig wissen, in welcher Stadt sie eine Straße suchen sollten. Stadtteile werden oft mit Städten verwechselt. Lag das letzte Ziel in Kreuzberg und sollte es nach Charlottenburg gehen, ist wieder das Buchstabieren von »B-e-r-l-i-n« erforderlich. Besonders irritierend ist die Zweideutigkeit des eigentlich so eindeutigen Orts »Berlin«. Irgendwo in Deutschland muss es ein zweites Berlin geben. Immer wieder fragen mich die deutschen Autos danach, ob ich Deutschlands Hauptstadt meine oder den abgelegenen Marktflecken, der sich irgendwo im Nichts versteckt. Google und Apple halten ihr Publikum mit solchen Fragen gar nicht erst auf. Sie rechnen stattdessen mit Wahrscheinlichkeiten.
Freies Verstehen von Worten ist bei Smartphones Standard, doch in der deutschen Auto-Premiumklasse weitgehend unbekannt. Auf »Kurfürstendamm 193« reagieren die meisten Limousinen nicht. Man muss mühsam buchstabieren: »K-u-r-f-ü-r-s-t-e-n-d-a-m-m 1-9-3«. Natürlich möchten Fahrer wie ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich möchte Fragen stellen wie »Wo gibt es guten Fisch?« oder »In welchem Kino läuft James Bond um 22:30Uhr?«. Die kalifornischen Geräte können diese Fragen beantworten, die deutschen nicht. Läuft der Tank leer, bieten deutsche Autos die Führung zur nächsten Tankstelle an. Doch aktuelle Benzinpreise kennen nur die wenigsten von ihnen. Wenn Wartungen anstehen, leuchten wochenlang Erinnerungen im Display auf. Doch einen Werkstatttermin vereinbaren die Autos nicht von allein. Sie kennen den Inhalt meines elektronischen Kalenders nicht und wissen nicht, wann ich Zeit habe. Schon gar nicht schreiben sie den Auftrag unter Werkstätten der Region aus, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erkunden. Auch mit dem Wechsel und der Lagerung der Reifen bleiben die Fahrer allein.
Die digitale Schwäche der Autoindustrie wird besonders augenfällig, als ich am Lenkrad die Taste für Sprachsteuerung drücke und »Brandenburger Tor« sage. Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen rechne ich mit einer Fehlermeldung. Stattdessen meldet sich eine freundliche Frauenstimme: »Habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest zum Brandenburger Tor? Dann bringe ich dich jetzt dahin.« Zunächst bin ich überrascht, doch dann stellt sich heraus, dass nicht das Auto spricht, sondern Apple. Das iPhone hat sich beim Einsteigen per Bluetooth mit dem Wagen verbunden. Deutsche Premium-Autos schleifen die Anfrage einfach zum Smartphone durch. Sie reduzieren sich auf Mikrofon und Lautsprecher, während sie die intelligenten Leistungen den Kaliforniern überlassen. Erfahrungen wie solche verleiten Autobesitzer dazu, ihre Handys an den Windschutzscheiben zu befestigen. Jeder Saugnapf steht für eine Produktenttäuschung. Wie seltsam, dass wir uns so lange nicht daran gestört haben. Die deutsche Industrie schien bislang nicht bereit und in der Lage, die Fluchtbewegung ihrer Kunden zu den Smartphones aufzuhalten. Im Gegenteil: Sie betätigte sich als aktive Fluchthelferin. Google Car und Apple CarPlay bringen die Handy-Inhalte direkt auf den Schirm vieler Autos. Wenn man im Auto Musik hören möchte, das iPhone aber nicht angeschlossen ist, erscheint eine Meldung:
Es ist kein Gerät mit dem System verbunden.
Ich finde, in dieser Nachricht kommt ein Missverständnis zum Ausdruck, dem viele traditionelle Unternehmen aufsitzen. Sie halten ihre geschlossenen Systeme für ausgefeilter als die offenen Smartphones. Dabei verhält es sich genau umgekehrt. Geräte sind simple Maschinen wie Toaster, Bügeleisen, Kaffeemaschinen oder Luftbefeuchter, Systeme hingegen sind sich wechselseitig beeinflussende Gebilde wie das Sonnensystem, das Periodensystem oder das System der freien Marktwirtschaft. Im Zusammenspiel zwischen Autos und Smartphones sind Mobilgeräte die Systeme und Autos die Geräte. Eigenartig, dass wir Koch und Kellner über so lange Zeit miteinander verwechselt haben.
Von Klaus Hommels möchte ich wissen, warum wir in Sachen Digitalisierung so unbedarft zu Werke gehen. Hommels ist einer der führenden deutschen Privatinvestoren in Start-ups. Skype, Facebook, Xing und Spotify gehörten zu seinen Entdeckungen. Früh erwarb er Anteile an diesen sensationellen Erfolgen und profitierte von den hohen Wertsteigerungen. Er ist einer der besten deutschen Kenner der Digitalisierung. Seine Firma Lakestar sitzt in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes. Wir nehmen in einem der beiden Konferenzräume Platz. Wände aus Glas umgeben uns. Teppichboden aus Naturfaser, roh belassene Ziegelwände und Sesselgruppen verleihen seinem Büro das typische Berliner Start-up-Flair: »Deutschland ist eine Unternehmer- und Ingenieurskultur, aber auch eine Kultur von vorsichtigen Kaufleuten, die das neue Modell noch lernen müssen«, sagt Hommels. Diese Kaufleute reagierten falsch auf lebensbedrohliche Herausforderungen: »Wir denken wie die Grafen im alten Japan. Wir sehen eine Gefahr am Horizont und trainieren unsere Samurai härter und härter. Wir geben ihnen bessere Schwerter und versorgen sie mit besserer Nahrung. Dann aber stehen unsere Samurai im Kampf jemandem gegenüber, der die Feuerwaffe erfunden hat, und der schlägt sie alle aus dem Feld.« Hommels folgert daraus: »Wir können trainieren, so viel wir wollen– es spielt keine Rolle. Wir müssen lernen, die richtige Ebene des Kampfes zu finden. Bisher haben wir sie nicht gefunden. Nicht bei Verlagen, Fernsehen, Musik. Nicht in der Industrie. Wir haben noch nicht verstanden, wie das Spiel läuft.«
Hat Klaus Hommels recht mit seiner Interpretation? Dieser Frage wollen wir in den nächsten Kapiteln nachgehen. Wir begeben uns auf die Suche nach den Gründen für die schleppende Digitalisierung. Dabei wollen wir zunächst die mangelnde Vernetzung untersuchen. Warum tun wir uns so schwer mit dem Zusammenschalten zu größeren Systemen? Beginnen wir also mit der Bestandsaufnahme.
DIEGRÜNDE
Vernetzung: Wir verbinden Systeme nicht
Mit der Digitalisierung haben deutsche Unternehmenfrüh begonnen. Doch sie versäumen es, ihre Produkte nach außen zu öffnen. Hardware wird so gebaut, dass Vernetzung nicht entstehen kann, selbst wenn sie gewünscht wird.
Warum genau halten viele deutsche Produkte in puncto Digitalisierung und Bedienbarkeit im internationalen Vergleich nicht mit? Das können am besten die Leute beantworten, die sie entwickelt haben und bauen. Menschen, die man selten kennenlernt, weil sie kaum öffentlich in Erscheinung treten. Ich beschließe, zuerst die Geschichte des Bosch-Rasenmähers zu erkunden. Sein Beispiel scheint mir besonders gut geeignet. Ein Massenprodukt für den Konsumentenmarkt, irgendwo angesiedelt zwischen Mechanik und digital. Dort also, wo die deutsche Industrie gerade steht: auf halbem Weg vom Maschinenbau zur App-Ökonomie und zum Internet der Dinge. Wer steckt dahinter, und was ging in den Leuten vor, die den Indego Connect verantworten? Ich recherchiere und finde heraus, dass Bosch-Rasenmäher aus England stammen. Aus einer Fabrik, die der Konzern vor Jahrzehnten gekauft und eingegliedert hatte. Der Chef heißt Alex Ronafoldi. Sein Titel lautet »Head of Product Area Robotics. Bosch Powertools, Home and Garden«. Er stammt aus Ungarn und wurde kürzlich zu den Rasenmähern versetzt, um dort die offenkundigen Qualitätsprobleme zu beheben, die auch der Stuttgarter Zentrale aufgefallen waren. Ich rufe ihn an. Ronafoldi spricht perfekt Englisch, wenn auch mit starkem Akzent. Meine Kritik, die ich ihm am Telefon vortrage, wehrt er nicht ab. Im Gegenteil: Er wirkt interessiert und sagt, alle von mir aufgezählten Probleme beschäftigten ihn auch. Ich lerne ihn als integre Führungspersönlichkeit kennen. Ronafoldi will seinem Arbeitgeber dienen und die bestmöglichen Produkte bauen. Wenn ich das nächste Mal in London sei, sagt er, solle ich bitte auf einen Sprung in Stowmarket vorbeikommen. Genau das tue ich einige Monate später.
Das Städtchen Stowmarket, Heimat von 15 000Seelen anderthalb Stunden nordöstlich von London, versteckt sich zwischen den flachen Wiesen und Weiden der Grafschaft Suffolk. Von Londons Liverpool Street Station ruckelt ein Vorortzug der Great Eastern Main Line nach Norden, doch von Great und Main ist den betagten Loks und Waggons nichts anzumerken. Dieseldämpfe beißen in der Nase; nicht alle Gleise sind elektrifiziert. Der Zug läuft im kleinen Bahnhof von Stowmarket ein, einem schmucken Backsteinbau mit angerostetem Eisendach. Ein Taxi bringt mich zu den Suffolk Works, einem betagten Flachbau an der Ausfallstraße. Weithin sichtbar leuchtet das Bosch-Logo an der Stirnseite. Im schlichten Empfangsraum mit niedrigen Decken und kaltem Neonlicht nickt mir die Rezeptionistin zu: »Alex erwartet Sie schon.« Ronafoldi, Jahrgang 1979, begrüßt mich mit ausgestreckter Hand. Er trägt ein schwarz-weiß gestreiftes Hemd und eine bordeauxfarbene Strickjacke. »Kommen Sie, wir setzen uns«, sagt er, führt mich in einen Konferenzraum, schaltet den Beamer an und erklärt mir den Markt für Roboter-Rasenmäher. Die Verkaufszahlen haben sich in den vergangenen fünf Jahren verzehnfacht; der Umsatz hat eine Viertelmilliarde Euro erreicht. Seine Indegos rollen überall dort, wo es grün ist und Menschen Rasen lieben. Er zeigt mir Karten von echten Gärten, die seine Roboter hochgeladen haben: »Wir dachten immer, die meisten Gärten sind viereckig. Aber schauen Sie hier: Sie haben die abwegigsten Formen. Viel komplizierter als vermutet. Wir dachten auch, dass die Gärten größer sind. In Wirklichkeit kaufen sich Leute mit eher kleinen Gärten einen Mähroboter. Eigentlich sind unsere Roboter zu groß und zu teuer dafür. Wir müssen sie kleiner und billiger machen.« Seine Präsentation erinnert mich an das Silicon Valley. Sie zeugt von systematischem Denken: Daten erheben, Daten auswerten, dann das Produkt so schnell wie möglich an die Erkenntnisse anpassen– so arbeitet man auch in Palo Alto. Vermutlich ist Ronafoldi damit auf dem richtigen Weg. »Aber warum kann der Indego so viele Dinge nicht, die er können müsste?«, frage ich nach. Das leuchtet mir nicht ein. Ronafoldi nickt: »Ich muss Ihnen zeigen, in welchem Kontext der Indego steht.«
Er bittet mich in den Nebenraum, einen gläsernen Showroom voller Produkte in Bosch-Grün. »In unserer Sparte bauen wir Powertools für den Garten«, erklärt er. »Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Rasenlüfter, Grasscheren, Laubbläser, Kettensägen.« Ronafoldi drückt mir eine Heckenschere mit mattschwarz glänzendem Schwert in die Hand. Das Gerät ist erstaunlich leicht, trotz des langen Schneidwerks. Ronafoldi sagt: »Genau. Optimales Verhältnis von Batteriegewicht und Leistungskraft. Digital kontrolliert. Es ist so effizient, dass man es den Kunden live vorführen muss, sonst glauben sie seine Kraft nicht.« Dann sieht er mich an: »Sie denken vielleicht, dass deutsche Unternehmen nicht früh genug digitalisiert haben. Aber das stimmt nicht. Die Deutschen waren Pioniere bei der Digitalisierung. Wo sie Schwächen haben, ist bei der horizontalen Vernetzung. Aber nicht bei der Digitalisierung.« Ich bin verdutzt. Das ist nicht die Aussage, die ich erwartet hatte. Wir sind doch eher Spätstarter in Sachen Digitalisierung, sage ich. Doch Ronafoldi schüttelt den Kopf. »Alle modernen Powertools laufen mit Lithium-Ionen-Batterien«, erläutert er und wiegt die Heckenschere in der Hand. »Lithium-Ionen-Batterien funktionieren nur mit digitaler Ladekontrolle. Ohne Digitalsteuerung kann man sie gar nicht betreiben. Seit vielen Jahren geht bei Powertools gar nichts ohne Chips. Deutsche Firmen sind Profis bei der digitalen Steuerung. Besonders Bosch.« Etwa bis 2004 wurden Elektrowerkzeuge von analoger Elektronik kontrolliert, erfahre ich. Dann lief die Analogtechnik in eine Sackgasse. Nennenswerte Leistungssteigerungen versprach nur noch digitale Elektronik, kombiniert mit einer neuen Generation von Batterien. Plötzlich zogen Chips in Bohrmaschinen, Laubbläser und Heckenscheren ein. Ronafoldi: »Zwischen 2004 und 2008 kam eine neue Generation von Ingenieuren ans Ruder. Digital denkende Leute, die in Windeseile Chips in alles einbauten, was sie in die Hände bekamen. Die Produkte wurden dadurch viel besser.« Mit den Chip-Experten hielten auch Programmierer Einzug in die Domäne von Werkzeugbauern. Simple Heckenscheren bekamen 1000Zeilen Programmcode verpasst. Mikrochips für 20Cent pro Stück katapultieren Maschinen, die im Laden 79Euro kosteten, in neue Leistungsklassen, die für diesen Preis vorher undenkbar waren. Akkuschrauber wurden so klein, dass sie in die Hosentasche passten. Ihre Popularität wuchs rasant an. Einzelne Modelle schossen über eine Million verkaufte Exemplare hinaus. »Digitalisierung ist nicht das Problem der deutschen Industrie«, beteuert Ronafoldi. »Glauben Sie mir, wohin Sie auch schauen: Alle Maschinen laufen seit vielen Jahren digital.«
Aus dem, was Ronafoldi mir erzählt, lerne ich eine erste Lektion: Von »Digitalisierungsdefizit« sollte man eigentlich nicht sprechen. Das wäre ungerecht. Es würde die Pionierleistungen leugnen, die Deutschlands Industrie vollbracht hat. Was man mit »Digitalisierungsdefizit« meint, ist eigentlich etwas ganz anderes, und das muss ich noch herausfinden. Jetzt will ich aber erst einmal wissen: »Wenn Sie so viel von Digitaltechnik verstehen, warum leistet Ihr Mähroboter nicht mehr?« Ronafoldi weist zur Tür. »Ich zeige Ihnen die Entwicklungsabteilung«, sagt er. Wir gehen nach nebenan in ein Großraumbüro. Ein Dutzend Ingenieure schaut kurz von den Schirmen auf. Hier sieht nicht viel anders aus als bei einem Start-up im Silicon Valley. Tische und Stühle eng gereiht, Berge von Papier, fast nur Männer. Nur dem biederen Mobiliar sieht man die industrielle Vergangenheit der Suffolk Works an. Im Mittelgang steht ein der Länge nach aufgesägtes Exemplar meines Mähers. Daneben lehnen Probedrucke der Verpackung. Sie interessieren mich besonders. »Wer entwirft die Verpackung und wer formuliert die Werbeversprechen?«, frage ich Ronafoldi. »Eine Abteilung anderswo im Konzern«, antwortet er. »Denen schicken wir unsere Vorschläge.«– »Kennt die Werbeabteilung das Produkt aus eigener Anschauung?«– »Nein, das ginge gar nicht, so viele Verpackungen, wie die im Laufe eines Jahres gestalten müssen.« Mir wird klar: Die Werbeabteilung war es, die das unhaltbare Versprechen auf die Verpackung gedruckt hatte. Leute, die weit weg saßen von der Entwicklung. Sie hatten den entscheidenden Satz auf die Verpackung und die Werbetafeln gedruckt: Echtzeit-Steuerung über eine App mit Live-Karte. Hier spüre ich nun einen deutlichen Unterschied zum Silicon Valley. Dort liegt die Verantwortung für ein Produkt samt Werbung und Verpackung immer im Team. Verpackungsdesigner sitzen in Rufweite der Ingenieure, ebenso die Autoren der Bedienungsanleitung. Niemals würde man im Silicon Valley einen so krassen Unterschied zwischen Produkt und Produktversprechen zulassen.
Das ist Lektion Nummer 2: Arbeitsteilung in Konzernen führt schnell zu gefährlichen Unterschieden zwischen den Leistungen der Produkte und den Versprechen in der Werbung. Ein weiterer Punkt interessiert mich: »Von wem stammen die Chips im Mäher?«, frage ich Ronafoldi. »Von Bosch«, antwortet er. »Und die Akkus? Auch von Bosch?« Er nickt. »Haben Sie das frei entschieden, oder müssen Sie alle Komponenten im Konzern kaufen?« Ronafoldi antwortet diplomatisch: »Bosch stellt ausgezeichnete Komponenten her. Die sind gut für das Produkt.« Eine ausweichende Antwort. Ich frage nach: »Würden Sie sich für einen anderen Chip entscheiden, wenn das hier Ihre eigene Firma und Ihr eigenes Geld wären?« Er bleibt vorsichtig: »Mag sein«, sagt er. »Wir würden uns auf dem Markt umschauen und wohl meistens bei Bosch kaufen. Die Komponenten sind ja sehr gut. Aber vielleicht nicht alles und immer.« Hier bietet sich Lektion Nummer 3 an: Einkaufspflicht innerhalb von Unternehmen kann sich negativ auf Produkte auswirken. Das kann sich schnell zu einem Nachteil gegenüber jungen Unternehmen auswachsen. Start-ups unterliegen keiner Kontrahierungspflicht. Sie suchen sich die besten Komponenten aus, von wem auch immer sie stammen mögen.
Zurück zu Alex Ronafoldi. »Hier ist es, was ich Ihnen zeigen wollte«, sagt er und deutet auf die Platine im oberen Teil des aufgeschnittenen Rasenmähers. »Wenn Sie bemängeln, dass unser Rasenmäher nicht so selbstständig wie ein Google-Auto durch den Garten fährt, einen Begrenzungsdraht braucht und die Karte auf Ihrem Handy nicht in Echtzeit auf dem neuesten Stand hält– hier liegt die Antwort. In den Chips auf der Platine. Sie müssen verstehen: Wir können hier nicht die bestmögliche Maschine bauen, sondern müssen eine technische Lösung finden, die genau in eine Marktlücke passt. Wir suchen ein Optimum, nicht ein Maximum.« Was meint er damit? »Nehmen wir zum Beispiel die Datenübertragung auf das Handy«, sagt er. Ich lerne, dass der Roboter ohne SIM-Karte auskommen sollte. Deswegen übernimmt Bosch die Kosten für einen Übermittlungs-Dienstleister, der auf alle Funknetze zugreift. Um die Kosten überschaubar zu halten, wurde von den Betriebswirten im Konzern ein begrenztes Datenvolumen vorgegeben. »Aufgabe der Ingenieure war es, die Datenpakete so klein wie möglich zu halten«, sagt Ronafoldi. Deswegen sendet der Mäher die Daten nicht kontinuierlich, wie die Werbung behauptet, sondern erst, wenn er ein Segment des Gartens abgemäht hat. Dann muss er stehen bleiben. Die Chips auf der Platine sind so ausgelegt, dass der Roboter nicht gleichzeitig fahren, Daten berechnen und senden kann. Dafür sind seine Chips zu schwach. Sie müssen alles nacheinander erledigen, weil sie es nicht gleichzeitig schaffen. Statt den Indego für den Parallelbetrieb aller Funktionen stark genug auszurüsten, fand ein technisch-wirtschaftlicher Kompromiss statt: Mähen und Datenverarbeiten funktionieren nicht gleichzeitig. Erledigt werden muss immer eins nach dem anderen. Schlimmer noch: Hat sich der Roboter einmal mit dem Netz verbunden, hängen die Daten eine Weile beim Funkdienstleister fest, weil dessen Netze, Router und Server ständig hinterherhinken. Auch sie sind unterdimensioniert, vor allem aus Kostengründen. Wenn sich die Daten irgendwann durch die dünnen Leitungen gekämpft haben, landen sie schließlich auf einem Server von Bosch. Dann erst kann die App des Kunden auf sie zugreifen.
Fünf bis zehn Minuten dauert der ganze Prozess. So lange läuft die Mobilfunksteuerung der Wirklichkeit hinterher. Als ich die Gründe erfahre, klingen sie halbwegs logisch, doch als Kunde würde ich sie trotzdem niemals akzeptieren. Sie sind Ergebnis einer langen Reihe kleiner Entscheidungen, bei der niemand die volle Verantwortung für die Zufriedenheit der Kunden übernahm. Schritt für Schritt verlor das Produkt an Qualität. Jeder in der Kette glaubte, seine Pflicht zu tun, doch alle gemeinsam fabrizierten eine Enttäuschung. Jeder verfolgte andere Ziele, alle hatten unterschiedliche Chefs, für jeden war der Indego nur ein Job unter vielen, für niemanden ein echtes Anliegen. Der Erste, der einen ganzheitlichen Eindruck vom Produkt gewinnt, ist der Kunde. Im Silicon Valley würde so etwas niemals passieren.
Lektion Nummer 4: Dezentrale Arbeitsteilung führt zu mittelmäßigen Produkten. Start-ups im Silicon Valley, die so arbeiten würden, kämen über die Beta-Testphase nicht hinaus. Kunden würden die Prototypen kritisieren und Investoren den Geldzufluss stoppen. Das Start-up wäre pleite. In traditionellen Unternehmen läuft das anders. Die Kundenkritiken des Indego im Web sind größtenteils verheerend, trotzdem preist Bosch seinen Mäher in der Werbung ungerührt weiter als mustergültigen Roboter an, der bestens mit dem Web verbunden ist.
»Warum baut Bosch gute Heckenscheren, Akkuschrauber, Laubbläser und Häcksler, bekommt einen Rasenmäher mit Cloud-Anbindung und Smartphone-Fernsteuerung aber nicht hin?«, frage ich Ronafoldi. Seine Antwort ist interessant: »Das hat viel mit Erwartungen zu tun. Zwei Welten stoßen aufeinander. Einerseits die Welt der Smartphones, von denen 2015 rund eine Milliarde Stück verkauft wurden. Ein riesiges Ökosystem mit Heerscharen von Programmierern, die ausgeklügelte Apps herstellen. Auf der anderen Seite die Welt der traditionellen Produkte, in der wir mit viel kleineren Stückzahlen hantieren, viel weniger Umsatz machen und nicht von den besten App-Herstellern mit Software überflutet werden.« Solange Bosch netzferne Powertools herstellte, argumentiert Ronafoldi, stand das Unternehmen sicher auf eigenem Terrain. »Sobald wir uns aber in die App-Welt hineinbegeben, erwarten die Leute einen Leistungsstandard, wie sie ihn von Samsung oder Apple gewohnt sind.« Echtzeit-Daten, Fernkontrolle ohne Latenzzeit, Live-Update, HD-Bilder, keine Wartezeiten, intuitive Bedienbarkeit, keine Abstürze, stabile Verfügbarkeit der Cloud– alles, was diesen auf dem Smartphone gelernten Ansprüchen nicht genügt, sieht sofort aus wie ein technischer Flop. »Selbst wenn wir es wollten, könnten wir diesen Standard nicht liefern. Die kleinen Stückzahlen geben das nicht her«, meint Ronafoldi. Lektion Nummer 5 folgt aus dem Gesagten: Das Zusammenwachsen der Branchen im Zuge der Digitalisierung setzt traditionelle Unternehmen hohen Erwartungen aus, die sie mit ihren bestehenden Kompetenzen nicht erfüllen können.
Aber warum setzt Ronafoldi seine Entwickler nicht darauf an, den einen perfekten Netzrasenmäher zu bauen? Weshalb investiert er nicht alle Kraft in ein einziges mitreißendes Produkt? So würde das Silicon Valley es machen. Doch Ronafoldi winkt ab: »Das ginge gar nicht. Wir müssen uns um zu viele Dinge gleichzeitig kümmern.« Der Hauptgrund: Baumärkte sind für den Absatz enorm wichtig. An Powertools verdienen die Märkte nicht viel Geld, aber die Geräte locken männliche Kundschaft an und erfüllen damit eine Marketing-Funktion. Deswegen stehen großflächige Elektrowerkzeug-Ausstellungen in den Baumärkten dort, wo in Supermärkten Obst und Gemüse warten: gleich am Eingang, als Anschmecker, Lustmacher und Kompetenzbeweis. Diese Erlebniszonen müssen von den Herstellern mit immer neuen Produkten bestückt werden. Eine einzelne Heckenschere von Bosch reicht da nicht aus, und sei sie noch so gut. Es muss ein halbes Dutzend her. In verschiedenen Größen und Leistungsklassen, obwohl es technisch gesehen eigentlich nur eine perfekte Heckenschere geben kann. Gleiches gilt für Bohrer, Rasenmäher, Häcksler oder Laubbläser. Statt die eine perfekte Maschine zu bauen, wie es das Silicon Valley tun würde, werden Ingenieure vom Handel gezwungen, sich in Dutzenden von Spielarten zu verzetteln. Hinzu kommt: Baumärkte wollen mit Versionen aufwarten, die es nur bei ihnen gibt. Dann können sie Bestpreisgarantien auf riesigen Werbetafeln in ihren Hallen aufhängen: »Wenn Sie dieses Produkt anderswo billiger sehen, bekommen Sie Ihr Geld zurück.« Der Kunde denkt, er macht ein gutes Geschäft. Tatsächlich aber gibt es diese spezielle Bohrmaschine bei der Konkurrenz gar nicht. Ein paar technische Details und die Typennummer unterscheiden sich von den Wettbewerbern. So wird die Geld-zurück-Garantie praktisch niemals fällig. Weil der deutsche Handel wenig vom Netz versteht und den Anschluss an E-Commerce seinerseits verpasst hat, muss er seine Flächen mit Angeboten nach altem Muster befeuern, weil sonst der Umsatz einbricht.
Wir können daraus Lektion Nummer 6 ableiten: Der unterdigitalisierte Handel zwingt den Herstellern seine Strategie auf und lenkt sie von konzentrierter Modernisierung ab. Hersteller und Handel setzen sich gegenseitig unter Druck, immer neue Iterationen bewährter Produkte auszustoßen. Ingenieure werden vom Handel überfordert. Statt Perfektion produzieren sie Vielfalt.
Ortswechsel. Stuttgart, Ingolstadt und München. Mich interessiert, ob das, was ich bei den Mährobotern gesehen habe, auch für Autos gilt. Sind auch Autos so wenig vernetzt, weil ihre Hersteller Geld bei den Komponenten sparen? Ich besuche Automanager und Ingenieure. Nach Gesprächen mit ihnen glaube ich, die Antwort lautet Ja. Nur verläuft der Wirkungszusammenhang andersherum. Hersteller sahen bisher keinen Sinn in der Vernetzung der Fahrzeuge und wählten deswegen Komponenten aus, die Verbindung gar nicht erst zulassen: entweder keine oder nur eine langsame Internetverbindung, unterdimensionierte Rechner, viel zu kleine Speicher. »Bis vor Kurzem herrschte bei uns die Philosophie von Maschinenbauern«, berichtet ein Ingenieur. »Wir glaubten, die Maschine ist perfekt, so, wie wir sie bauen. Niemand sah den Bedarf, nachträglich Software oder Daten ins Auto zu holen. App-Stores– klar, für Smartphones schien das sinnvoll, aber nicht für Autos. Alle möglichen Gründe kamen in internen Debatten gegen ein App-Ökosystem auf den Tisch. Sicherheit, Kosten, Verlässlichkeit, Zahlung, Abrechnung.« Daher sahen Controller und Baureihenmanager keine Notwendigkeit, Autos mit ungenutztem Speicher und freier Rechenkapazität auszustatten. »So absurd es klingt«, sagt der Ingenieur, »Handys für 400Euro kommen fast leer auf den Markt und bieten massenhaft Platz für weitere Anwendungen, Autos für 70 000Euro sind datenmäßig schon voll, wenn sie vom Band rollen.« Handys belegen bei der Auslieferung rund 5Prozent ihres Speicherplatzes mit Daten,Autos fast 90Prozent. Die Fahrzeuge sind randvoll mit Programmen, die sie für den Betrieb benötigen. Für Apps könnte man sie nachträglich gar nicht öffnen, selbst wenn man es wollte. Es fehlt schlichtweg der Speicherplatz. Um Autos mit Gewinn zu produzieren, wird kleinteilig gespart. Terabyte-Speicher, die im Elektronikmarkt 50Euro kosten, werden selbst in Premium-Wagen nicht einmal auf Verdacht eingebaut. Ein Volkswagenvorstand rühmte sich damit, einen Chip für 2,50 Euro gestrichen zu haben. Bei zehn Millionen Autos pro Jahr brachte die Aktion einen zusätzlichen Gewinn von 25 Millionen Euro. Mit solchen Maßnahmen blieb die Digitalisierung auf der Strecke. Erst jetzt ändert sich dieses Denken langsam. Ein Vorstand berichtet: »