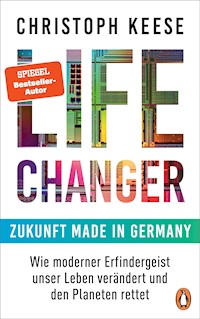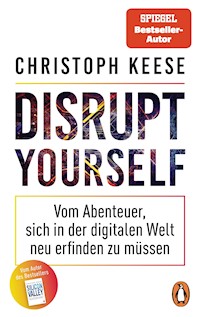6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was mit der digitalen Revolution wirklich auf uns zukommt
Aus erster Hand berichtet Christoph Keese von den Innovationen im Silicon Valley und verbindet die vielen Facetten des digitalen Wandels zum großen Bild. Er traf Erfinder, Gründer, Wagniskapitalgeber und Professoren in Stanford und Berkeley – auf der Suche nach Erfolgsmustern und Treibern der boomenden Internetwirtschaft. Wie funktioniert dieses »Einfach tun, was sonst keiner wagt«? Warum fällt traditionellen Firmen die »disruptive Innovation« so schwer? Wächst uns Google über den Kopf? Was ist der Netzwerkeffekt? Schafft das Internet wirklich Geld, Banken, Einzelhandel, Zeitungen, Bücher und Verkehrsampeln ab? Was muss Deutschland unternehmen, um den Anschluss nicht zu verpassen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Keese
Silicon Valley
Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2014
beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-12258-4V004
www.knaus-verlag.de
Für Caspar, Nathan und Camilla
»Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.«
Carly Fiorina
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
DAS TAL
Die Hauptstadt, die keine sein möchte
Palo Alto: Explosives Gemisch aus Geist und Geld
Analoge Arbeitskultur: Wer nicht am Ort ist, spielt keine Rolle
Stanford und seine Gründer: »Die Vorlesungen besuche ich zur Erholung«
Exklusiver Boom: Die Wertschöpfung im reichsten Tal der Welt erreicht nur die Gebildeten
DIE KULTUR
Technik-Kult: Probleme, gebt uns Probleme
Grenzenlose Innovation: Niemand ist sicher vor dem ständigen Angriff von unten
Hochgeschwindigkeitsökonomie: Die Entdeckung der Schnelligkeit
Risikokultur: Beim nächsten Mal machen wir bessere Fehler
DIE FOLGEN
Skalieren oder verlieren: Vom Zeitalter der Plattformen
Alles dem Gewinner. Die Macht der Monopole
Befreit vom Chef, dafür anderen Zwängen ausgeliefert: Die neue Arbeitswelt
Keine Geheimnisse mehr, nirgends: Das Zeitalter der Echtzeit-Kommunikation
Unbegrenzte Machbarkeit: Der Mensch, hochgeladen in die Cloud
UND JETZT?
ANHANG
Dank
Literatur und Quellen
Index
Vorwort
»Auf gewisse Weise sind wir der Kanarienvogel im Bergwerk. Das erste Schlachtfeld. Uns folgen alle diejenigen, die etwas erzeugen, das digitalisiert werden kann.«
Peter Gabriel, Musiker
Im Jahr 2013 haben meine Frau, unsere drei Kinder und ich für sechs Monate in Palo Alto im Herzen des Silicon Valley gelebt. Im Auftrag meines Arbeitgebers Axel Springer habe ich den digitalen Wandel und seine Folgen für die Medienbranche untersucht, gemeinsam mit meinen Kollegen Kai Diekmann, Chefredakteur von Bild, Peter Würtenberger, Chef unseres Anzeigenvermarkters ASMI, und Martin Sinner, Gründer der Preisvergleichsseite Idealo, die mehrheitlich zu Springer gehört. Am Anfang dieser Recherche stand Unbehagen: Europa hat den Anschluss verloren. Warum werden die Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts nicht hier erfunden? Früher kamen fast alle Durchbrüche aus Europa: Fernglas, Mikroskop, Eisenbahn, Auto, Penicillin, Funk, Radio, Fernsehen und Computer, um nur einige Beispiele zu nennen. Heute liegt Europa in Sachen Digitalisierung, der wichtigsten Technologie der Gegenwart, weit zurück. Google, Facebook, Apple, Twitter & Co. haben wir nicht nur nicht erfunden. Wir hätten sie auch nicht erfinden können. Sie sind mehr als nur geniale Eingebungen begabter Studenten. Sie sind das Produkt einer einzigartigen Kultur, die man mit dem etwas unscharfen Sammelbegriff SiliconValley bezeichnet. Diese Kultur entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit zur Leitkultur des digitalen Zeitalters. Während der Internet-Revolution in Deutschland zu leben, ist ein bisschen so, wie das 19. Jahrhundert in Lissabon zu verbringen. Angenehme Lebensumstände zwar, aber weit ab vom Schuss und abgehängt von der industriellen Revolution. Wir Europäer sehen freundlich-aufgeschlossen dabei zu, wie Kalifornier eine neue Innovationskultur schaffen und damit beispiellose technische Durchbrüche und unternehmerische Erfolge erzielen. Wie dort eine ganze Generation begabter Techniker zu Gründern wird und Millionen Arbeitsplätze schafft, während bei uns Anstellungsverhältnisse in herkömmlichen Unternehmen noch immer als allgemeines Ideal und Vorbild gelten. Wie Milliarden Wagniskapital in die Volkswirtschaft fließen und sie von Grund auf erneuern. Wie Wohlstand von Europa nach Kalifornien abgesaugt wird. Wie kalifornische Unternehmen in einen lebenswichtigen Markt nach dem anderen vordringen und dort durch glänzende Produkte und überragendes Geschick immer größere Marktanteile gewinnen. Wie sie ihre Vorstellungen von Recht und Gesetz durchsetzen. Wie sie die Deutungshoheit über die digitale Welt ausüben. Wie sie bestimmen, was modern und was unmodern ist, was das Internet zu sein hat und was nicht, welche Gesetze dort gelten und welche nicht. Das Internet tut für den menschlichen Geist das, was die Dampfmaschine für den menschlichen Muskel geleistet hat, hat der verstorbene FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher treffend angemerkt: Sie steigert seine Wirkung ins Unermessliche. Was bedeutet das für die einzelnen Bereiche unseres Lebens? Die Debatte darüber wird im Silicon Valley mit voller Wucht geführt, doch bei uns hat sie gerade erst begonnen. Allzu lange fanden Europäer nicht das Geringste dabei, sich nicht in diese Diskussion einzumischen, sich nicht sachkundig zu machen und nicht selbstbewusst ihre Interessen zu vertreten. Dies scheint sich gerade zu ändern, und das ist dringend notwendig. Dieses Buch soll einen Beitrag dazu leisten.
Es wäre einfach, eine Anklageschrift gegen das Silicon Valley zu verfassen. Doch so leicht können wir es uns nicht machen. Das Silicon Valley denkt komplexer und anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Machbarkeit und Moral stehen nicht in einem simplen Widerspruch. Selbst die Leute, die für die NSA programmieren, sind nicht unmoralisch im trivialen Sinne. Sie leben nach ihrer eigenen Moral, einer Moral der Machbarkeit. Wenn man das Silicon Valley verstehen will, muss man sich darauf einlassen. Interessant wird die Auseinandersetzung erst, wenn man Ambivalenz und Vielschichtigkeit dieser Kultur betrachtet und sich bemüht, sie aus ihren Wertvorstellungen, Motivationsanreizen und Verhaltensregeln heraus zu begreifen. Ich nähere mich dem Ort deswegen möglichst unbefangen an und versuche, Chancen wie Risiken aufzuzeigen und sie gegeneinander abzuwägen. Gefragt wird vor allem, was die Entwicklung für uns bedeutet und wie wir auf sie reagieren können.
Das SiliconValley ist ein geografischer Ort, eine Antipode zu Europa, eine exotische Region am anderen Ende der Welt. Aber es ist auch eine Chiffre für eine neue Zeit. Berichtet wird hier von beidem: vom konkreten Ort und vom Geist dieses Orts, der fast überall umherspukt, wo moderne Menschen sich heute bewegen. Jeder, der in das Silicon Valley zieht, wird persönlich herausgefordert. Er sieht sich mit seinen Hoffnungen und Ängsten konfrontiert. Er wundert sich anfangs über alles und kann manches erst mit etwas Abstand erfassen. So ist es auch mir ergangen. Deswegen erzähle ich in diesem Buch auch die Geschichte meiner persönlichen Annäherung an das Tal. Zum Teil im Stil einer Reportage, dann vor allem als eine sachliche Auseinandersetzung mit den Fakten, Entwicklungen und Prognosen.
In Sachen Google bin ich befangen. Mein Arbeitgeber führt eine Reihe politischer und juristischer Auseinandersetzungen mit dem Unternehmen. Es geht um Urheberrecht und den Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Google. Ich habe beruflich viel mit diesen Fällen zu tun. Dennoch bemühe ich mich in diesem Buch um Fairness, Sachlichkeit und eine ausgewogene Darstellung. Das fällt mir nicht schwer. Denn Google ist auch ein geschätzter Geschäftspartner. Wir sind wohl das, was man Frenemies nennt – Freunde und Gegner gleichzeitig. Die Auseinandersetzung ist sinnvoll und notwendig. Jede technologische Zeitenwende hat die Gesellschaft vor grundsätzliche Fragen gestellt. So war es auch nach der Erfindung von Eisenbahn, Dampfmaschine, Telefon, Flugzeug oder Atomkraft. Es prallen unterschiedliche Vorstellungen von Zukunft aufeinander. Nur ein offener Diskurs kann sicherstellen, dass Gesellschaften sich dem Neuen öffnen, ohne ihre Grundwerte dabei aufzugeben. Um nicht mehr und nicht weniger sollte es heute gehen.
Christoph Keese
Berlin, im Sommer 2014
DAS TAL
Die Hauptstadt, die keine sein möchte
Im SiliconValley ballt sich das Herrschaftswissen der Welt. Doch in der Zentrale des Internet duckt man sich am liebsten vor der eigenen Bedeutung weg. Annäherung an das mächtigste Tal der Welt.
Das Tal, von dem wir wissen wollen, wie es unser Leben verändert, könnte unauffälliger nicht sein. Es ist der 12. Februar 2013. Wir sitzen seit 13 Stunden im Flugzeug, die Kinder schlafen mit den Köpfen auf unseren Knien, als unter uns endlich das Silicon Valley auftaucht. Ich sehe aus dem Fenster. Wir durchstechen die dicken Quellwolken über der Golden Gate Bridge. Ein halbes Dutzend Mal bin ich in den vergangenen zehn Jahren hier gewesen, aber die Trivialität dieser Gegend verblüfft mich immer wieder. Nicht die Landschaft ist trivial. Sie ist grandios. Spektakulär. Schöner als vieles andere auf der Erde. Trivial aber ist die Bebauung. Nichts hat sich geändert seit meinem letzten Besuch. Gähnende Langeweile. Eine Weltmacht auf Valium, ein Kraftzentrum unter der Tarnkappe.
Keine Spur von Weltkonzernen, Fabriken oder Forschungslaboren. Das stellt man sich anders vor. Dass Googles Heimat irgendwie mächtig aussieht, bedeutsam und einflussreich. Nichts dergleichen. Keine Hochhäuser, Industriezonen oder Villen mit riesigen Gärten. Die straff geführten Internetkonzerne, gefürchtet für ihren Willen, den Rest der Welt in digitale Kolonien ohne Mitspracherecht zu verwandeln, sitzen in Pappschachteln aus Beton. Milliarden Menschen, heißt es, werden von diesen Konzernen in die elektronische Abhängigkeit geführt, aber warum in gesichtslosen Büroparks? Wird ihnen darin nicht selbst langweilig? Wenn das hier das Rom des Internetzeitalters sein soll, warum baut dann niemand ein Kapitol? Auf Erdbebenspalten errichtet man keine Hochhäuser, heißt es, aber San Francisco tut es doch auch. Warum misst das höchste Gebäude von Palo Alto nur zwölf Etagen? So hoch sind in New York schon die Eingangshallen von Firmen, die nicht ein Tausendstel von dem verdienen, was hier verdient wird. Millionäre und Milliardäre gibt es hier so viele auf so engem Raum wie nirgendwo sonst in den Vereinigten Staaten, warum bauen sie keine Pools in ihre Gärten? Manche tun es, die meisten aber nicht. Warum fällt den Stadtplanern hier kein besseres Straßenraster ein als das Schachbrettmuster – bei all dem Geist und Genie, die in das Design von Apple-Produkten fließen? Unser Airbus, der San Francisco ansteuert, fliegt wie jedes Flugzeug eine 180-Grad-Kurve über Palo Alto. Die Maschine lehnt sich steil auf meine Seite. Unter der Scheibe liegt jetzt flach diese seltsame kleine Stadt. Als Architekturstudent müsste man sicher nicht hierher kommen. Als Medienmanager schon.
Das Silicon Valley ist noch nicht einmal wirklich ein Tal. Schon der Name führt in die Irre. Westlich liegt der Pazifik, und von seiner Küste, mit erstaunlich wenigen Stränden und dafür umso mehr schroffen Felswänden, steigt eine bewaldete Hügelkette an. Sie kann als westliche Begrenzung des »Tals« gelten. Unter Naturschutz gestellt, ist sie kaum besiedelt. Die Hälfte des Silicon Valley ist mehr oder weniger ein Urwald. Östlich des Tals gibt es keine Erhebungen. Die Flanke der Hügel fällt flach ab bis zur Bucht von San Francisco. Erst 25 Kilometer dahinter tauchen wieder Berge auf, weit hinter dem anderen Ufer der Bucht. »Tal« klingt besser als »Hügelflanke«, was es in Wahrheit ist. Das vermeintliche Valley ist 70 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. Davon sind 20 Kilometer Wald und Grassteppe, und nur zehn Kilometer Zivilisation. Das Ganze ist kaum größer als Berlin.
Das letzte Fleckchen Westen, bevor der Osten beginnt, hat Durs Grünbein Kalifornien einmal genannt. Jetpiloten müssen hart ins Ruder greifen, um das Silicon Valley nicht zu verpassen. Eine Minute Überflugzeit, dann ist es schon vorbei. Unsere Swiss-Maschine fährt die Klappen aus und rumpelt über die kleinen Wohnhäuser und flachen Büroquartiere von Menlo Park hinweg, einem Örtchen nördlich von Palo Alto. Hier werden weltweit einmalige 15 Milliarden Dollar Venture Capital pro Jahr ausgegeben, und hier sitzt Facebook mit seiner Hauptverwaltung.
Nach einer Studie würde das Internet, wenn es ein Land wäre, innerhalb von vier Jahren alle anderen Länder der Welt bis auf vier wirtschaftlich überrunden. Nur eine richtige Hauptstadt leistet es sich nicht. Obwohl fünf der sechs meistbesuchten Webseiten der Welt von hier kommen: Facebook, Google, YouTube (gehört zu Google), Yahoo! und Wikipedia. Die sechste Webseite stammt aus China. Trotzdem, Erhabenheit sucht man vergebens. Wenn man New York anfliegt, sieht man schon an der Skyline, wie reich und mächtig Manhattan sein muss. Die New Yorker zeigen, was sie haben. Ihr Selbstbewusstsein wächst in den Himmel. Höhere Hochhäuser anderswo sind ihnen ein Stachel im Fleisch. Auch Los Angeles ist nicht für Bescheidenheit bekannt. Reichtum und Luxus springen den anfliegenden Besucher schon in Form der vielen Tausend Luxuspools durch die Scheibe an. Radikales Understatement dagegen herrscht im Silicon Valley. Mich erinnert die Gegend aus der Luft an eine Kleingartenkolonie. Nichts sticht hervor, alles duckt sich weg. Von hier aus wird das 21. Jahrhundert gesteuert. Hierher fließen die gewaltigen Geld- und Datenströme der Digitalwirtschaft. Noch nie haben so wenige Menschen so viele Informationen über alle anderen Menschen besessen. Und trotzdem macht sich das Silicon Valley klein. Zufall oder Methode?
San Francisco auf der Spitze der Halbinsel ist zwar eine respektable Metropole, wenn auch nach Einwohnern und Fläche kleiner als München. Doch die Stadt gehört nicht zum Silicon Valley. Das Tal besteht streng genommen nur aus putzigen Ortschaften mit spanisch oder verträumt klingenden Namen wie San Carlos, Palo Alto, Mountain View und Cupertino, und einer hässlichen, ausgefransten Großstadt namens San José. Mit Ausnahme von San José sind das Orte minderer Bedeutung, kaum größer als Castrop-Rauxel. Unwichtig, wenn es da nicht die Hightech-Industrie gäbe, die wie ein Segen über sie gekommen ist. Fleckchen, die zufällig Heimat von Weltmächten wie Oracle, Apple, Google, Intel und Stanford geworden sind. Traum eines jeden Wirtschaftsförderers.
BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, Bosch, BASF und Lufthansa fürchten sich vor dieser Gegend. Einige von ihnen haben aus Vorsicht große Forschungszentren hier errichtet. Die Bundeskanzlerin warnt, dass Deutschlands stolze Industrie von dieser ehemaligen Obstplantage, nichts anderes war das Silicon Valley kurz nach Kriegsende, schon bald überholt werden könnte. Übertriebene Alarmstimmung oder berechtigte Sorge? Das Herz des Internet schlägt in Schlafstädten – Hewlett-Packard, Google, Apple sind an Orten entstanden, die langweiliger nicht sein könnten. Landschaftlich reizvoll, aber städtebaulich banal.
Unsere drei Kinder – acht, sechs und drei Jahre alt – werden in die deutsche Schule von Mountain View gehen: German International School of SiliconValley, GISSV. Gleich neben der Google-Zentrale und dem NASA-Forschungszentrum. Die Eltern ihrer Schulkameraden arbeiten für Firmen, deren Logos auch hierzulande jedes Kind kennt. Unser sechsjähriger Sohn glaubt bald, dass ich bei Apple bin, weil alle meine Computer und Telefone von Apple stammen. Außerdem arbeiten alle Eltern seiner Klassenkameraden bei Tech-Konzernen. Bei einem Verlag ist kein anderer Vater, Bild-Chef Kai Diekmann ausgenommen. Verlage gelten hier als etwas überholt und von vorgestern. Dinosaurier, die das Internet nicht richtig verstanden haben und nicht begreifen wollen, dass kein Geld mehr mit Journalismus zu verdienen sein soll, statt Artikel, Fotos und Videos von Algorithmen aufspüren zu lassen und dem Publikum als Sammlungen zu präsentieren. Aggregieren heißt das. Aggregation ist gut, weil sie automatisch funktioniert und fast kein Personal braucht, wenn die Programmierer ihre Arbeit erst einmal abgeschlossen haben. Produktion hingegen ist nicht gut, glaubt das Silicon Valley, ganz gleich, ob es sich nun um Journalismus, Musik, Filme, Autos, Flugzeuge, Waschmaschinen, Heizkessel, Strom oder Teddybären handelt.
»Eine Reise auf der Suche nach der Zukunft«, haben die Medien-Branchendienste geschrieben, als wir in Berlin losgeflogen sind. Für uns ist es eher eine Reise auf der Suche nach Anschluss. Ein Ankämpfen gegen den Rückstand. Für jedes General Electric gab es in Deutschland früher einmal ein Siemens, für jedes IBM ein Nixdorf, für jedes Kodak ein Agfa, für jedes Pfizer ein Hoechst, für jedes Sony und Samsung ein Telefunken, Grundig oder Loewe. Doch mit der Digitalisierung ist das einstige Musterland aus dem Tritt geraten. Die Deutschen fremdeln mit dem Netz. »Neuland« hat Angela Merkel das Internet etwas ungeschickt, in der Sache aber zutreffend genannt. 25 Jahre ist das Web inzwischen alt, ihre große Liebe dazu müssen die Deutschen aber erst noch entdecken.
SAP, Deutschlands letzter internationaler Computer-Erfolg, stammt aus den 70er-Jahren. Mit Ausnahme des Netzdienstleisters United Internet kommt keiner der großen Erfolge der Internet-Ära aus Deutschland, und selbst United Internet ist ein eher regionales Phänomen geblieben. Alle maßgeblichen Techniktrends von der Suchmaschine über soziale Netzwerke bis zum Smartphone wurden in Deutschland um Jahre zu spät erkannt. Was machen die Kalifornier besser als die Deutschen? Warum locken sie so viele Talente an? Wie werden sie so innovativ? Weshalb sind sie so schnell? Für Verlage ist das eine Schicksalsfrage. Sie haben ihre Seiten im Netz zwar früh gestartet, 1994 oder kurz danach. Doch dass Verlage die wichtigen Trends immer rechtzeitig erkannt hätten, können sie nicht von sich behaupten. Ihre Webauftritte waren zu lange eher Fortsetzungen des herkömmlichen Zeitungs- und Zeitschriftenjournalismus. Zu spät haben Verlage sich gefragt, was Suche eigentlich bedeutet, was das Wesen von Social Media ist, warum Auktionen unvermeidbar sind, weshalb Algorithmen menschliche Intelligenz aushebeln können, wieso die Cloud Wertschöpfungsketten sprengt und warum Daten heute nicht nur die Währung für alles Mögliche sind, sondern künftig vielleicht sogar den größten Wert von allen darstellen.
Als die Maschine in San Francisco aufsetzt, beschleicht mich eine Mischung aus Heimatgefühl und Ungewissheit: Heimatgefühl, weil ich mich hier auskenne. Ungewissheit, weil ich weiß, dass meinem Beruf im Silicon Valley wenig Respekt entgegengebracht wird. Unabhängiger Journalismus, der sich selbst finanziert, ist hier kein Leitbild. Ich bin dafür eingetreten, dass Aggregatoren wie Google Lizenzgebühren an Verlage zahlen. Wird überhaupt noch jemand mit mir sprechen wollen? Nimmt man mir das übel? Vieles male ich mir bei der Landung aus, nur eines nicht: die Offenheit des Silicon Valley, die uns später entgegen meiner anfänglichen Sorge entgegenschlägt, und die Bereitschaft, jede Frage zu beantworten und jedes Gespräch zu führen. Die Reise beginnt in Palo Alto, dem Zentrum dieses Tals der Innovationen.
Palo Alto: Explosives Gemischaus Geist und Geld
Es weht ein Hauch von Revolution: Wie ein Universitätsstädtchen am Rande der Welt zum Austragungsort des 21. Jahrhunderts wurde und warum seine Einwohner immer alles infrage stellen, was bisher als ausgemacht galt.
Die Passagiere klettern müde aus ihren Sitzen. Draußen schlägt uns milde Luft entgegen. 19 Grad. Willkommene Abwechslung zu Berlin, das wir bei Eis und Schnee verlassen haben, begleitet von viel Schulterklopfen: »Viel Spaß im Urlaub.« Dass man nach Kalifornien zum Arbeiten geht, passt bei manchen nicht ins Klischee. Nach umständlicher Visaprozedur besteigen wir unseren Mietwagen, einen siebensitzigen Toyota. Es geht Richtung Süden auf dem Highway 101, der Hauptverkehrsader des Silicon Valley. Wolken hängen über den Küstenbergen und fließen an den Hängen hinunter zum Flughafen. San Francisco ist ein Schlechtwetterloch. Mark Twain hatte recht: Die Sommer sind hier oft kälter als die Winter in den Bergen. Doch es gibt ein erstaunliches Mikroklima. Nach ein paar Kilometern bricht die Sonne durch; die Temperatur steigt um fünf Grad. Wenige Orte auf der Welt bergen solche Temperaturunterschiede auf so kurzer Distanz. 15 Grad Differenz sind es im Hochsommer zwischen San Francisco und San José. Palo Alto, nur 40 Kilometer von San Francisco entfernt, ist rund ums Jahr sonnig und warm. Die Entscheidung zwischen San Francisco und dem Silicon Valley ist auch eine Entscheidung zwischen Frieren und Schwitzen, Großstadt und Dorf. Kaum ein Abendessen in der Bay Area, bei dem die Glaubensfrage des Wohnsitzes nicht leidenschaftlich diskutiert wird.
Der Highway ist in erbarmungswürdigem Zustand. Es fehlen streckenweise die Spurstreifen. Leitplanken rosten, abgeplatzte Lastwagenreifen liegen herum, und Furchen tun sich auf. Reiche Bürger, armer Staat, das sind auch kalifornische Verhältnisse, nicht nur italienische. Der Golden State lebt in prekären Verhältnissen. Er bleibt seinen Angestellten manchmal wochenlang das Gehalt schuldig; Dienstleister werden mit Wechseln statt mit Bargeld bezahlt; Schulen und andere Institutionen müssen selbst sehen, wo sie bleiben. Vergleichsweise gut geht es nur den reichen Kommunen im Silicon Valley. Ihre Steuereinnahmen sprudeln. Palo Alto, knapp 70 000 Einwohner groß, ist eine der reichsten Gemeinden Amerikas. Viel Aufhebens macht die Stadt allerdings nicht davon. Bescheidenheit ist erste Bürgerpflicht. Ein 08/15-Schild auf dem Highway verkündet »Next 3 Exits Palo Alto«. Wer abgelenkt ist, rauscht achtlos daran vorbei.
Schrifttafeln in den Bergen wie in Hollywood oder verspielte Straßenschilder wie in Beverly Hills gibt es nicht. Wir steuern auf die Ausfahrt »University Avenue« zu. Hier geht es nach Stanford, der wichtigsten Hochschule des World Wide Web. Doch das Ausfahrtsschild sieht aus wie jedes andere: grün, sachlich, mit Funkelnägeln für die Nachtreflektion. Nur wenig Extravaganz leistet sich die Gemeinde: ein geschnitztes, bunt angemaltes Ortseingangsschild aus Zedernholz gleich hinter der Autobahn: »Welcome to Palo Alto«. Wahrscheinlich hat es der Rotary-Club gespendet. Gleich hinter der Holztafel lässt Palo Alto es regnen. Ihren Reichtum drückt die Gemeinde durch den verschwenderischen Umgang mit Wasser aus. Die kalifornische Steppe, von April bis November gelb wie Stroh, weicht einem Garten Eden. Hohe Bäume säumen die Straßen, jeder auf die perfekte Form gestutzt. Blumenbeete prangen in den Vorgärten. Bunt gestrichene Holzzäune säumen die Grundstücke. Offene Veranden mit weißen Schaukelstühlen leuchten in der Sonne. Die sauber getrimmten Hecken geben den Blick auf gepflegte Häuser frei. Nichts ist versteckt, alles wirkt offen. Trottoirs laden zum Spazieren ein. Flaneure tragen Sommerhüte aus Stroh, weiße Hosen und Slipper aus Leinen oder Leder. Wir sehen einen Mann im breit gestreiften, blau-roten Jackett, als ginge er zu einer englischen Landpartie, dabei steuert er nur auf Wells Fargo zu. Studenten laufen in Shorts und Flip-flops herum. Kein Wölkchen erinnert ans kalte San Francisco. »Warum hängen die Kabel an Masten und liegen nicht unter der Erde«, fragen die Kinder. Stimmt, wie schwarze Spaghetti baumeln Strom- und Telefonkabel an den braun imprägnierten Stämmen.
Die University Avenue führt in die winzige Innenstadt. Eine einzige Einkaufsstraße gibt es, keine Fußgängerzone, ein paar Geschäfte in den Nebenstraßen. Aber viel Publikum. Es wimmelt auf den Bürgersteigen von Leuten. Die Cafés und Restaurants sind immer zum Bersten voll. Ohne Reservierung geht nichts. Bei den populären Restaurants wie dem Evvia in der Emerson Street muss man sich Wochen vorher anmelden. An den Bäumen hängen noch die Weihnachtssterne und elektrischen Tannenbäume. Kleinstadt, Studentenmetropole, Wirtschaftszentrum und Hippie-Kommune, Palo Alto ist alles auf einmal. Wir fahren an einem Yogaladen vorbei, einem Esoterikshop, einem indischen Klangschalenhändler. Gegenüber die Baguetterie, ein halbes Dutzend elegant-entspannter Möbelgeschäfte, ein israelischer Hummus-Imbiss und das University Café, in dem Milliardendeals gemacht werden. Einen Spezialisten für Waffeleis gibt es, vor dem die Leute Schlange stehen, ein pleitegegangener Buchladen, den Samsung gerade zu einem Inkubator für Firmengründungen umbaut, einen riesigen Fahrradladen, dazu Cafés, Friseure, Kioske und drei Programmkinos. Diese Kinos sind ein Phänomen: Bollwerke gegen die Massenkultur. Sie zeigen nur Klassiker aus den 20er bis 30er-Jahren. Blockbuster sind tabu. Ein reizendes Antiquariat konnte sich halten. Lincolns Gettysburg Address ist gleich in mehreren Originalausgaben erhältlich. Als ich dort ein paar Tage nach der Ankunft stöbere, ist der Laden gut gefüllt, und dabei bleibt es. Intellektuelle bilden in diesem Ort die Mehrheit, ganz ähnlich wie in Harvard oder Oxford.
Palo Alto ist der Gegenentwurf zu New York. Ihren Aufstieg von der ruhigen Universitätsstadt zum Zentrum einer globalen Industrie hat die Stadt auch dem Abstieg von Manhattan zu verdanken. Die 80er-Jahre waren die Blütezeit der Finanzbranche. Spekulanten wie die Kunstfigur Gordon Gekko, in Oliver Stones Film Wall Street durchaus realitätsnah dargestellt, schufen ein Rollenmodell, dem Millionen junger Menschen kritiklos folgten. Schnell reich zu werden, ohne selbst etwas Bleibendes zu schaffen, galt als Inbegriff des amerikanischen Traums. Einen Job im Investmentbanking zu ergattern, Firmen billig zu kaufen, zu zerschlagen, teuer wieder zu verkaufen und damit ein Vermögen zu verdienen – das erschien vielen als erstrebenswerte Karriere.
Ins Wanken geriet dieses Leitbild erst durch die zahlreichen Betrugsskandale und die Börsencrashs von 1987, 2000 und 2008. Die Bewunderung für die Wölfe der Wall Street schlug in Kritik und Ablehnung um, und eine neue Generation von Schulabsolventen grenzte sich ganz bewusst von einer seelenlosen Form des Kapitalismus ab. New York verlor diesen Nimbus. Viele, die früher Betriebswirtschaft studiert hätten, wurden Ingenieure und Programmierer. Die Erfindung des World Wide Web gab ihnen ein aufregendes Betätigungsfeld. Diese neue Generation sammelte sich an der Westküste. An den Universitäten dort herrschte ein explosives Traditionsgemisch aus Ingenieurskunst und Unternehmergeist. Hier galt das Schaffen bleibender Werte als selbstverständlich. Palo Alto versprach Lebenssinn, und New Yorks Finanzwelt konnte dem wenig entgegensetzen. Im Laufe der Zeit löste die Computerindustrie New Yorks Finanzwirtschaft als Schlüsselbranche ab. Eine neue Ära begann, und das verträumte Städtchen Palo Alto entfaltete jählings die gleiche magnetische Wirkung wie früher New York. Es wurde cool, hierherzuziehen. Das Silicon Valley mutierte zu einem Brennpunkt der Gegenwart.
Wir spüren diese Stimmung sofort. Palo Alto ist kein Getto für Firmensöldner wie La Défense vor den Toren von Paris. Palo Alto ist hip, nonkonformistisch, unkonventionell, gepflegt, aber entspannt. Erste Maßnahme am ersten Wochenende: Shorts kaufen, Flip-flops, Leinenschuhe, Leinenhosen. Ein einziger Anzug hatte in die 20 Kilo Fluggepäck gepasst, und in sechs Monaten Palo Alto habe ich ihn kein einziges Mal angezogen.
Jedem, der herkommt, schlägt revolutionärer Geist entgegen. Seit jeher wird in Kalifornien aufmüpfig gedacht. Ein Land weitab der Regierung in Washington, das sich schon immer in seiner Geschichte alle Freiheiten herausgenommen hat. Querdenker und Revoluzzer gehören zum Inventar. Mit dem Zustrom der Ingenieure in den Neunzigern erlebten die Sixties eine Renaissance. San Francisco, die Stadt der Blumenkinder, Umstürzler und Drogenpropheten, des »Sommers der Liebe« 1967, des Haight-Ashbury-Districts, verwandelte sich nun in eine Stadt der Gründer, und umliegende Gemeinden wie Palo Alto zogen mit. Hippie-Mähnen und Batikhemden prägen das Straßenbild zwar nicht mehr, dafür aber Kapuzenpullis und kurzärmlige Muskelshirts im Mark-Zuckerberg-Stil. Der Geist ist derselbe geblieben wie vor 50 Jahren seit dem Monterey Pop Festival, dem Fanal der Hippie-Bewegung: Aufstand gegen das Establishment. Damals mit Musik, heute mit Technik. Computer waren das, worauf Revoluzzer gewartet hatten. Mit ihnen kann man Machtstrukturen mit geringem Aufwand und großer Wirkung angreifen. Viel besser als mit Sit-ins, Demos und Haschbrownies. Jeder kann mitmachen. Querdenker planen die Abschaffung von Großbanken, Telefonkonzernen und Automultis, nur – anders als in den Sechzigern – mit legalen Mitteln. Nicht durch Sabotage, sondern durch Wettbewerb.
Palo Alto ist ein eigenwilliges Gemisch aus Geist und Geld. Geprägt von der Bereitschaft, alles infrage zu stellen. Vom Drang, alles neu zu erfinden. Das herrschende System soll mit seinen eigenen Mitteln geschlagen werden. Die Erfolge dieser Subversion sind beträchtlich. Ironischerweise werden die Althippies von damals nun aus ihren urbanen Biotopen verdrängt. Ihre Tech-Nachfolger haben zwar den gesellschaftlichen Impuls der Sixties aufgenommen, aber eine ganz andere Szene gebildet. Mit echten Hippies will kein waschechter Googler etwas zu tun haben. Folglich schreitet die Gentrifizierung ganzer Quartiere unerbittlich voran.
Wer die Gesellschaft verändern will, wird Programmierer, sehr im Unterschied zu Deutschland, wo gesellschaftlich engagierte Menschen lieber in die Politik gehen. Es ist kein Zufall, dass Apple etwa zur gleichen Zeit wie die Grünen entstand. Palo Alto brachte Steve Jobs und Frankfurt Joschka Fischer hervor. Beide gingen ähnlich radikal zu Werke. Fischer warf Steine, Jobs zertrümmerte Monopole von Microsoft und IBM. Sie unterschieden sich in ihren Mitteln, nicht in ihrem Anspruch auf Veränderung. Der legendäre Wahl- und Werbespruch von Apple (»Think different«) könnte ebenso für die deutschen Reformer gelten. Interessanterweise suchte Apple für seine Kampagne die gleichen Helden aus wie die Grünen in Deutschland: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, den Dalai Lama und Albert Einstein.
Anfang der 80er-Jahre war ich Austauschschüler im Silicon Valley. Schon damals war das Tal berühmt für seine Technik-Industrie. Doch es waren vor allem Rüstungsfirmen, die den Ton angaben. Das Moffett Federal Airfield zwischen Mountain View und Sunnyvale diente seit dem Zweiten Weltkrieg als zentraler Militärflugplatz der Region. Rundherum siedelten Firmen des militärisch-industriellen Komplexes, darunter Lockheed. Sie bildeten den Kern der späteren Hightech-Region. Der Kalte Krieg verlangte immer raffiniertere Elektronik für Langstreckenraketen, Frühwarnsysteme, Flugzeugträger, U-Boote und Satelliten. Rund um die Militärbasis in San José und das NASA-Forschungszentrum in Mountain View scharten sich Konzerne, die von den Milliardenaufträgen der Rüstungsprogramme lebten. Das Silicon Valley war eine Außenstelle des Pentagon. Zivile Produkte spielten kaum eine Rolle. Entsprechend elitär war das Internet, damals noch in seiner militärischen Frühform. Armee und Universitäten hatten Zugang, die Öffentlichkeit blieb außen vor. Das Netz diente der nationalen Sicherheit. Es sollte Kommunikation sichern, wenn russische Atomraketen zuschlugen. Im Atomkrieg hätten wenigstens die Daten überlebt.
Den ersten vernetzten Computer meines Lebens sah ich im Sommer 1980 in Palo Alto. Damals war das Netz so neu, dass ich nicht richtig verstand, was ich da sah. Es war ein stickiger Nachmittag im Haus eines Schulfreundes, dessen Familie zur Netzelite jener Tage gehörte: Der Vater forschte an Geheimprojekten für das Pentagon, die Mutter unterrichtete Technik an der Palo Alto High School gleich gegenüber von Stanford, und der Onkel war der legendäre Schachweltmeister Bobby Fischer. Diese Leute waren vermutlich die Einzigen, die wussten, wo das verschollene Schachgenie steckte. Verraten haben sie es mir nicht. Weiter als in solche Kreise reichte das Netz damals noch nicht. Im Arbeitszimmer der Familie stand eine Spielkonsole ohne Bildschirm. Sie war mit dem Zentralrechner von Stanford verbunden und stichelte ihre Ergebnisse per Nadeldrucker auf Endlospapier. Zwischen Wimpeln und Kaffeetassen stand es da einfach herum, das Internet, unauffällig und schlicht. Bastlerkram, schnell vergessen.
Damals überlegte ich, in Kalifornien zu bleiben und zu studieren. Ich entschied mich dagegen. Heute würde meine Antwort anders ausfallen. Wer das Glück hat, als Austauschschüler im Silicon Valley zu landen, setzt vermutlich alles daran, nach Stanford zu kommen, einen Job bei Google, Facebook oder Apple zu ergattern und später vielleicht sein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch damals sah die Sache anders aus. Niemand aus meinem Jahrgang, mich eingeschlossen, hatte Lust, hier zu leben. Eine Laufbahn in der Rüstungsindustrie? Unvorstellbar. Daheim demonstrierten wir gegen Pershings, hier wurden sie gebaut. Ich träumte von Medien oder Film. Hollywood, nicht die Computerbranche nahm meine Fantasie gefangen. Unsere Helden hießen George Lucas und Steven Spielberg. Das waren die großen Visionäre jener Tage. Von Steve Jobs hatten wir zwar schon gehört, doch bis zu seinem großen Durchbruch mit dem Macintosh dauerte es noch vier Jahre. Jobs war ein Tüftler. Ein Mann, der Schreibwerkzeuge herstellte, auf denen Lucas und Spielberg Drehbücher verfassen konnten. Ein Bastler, ein Techniker, ein Lieferant. Apple, eine Hinterhof-Klitsche, bot keinen Grund, dort anzuheuern.
Heute ist das Militär auf einen fast unsichtbaren Rest zusammengeschrumpft. Palo Alto könnte ziviler kaum sein. Eine Stadt wie aus dem Handbuch für perfekte Gemeinden. Nicht einfach nur reich, sondern auch noch voller Bürgersinn. Öffentliche Verkehrsmittel kosten nichts, man steigt einfach ein. Städtische Busse werben auf ihrer Karosserie mit lachenden Gesichtern, die für Umweltschutz eintreten: »Free Shuttle – Just hop on«. Es gibt ein kommunales Freibad, fünf öffentliche Bibliotheken, ein stattliches Rathaus, eine prunkvolle Jugendstil-Post, zahlreiche Parks und herausgeputzte Schulen.
Die Bürger behandeln ihre Stadt wie ein Geschenk. Keine Mühe oder Ausgabe scheint ihnen zu groß, um die Lebensqualität weiter zu steigern. Die ohnehin schon luxuriöse Hauptbibliothek erlebt gerade ein ehrgeiziges Sanierungsprogramm. Im Schwimmbad kostet der Eintritt ein Fünftel des Preises von Berlin. Sitzungen des Stadtrats werden rege besucht; sich aufstellen zu lassen, wenn man gefragt wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Fremde auf der Straße zu grüßen, gehört zum normalen Umgangston, und ein Wochenende ohne Straßenfeste gibt es kaum. Es wimmelt von Kirchen aller großen Religionen und Splittergruppen. Rüdes Großstadtgehabe ist unbekannt. An den meisten Kreuzungen stehen keine Ampeln, sondern vier Stoppschilder. Begegnen sich Autos, nehmen die Fahrer Blickkontakt auf und winken sich gegenseitig freundlich die Vorfahrt zu. Lieber wartet man ein paar Sekunden, bis endlich jemand losfährt, als sich vorzudrängeln. Berliner würden Satelliten-Geräte kaufen, die feststellen, wer zuerst an der Kreuzung ankommt. Nicht so in Palo Alto. Hier beharrt man nicht auf Vorfahrt, sondern übt Rücksicht. In einer Meriokratie, in der Rang über Leistung definiert wird, funktioniert interessanterweise auch die Straßenverkehrsordnung besser.
Die Palo Alto High School, neben Stanford der zweite Stolz der Stadt, ist bestechend schön. Viel schöner als damals in meinem Austauschjahr, und größer zudem. Es wurde renoviert und angebaut. Weiße Bauten im spanischen Stil säumen eine palmenbestandene Wiese. Baseball-Mannschaften trainieren auf großen Feldern. Eine eigene Kirche und ein eigenes Theater. Gleich nebenan »Town & Country«, das schönste Einkaufszentrum der Stadt, untergebracht in rustikalen Holzbauten. Die Schließschränke der Schüler stehen unter offenem Himmel. Das Leben findet draußen statt. Weil Palo Alto reich ist, sind auch die Schulen gut. Ich werde mich zwar nie an diese Gleichung gewöhnen, aber den Kaliforniern gilt jeder Ausgleich der Lebensverhältnisse durch staatliche Finanzierung schon als Sozialismus. Unterstützt mit viel privatem Spendengeld, gewährt Paly, wie die Schule im Volksmund heißt, die bestmögliche Vorbereitung auf Stanford.
Manche reiche Asiaten kaufen bei der Geburt ihrer Kinder eines der millionenteuren Häuser im Ort, ohne dort zu leben – nur weil es dann einen Rechtsanspruch auf den Besuch von Paly gibt. Ein Traum für Tigermoms und Helicopter-Dads. Immer wieder kommt es zu Wohnsitzbetrug: Auswärtige Eltern bezahlen Einwohner, damit sie ihre Kinder unter falscher Adresse anmelden können. Etwas Gutes hat der Paly-Kult allerdings: Es gilt als Ehrensache, Geld für Public Schools zu spenden. Öffentliche Schulen sind moralische Pflicht, Privatschulen verpönt. Höchst ungewöhnlich für die USA.
Der Ort macht wenig Aufheben um seine Geschichte. Gelebt wird in der Zukunft. Alles Vergangene verschwindet aus dem Blick. So zum Beispiel die Garage, in der William Hewlett und David Packard 1939 ihr Unternehmen gründeten. Sie steht noch heute, gehört aber zu einem Privathaus und ist nicht öffentlich zugänglich. Lediglich eine Plakette im Vorgarten erinnert an die Gründer. Andernorts gäbe es Touristenrummel und Souvenirhändler. Palo Alto ist anders. Wer nicht weiß, wo die Garage steht, findet sie nicht: 367 Addison Avenue. Um die Ecke, an der Lincoln Avenue, ziehen wir mit der Familie ein. Die HP-Garage entdecken wir nur durch Zufall. Ganz ähnlich der Medaillon Rug Store auf der University Avenue, ein Teppichhändler, der Innovationsgeschichte schrieb, weil er Büros an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vermietete. Unweit davon der Apple Store, in dem Steve Jobs ständig nachschaute, wie seine Geräte im Laden wirkten. Unsichtbar auch das Elektronikgeschäft, in dem Apple erfunden wurde. Steve Jobs und sein Mitgründer Steve Wozniak, damals noch Twens, hatten Computer-Platinen für das Geschäft hergestellt, bis der Besitzer sie bat, die Komponenten zu einem fertigen Gerät zusammenzuschrauben. Sie taten das nur widerwillig – Bausätze galten damals als angesagter. Wer wollte schon einen fertigen Computer kaufen? Doch Jobs und Wozniak brauchten das Geld. Heraus kam der Apple I. Der Elektronikladen ging später pleite. Ein Erotikshop zog ein, und der ist ebenfalls Geschichte. Apples Gründungsstätte ist schlicht vergessen worden. Reliquien werden allenfalls im Computer History Museum von Mountain View gesammelt. Der Besuch dort lohnt sich übrigens sehr.
Nur wenig auffälliger ist PARC, das PaloAlto Research Center, in den Bergen oberhalb der Universität. Im Auftrag des Kopierkonzerns Xerox betrieb PARC Grundlagenforschung. Hier wurden die Maus und die grafische Benutzeroberfläche erfunden. Xerox wusste damit nichts anzufangen, doch Steve Jobs kopierte die Idee. Ein Freund hatte ihn zu PARC gebracht. Jobs ging nur gezwungenermaßen mit, erkannte aber das Potential und baute seine Computer um die Idee herum. Ohne PARC gäbe es heute weder Smartphone noch Tablet. Doch nicht einmal eine Gedenktafel erinnert dort an die Geschichte. Es ist einfach nur ein flacher, unscheinbarer Bungalow in den Bergen.
Das Gemisch aus Geist und Geld zündet immer da, wo kreative Köpfe zusammenkommen. Der Funke springt kreuz und quer durch die Stadt. Mal leuchtet er hier auf, mal da. Selbst Insider tun sich schwer, seinem Verlauf zu folgen. Projekte beginnen meist irgendwo auf dem Campus der Universität. In einem der vielen Cafés, auf irgendeiner Wiese in der Sonne, auf einem Basketballplatz. Immer dort, wo zwei, drei Gleichgesinnte etwas planen. Sie nisten sich irgendwo ein. Räume stellt die Uni kostenlos zur Verfügung. Meistens campieren Start-ups aber in den Hinterzimmern von Wagniskapitalgebern, in Wohngemeinschaftsküchen, Wohnheimzimmern, Co-Working-Spaces oder bei Inkubatoren. Mehr als einen Küchentisch und Laptops braucht es nicht. Eine gewisse Weltvergessenheit gehört zum Genius Loci dazu. Palo Alto lebt so sehr in virtuellen Zukunftswelten, dass Unbequemlichkeiten des Alltags kaum ins Gewicht fallen. Durch das Silicon Valley rast nicht etwa ein computergesteuerter Magnetzug, sondern es zuckelt eine schnaufende Diesellokomotive. Die Strecke nach San Francisco ist nicht elektrifiziert, und an den gefährlichen Bahnübergängen heult Tag und Nacht die Sirene auf. Ein Anachronismus. Wir können in den ersten Nächten kaum schlafen, obwohl der nächste Bahnübergang anderthalb Kilometer entfernt liegt. Die Sirene hat es in sich. Auf der anderen Seite der Bucht fährt seit den 70er-Jahren BART, Bay Area Rapid Transit, seinerzeit das modernste öffentliche Nahverkehrssystem der Welt, mit vollautomatischen Zügen ohne Fahrer und Schaffner. Das Silicon Valley auf der westlichen Seite der Bucht hätte sich anschließen lassen können, doch in Volksabstimmungen fiel der Ausbau durch. Irgendwie leuchtete den Leuten der Vorteil nicht ein. So lassen sich die Bürger bis heute lieber aus dem Schlaf reißen, als in Elektrozüge zu investieren. Das Silicon Valley ist nicht modern, es baut nur moderne Produkte.
In krassem Unterschied zur Rückständigkeit beim öffentlichen Nahverkehr steht die Begeisterung für ökologisches Denken. Gesunde Ernährung ist ein Dauerthema. Kaum jemand verpflegt sich ohne Organic Food. Ganz Palo Alto kauft bei Wholefoods ein, einem Biosupermarkt der Extraklasse. Qualität, Frische und Konsequenz sind vorbildlich. Wholefoods steht mitten in der Stadt, rings herum siedeln Start-ups. Gründer werben beim Einstellen von Mitarbeitern mit der Nähe zu dem Geschäft. Die Regale quellen über von veganen Spezialitäten, in jedem Gang ist auf Schildern vermerkt, wie viel Prozent der Waren aus der Region kommen. Auch Mülltrennung wird mit Leidenschaft betrieben. Schulklassen unternehmen Pflichtausflüge in die Aufbereitungsanlage und führen Recycling-Lehrstücke in der Aula auf. Green Technology gehört an der Universität zu den Forschungsschwerpunkten. Nicht weniger Ingenieure arbeiten an sauberer Energie als an der Weiterentwicklung des Internet. Elektroautos boomen, und Innovationsführer Tesla sitzt mit seiner Zentrale am Ort. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das erste vollautomatische, sich selbst steuernde, emissionsfreie Serien-Elektroauto der Welt aus Palo Alto kommen.
Unser Toyota rollt auf das Ziel der Reise zu. Eigentlich sind es zwei Ziele: 481 Washington Avenue und 381 Lincoln Avenue. Das Haus in der Washington Avenue hat unsere Firma gemietet, in die Lincoln Avenue zieht auf eigene Kosten meine Familie ein. Das Firmenhaus, ein Neubau im spanischen Hazienda-Stil, dient meinen Kollegen und mir als Wohngemeinschaft. Ringsherum blühen die Hecken, die Sandsteinfassade leuchtet in der Sonne, und ein gewaltiger Baum mit mächtigem Stamm spendet Schatten im Garten. Bäume wie dieser gaben Palo Alto den Namen: »Hoher Stamm«. Gefrühstückt wird in der Küche, getagt im Wohnzimmer, gearbeitet im Foyer, gekocht aus dem gemeinsamen Kühlschrank. Grundstücke in Palo Alto sind so teuer, dass Käufer den Altbau oft abreißen lassen, um ihr Traumhaus zu bauen. Die Baukosten fallen beim Kaufpreis kaum ins Gewicht. So war es auch hier. Herausgekommen sind ein paar gewöhnungsbedürftige Besonderheiten: ein kitschiger Brunnen im Lichtschacht, eine Felsengrotte als Badezimmer im Souterrain und computergesteuerte Duschen ohne Wasserhähne. Wir richten das Haus komplett mit Ikea ein. Gleich am Ortseingang betreiben die Schweden ein großes Möbelhaus. Vom Firmen-Domizil sind es nur fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Lincoln Avenue. Das Familienhaus, ganz aus Holz gebaut, stammt von 1892. Universitäts-Gründer Leland Stanford hat es noch persönlich für seine Professoren anlegen lassen. Ganze Straßenzüge sind damals mit Häusern für die akademische Belegschaft entstanden. Professorville heißt der Stadtteil noch heute.
Unser Garten in der Washington Avenue grenzt rückwärtig beinahe an den Garten von Steve Jobs. Dazwischen liegt nur noch eine andere Parzelle. Dort, an der Ecke von Waverley Street und Santa Rita Avenue, steht das Ziegelhaus mit Reetdach, in dem Jobs lebte und starb. Auf einer wild wachsenden Wiese davor blühen sieben Apfelbäume. Es ist die einzige wilde Wiese in der Gegend, niemand anders gönnt sich diesen Ausbruch aus dem ungeschriebenen Vorgarten-Kodex, der akkurat geschnittenes Gras vorsieht. Doch dem Local Hero verzieh man diese Unbotmäßigkeit. Und es sind die einzigen Apfelbäume weit und breit – Apple. Jobs Witwe Laurene Powell lebt noch immer hier. Es ist ein bescheidenes Haus verglichen mit dem Reichtum seines Besitzers. Hinter den kleinen Fenstern im Erdgeschoss liegt das Arbeitszimmer. Ich erkenne es von den Fotos in Walter Isaacsons Biografie. Es ist ein stiller, magischer Ort. Wer vorbeikommt, spricht leise. Auch ich unterhalte mich hier unwillkürlich gedämpft.
Das Haus verkörpert den Charakter dieser Stadt: Bescheidenheit, Offenheit, Unscheinbarkeit, Kreativität. Vier Branchen hat Jobs von diesem Wohnzimmer aus revolutioniert: Computer mit iMac und iPad, Musik mit iPod und iTunes, Film mit Pixar und Kommunikation mit iPhone und dem AppStore. Verblüffend, wie winzig die Brandherde solcher Revolutionen sein können. Was hatte ich erwartet? Eine Villa im antiken Stil wie Hearst Castle, das größenwahnsinnige Schloss des Verlegers William Randolph Hearst in San Simeon weiter südlich an der kalifornischen Küste? Oder einen Glaspalast im Stil der Apple Stores? Beides würde nicht zu Palo Alto passen. Und nicht zu Steve Jobs, der den größten Teil seines Lebens hier verbracht hat. Kreativität braucht nicht viel Platz. Ein Esszimmertisch. Ein kleines Büro. Drei, vier Leute, die sich zusammen etwas ausdenken. Ein Zettel für Notizen.
Innovation entsteht durch den freien, ungehemmten Austausch von Menschen auf kleinstem Raum. Alle Firmen, die ich besuche, legen Wert auf Dichte. Physische Nähe, glauben sie, ist so wichtig wie die Abwesenheit allzu strenger Regeln. Räumliche Distanz behindert Kreativität, ebenso wie steifer gesellschaftlicher Umgang oder soziale Konvention. Vorschriften töten Ideen. Menschen werden kreativ, wenn sie beruflich so arbeiten dürfen, wie sie privat leben: eng verwoben, in freundschaftlichem Abstand, im ständigen Dialog, im freien Spiel der Ideen, ohne Angst vor Bestrafung durch eine höhere Instanz.
Beim Joggen fällt mir auf: Nirgendwo gibt es Gardinen. Offenheit ist Programm. Davon zeugen die niedrigen Zäune und Hecken ebenso wie der Dialog in den Cafés, die kurzen Distanzen, die kollektive Missachtung von Mustern und Denkverboten, die Akzeptanz alles Fremden und Ausländischen, der bunte Mix von Nationen, die Neugier, die Begeisterung für bleibende Werte, der Wunsch, dem Establishment eins auszuwischen.
Wie schaffen diese Leute es, Welterfolge zu produzieren? Davon handelt das nächste Kapitel: von der Arbeitskultur.
Analoge Arbeitskultur: Wer nicht am Ort ist, spielt keine Rolle
Persönliche Anwesenheit ist Pflicht, virtuelle Kommunikation verpönt. Das Silicon Valley pflegt einen extremen Kult der Nähe.
Sein Büro ist lila gestrichen. Lila! Nur dieser Mann bringt so etwas fertig. Saeed Amidi steht im Türrahmen und winkt mich herein: »Komm, setz dich. Willst du Wasser?« Amidi ist ein bulliger Typ mit jovialen Gesten. Aufmerksam, alert, gewieft. Jemand, der einem schnell den Arm um die Schulter legt. Vollblutunternehmer ist das Wort, das einem gleich einfällt. Mit Wasser kennt er sich aus. Er besitzt Wasserabfüllanlagen im Nahen Osten. Eines seiner vielen Geschäfte. Im Hauptberuf leitet Amidi PlugAndPlay, einen führenden Inkubator, also Gründungsbeschleuniger. PlugAndPlay liegt am Stadtrand von Sunnyvale südlich von Mountain View. Ich besuche Amidi in der Zentrale: ein verspiegelter Gebäudekubus, in dem Dutzende von Start-ups auf mehreren Etagen ihre Interimslager aufgeschlagen haben.
An mehr als 70 Firmen ist Amidi beteiligt. Welche sind das? »PayPal, Dropbox und Lending Club zum Beispiel.« Er dreht sich um und zieht eine Broschüre aus der Schublade, in der alle aufgelistet sind. Amidi ist der Pate des Silicon Valley. Jeder kennt ihn, jeder hatte schon einmal mit ihm zu tun. Er gehört zu einem alteingesessenen Clan. Auf der University Avenue betreibt seine Familie einen Teppichladen. »Da kamen immer junge Gründer in mein Geschäft und wollten Teppiche für ihre neuen Büros kaufen, damit die nicht so ungemütlich aussehen«, erzählt er. »Das begann vor etwa zehn Jahren, als die Gründungswelle Fahrt aufnahm. Viele konnten ihre Teppiche nicht bezahlen. Also nahm ich ihre Aktien in Zahlung.« Er erfand ein Carpet-for-Equity-Programm, und es machte ihn reich. Mit Teppichen stieg er billig in Firmen ein, die später Millionen und Milliarden wert wurden.
Ich frage Amidi nach der Arbeitskultur des Silicon Valley. »Das Zentrum der virtuellen Welt hasst nichts mehr als virtuelle Kommunikation«, antwortet er. »Fernbeziehungen sind verpönt. Wer etwas erreichen will, muss vor Ort sein. Besonders Investoren legen größten Wert auf Nähe. Wen man nicht kennt, dem traut man nicht, und wem man nicht traut, mit dem macht man keine Geschäfte.« Geschwindigkeit, Offenheit und räumliche Nähe seien die wichtigsten Faktoren. »Jedes Start-up in diesem Inkubator könnte einsam in irgendeinem Bürocenter sitzen und im eigenen Saft schmoren. Dann gäbe es keine Befruchtung von außen mehr, keinen Austausch, keine Herausforderung, keine Kritik. Das wäre nicht gut. Gründen heißt Kommunizieren. Hier sitzen die kompetentesten Kritiker am Schreibtisch nebenan.« Er macht eine Wuselgeste mit den Armen: »Das Silicon Valley ist ein Ameisenhaufen. Jeder kommuniziert mit jedem. Wie in einem Dorf. Wer wegfährt, verliert den Anschluss. Und wer hier ist, bekommt Kontakt, den er auf anderem Wege nie gefunden hätte.«
Amidi führt mich durch den Inkubator. Tische, an denen in deutschen Firmen einzelne Mitarbeiter sitzen, bieten hier sechsköpfigen Start-ups Platz. »Die flüstern sich ständig irgendetwas zu«, sagt Amidi. »Das macht sie schnell. Schaff nur drei Fuß Platz zwischen ihnen, und sofort hört das Gemurmel auf. Sofort stoppt die Kommunikation. Nicht Geiz lässt die Teams so eng zusammenrücken. Es ist Instinkt. Wer reden will, kommt sich nah. Wer weiter weg rückt, will in Wahrheit ungestört bleiben.« Wie konzentrieren sich die Leute? »Kopfhörer, Rauschunterdrückung, mit dem Laptop in die Caféteria gehen, aufstehen, wenn man telefoniert. Das ist gar nicht so schwer.« Amidi zeigt auf die Flaggen unter der Decke: »Kulturelle Vielfalt ist ebenso wichtig. Aus Spaß hängen die Leute ihre Fahnen auf. Sie kommen von überallher. Je unterschiedlicher sie sind, desto besser die Ergebnisse. Wer nicht in einem Inkubator sitzt, frequentiert die Cafés. Sie sind immer voll. Europäer, die für drei Tage ins Silicon Valley kommen, machen sich nicht klar, wie wichtig dieser persönliche Austausch ist. Ohne ihn findet man in diese Kultur nicht hinein.«
Diese Botschaft höre ich immer wieder. »Wen ich mit dem Fahrrad nicht erreichen kann«, sagt ein bekannter Venture Capitalist, »in den investiere ich nicht. Ich muss zur Not jeden Tag hinfahren können, um dem Team Dampf zu machen. Aber auch wenn es gut läuft, will ich genau wissen, was meine Firmen gerade tun. Nähe ist absolut unverzichtbar.« Ein anderer Anleger ist ähnlich streng: »Die größte Distanz zu Leuten, mit denen ich Geschäfte mache, sind 30 Minuten. In San Francisco können sie meinetwegen sitzen, aber nicht weiter weg.« Marc Andreessen, Gründer von Netscape und einer der führenden Investoren, sieht es ähnlich: »Investoren bieten nicht nur Bargeld«, sagt er. »Was sie vor allem mitbringen, sind Rat und Tat. Sie helfen Gründern, ihre Geschäfte zu entwickeln. Geld ist im Überfluss vorhanden. Man bekommt es an jeder Ecke. Was Gründer suchen, sind das persönliche Engagement und das Netzwerk des Investors. Dass er aktiv mitmacht. Und das geht nur, wenn er direkt um die Ecke sitzt. Auf Entfernung funktioniert das nicht.«
Xavier Damman, Gründer und Chef des Start-ups Storify, zieht einen historischen Vergleich heran: »Das Silicon Valley ist wie Florenz während der Renaissance. Talent und Kapital sitzen dicht nebeneinander in einer Metropole, und ihre Wege kreuzen sich ständig.« Netzwerke sind wichtiger als Geld. »Nur über Netzwerke kommt eine junge Firma voran. Nur so findet sie Kunden, Ratgeber, Technologiepartner oder neue Mitarbeiter.« Auch Akshay Kothari bestätigt diese These: »Wir brauchen Dichte.« Kothari ist Gründer von Pulse, einem Nachrichten-Aggregator. Seine Firma, inzwischen verkauft an LinkedIn, fasst journalistische Artikel aus vielen Quellen in einer App zusammen. Kothari sagt: »Programmierer müssen sich Informationen auf kurze Distanz zumurmeln können, sonst kommen sie nicht weiter.«
Pulse logiert in einem Loft in der Innenstadt von San Francisco. Auch dort sitzen überraschend viele Leute auf engstem Raum. Die Mitarbeiter drängen sich zu acht oder zehnt an langen Tischen, so dicht wie in einem Restaurant. Nach deutscher Arbeitsstättenrichtlinie wäre das nicht statthaft. Unglücklich sehen sie dabei allerdings nicht aus. Im Gegenteil. Die Sitzanordnung funktioniert problemlos. Glückliche und entspannte Gesichter ringsum. Fast wie in einer Wohngemeinschaft: Alle reden über alles und jeden, aber so leise, dass sich trotzdem jeder konzentrieren kann. Millionenfach multipliziert, muss diese intensive Kommunikation einen messbaren Effekt auf die Leistungskraft einer Volkswirtschaft haben.
Jeder ist hier ständig auf dem neuesten Stand. Herrschaftswissen gibt es nicht. Hierarchien sind unsichtbar. Investoren, Freunde und Konkurrenten kommen unangekündigt vorbei, während ich mit Kothari rede. Sie stehen in der Tür, trinken einen Kaffee und erzählen von einer neuen Idee oder einer neuen Technologie. Sie bringen einen Bekannten mit, beugen sich über die Bildschirme, werden ihre Ratschläge los und verschwinden wieder. Jeder kann an dem Gespräch teilnehmen, jeder sieht, was gerade los ist. Eine große Schüssel mit Bananen und Äpfeln wartet auf der Theke. Müsliriegel liegen in der Auslage, Cornflakes und Milch stehen zum freien Zugriff bereit. »Das sieht vielleicht verschwenderisch aus«, sagt Kothari. »Aber es macht produktiv. Auf jeder guten Party spielt die Küche die Hauptrolle. So muss man auch Firmen organisieren. Wir bauen unsere Büros um die Küche herum, und die meisten anderen Firmen, die ich kenne, tun das auch. Die zwanglosesten Gespräche ergeben sich immer in der Küche. So lassen sich die Grenzen zwischen Abteilungen und Fachgebieten am einfachsten überwinden.«
Mittagszeit. Der Koch schlägt an eine Schiffsglocke. Alle kommen zu Tisch. Niemand geht in ein Restaurant, niemand spaziert um den Block. Zwei Stunden lang hat der Koch vor aller Augen mitten im Büro gekocht. Alle haben ihm über die Schulter geschaut und gefragt, was es heute zu essen gibt. Das Mahl ist kostenlos, wie fast überall im Silicon Valley. Die Investition zahlt sich aus: Wege zu Restaurants fallen weg, der Gesprächsfluss wird nicht unterbrochen, und der Teamgeist wächst. Bei Tisch wird wild diskutiert. Thema ist wie immer das neue Produkt.
Die Intensität der Arbeit ist sofort spürbar. Die Leute brennen. Und sie beuten sich selbst aus. Sie trennen kaum noch zwischen ihrem Privatleben und dem Beruf. Nur selten enden Arbeitstage nachmittags um fünf. Projekte sind in Sprints und Entspannungsphasen organisiert. Bei Sprints wohnen alle für vier oder fünf Tage im Büro und programmieren Tag und Nacht. Auf einer Tafel stehen die Ziele, die sie verabredet haben. Aufgehört wird erst, wenn alles fertig ist. Der Koch hält sie bei Laune. Nach dem Sprint fährt die Firma für ein paar Tage mit den Familien zum Strand. Alle entspannen sich in der Sonne, machen Lagerfeuer mit den Kindern und zelten in den Dünen. Es folgen einige ruhige Tage im Büro, und dann steht schon der nächste Sprint an. Ein fordernder, anstrengender Rhythmus. Doch persönliche Opfer zu bringen, ist Ehrensache. Für die meisten ist das hier die Chance auf den großen Durchbruch, auf Geld und Ruhm.
Ganz ähnlich sieht es bei Airbnb aus, dem Vermittlungsdienst für Privatwohnungen, inzwischen ein ernst zu nehmender Konkurrent für Hotels. Gründer Brian Chesky führt mich durch die Räume am Rande der Innenstadt von San Francisco. Fünf Köche werkeln gleichzeitig in der Mitte des Lofts. Schlafcouchs und Matratzen stehen zwischen den Schreibtischen herum. Ein aufgeschnittener Pappkarton bietet die Übernachtung für einen Dollar an – als Witz. Trotzdem hat jemand das Angebot angenommen. Füße schauen unten aus dem Karton hervor. Gleich neben der Rezeption steht ein nachgebautes Baumhaus. Fünf Übernachtungsgäste haben darin Platz. An den Tischen drangvolle Enge wie bei Pulse. In einer Art Theater trifft sich die ganze Belegschaft einmal in der Woche. Chesky und seine Mitgründer klettern auf die Bühne, berichten Neuigkeiten, stellen Features vor und begrüßen Neuankömmlinge. Es wird heiß diskutiert: Strategie, Finanzierung, das Produkt, die Konkurrenz, der nächste Sprint. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland ist Airbnb in eine neue, viel größere Firmenzentrale umgezogen. Dort wurde ständige Kommunikation noch planmäßiger organisiert. Alles ist auf Gemeinschaftserleben ausgerichtet, ergänzt um Hunderte von Rückzugsmöglichkeiten.
Auch bei Google in Mountain View geht es zu wie auf einem Uni-Campus. Dutzende von Gebäuden gruppieren sich um Beachvolleyplatz, Kräutergarten, Sonnenterrasse, Cafés, Liegewiesen und Yogalogen. Kernstück ist auch hier die Küche. Die beiden Gründer sind bekannt dafür, Köche aus Restaurants abzuwerben, bei denen es ihnen geschmeckt hat. Die Google-Kantine gleicht einem asiatischen Dorf: Wie Garküchen stehen die Stände der Küchenchefs nebeneinander. Täglich kochen sie um die Wette. Die Mitarbeiter streifen durch die Gassen und bedienen sich – auch hier ist das Essen kostenlos.
Mit geregelten Arbeitsbedingungen steht das Silicon Valley auf Kriegsfuß. Arbeit dient in erster Linie nicht dem Broterwerb, sondern der Erfüllung einer privaten Leidenschaft. Zumindest ist das die Legende, mit dem das Silicon Valley seine Belegschaft zu Höchstleistungen aufputscht. Der Glaube an eine große Vision hilft, das Werk so schnell wie möglich zu vollenden. Teams sollen die Familie ersetzen, zumindest aber ergänzen. Für viele junge Leute, die gerade erst in die Stadt gekommen sind, ist das ein willkommenes Identifikationsangebot. Sie nehmen das Surrogat dankbar an. Neue Mitarbeiter stoßen laufend hinzu und werden schnell integriert. Freundschaften entstehen. Die Legende vom großen gemeinsamen Ziel hat etwas Ungerechtes, denn diejenigen, die am härtesten arbeiten, sind oft jene, die am wenigsten davon profitieren, weil sie die wenigsten Aktien besitzen. Ihre Ersatzfamilien leben in kommunikativer Abgeschiedenheit. Alles, was sie für ihre Arbeit brauchen, liegt ein paar Schritte entfernt. Bei Facebook gibt es sogar Automaten, bei denen man sich ein neues iPad oder ein Ladegerät ziehen kann. Der Gang zum Beschaffungswesen entfällt. Kontakt mit der Außenwelt stört, wenn man ihn nicht gerade selbst sucht.
Für Europäer hat diese Kultur weitreichende Folgen: Unsere Zukunft wird in 10 000 Kilometern Entfernung von einem Tal geprägt, bei dem wir nicht mitmachen dürfen, wenn wir nicht persönlich hinfahren. Selbst voll dabei zu sein oder gar keine Rolle zu spielen – das ist die Wahl, vor die uns das Silicon Valley stellt. Viele Firmen rund um Palo Alto besitzen kein Festnetztelefon mehr und stehen nicht im Telefonbuch. Sie telefonieren ausschließlich mobil. Wer nicht das Glück hat, die Handynummern zu kennen, erreicht sie nicht. Wer noch niemanden kennt, kann auch niemanden treffen. Aufgeschlossen für Fremde ist im persönlichen Gespräch zwar jeder, doch den elektronischen Kommunikationswegen entziehen sich die meisten.
Es ist schwer, eine Reise ins Silicon Valley vorzubereiten. Termine aus der Ferne zu vereinbaren, gelang mir nur bei etablierten Unternehmen, nicht bei Start-ups. Niemand antwortete auf E-Mails, niemand ging ans Telefon. Erst dachte ich, ich mache etwas falsch. Doch einmal angekommen, wurde klar: So läuft es immer. Ein Investor musterte unverhohlen meine Visitenkarte. »Aha, Sie wohnen hier? In Palo Alto? Interessant.« Von diesem Moment an nahm er mich ernst. Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter – dafür ist das Silicon Valley blind. Nur bei der persönlichen Anwesenheit ist man unerbittlich: Wer nicht hier wohnt, findet nicht statt.
In den ersten Tagen versuche ich die Gesprächsanbahnung noch auf dem traditionellen Weg: Ich schreibe nette E-Mails. Doch niemand antwortet. Wenn es doch einmal Telefonnummern gibt, geht niemand an den Apparat. Im besten Fall melden sich die Anrufbeantworter. Auf die Nachrichten, die ich hinterlasse, ruft nie jemand zurück. Telefonzentralen leisten sich nur Großkonzerne. Alle anderen betreiben Sprachcomputer, die den Anrufer in eine Endlos-Warteschleife weiterleiten oder den aufgesprochenen Text in E-Mails verwandeln, die niemand liest. Nicht nur mir geht es so. Alle neu Zugezogenen haben das gleiche Problem. Der Eintritt in die interessanten Kreise von Palo Alto ist schwer, wenn man es virtuell versucht.
Spontane Besuche bei Firmen sind aussichtslos. Schon deshalb, weil man die Adressen nicht kennt. Zwar hat natürlich jede Firma eine Webseite, doch da steht fast nie eine Anschrift. Selbst das Firmenverzeichnis Crunchbase hilft nicht weiter. Viele Firmen geben keine Büroadresse mehr an. Sie wollen absichtlich nicht gefunden werden. Die einzige Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen, besteht über persönliche Empfehlungen in Netzwerken wie von etablierten Mitgliedern der Gemeinde.
Das ist einer der Gründe, warum so wenig Geld aus dem Silicon Valley nach Deutschland fließt und Gründer herkommen müssen, wenn sie etwas von den jährlich 15 Milliarden Dollar Wagniskapital abbekommen möchten. Ich treffe Matthew Le Merle, den Vorsitzenden des Netzwerks Keiretsu, in dem Business Angels organisiert sind – Anleger, die privates Geld in junge Firmen investieren. »Im Silicon Valley geht nichts ohne direkten menschlichen Kontakt«, sagt auch Le Merle. Persönliche Beziehungen sind wichtiger als alles andere. »Man muss sich kennen und vertrauen, um irgendetwas zu erreichen. Ich kenne niemanden, der gern Geschäfte macht mit Leuten, die er nicht täglich besuchen kann. Ständiger Austausch ist wichtig für den Erfolg. Lange Anreisen erhöhen die Komplexität und senken nachweislich die Erfolgswahrscheinlichkeit.«
Ausgerechnet das Silicon Valley. Hunderte von Firmen wetteifern hier um die beste Technologie für virtuelle Kommunikation: Videokonferenzen, Hangouts, soziale Netzwerke, Pinnwände. Googles Datenbrille »Glass« projiziert Nachrichten direkt auf die Netzhaut. Ingenieure träumen davon, Kommunikationsmodule direkt ins Gehirn zu pflanzen. Die Grenzen zwischen Hier und Dort verschwinden. Erwartet hatte ich von meiner Reise eine hypervirtuelle Welt: Heimarbeit, ständige Videokonferenzen und elektronischen Zugang zu jedermann. Doch virtuelle Welten sind out. Sie sind nirgendwo so unbeliebt wie bei ihren eigenen Erfindern. Matthew Le Merle nickt: »Es sind superdichte Netzwerke auf engstem Raum. Nur unter solchen Bedingungen entstehen starke Ideen. Kreativität braucht Nähe.«
»Jeder Anruf von außen würde uns ablenken«, bestätigt Akshay Kothari von Pulse. »Wir haben gar nicht die Mittel, uns um jeden zu kümmern, der etwas von uns will. Es gibt zu viele Zeiträuber. Wir möchten unser neues Produkt so schnell und so gut wie möglich auf den Markt bringen. Die Zeit ist knapp. Jeder Tag ist kostbar. Wenn wir zu spät sind, überholt uns die Konkurrenz. Wir müssen unseren Vorsprung verteidigen. Jeder im Team weiß: Es gilt, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Ob wir auf die vielen Einladungen zu Kongressen oder auf alle Anfragen aus dem Ausland antworten oder nicht, macht für den Projekterfolg kaum einen Unterschied. Wir kennen die Leute, die uns helfen können. Wer nicht dazugehört, den müssen wir für eine Weile ausblenden. Anders geht es nicht.«