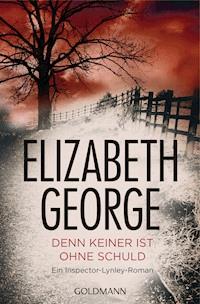9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Inspector Lynley ist zurück!
Ein Mann wandert die Küste Cornwalls entlang. Seit Wochen hat er nicht mehr in einem Bett geschlafen, sich gewaschen, sich rasiert. Als er über der Klippe bei Polcare Cove innehält, bleibt sein Blick an etwas Rotem hängen. In der Tiefe liegt ein zerschmetterter Körper. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Und unter den Verdächtigen ist auch der einsame Wanderer: Inspector Thomas Lynley, der nach dem tragischen Tod seiner Frau und seines ungeborenen Kindes sein Heil in der Flucht suchte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1156
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Es ist Ende April. Durch das wechselhafte Frühlingswetter wandert ein Mann die Küste Cornwalls entlang. Seit Wochen hat er nicht mehr in einem Bett geschlafen, sich gewaschen, sich rasiert. Als er über der Klippe bei Polcare Cove innehält, bleibt sein Blick an etwas Rotem hängen. In der Tiefe liegt ein zerschmetterter Körper.
Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Sabotageakt und Mord, und die örtliche Ermittlerin Bea Hannaford steht bald schon einem ganzen Dutzend Verdächtigen gegenüber. Darunter auch der Wanderer, der von sich behauptet, Thomas Lynley zu heißen – doch ausweisen kann er sich nicht. Als Hannaford bei New Scotland Yard Informationen einfordert, bekommt sie seine Dienstmarke übermittelt, die keineswegs vernichtet wurde, als Lynley nach dem tragischen Tod seiner Frau den Dienst quittiert hatte.
Hannaford bezieht den Detective Superintendent, der er nicht mehr zu sein behauptet, in ihre Ermittlungen ein. Und tatsächlich hat Lynley bereits einen ersten Verdacht. Nur eine Person, weiß er, kann ihm auf unbürokratischem Wege mehr Informationen beschaffen. Und er ruft Barbara Havers an …
Elizabeth George
Doch die Sünde ist scharlachrot
Ein Inspector-Lynley-Roman
Deutsch von Ingrid Krane-Müschen und Michael J. Müschen
Goldmann
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Careless in Red« bei HarperCollins Publishers, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Der Abdruck des Abzugs aus dem Schähnäme in der Übersetzung von Uta von Witzleben erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Diederichs Verlags.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: GettyImages/Matt Anderson Photography
TH · Herstellung: kw
ISBN 978-3-641-26142-9V004
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Zum Gedenken an Stephen Lawrence, der am 22. April 1993 in Eltham, South-East London, ermordet wurde.
Die Täter – fünf Männer – wurden bis zum heutigen Tage nicht verurteilt.
Wenn du wirklich mein Vater bist, Dann hast du dein Schwert mit dem Blut deines Sohnes befleckt. Und das hast du nur deinem Starrsinn zu verdanken. Denn ich habe versucht, in dir die Liebe zu wecken …
aus dem Schāhnāme
1
Er fand die Leiche am dreiundvierzigsten Tag seiner Wanderung. Der April neigte sich bereits dem Ende zu, auch wenn der Mann sich dessen kaum bewusst war. Wäre er in der Lage gewesen, seine Umgebung wahrzunehmen, hätte die Flora entlang der Küste ihm einen unschwer zu deutenden Hinweis auf die Jahreszeit gegeben. Bei seinem Aufbruch war das einzige Anzeichen wiedererwachenden Lebens der gelbe Schleier der Ginsterknospen gewesen, die sporadisch oben auf den Klippen sprossen. Inzwischen hatte sich dort ein wahres Farbenmeer ausgebreitet, und hier und da rankte Angelika um die geraden Stämme der Hecken. Nicht mehr lange, und auch der Fingerhut würde die Straßenränder säumen und Breitwegerich seine feurigen Köpfe aus den Bruchsteinmauern recken, die in diesem Teil der Welt die Felder begrenzten. Doch so weit war es noch nicht, und all diese Tage, die sich zu Wochen aufgereiht hatten, war er in dem Bemühen gewandert, nicht vorauszublicken, geschweige denn an die Vergangenheit zu denken.
Er trug praktisch nichts bei sich, lediglich einen uralten Schlafsack, einen Rucksack mit ein wenig Proviant, den er aufstockte, wenn er gerade einmal daran dachte, und eine Flasche, die er morgens mit Wasser füllte, falls in der Nähe seines Schlafplatzes welches zu finden war. Alles Übrige trug er am Leib: eine wetterfeste Jacke, eine Kappe, ein kariertes Hemd, eine Hose. Stiefel, Socken, Unterwäsche. Er war völlig unvorbereitet zu dieser Wanderung aufgebrochen, und das war ihm gleichgültig gewesen. Er hatte nur eines gewusst: Er konnte lediglich auf Wanderschaft gehen oder aber zu Hause bleiben und schlafen, und wäre er zu Hause geblieben, hatte er erkannt, dann hätte er irgendwann nicht mehr den Willen aufgebracht, wieder aufzuwachen.
Also wanderte er. Er hatte keine Alternative gesehen. Er hatte die steilen Aufstiege zu den Klippen bewältigt, während der Wind und die scharfe, salzige Luft ihm ins Gesicht peitschten. Dann wieder war er über Strände gelaufen, wo bei Ebbe Felsen aus dem nassen Sand ragten. Er war außer Atem geraten, der Regen hatte seine Hosenbeine durchweicht, spitze Steine hatten sich in seine Schuhsohlen gebohrt, und all dies hatte ihn daran gemahnt, dass er lebte und weiterleben sollte.
So hatte er also mit dem Schicksal eine Wette abgeschlossen. Falls er die Wanderung überlebte, dann sollte es wohl so sein. Falls nicht, lag sein Ende in der Hand der Götter. Ja: Götter, entschied er. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass es da draußen nur ein einziges übergeordnetes Wesen geben sollte, das auf eine göttliche Tastatur einhämmerte, hier etwas einfügte oder dort etwas für immer löschte.
Seine Familie hatte ihn gebeten, nicht zu gehen. Sie hatten gesehen, in welchem Zustand er sich befand. Doch wie in so vielen Familien seines Standes hatte dies niemand offen ausgesprochen. Seine Mutter hatte lediglich gesagt: »Bitte, tu es nicht, Liebling.« Und sein Bruder hatte ihn gebeten: »Lass mich mitkommen«, das Gesicht bleich, und wie immer hing die Drohung eines neuerlichen Rückfalls über ihm und über ihnen allen. Seine Schwester hatte den Arm um ihn gelegt und gemurmelt: »Irgendwann kommt man darüber hinweg, du wirst sehen.« Aber keiner von ihnen hatte ihren Namen ausgesprochen oder das Wort, das schreckliche, definitive, endgültige Wort.
Und er selbst sprach es ebenso wenig aus. Er hatte überhaupt nichts gesagt, nur dass er auf Wanderschaft gehen müsse.
Der dreiundvierzigste Tag war genauso verlaufen wie die zweiundvierzig zuvor. Er war an der Stelle aufgewacht, wo er sich am Vorabend hatte hinfallen lassen – ohne die geringste Ahnung, wo er sich befand. Er wusste nur, dass er dem Küstenwanderweg folgte. Er hatte sich aus dem Schlafsack geschält, Jacke und Stiefel angezogen, den Rest seines Wassers getrunken und war wieder losgelaufen. Das Wetter, das schon den ganzen Tag über launisch gewesen war, verschlechterte sich am frühen Nachmittag. Blauschwarze Wolken jagten über den Himmel. Immer höher türmte der Wind sie auf, zog sie zu einem Sturm zusammen. Es schien, als hielte ein riesiger Schild sie davon ab, sich zu zerstreuen.
Gegen den Wind kämpfte er sich die Klippe hinauf. Unter ihm lag die schmale Bucht, wo er vielleicht eine Stunde gerastet und die Wellen betrachtet hatte, die mit ungeheuerlicher Wucht gegen die steil aufragenden Schieferfelsen brandeten. Dann hatte die Flut eingesetzt, und er hatte zugesehen, dass er wieder nach oben kam, um Schutz vor dem Wetter zu suchen.
Als er die Klippe fast erklommen hatte, musste er sich hinsetzen. Er war außer Atem. Es war verwunderlich, dass die wochenlange Wanderung ihm inzwischen nicht genügend Ausdauer für die vielen Kletterpartien entlang der Küste verliehen hatte. Er hielt inne, um wieder zu Atem zu kommen, verspürte ein Ziehen, das er als Hunger identifizierte, und nutzte die Pause, um das letzte Stück der getrockneten Wurst zu verzehren, die er erstanden hatte, als er vor unbestimmter Zeit an einem Weiler vorübergekommen war. Dann stellte er fest, dass er auch durstig war, und stand auf, um sich nach irgendeiner Form menschlicher Behausung umzusehen: Dorf, Fischerhütte, Ferienhaus oder Farm.
Doch es gab nichts dergleichen. Aber der Durst tat gut, dachte er resigniert. Der Durst war genau wie die spitzen Steine, die er durch die Schuhsohlen hindurch spürte, wie der Wind, wie der Regen. All das erinnerte ihn an die Dinge, an die er sich erinnern musste.
Er wandte sich wieder der See zu und entdeckte einen einsamen Surfer jenseits der Linie, wo die Wellen sich brachen. Er hätte nicht sagen können, ob es ein Mann oder eine Frau war, denn die Gestalt war von Kopf bis Fuß in schwarzes Neopren gehüllt – zu dieser Jahreszeit die einzige Möglichkeit, den eiskalten Temperaturen zu trotzen. Vom Surfen verstand er nichts, doch er erkannte in der Gestalt dort auf dem Wasser einen Seelenverwandten, einen Zönobiten. Es hatte nichts mit religiöser Einkehr zu tun, doch waren sie beide allein an einem Ort, wo sie nicht allein sein sollten. Außerdem hatten sie beide sich hier draußen einem Wetter ausgesetzt, das ihrem Unterfangen unangemessen war. Der Regen – und es bestand kein Zweifel daran, dass es bald anfangen würde zu regnen – würde den Wanderweg entlang der Küste gefährlich aufweichen. Und auch der Surfer hätte sich angesichts der freiliegenden Riffs die Frage stellen müssen, wieso er sich dort draußen überhaupt herumtrieb.
Doch der Wanderer hatte wenig Interesse daran, die Antwort auf diese Frage zu finden. Nachdem er sein karges Mahl beendet hatte, nahm er seinen Weg wieder auf. Hier waren die Klippen bröckelig, ganz anders als dort, wo er seinen Weg begonnen hatte. Dort hatten sie großteils aus Granit bestanden, aus Eruptivgestein, das vulkanische Kräfte zwischen Lava, Kalkstein und Schiefer emporgepresst hatten. Und obwohl Zeit, Wetter und die rastlose See daran nagten, waren die Klippen massiv, sodass ein Wanderer sich bis an die Kante wagen konnte, um übers Wasser zu blicken oder die Möwen zu beobachten, die Landeplätze in den Felsspalten suchten. Hier jedoch bestanden sie aus Weichgestein: Schiefer und Sandstein, und am Fuß der Klippen häuften sich die Gesteinsbrocken, die immer wieder von den Kanten brachen. Wenn man sich zu nah an den Rand wagte, riskierte man abzustürzen; und womöglich riskierte man sogar den Tod.
Schließlich erreichte er den Punkt, wo sich entlang der Klippe eine Ebene von gut einhundert Metern erstreckte. Ein Pfad führte weg von der See, war an einer Seite von Ginster und Grasnelken begrenzt, an der anderen von einem Zaun, der eine Weide einfriedete. Der Wanderer stemmte sich gegen den Wind und ging weiter. Seine Kehle war inzwischen völlig ausgetrocknet, und hinter den Augen hämmerte ein dumpfer Kopfschmerz. Als er das Ende des Plateaus erreichte, überkam ihn heftiger Schwindel. Wassermangel, dachte er. Er würde nicht mehr allzu weit gehen können, ohne etwas dagegen zu tun.
Ein Zauntritt markierte den Übergang zur Weide. Er setzte an hinüberzuklettern, musste jedoch innehalten, bis die Welt für einen Moment aufhörte, sich zu drehen – gerade lange genug, dass er den Abstieg zur nächsten Bucht finden konnte. Er hätte nicht zu sagen vermocht, wie viele solcher Buchten er auf seiner Wanderung bereits passiert hatte. Und er hatte auch keine Ahnung, wie diese oder die anderen zuvor hießen.
Als der Schwindel nachließ, hob er den Blick und entdeckte ein einsames Cottage am Rand der Wiese, die sich vor ihm erstreckte. Es stand keine zweihundert Meter von der Klippe entfernt am Ufer eines mäandrierenden Baches. Und es verhieß Trinkwasser.
Noch während er den Zauntritt überwand, trafen ihn die ersten Regentropfen, und er schlüpfte aus den Gurten des Rucksacks und fischte seine Kappe hervor. Er zog sie tief in die Stirn – eine alte Baseballmütze seines Bruders mit der Aufschrift »Mariners« –, als er aus dem Augenwinkel etwas Rotes aufblitzen sah. Er sah genauer hin und entdeckte am Fuß der Klippe, die die jenseitige Begrenzung der Bucht unter ihm bildete, einen roten Farbklecks auf einem breiten Schieferblock, dem landseitigen Ende eines Riffs, das sich ins Meer hinaus erstreckte.
Konzentriert musterte er den roten Fleck. Aus dieser Entfernung hätte von Abfall bis Lumpen alles dahinterstecken können, aber er wusste intuitiv, dass es sich um etwas anderes handelte. Denn auch wenn es eine undefinierbare Masse bildete, sah ein Teil davon aus wie ein ausgestreckter Arm, der sich nach einem unsichtbaren Wohltäter reckte – einem Wohltäter, der nicht da war und auch nie mehr kommen würde.
Er ließ eine volle Minute verstreichen, zählte einzeln die Sekunden. Vergebens wartete er darauf, dass die Gestalt sich rührte. Dann machte er sich an den Abstieg.
Ein leichter Regen fiel, als Daidre Trahair in den holprigen Weg nach Polcare Cove einbog. Sie schaltete die Scheibenwischer ein. Sie würde alsbald die Wischblätter ersetzen lassen müssen, selbst wenn der Frühling bald in den Sommer überging und Scheibenwischer dann überflüssig würden. Der April war bislang so unbeständig gewesen, wie sein Ruf besagte, und auch wenn der Mai in Cornwall oft sonnig war, konnte der Juni ein meteorologischer Albtraum sein. Daidre überlegte, wo sie sich neue Wischblätter würde besorgen können. So musste sie nicht darüber nachdenken, dass sie hier, am Ende ihrer Reise gen Süden, rein gar nichts fühlte: weder Entsetzen noch Verwirrung, Wut, Unmut oder Mitgefühl – und nicht einen Funken Trauer. Letzteres machte ihr inzwischen nicht einmal mehr Sorgen. Wer könnte ernstlich erwarten, dass sie Trauer empfand? Aber der Res … So gänzlich emotionslos zu sein – wo doch wenigstens ein Mindestmaß an Gefühl angemessen gewesen wäre –, gab ihr zu denken. Zum einen erinnerte es sie an das, was sie zu oft von zu vielen Liebhabern gehört hatte. Zum anderen deutete es auf einen Rückschritt zu ebenjenem Selbst hin, das sie längst überwunden zu haben glaubte.
So boten ihr das nutzlose Hin und Her der Scheibenwischer und der Schmierfilm, den sie hinterließen, eine willkommene Ablenkung. Wo befand sich denn nun der nächste Autozubehörhandel? In Casvelyn? Möglicherweise. Alsperyl? Wohl kaum. Vielleicht würde sie bis Launceston fahren müssen.
Gemächlich rollte sie auf das Cottage zu. Die Straße war schmal, und auch wenn Daidre nicht mit Gegenverkehr rechnete, war es doch immer möglich, dass jemand auf diesem Weg vom Strand heraufkam und es eilig hatte, ins Trockene zu kommen, und davon ausging, dass niemand sonst bei diesem Wetter hier unterwegs war.
Zu ihrer Rechten erhob sich ein Hügel, der ungleichmäßig von Ginster und Bitterling bedeckt war. Links erstreckte sich das Tal von Polcare, ein riesiger grüner Fingerabdruck aus Weideland, den ein Bach durchmaß, der vom höher gelegenen Stowe Wood herabfloss. Dieser Ort sah vollkommen anders aus als die typischen Anhöhen Cornwalls, und das war auch der Grund, warum sie sich dafür entschieden hatte. Eine geologische Laune hatte das Tal so breit geformt, als wäre es durch einen Gletscher entstanden – obschon Daidre wusste, dass dies nicht der Fall sein konnte –, und es war nicht wie so viele andere Täler von Flüssen gekerbt, deren Wasser über Äonen den harten Stein hinfortgenagt hatten. So kam es, dass sie sich in Polcare Cove nie eingeengt fühlte. Ihr Cottage war klein, aber die Umgebung weitläufig, und offenes Gelände war eine entscheidende Voraussetzung für ihren Seelenfrieden.
Als sie auf den kleinen Flecken aus Kies und Gras einbog, der ihr als Einfahrt diente, sah sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Das Tor stand offen. Es war zwar nicht verriegelt gewesen, aber sie wusste genau, dass sie es bei ihrem letzten Besuch hinter sich zugezogen hatte. Nun stand es weit genug auf, um einen Menschen hindurchzulassen.
Daidre hielt an und zögerte einen Moment, ehe sie sich einen Ruck gab. Sie stieg aus, stieß das Tor ganz auf und fuhr hindurch.
Als sie geparkt hatte und zurückging, um das Tor zu schließen, entdeckte sie den Fußabdruck. Er hatte sich tief in die lockere Erde gedrückt, dort wo sie ihre Primeln gepflanzt hatte. Der Abdruck eines großen Fußes, eines Stiefels vielleicht. Eines Wanderstiefels. Das warf ein völlig neues Licht auf die Situation.
Ihr Blick wanderte von dem Fußabdruck zum Cottage. Die blaue Eingangstür schien unbeschädigt, doch als sie eilig das Gebäude umrundete, um nach weiteren Spuren eines Eindringlings zu suchen, entdeckte sie die zerbrochene Scheibe im Fenster gleich neben der Hintertür, die sich zum Bach hin öffnete, und die Tür selbst stand einen Spaltbreit offen. Ein frischer Lehmklumpen lag auf der Schwelle.
Sie wusste, eigentlich hätte sie ängstlich oder zumindest vorsichtig sein sollen, doch stattdessen empfand Daidre Zorn über das zerbrochene Fenster. Aufgebracht riss sie die Tür auf und trat durch die Küche ins Wohnzimmer – und blieb wie angewurzelt stehen. Im schwachen Licht des dämmrigen Tages sah sie einen Mann aus dem Schlafzimmer kommen. Er war groß, bärtig und so ungepflegt, dass sie ihn über die gesamte Tiefe des Zimmers hinweg riechen konnte.
»Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind oder was Sie hier suchen, aber Sie werden auf der Stelle gehen! Wenn nicht, werde ich Gewalt anwenden, und ich versichere Ihnen, dass Sie das nicht wollen.« Dann tastete sie hinter sich nach dem Schalter für die Küchenlampe. Sie fand ihn, und helles Licht fiel bis ins Wohnzimmer, bis zu den Füßen des Mannes. Er kam einen Schritt auf sie zu, trat ins Licht, und sie konnte sein Gesicht sehen.
»Mein Gott«, stieß sie hervor. »Sie sind verletzt. Ich bin Ärztin. Kann ich Ihnen helfen?«
Er zeigte in Richtung Meer. Wie immer konnte sie die See von hier aus hören, aber sie schien irgendwie näher zu sein als sonst – das Rauschen verstärkt vom auflandigen Wind. »Am Strand liegt eine Leiche«, stammelte er. »Auf den Felsen, am Fuß der Klippe. Sie ist … Er ist tot. Ich bin hier eingebrochen. Es tut mir leid. Ich ersetze Ihnen den Schaden. Ich habe ein Telefon gesucht, um die Polizei zu verständigen. Wo sind wir hier?«
»Eine Leiche? Bringen Sie mich hin!«
»Er ist tot. Es gibt nichts …«
»Sind Sie Arzt? Nein? Ich aber. Also: Bringen Sie mich hin! Wir verlieren kostbare Zeit, statt vielleicht ein Leben zu retten.«
Der Mann sah aus, als wollte er Einwände erheben. Sie fragte sich, ob er ihr nicht glaubte. Du? Ärztin? Viel zu jung! Doch schließlich schien er ihre Entschlossenheit zu erkennen. Er nahm die Mütze ab, fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn und verteilte unbemerkt Schlamm auf seinem Gesicht. Sein helles Haar war zu lang, stellte sie fest. Aber er war vom gleichen Typ wie sie: beide schlank und blond. Sie hätten Geschwister sein können; sogar seine Augen waren so braun wie die ihren.
»Meinetwegen«, sagte er. »Kommen Sie mit.« Er durchquerte den Raum, ging an ihr vorbei und hinterließ seinen säuerlichen Körpergeruch: Schweiß, ungewaschene Kleidung, ungeputzte Zähne, Hautfett und irgendetwas anderes, was untergründiger und beunruhigender war. Sie wich zurück und blieb auf Distanz, als sie das Cottage verließen und den Weg hinabgingen.
Der Wind war schneidend. Sie stemmten sich dagegen, genau wie gegen den Regen, während sie eilig zum Strand hinunterstiegen. Sie kamen zu der Stelle, wo der Bach sich zu einem Teich verbreiterte, ehe er sich über eine natürliche Felsbarriere zum Meer hinab ergoss. Hier begann Polcare Cove, bei Ebbe ein schmaler Strandstreifen, bei Flut lediglich Felsen und Klippen.
»Dort drüben«, rief der Mann gegen den Wind an und führte sie zum nördlichen Ende der Bucht. Jetzt sah sie es selbst. Eine menschliche Gestalt lag dort auf dem Schieferfelsen: eine leuchtend rote Windjacke, eine dunkle, weite Hose, in der man sich bequem bewegen konnte, dünne und extrem flexible Schuhe. Sie trug eine Art Geschirr um die Hüften, von dem alle möglichen Metallgegenstände baumelten, dazwischen ein leichter Stoffbeutel, aus dem sich eine weiße Substanz über den Felsen ergossen hatte. Kreide für die Hände, dachte Daidre. Sie trat näher, um in das Gesicht der Gestalt zu sehen.
»O mein Gott … Das ist … Er ist geklettert! Sehen Sie, da liegt sein Seil.« Das Seil – eine lange Nabelschnur, die noch mit dem Körper verbunden war – schlängelte sich von dem Gestürzten bis zum Fuß der Klippe und bildete dort einen ungleichmäßigen Haufen. Der Karabinerhaken am Ende schien auf den ersten Blick fachkundig angeknotet.
Daidre tastete nach dem Puls, obschon sie wusste, dass sie keinen mehr finden würde. An dieser Stelle war die Klippe über sechzig Meter hoch. Wenn er von dort oben gestürzt war, und das war höchstwahrscheinlich passiert, hätte nur ein Wunder ihn retten können.
Doch das war nicht eingetreten. »Sie hatten recht«, sagte sie zu ihrem Begleiter. »Er ist tot. Und die Flut kommt. Hören Sie, wir müssen ihn wegschaffen, sonst …«
»Nein!« Die Stimme des Fremden klang streng.
Daidre war plötzlich verunsichert. »Bitte?«
»Die Polizei muss das sehen. Wir müssen sie anrufen. Wo ist das nächste Telefon? Haben Sie ein Handy? Im Cottage war nichts …« Er wies in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Er hatte in ihrem Cottage kein Telefon finden können.
»Ich habe mein Handy nicht dabei«, antwortete sie. »Ich nehme es nie mit, wenn ich herkomme. Und wozu sollte das auch noch gut sein? Er ist tot, und es ist ziemlich eindeutig, wie es passiert ist. Die Flut steigt, und wenn wir ihn nicht bewegen, wird das Wasser es tun.«
»Wie lange?«
»Wie bitte?«
»Die Flut. Wie viel Zeit bleibt uns?«
»Ich weiß es nicht.« Sie blickte aufs Wasser. »Vielleicht zwanzig Minuten? Eine halbe Stunde?«
»Wo ist das nächste Telefon? Sie haben doch einen Wagen.« Und wie eine Variation ihrer eigenen Worte fügte er hinzu: »Wir verschwenden kostbare Zeit. Ich kann hier bei ihm bleiben, wenn Ihnen das lieber ist.«
Es war ihr nicht lieber. Er würde ganz sicher entschwinden wie ein Geist, wenn sie ihm die Gelegenheit dazu gäbe. Er würde darauf setzen, dass sie den Anruf tätigte, an dem ihm so gelegen war, aber er selbst würde sich davonmachen und es ihr überlassen … was zu tun? Sie hatte so eine Ahnung, und diese Ahnung gefiel ihr ganz und gar nicht.
»Kommen Sie mit«, sagte sie.
Sie fuhr zum Salthouse Inn. Es war die einzige Adresse im Umkreis von Meilen, die ihr einfiel, wo sie sich mit Sicherheit Zugang zu einem Telefon verschaffen konnten. Die einsame Gaststätte stand an der Kreuzung dreier Straßen: ein weißes, gedrungenes Gebäude aus dem dreizehnten Jahrhundert, das ein Stück landeinwärts von Alsperyl gelegen war, südlich von Shop und nördlich von Woodford. Daidre fuhr in halsbrecherischem Tempo, aber der Mann protestierte nicht und schien auch nicht besorgt, dass sie einen Abhang hinunterrasen oder in einer Hecke landen könnten. Weder schnallte er sich an, noch hielt er sich fest.
Sie schwiegen beide. Eine spürbare Spannung hatte sich zwischen ihnen aufgebaut, weil sie Fremde waren, aber ebenso wegen der vielen offenen Fragen. Daidre war erleichtert, als sie die Gaststätte erreichten. An der frischen Luft zu sein und seinen Gestank nicht mehr in der Nase zu haben, war ein Segen – und eine sinnvolle Aufgabe vor sich zu haben, ein Gottesgeschenk.
Er folgte ihr über die gekieste Freifläche, die als Parkplatz herhielt, zu einer niedrigen Tür. Sie mussten beide den Kopf einziehen, um einzutreten. Sie gelangten in einen Vorraum, wo ein Durcheinander aus Regenjacken und tropfenden Schirmen herrschte. Sie verschwendeten keinen Gedanken daran, ihre Jacken abzulegen, sondern schritten direkt auf die Bar zu.
Die Stammgäste, die hier schon nachmittags gern ein Gläschen nahmen, saßen an ihren üblichen Plätzen um die verschrammten Tische am Feuer. Die Kohlen strahlten eine angenehme Wärme ab. Die Flammen erhellten die ihnen zugewandten Gesichter und überzogen die rußigen Wände mit einem sachten Schimmer.
Daidre nickte den Gästen zu. Sie kam selbst gelegentlich hierher, sodass man einander flüchtig kannte. »Dr. Trahair«, grüßten die Männer murmelnd, und einer fügte hinzu: »Sind Sie fürs Turnier runtergekommen?« Aber die Frage verhallte, als die Blicke auf ihren Begleiter fielen und von ihm zurück zu ihr glitten, neugierig und verwundert. Fremde waren in dieser Gegend weiß Gott keine Seltenheit. Gutes Wetter lockte sie scharenweise nach Cornwall. Aber sie kamen und gingen als Fremde und erschienen für gewöhnlich nicht in Begleitung bekannter Gesichter.
Sie trat an die Theke. »Brian, ich brauche Ihr Telefon«, sagte sie. »Es ist ein furchtbarer Unfall passiert. Dieser Mann hier …« Sie wandte sich an den Fremden. »Ich weiß Ihren Namen nicht.«
»Thomas.«
»Thomas. Und wie weiter?«
»Thomas«, beharrte er.
Sie runzelte die Stirn, fuhr aber, an den Wirt gerichtet, fort: »Dieser Mann hier, Thomas, hat in Polcare Cove einen Toten gefunden. Wir müssen die Polizei rufen.« Dann fügte sie mit gesenkter Stimme hinzu: »Brian, ich glaube … Ich glaube, es ist Santo Kerne.«
Constable Mick McNulty war auf Streife, als sein Funkgerät ihn aus dem Halbschlaf riss. Er konnte von Glück sagen, dass er überhaupt im Streifenwagen gesessen hatte, als der Funkspruch kam. Er war gerade erst von einem Mittagsquickie mit seiner Frau zurück, gefolgt von einem zufriedenen Nickerchen, sie beide nackt unter der Tagesdecke, die sie zuvor vom Bett gerissen hatten. (»Wir dürfen keine Flecken draufmachen, Mick, es ist die einzige, die wir haben!«) So kam es, dass er erst seit fünfzig Minuten wieder an der A39 Jagd auf Verkehrssünder und andere Übeltäter machte. Doch die Heizung, der Rhythmus der Scheibenwischer und die Tatsache, dass sein zweijähriger Sohn ihn fast die ganze Nacht wach gehalten hatte, hatten seine Lider schwer werden lassen, und so hatte er sich eine Haltebucht für ein Päuschen gesucht. Er war gerade eingedöst, als ihn das Funkgerät aufstörte.
»Leiche am Strand. Polcare Cove. Bitte umgehend hinfahren. Sichern Sie den Fundort, und erstatten Sie Bericht.«
»Wer hat das gemeldet?«, wollte er wissen.
»Ein Wanderer und eine Ferienhausbesitzerin. Sie erwarten Sie am Polcare Cottage.«
»Und das ist wo?«
»Herrgott noch mal, Mann, schalten Sie Ihr Hirn ein!«
Mick zeigte dem Funkgerät den bösen Finger. Dann ließ er den Motor an, rollte auf die Straße und schaltete das Warnlicht und die Sirene ein, was sonst nur im Hochsommer vorkam, wenn ein eiliger Tourist auf der Straße einen folgenschweren Fahrfehler beging. Das einzig Spannende, das Mick zu dieser Jahreszeit für gewöhnlich erlebte, waren die Surfer, die es nicht erwarten konnten, sich in die Wellen der Widemouth Bay zu stürzen: mit zu viel Schwung auf den Parkplatz, zu spät abgebremst, und ab über die Böschung auf den Strand. Nun, Mick konnte diesen Überschwang verstehen. Er verspürte ihn selbst, wenn die Wellen gut waren, und das Einzige, was ihn dann von seinem Neoprenanzug und seinem Board fernhielt, war die Uniform, die er trug und die er auch bis zur Rente hier in Casvelyn zu tragen gedachte. Seine Pension zu verspielen, gehörte nicht zu seinem Karriereplan. Nicht umsonst nannte man den Posten in Casvelyn in Kollegenkreisen den »samtgepolsterten Sarg«.
Trotz Sirene und Warnlicht brauchte er immer noch zwanzig Minuten bis zum Polcare Cottage, dem einzigen Haus an der Straße zur Bucht hinab. Luftlinie war es nur eine Strecke von fünf Meilen, doch die Sträßchen waren nicht breiter als anderthalb Autos und schlängelten sich weitschweifig um Felder, Wälder, Weiler und Dörfer.
Das Cottage war senfgelb gestrichen, wirkte wie ein Leuchtfeuer im dämmrigen Nachmittagslicht – ganz und gar unüblich für diese Gegend, in der fast alle Bauwerke weiß waren. Auch die beiden Außengebäude in leuchtendem Purpur und Limonengrün trotzten der lokalen Tradition. In beiden war es dunkel, aber durch die Fenster des Cottages strömte Licht in den umliegenden Garten.
Mick schaltete die Sirene aus und parkte, ließ aber Scheinwerfer und Warnlicht an. Das fand er cool. Er trat durch das Tor und ging an dem alten Vauxhall in der Auffahrt vorbei. Dann klopfte er vernehmlich an die leuchtend blaue Tür. Sofort erschien eine Gestalt auf der anderen Seite des bleiverglasten Türfensters, ganz so als hätte sie in der Nähe gestanden und gewartet. Sie trug enge Jeans und einen Rollkragenpullover. Ihre Ohrringe klimperten, als sie Mick ins Haus winkte.
»Mein Name ist Daidre Trahair«, stellte sie sich vor. »Ich habe angerufen.«
Sie führte ihn in eine kleine Diele, die mit Gummistiefeln, Wanderschuhen und Windjacken vollgestopft war. Ein riesiger eiförmiger Eisenkessel, den Mick als Erzförderkorb identifizierte, stand in einer Ecke und war mit Schirmen und Wanderstöcken gefüllt. Eine grob gezimmerte schmale Bank diente zum An- und Ausziehen von Stiefeln. Man konnte sich in der Enge kaum bewegen.
Mick schüttelte die Regentropfen von seiner Jacke und folgte Daidre ins Herz des Cottages: das Wohnzimmer. Dort hockte ein ungepflegter bärtiger Mann vor dem Kamin und mühte sich ungeschickt mit einer Handvoll Kohlebriketts ab. Der Schürhaken, mit dem er hantierte, hatte einen Griff in Form eines Entenkopfes. Er sollte eine Kerze unter die Kohlen halten, bis das Feuer in Gang kommt, dachte Mick. So hatte seine Mum das immer gemacht, und es hatte immer wunderbar funktioniert.
»Wo ist der Tote?«, fragte er. »Und ich brauche Ihre Personalien.« Er zückte sein Notizbuch.
»Die Flut steigt«, sagte der Mann. »Die Leiche liegt auf dem … Ich weiß nicht, ob es ein Teil des Riffs ist, aber das Wasser … Sicher wollen Sie sich zuerst die Leiche ansehen. Bevor Sie sich den Formalitäten widmen, meine ich.«
Derartige Vorschläge von Zivilisten, die all ihre Kenntnisse der Polizeiarbeit aus den Krimiserien auf irgendeinem Privatsender bezogen, gingen Mick mächtig auf den Zeiger. Und das galt auch für die Stimme des Mannes, deren Tonfall, Timbre und Akzent in auffälligem Widerspruch zu seiner Erscheinung standen. Er sah aus wie ein Penner, aber er redete nicht so. Vielmehr erinnerte der Mann ihn an das, was seine Großeltern »die gute alte Zeit« nannten, als die sogenannten feineren Leute in ihren Nobelkarossen nach Cornwall heruntergekommen und in schicken Hotels mit riesigen Veranden abgestiegen waren. Damals, als Auslandsreisen noch nicht ansatzweise so populär gewesen waren. »Die wussten noch, was ein anständiges Trinkgeld ist«, hatte sein Großvater immer gesagt. »Natürlich war das Leben damals auch noch nicht so teuer. Für einen Schilling kam man bis nach London!« Er hatte schon immer gern ein bisschen übertrieben, Micks Großvater – Teil seines Charmes, behauptete seine Mutter.
»Ich wollte den Toten vom Riff wegschaffen«, erklärte Daidre Trahair. »Aber er war dagegen.« Sie nickte zu dem Mann hinüber. »Es war ein Unfall. Ich meine, natürlich muss es ein Unfall gewesen sein, darum sah ich keinen Grund, warum … Ich war besorgt, dass das Meer ihn mitnimmt.«
»Wissen Sie, wer es ist?«
»Ich … Nein«, antwortete sie. »Ich habe sein Gesicht kaum sehen können.«
Mick widerstrebte es, ihnen nachzugeben, aber sie hatten recht. Er nickte zur Tür hinüber. »Dann woll’n wir ihn uns mal ansehen.«
Sie traten hinaus in den Regen. Der Mann brachte eine zerschlissene Baseballkappe zum Vorschein und setzte sie auf. Die Frau streifte sich eine Regenjacke über und zog die Kapuze über ihr sandfarbenes Haar.
Mick machte am Streifenwagen halt und holte die kleine Kamera heraus, die man ihm genehmigt hatte. Die Anschaffung war genau für einen Moment wie diesen gedacht gewesen. Denn falls er den Leichnam bewegen musste, würden sie wenigstens einen fotografischen Nachweis haben, wie der Fundort ausgesehen hatte, bevor das Wasser anstieg und den Toten fortzuspülen drohte.
Unten am Strand wehte es mächtig, und die Brandung kam gleichzeitig von links und rechts. Draußen auf dem Meer baute sich eine verführerische Dünung auf. Die Wellen bildeten sich schnell und brachen noch schneller – genau die Art Seegang, die einen Anfänger hinauslocken und umbringen konnte.
Der Tote indes war kein Surfer gewesen. Mick war überrascht. Er hatte angenommen … Wie hatte er sich nur dazu hinreißen lassen können! Er war froh, dass er seine voreiligen Schlüsse für sich behalten und nichts zu dem Mann und der Frau gesagt hatte.
Es war genau, wie Daidre Trahair es beschrieben hatte: Es sah wie ein Unfall aus. Ein junger Kletterer – eindeutig tot – lag auf einem Schieferfelsen am Fuß der Klippe.
Mick fluchte leise, als er die Leiche in Augenschein nahm. Das hier war nun wirklich nicht die beste Stelle zum Klettern, weder allein noch mit Partner. Zwar gab es in der Felswand Schieferschichten, wo man mit Händen und Füßen gut Halt finden konnte, und genügend Spalte, um Friends und Klemmkeile zur Sicherung einzusetzen, aber ebenso gab es Sandsteinflächen, die zerbröselten wie mürbes Gebäck, wenn man den entsprechenden Druck darauf ausübte.
So wie es aussah, war der Tote allein geklettert. Er hatte sich von der Klippe abgeseilt, um anschließend wieder nach oben zu steigen. Das Seil schien intakt, und der Karabiner war immer noch mit einem Achterknoten daran befestigt. Der Kletterer selbst war über ein Grigri mit dem Seil verbunden. Sein Abstieg hätte eigentlich problemlos funktionieren müssen.
Materialfehler oben an der Klippe, schloss Mick. Sobald er hier unten fertig war, würde er über den Küstenpfad nach oben kraxeln, um dort nach dem Rechten zu sehen.
Er machte seine Aufnahmen. Die Wellen krochen immer näher an den Toten heran. Mick fotografierte ihn und seine Umgebung aus jedem möglichen Winkel, dann nahm er das Funkgerät von der Schulter und bellte hinein. Doch er bekam nur statisches Rauschen zur Antwort. »Verflucht!« Er ging zum höchsten Punkt des Strandes hinüber, wo der Mann und die Frau warteten. Zu dem Mann sagte er: »Ich brauche Sie gleich«, dann ging er noch ein paar Schritte und versuchte erneut, eine Funkverbindung herzustellen. »Rufen Sie den Coroner an«, trug er dem Sergeant auf, der den Funkdienst in der Wache in Casvelyn versah. »Wir müssen den Leichnam wegschaffen. Hier kommt eine verdammt hohe Flut, und wenn wir den Kerl nicht bewegen, wird er weggespült.«
Und dann warteten sie, zur Untätigkeit gezwungen; die Minuten verstrichen, das Wasser stieg, bis endlich das Funkgerät fiepte. »Coroner … einverstanden … von der Flutlinie … Straße«, krächzte die Stimme. »Welche … Fundort … gebraucht?«
»Kommen Sie hier raus, und bringen Sie Ihre Regenjacke mit! Irgendjemand soll die Wache besetzen, während wir weg sind.«
»Kennen … Toten?«
»Irgendein Junge. Keine Ahnung, wer es ist. Sobald wir ihn von der Klippe geholt haben, sehe ich nach, ob er einen Ausweis bei sich hatte.«
Mick trat auf den Mann und die Frau zu, die in sich gekehrt ein paar Schritte voneinander entfernt standen und dem Wind und Regen den Rücken zugewandt hatten. Zu dem Mann sagte er: »Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber wir haben einen Job zu erledigen, und ich will nicht, dass Sie irgendwas anderes machen als das, was ich Ihnen jetzt sage. Kommen Sie mit!« An die Frau gerichtet, fügte er hinzu: »Und Sie auch.«
Sie suchten sich einen Weg über die Felsbrocken. Die Flut hatte den Sand bereits bedeckt. Im Gänsemarsch überquerten sie den ersten Schieferfelsen. Auf halbem Weg blieb der Mann stehen und streckte Daidre Trahair die Hand entgegen, um ihr behilflich zu sein. Doch sie schüttelte den Kopf. Es gehe schon, versicherte sie ihm.
2
Cadan Angarrack war der Regen egal. Ebenso egal war ihm der Anblick, den er der kleinen Welt von Casvelyn bot. Er trat in die Pedale seines Freestyle-BMX. Seine Knie hoben sich bis auf Hüfthöhe, und seine Ellbogen standen ab wie Warndreiecke. Er wollte nur nach Hause kommen, um die Neuigkeiten zu verkünden. Pooh hockte auf seiner Schulter, protestierte kreischend und schrie dann und wann »Scheiß Landratte« in Cadans Ohr – immer noch besser, als wenn er auf sein Ohrläppchen eingehackt hätte, was in der Vergangenheit gelegentlich vorgekommen war, ehe er den Vogel Manieren gelehrt hatte. Also versuchte Cadan gar nicht erst, ihn zum Schweigen zu bringen. Stattdessen antwortete er: »Ja, gib’s ihnen, Pooh«, woraufhin der Papagei krakeelte: »Spreng Löcher im Speicher« – eine Redewendung, auf die Cadan sich überhaupt keinen Reim machen konnte.
Hätte er sein Fahrrad zu Trainingszwecken gefahren und nicht als Transportmittel, hätte er den Vogel nicht bei sich gehabt. Zu Anfang hatte er Pooh immer mitgenommen und ihm einen Platz in der Nähe des leeren Swimmingpools gesucht, während er sein Programm absolvierte und nicht nur seine Tricks verbesserte, sondern auch seine Trainingsstrecke ausbaute. Aber irgendeine dämliche Lehrerin von der Grundschule neben dem Freizeitzentrum hatte sich über Poohs Vokabular beklagt und insbesondere darüber, was es den zarten Kinderseelen antun mochte, die sie mühevoll zu formen versuchte, und Cadan war zurechtgewiesen worden: Lass den Vogel zu Hause, wenn er nicht den Schnabel halten kann und du weiterhin den leeren Pool nutzen willst. Es war ihm nichts anderes übrig geblieben. Er konnte nur den Pool benutzen, weil er bei der Stadtverwaltung niemanden für seine Idee hatte gewinnen können, am Binner Down eine Airjump-Strecke einzurichten. Sie hatten ihn dort nur angeglotzt, als wäre er nicht ganz dicht, und Cadan hatte gewusst, was sie dachten – dasselbe, was sein Vater nicht nur dachte, sondern auch aussprach: »Zweiundzwanzig Jahre alt, und du spielst immer noch mit deinem Fahrrad herum? Was ist eigentlich los mit dir?«
Nichts, dachte Cadan. Absolut gar nichts. Wenn ihr denkt, es wäre einfach – Tabletop, Tailwhip –, dann versucht es doch mal selbst.
Natürlich taten sie das nicht. Weder die Verwaltungstypen noch sein Vater. Sie gafften ihn nur an, und ihr Ausdruck war unmissverständlich: Mach was aus deinem Leben. Beschaff dir endlich einen Job, Herrgott noch mal.
Und genau das war es, was er seinem Vater zu berichten hatte: Er hatte sich eine bezahlte Arbeit gesucht. Trotz Pooh auf der Schulter war es ihm tatsächlich gelungen, einen neuen Job zu finden. Sein Dad musste natürlich nicht unbedingt erfahren, wie er das angestellt hatte. Cadan hatte eigentlich nur bei den Leuten von Adventures Unlimited angefragt, ob ihnen überhaupt klar sei, was sich mit dem verfallenen Minigolfplatz anfangen lasse. Und am Ende hatten sie ihm angeboten, ihnen bei der Instandsetzung des alten Hotels zu helfen. Als Gegenleistung durfte er den Minigolfplatz als Trainingsstrecke zur Perfektionierung seiner Fahrradakrobatik nutzen. Allerdings würde er vorher die kleinen Häuschen und Hindernisse abbauen müssen. Lew Angarrack musste nur eines wissen: Nachdem er seinen Sohn für dessen zahllose Unzulänglichkeiten aus dem Familienunternehmen gefeuert hatte – aber wer wollte schon Surfbretter bauen? –, hatte dieser nichtsnutzige Sohn es tatsächlich fertiggebracht, Job A binnen zweiundsiebzig Stunden mit Job B zu ersetzen. Das war rekordverdächtig, fand Cadan. Meistens gab er seinem Dad mindestens fünf oder sechs Wochen lang Gelegenheit, stinksauer auf ihn zu sein.
Er rumpelte den unbefestigten Pfad hinter der Victoria Road entlang und wischte sich den Regen aus den Augen, als sein Vater ihn im Auto überholte. Lew Angarrack schaute ihn zwar nicht an, aber der säuerliche Gesichtsausdruck verriet Cadan, dass er sehr wohl wahrgenommen hatte, was für einen Anblick sein Sohn bot. Und wahrscheinlich erinnerte er sich auch gerade an den Grund, warum dieser Versager mit dem Rad durch den Regen fuhr, statt hinter dem Steuer seines Autos zu sitzen.
Cadan sah seinen Vater aus dem RAV4 steigen und das Garagentor öffnen. Rückwärts setzte er den Toyota hinein, und als Cadan sein Rad durch das Törchen in den Garten schob, hatte Lew sein Surfboard bereits abgespritzt. Er holte den Neoprenanzug aus dem Wagen, um ihn ebenfalls abzuspülen, während der Schlauch auf dem Rasen lag und gluckernd Wasser von sich gab.
Cadan betrachtete seinen Vater einen Moment. Er wusste, dass er ihm äußerlich nachschlug, aber damit endete alle Ähnlichkeit. Sie hatten die gleiche untersetzte Statur, Schultern und Brust breit, sodass sie wie Keile gebaut waren, und das gleiche Übermaß an dunklem Haar, welches sich bei seinem Vater zunehmend auch am Körper zeigte. Er wurde dem Spitznamen »Gorillamann«, den Cadans Schwester ihm insgeheim gegeben hatte, zunehmend gerecht. Aber das war auch schon alles. In jeder anderen Hinsicht waren sie so verschieden wie Feuer und Wasser. Für seinen Vater war die Welt in Ordnung, wenn alles an seinem zugewiesenen Platz war und sich niemals irgendetwas änderte, und zwar bis ans Ende seiner Tage. Wohingegen Cadan … Nun, er selbst hatte ganz andere Vorstellungen. Für seinen Vater bestand die ganze Welt aus Casvelyn. Niemals würde er es bis an den Nordstrand von O’ahu schaffen. Träum nur weiter, Dad. Das wäre das größte Wunder, das die Welt je gesehen hätte. Cadan hingegen hatte große Pläne, und die beinhalteten seinen Namen in riesigen Leuchtbuchstaben, die X-Games, Goldmedaillen und sein grinsendes Konterfei auf dem Cover von Ride BMX.
Er wandte sich an seinen Vater: »Auflandiger Wind heute. Warum warst du draußen?«
Lew antwortete nicht. Er ließ das Wasser über den Anzug laufen, schlug ihn um und tat das Gleiche mit der Rückseite. Er wusch die Stiefel, Kapuze und Handschuhe aus, ehe er ganz gemächlich den Blick erst auf Cadan und dann auf den mexikanischen Papagei auf dessen Schulter richtete. »Sieh lieber zu, dass du den Vogel aus dem Regen schaffst.«
»Der macht ihm nichts aus. Da, wo er herkommt, regnet es andauernd. Du hattest keine guten Wellen, was? Die Flut steigt ja gerade erst. Wo warst du?«
»Ich brauchte keine Wellen.« Sein Vater las den Neoprenanzug vom Rasen auf und hängte ihn an seinen angestammten Platz über die Rückenlehne eines alten Gartenstuhls aus Aluminium, dessen geflochtene Sitzfläche vom Gewicht unzähliger Hinterteile eingedellt war. »Ich wollte nachdenken. Zum Denken braucht man keine Wellen, oder?«
Warum dann all die Mühe, die Ausrüstung zusammenzusuchen und zum Strand runterzuschaffen?, wollte Cadan fragen, hielt sich dann aber zurück, denn hätte er gefragt, hätte er auch eine Antwort bekommen und erfahren, worüber sein Vater nachgedacht hatte. Da gab es drei Möglichkeiten, und weil eine davon Cadan selbst und die Liste seiner Fehltritte war, beschloss er, diesen ganzen Themenkomplex zu meiden. Er folgte seinem Vater ins Haus, wo Lew sich das Haar mit einem schlaffen Handtuch frottierte, das nur zu diesem Zweck an einem Haken hinter der Tür hing. Dann ging er zur Anrichte und schaltete den Wasserkocher ein. Jetzt kam also der Nescafé. Ein Löffel Zucker, keine Milch. Immer in demselben Kaffeebecher, dem mit der Aufschrift »Newquay Invitational«. Während er seinen Kaffee trank, stand er am Fenster und starrte hinaus in den Garten, und war der Becher geleert, wurde er umgehend gespült. Sein Vater war die Spontaneität in Person.
Cadan wartete, bis Lew den Becher in der Hand hielt und wie üblich ans Fenster trat. Er nutzte die Zeit, um Pooh im Wohnzimmer auf seinen Stammplatz zu setzen. Dann kehrte er in die Küche zurück und verkündete: »Ich hab ’nen Job, Dad.«
Sein Vater trank einen Schluck. Völlig lautlos. Kein Schlürfen von heißem Kaffee, kein zustimmender Brummlaut. Als er sich schließlich entschloss zu sprechen, fragte er: »Wo ist deine Schwester?«
Cadan gedachte nicht, sich ablenken zu lassen. »Hast du gehört, was ich gesagt hab?«, fragte er. »Ich habe einen Job. Einen vernünftigen.«
»Und hast du gehört, was ich dich gefragt habe? Wo ist Madlyn?«
»Es ist ein normaler Werktag. Ich nehme an, sie ist bei der Arbeit.«
»Da bin ich vorbeigefahren. Da war sie nicht.«
»Dann weiß ich auch nicht, wo sie ist. Vermutlich sitzt sie irgendwo und heult in die Suppe, statt sich zusammenzureißen, wie jeder andere es täte. Man könnte glatt meinen, es wäre das Ende der Welt.«
»Ist sie in ihrem Zimmer?«
»Ich hab dir doch gesagt …«
»Wo?«
Lew hatte sich immer noch nicht vom Fenster abgewandt, was Cadan auf die Palme brachte. Am liebsten hätte er ein halbes Dutzend Pints vor den Augen seines Vaters geleert, nur damit der ihm endlich seine Aufmerksamkeit schenkte. »Ich sag doch, ich weiß nicht, wo …«
»Wo hast du einen Job bekommen?« Lew wandte sich um. Nicht nur eine Drehung des Kopfes, sondern des ganzen Körpers. Er lehnte sich an die Fensterbank. Sein Blick ruhte auf seinem Sohn, und Cadan wusste, er wurde gelesen, abgeschätzt und für unzulänglich befunden. Auf dem Gesicht seines Vaters lag ein Ausdruck, den er kannte, seit er sechs war.
»Adventures Unlimited«, antwortete er. »Ich soll das Hotel auf Vordermann bringen, bis die Saison anfängt.«
»Und was dann?«
»Wenn alles klappt, werde ich Trainer.« Dies zu behaupten, war zwar ein bisschen voreilig, aber es stand immerhin zu hoffen; schließlich waren sie im Moment ja wirklich dabei, Trainer für den Sommer auszuwählen. Abseilen, klettern, Kajak fahren, schwimmen, segeln … Er konnte all das, und selbst wenn sie ihn dafür nicht wollten, hatte er ja immer noch das Freestyle-BMX-Fahren in der Hinterhand und seinen Plan, den Minigolfplatz umzugestalten. Doch das erzählte er seinem Vater nicht. Eine Silbe über Freestyle, und Lew würde das Wort »Hintergedanken« hineininterpretieren, als stünde es auf Cadans Stirn tätowiert.
»Wenn alles klappt.« Lew stieß die Luft durch die Nase aus. Das war seine Version eines verächtlichen Schnaubens, und es sagte mehr aus, als ein dramatischer Monolog es vermocht hätte. »Und wie willst du dort hinkommen? Auf dem Ding da draußen?« Womit er das Fahrrad meinte. »Denn deinen Autoschlüssel bekommst du von mir nicht zurück, und auch nicht deinen Führerschein. Also bild dir ja nicht ein, ein Job würde daran etwas ändern.«
»Hab ich dich vielleicht um den Schlüssel gebeten?«, konterte Cadan. »Oder um den Führerschein? Ich geh zu Fuß. Oder wenn’s sein muss, nehm ich das Rad. Mir ist egal, wie das aussieht. Heute bin ich ja auch mit dem Rad hingefahren.«
Wieder dieses Schnauben. Cadan wünschte sich, sein Vater würde einfach sagen, was er dachte, statt es mit Mimik und nicht sonderlich subtilen Lauten auszudrücken. Hätte Lew Angarrack geradeheraus gesagt: »Du bist ein Versager, Junge«, dann hätte Cadan wenigstens etwas gehabt, worüber er mit ihm streiten konnte: sein Versagen als Sohn gegenüber Lews andersgeartetem Versagen als Vater. Aber Lew wählte immer den indirekten Weg, nämlich den des Schweigens, vielsagender Atemgeräusche oder, wenn gar nichts anderes half, den Vergleich zwischen Cadan und seiner Schwester: der heiligen Madlyn, einer Weltklassesurferin auf dem Weg nach ganz oben. Jedenfalls bis vor Kurzem.
Cadan bedauerte seine Schwester um das, was ihr passiert war, aber ein kleiner, hässlicher Teil in ihm jauchzte vor Freude. Für ein so kleines Mädchen hatte sie einen viel zu langen Schatten geworfen, und das jahrelang.
Er fragte: »Und das ist alles? Kein ›Gut gemacht, Cadan‹? Oder ›Glückwunsch‹? Oder wenigstens ›Jetzt hast du mich aber echt mal überrascht‹? Ich habe einen Job gefunden, übrigens sogar einen gut bezahlten, aber das ist dir scheißegal, weil … Warum eigentlich? Ist er nicht gut genug? Oder weil er nichts mit Surfen zu tun hat? Er ist …«
»Du hattest einen Job, Cadan. Du hast ihn vermasselt.« Lew trank den letzten Schluck Kaffee und stellte den Becher in die Spüle. Dort schrubbte er ihn gründlich, wie er es mit allen Dingen tat. Keine Flecken, keine Keime.
»Das ist doch Blödsinn«, entgegnete Cadan. »Es war von Anfang an eine miserable Idee, für dich zu arbeiten, und das haben wir beide gewusst, selbst wenn du’s nicht zugeben willst. Ich bin eben nicht so detailversessen. Das war ich noch nie. Ich hab dafür einfach nicht … ich weiß nicht … die Geduld oder was auch immer.«
Lew trocknete Becher und Löffel ab und räumte beides weg. Dann wischte er die verschrammte alte Edelstahlspüle aus, obwohl nicht ein einziger Krümel darin zu entdecken war. »Das Problem mit dir ist: Du erwartest, dass alles im Leben Spaß machen soll. Aber so ist das Leben einfach nicht, und das willst du nicht einsehen.«
Cadan wies auf den Garten und die Surfausrüstung hinaus, die sein Vater gerade vom Salzwasser gereinigt hatte. »Und dabei geht’s nicht um Spaß? Du hast jede freie Minute deines ganzen Lebens damit zugebracht, Wellen zu reiten. Ist das denn was anderes? Eine Art nobles Streben, wie die Suche nach einem Aids-Medikament? Oder der Kampf gegen die weltweite Armut? Du machst mich fertig, weil ich tue, was ich tun will, aber hast du nicht immer genau das Gleiche getan? Nein, warte! Antworte nicht! Ich weiß schon. Bei allem, was du tust, geht es nur darum, einen zukünftigen Champion zu fördern. Ein Ziel zu haben. Während das, was ich tue …«
»Gegen ein Ziel ist nichts einzuwenden.«
»Nein, das stimmt. Und ich hab meins. Es ist eben nur ein anderes als deines. Oder Madlyns. Oder was einmal Madlyns war.«
»Wo ist sie?«, fragte Lew.
»Ich hab dir doch gesagt …«
»Ich weiß, was du gesagt hast. Aber du wirst doch zumindest eine Ahnung haben, wo deine Schwester stecken könnte, wenn sie nicht zur Arbeit gegangen ist. Du kennst sie. Und ihn kennst du mindestens genauso gut.«
»Hey. Häng mir das nicht an! Sie wusste, was er für einen Ruf hat. Das weiß doch jeder. Aber sie wollte ja auf niemanden hören. Außerdem geht es dir gar nicht darum, wo sie sich gerade aufhält, sondern allein um die Tatsache, dass sie aus der Bahn geworfen ist. So wie du.«
»Sie ist nicht aus der Bahn geworfen.«
»Das ist sie sehr wohl! Und was bleibt dir jetzt, Dad? Du hast deine Träume auf sie projiziert, statt deine eigenen zu leben.«
»Sie wird wieder anfangen.«
»Darauf würde ich nicht wetten.«
»Untersteh dich …« Lew unterbrach sich abrupt.
Sie starrten einander über die Küche hinweg an. Es waren nur drei Meter, aber gleichzeitig war es eine Kluft, die von Jahr zu Jahr breiter wurde. Jeder stand auf seiner Seite am Rand des Abgrunds, und Cadan kam es so vor, als würde einer von ihnen über kurz oder lang hineinstürzen.
Selevan Penrule ließ sich auf dem Weg zum Clean-Barrel-Surfshop alle Zeit der Welt, denn er war zu dem Schluss gekommen, es wäre unziemlich gewesen, Hals über Kopf aus dem Salthouse Inn zu stürzen, sowie das Gerücht über Santo Kerne die Runde machte. Er hätte Grund genug dafür gehabt, aber er wusste, es hätte nicht gut ausgesehen. Außerdem war er in einem Alter, da man überhaupt nirgendhin mehr Hals über Kopf stürzte. Zu viele Jahre hatte er Kühe gemolken und die blöden Rindviecher von einer Weide zur anderen getrieben, sodass sein Rücken jetzt für alle Zeit krumm war und seine Hüften im Eimer. Mit achtundsechzig fühlte er sich wie achtzig. Er hätte fünfunddreißig Jahre eher verkaufen und den Caravanpark eröffnen sollen, und das hätte er auch getan, wenn er das Geld, den Schneid, die Vision, keine Frau und keine Kinder gehabt hätte. Sie alle waren jetzt fort, das Haus abgerissen und die Farm umfunktioniert. »Sea Dreams« hatte er es getauft: vier ordentliche Reihen von Feriencaravans, die wie Schuhkartons auf den Klippen über der See standen.
Er fuhr vorsichtig. Gelegentlich liefen Hunde über die engen Landsträßchen. Auch Katzen. Kaninchen. Vögel. Selevan hasste die Vorstellung, ein Tier zu überfahren, nicht wegen des schlechten Gewissens, das er verspüren würde, wenn er ein Leben beendete, sondern wegen der Unannehmlichkeiten, die dies mit sich brächte. Er würde anhalten müssen, und er verabscheute es anzuhalten, wenn er einmal einen Kurs eingeschlagen hatte. In diesem Fall führte sein Kurs ihn hinüber nach Casvelyn zu dem Surfshop, wo seine Enkelin arbeitete. Er wollte derjenige sein, der Tammy die Nachricht überbrachte.
Als er in die Stadt kam, parkte er am Kai, die Nase seines altersschwachen Landrovers auf den Casvelyn Canal gerichtet, einen schmalen Wasserlauf, der früher einmal Holsworthy und Launceston mit dem Meer verbunden hatte, heute aber nur noch sieben Meilen landeinwärts mäandrierte, ehe er abrupt endete wie ein unterbrochener Gedanke. Selevan hatte auf der falschen Seite angehalten; das Stadtzentrum und der Surfshop befanden sich am gegenüberliegenden Ufer, aber dort drüben gab es keine Parkplätze, ganz gleich zu welcher Jahreszeit. Außerdem kam der kurze Spaziergang ihm gelegen. Das Wetter und die Jahreszeit waren ihm egal. Auf dem Weg die halbmondförmige Straße entlang, die den südwestlichen Stadtrand markierte, würde er Zeit zum Nachdenken haben. Er musste sich eine Strategie zurechtlegen, wie er die Neuigkeiten wohldosierte und gleichzeitig ihre Reaktion darauf ablesen konnte. Denn was Tammy war und was Tammy zu sein behauptete, stand nach Selevan Penrules Meinung in krassem Gegensatz zueinander. Das war ihr nur noch nicht bewusst.
Als er ausstieg, nickte er ein paar Fischern zu, die im Regen zusammenstanden und rauchten, ihre Boote am Kai vertäut. Sie waren durch die Kanalschleuse am entlegenen Ende des Kais vom Meer hereingekommen, und sie sahen so ganz anders aus als die Boote und Bootsführer, die mit Beginn des Sommers nach Casvelyn kommen würden. Selevan zog diese Gruppe hier eindeutig vor. Sicher, er verdiente sein Auskommen mit dem Fremdenverkehr, aber das musste ihm ja nicht gefallen.
Er ging in Richtung Stadtzentrum, vorbei an einer Reihe Läden. Er machte bei Jill’s Juices halt, um sich einen Kaffee zu holen, und erstand ein Päckchen Dunhill und eine Rolle Pfefferminzbonbons bei Pukkas Pizza Etcetera (wobei der Schwerpunkt auf dem Etcetera lag, denn die Pizza war ungenießbar). Dann stieß er auf die Promenade, die in Richtung Stadtzentrum ein wenig anstieg. Der Clean-Barrel-Surfshop befand sich an einer Straßenecke, und auf dem Weg dorthin passierte er einen Frisör, einen schmuddeligen Nachtclub, zwei extrem heruntergekommene Hotels und einen Fish-and-Chips-Laden.
Bis er am Surfshop ankam, hatte er seinen Kaffee ausgetrunken. Er konnte keinen Mülleimer entdecken, also faltete er den Pappbecher zusammen und steckte ihn sich in die Jackentasche. Ein paar Schritte entfernt stand ein junger Mann mit Haaren von undefinierbarer Farbe. Er war offenbar in ein ernstes Gespräch mit Nigel Coyle vertieft, dem Inhaber von Clean Barrel. Das dürfte Will Mendick sein, dachte Selevan. Er hatte große Hoffnungen in Will gesetzt, aber bislang war nichts daraus geworden.
Selevan hörte, wie Will zu Nigel Coyle sagte: »Ich geb ja zu, dass es ein Fehler war, Mr. Coyle. Ich hätte es ihm nicht vorschlagen sollen. Aber es ist ja nicht so, als hätt ich so was früher schon mal gemacht.«
»Du bist kein besonders guter Lügner«, erwiderte Coyle, und dann stapfte er davon und ließ den Wagenschlüssel in seiner Hand klimpern.
Will murmelte finster vor sich hin: »Scheiß auf dich, Mann.« Und als Selevan zu ihm trat: »Hallo, Mr. Penrule. Tammy ist drinnen.«
Selevan traf seine Enkelin im Laden an, als sie gerade dabei war, einen Ständer mit bunten Prospekten zu füllen. Er betrachtete sie, so wie er sie immer betrachtete, nämlich wie eine Art Säugetier, das ihm nie zuvor untergekommen war. Er missbilligte das meiste dessen, was er sah: Sie war nur Haut und Knochen und ganz in Schwarz gekleidet. Schwarze Schuhe, schwarze Nylons, schwarzer Rock und schwarzer Pulli. Das Haar zu dünn und zu kurz geschnitten, und sie tat nicht einmal mehr etwas von diesem Klebezeug hinein, um es in Form zu bringen. So hing es lediglich schlaff an ihrem Schädel herunter.
Selevan hätte mit der Magerkeit und der Vorliebe für schwarze Kleidung leben können, wäre das Mädchen in anderer Hinsicht wenigstens ansatzweise normal gewesen. Er hätte es verstanden, wenn sie ihre Augen mit Kohlestift geschwärzt und Silberringe in ihren Augenbrauen und Lippen oder einen Stecker in der Zunge getragen hätte. Nicht dass ihm das gefiel, aber er hätte es verstanden. Das war nun einmal die Mode bei gewissen Leuten in ihrem Alter, und man konnte nur hoffen, dass sie zu Verstand kamen, ehe sie sich vollkommen entstellten. Waren sie erst einmal einundzwanzig oder vielleicht fünfundzwanzig und stellten fest, dass ihnen gut bezahlte Jobs nicht gerade vor die Füße fielen, dann besannen sie sich schon wieder selbst eines Besseren. So wie Tammys Vater. Und was war der jetzt? Lieutenant Colonel in der Army und in Rhodesien stationiert oder wo auch immer – denn Selevan kam bei den häufigen Versetzungen nicht mehr mit, und für ihn würde es immer Rhodesien bleiben und auch so heißen, ganz egal wie es sich heutzutage nannte. Jedenfalls hatte er eine glänzende Karriere eingeschlagen.
Aber Tammy? »Können wir sie zu dir schicken, Dad?«, hatte ihr Vater Selevan gefragt. Seine Stimme am Telefon hatte so deutlich geklungen, als stünde er im Nachbarzimmer und nicht in irgendeinem afrikanischen Hotel, wo er seine Tochter geparkt hatte, nur um sie wenig später in den Flieger nach England zu setzen. Was hätte ihr Großvater da noch tun können? Sie hatte ihr Ticket bereits in der Tasche. Sie war quasi schon unterwegs. »Wir können sie dir doch schicken, Dad, oder? Das hier ist nicht die richtige Umgebung für sie. Sie sieht hier zu viel. Wir glauben, das ist das Problem.«
Selevan hatte seine eigene Theorie, was das Problem war, aber ihm gefiel der Gedanke, dass ein Sohn sich auf die Weisheit seines Vaters berief. »Schick sie mir«, hatte er also zu David gesagt. »Aber wenn sie bei mir wohnt, lasse ich mir nicht auf der Nase herumtanzen. Sie muss ordentlich essen und ihr Zeug aufräumen und …«
Das sei doch selbstverständlich, versicherte sein Sohn ihm.
Und so war es auch. Das Mädchen hinterließ kaum eine Spur irgendwo. Selevan hatte geglaubt, sie würde ihm Kummer bereiten, aber er hatte gelernt, dass der Kummer, den sie ihm machte, darin bestand, dass sie ihm nicht einen Hauch von Kummer machte. Das war nicht normal, und das war der Kern des Problems. Denn, verdammt noch mal, sie war doch seine Enkelin. Und das hieß, sie sollte normal sein.
Sie schnipste den letzten Prospekt an seinen Platz, rückte dann den ganzen Stapel gerade und trat einen Schritt zurück, so als wollte sie ihr Werk begutachten, als Will Mendick eintrat. »Hat nichts genützt«, eröffnete er Tammy. »Coyle stellt mich nicht wieder ein.« Und an Selevan gewandt: »Sie sind heute früh dran, Mr. Penrule.«
Tammy fuhr herum. »Grandpa! Hast du meine Nachricht nicht bekommen?«
»Ich war noch nicht zu Hause«, erklärte Selevan.
»Oh. Ich wollte … Will und ich hatten vor, nach Feierabend noch einen Kaffee trinken zu gehen.«
»Ach, wirklich?« Selevan war erfreut. Vielleicht hatte er sich ja doch getäuscht, was Tammys Einstellung zu dem jungen Mann betraf.
»Er fährt mich anschließend nach Hause.« Dann runzelte sie die Stirn, als ihr aufging, dass es noch viel zu früh war, um von ihrem Großvater abgeholt zu werden. Sie sah auf die Uhr, die locker um ihr dürres Handgelenk schlackerte.
»Ich komme gerade vom Salthouse Inn«, erklärte Selevan. »Draußen in Polcare Cove hat es einen Unfall gegeben.«
»Geht es dir gut?«, fragte sie. »Du hast dich doch nicht verletzt?« Sie klang besorgt, und das freute Selevan. Tammy liebte ihren alten Großvater. Er war streng mit ihr, aber das nahm sie ihm nicht übel.
»Hatte nichts mit mir zu tun«, stellte er klar, und als er fortfuhr, ließ er sie nicht aus den Augen: »Es war Santo Kerne.«
»Santo? Was ist mit ihm?«
Hatte ihre Stimme sich gehoben? Hörte er Panik? Ein Sich-Wappnen gegen schlechte Neuigkeiten? Selevan hätte das gerne geglaubt, aber er brachte ihren Tonfall nicht in Einklang mit dem Blick, den sie mit Will Mendick tauschte.
»Soweit ich weiß, ist er von der Klippe gestürzt«, sagte er. »Unten in Polcare Cove. Dr. Trahair kam mit irgend so einem Wanderer in den Pub, um die Polizei zu rufen. Dieser Kerl – der Wanderer – hat den Jungen gefunden.«
»Geht es ihm gut?«, erkundigte sich Will Mendick, und im selben Moment fragte Tammy: »Aber Santo ist nichts passiert, oder?«
Das gefiel Selevan außerordentlich: die überstürzte Art, wie Tammy die Worte hervorbrachte und was das über ihre Gefühle aussagte – auch wenn man kaum einen Kerl finden konnte, der die Zuneigung eines jungen Mädchens weniger verdiente als Santo Kerne. Wenn denn Zuneigung bestand, war das ein gutes Zeichen, und aus genau diesem Grund hatte Selevan Penrule Santo Kerne in jüngster Zeit Zutritt zum Gelände von Sea Dreams gewährt. Er hatte ihm die Erlaubnis erteilt, die Abkürzung zu den Klippen und zum Meer zu nehmen; und wer mochte schon wissen, was daraufhin in Tammys Herz gedieh? Und das war doch das Ziel gewesen, oder? Dass Tammy gedieh und Ablenkung fand.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Selevan. »Ich weiß nur, dass Dr. Trahair reingekommen ist und zu Brian vom Salthouse Inn gesagt hat, dass Santo Kerne unten auf den Felsen in Polcare Cove liegt. Mehr weiß ich nicht.«
»Das klingt nicht gut«, meinte Will Mendick.
»War er draußen zum Surfen, Grandpa?«, fragte Tammy. Aber es war nicht ihr Großvater, den sie bei der Frage ansah. Ihr Blick war auf Will gerichtet.
Das bewog Selevan, den jungen Mann ein wenig genauer in Augenschein zu nehmen. Will atmete ein bisschen komisch, stellte er fest, wie ein Sprinter, aber sein Gesicht war bleich geworden. Von Natur aus hatte er eine frische Farbe, darum fiel es auf, wenn ihm das Blut aus den Wangen wich.
»Keine Ahnung, was er dort getrieben hat«, gab Selevan zurück. »Aber fest steht: Irgendetwas ist ihm passiert. Und es sieht schlimm aus.«
»Wieso?«, fragte Will.
»Weil sie den Jungen kaum allein dort auf den Felsen hätten liegen lassen, wenn er nur verletzt gewesen wäre und nicht …« Er hob die Schultern.
»Doch nicht etwa tot?«, fragte Tammy leise.
»Tot?«, wiederholte Will.
»Du gehst jetzt besser, Will«, fuhr Tammy herum.
»Aber wie soll ich …«
»Dir fällt schon was ein. Los jetzt. Wir gehen ein andermal Kaffee trinken.«
Das war anscheinend alles, was er hören wollte. Will nickte Selevan zu und wandte sich zur Tür. Im Vorbeigehen berührte er Tammy an der Schulter. »Danke, Tammy«, murmelte er noch. »Ich ruf dich an.«
Selevan versuchte, das als gutes Zeichen zu werten.
Das Tageslicht schwand rasch, als Detective Inspector Bea Hannaford in Polcare Cove eintraf. Als ihr Handy geklingelt