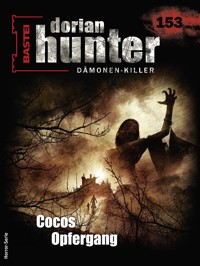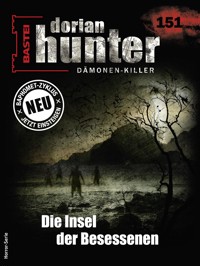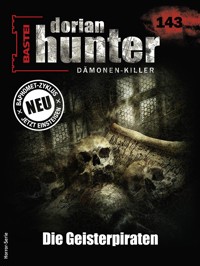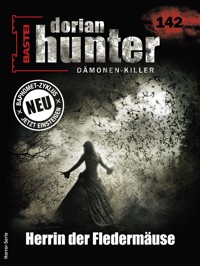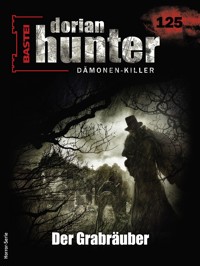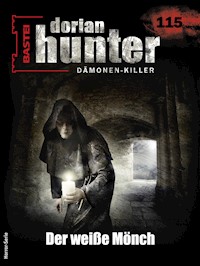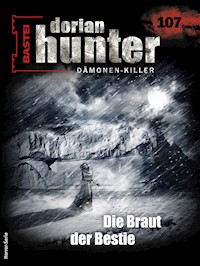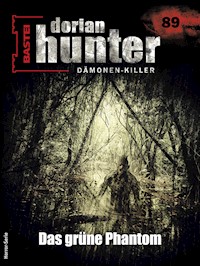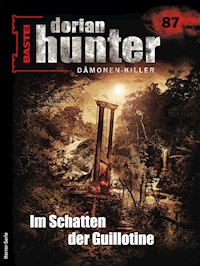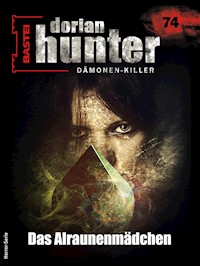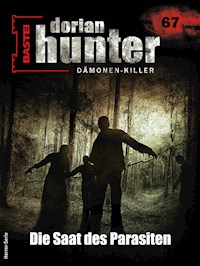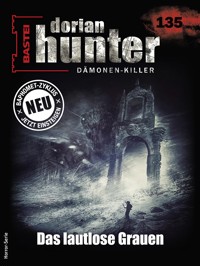
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Tempel des Hermes Trismegistos ist zerstört, sein Besitzer in der Januswelt Malkuth verschwunden! Unmittelbar vor der Vernichtung zeigte der magische Tisch im Tempel sieben düstere Szenen. Eine davon zeigt Dorian Hunters Sohn Martin in unmittelbarer Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DAS LAUTLOSE GRAUEN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
Als Rückzugsort in seinem Kampf bleibt Dorian neben der Jugendstilvilla in der Baring Road in London noch das Castillo Basajaun in Andorra, in dem er seine Mitstreiter um sich sammelt – darunter die ehemalige Hexe Coco Zamis, die aus Liebe zu Dorian die Seiten gewechselt hat. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Martin hat Coco diesen zum Schutz vor den Dämonen an einem Ort versteckt, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
Auf der Suche nach der Mumie des Hermes Trismegistos findet Dorian den Steinzeitmenschen Unga, der Hermon gedient hat und der sich nach seinem Erwachen schnell den Gegebenheiten der Gegenwart anpasst. Auf Island gewinnt Dorian den Kampf um das Erbe des Hermes Trismegistos.
Eine neue Gefahr zieht am Horizont auf: Die Janusköpfe von der Parallelwelt Malkuth versuchen die Erde zu erobern, aber die Sekte der Padmas kann sie mit Dorians Hilfe abwehren. Hinter dem Anführer der Padmas, dem Padmasambhawa, verbirgt sich Hermes Trismegistos. Dorian macht Hermon klar, dass er für das Entstehen der fürchterlichen Psychos auf Malkuth verantwortlich ist. Um zu büßen, geht Hermon durch eins der letzten Tore nach Malkuth, bevor sich dieses schließt. Auf der Erde sind zehn Janusköpfe gestrandet. Olivaro, das ehemalige Oberhaupt der Schwarzen Familie und selbst ein Januskopf, beschließt, seine Artgenossen zu jagen. Die Suche nach einem Weg zurück führt den Januskopf Chakravartin zum Tempel des Hermes Trismegistos. Aber der Erzdämon Luguri bringt Chakravartin in seine Gewalt und stürmt den Tempel. Dessen Sicherheitssysteme leiten daraufhin die Selbstzerstörung ein. Dorian und Unga können nur zwei Kommandostäbe, zwei Magische Zirkel und zwei Bücher aus dem Tempel retten. Unmittelbar vor der Vernichtung zeigt der magische Tisch sieben düstere Szenen, die Dorian als Prophezeiungen begreift. Eine davon zeigt seinen eigenen Sohn in großer Gefahr.
DAS LAUTLOSE GRAUEN
von Roy Palmer
Ray Mandell verzog den Mund zu einem verächtlichen Lächeln. »Frische Calamari? Da hört sich doch alles auf! Lebender Tintenfisch mitten in London? Für wen halten uns diese Südländer eigentlich? Glauben die, sie könnten uns so einen Bären aufbinden? Und dann dieser Wahnsinnspreis. Zwei Pfund die Portion. Hier – sieh dir das an!«
Er reichte die Speisekarte Steward Drummond, der ihm gegenübersaß. Steward gab durch eine Kopfbewegung seiner Frau Britt zu verstehen, dass er bereits das Menü studiert hatte. Britt, die den Platz neben ihm eingenommen hatte, versuchte gerade angestrengt, die italienischen Ausdrücke auf der Karte auszusprechen.
»Du lieber Himmel, es gibt ja so viele Fischgerichte! Da hat man wirklich die Qual der Wahl.«
»Ist doch egal, wovon uns schlecht wird. Bestellen wir einfach irgendetwas«, schlug Steward vor. Er grinste und freute sich insgeheim auf Rays Reaktion. Ray Mandell verstand einfach keinen Spaß.
1. Kapitel
Eigentlich war es eine verrückte Idee, mit ihm und seiner Frau ausgerechnet ein italienisches Restaurant am Piccadilly Circus zu besuchen. Bekanntlich war er der Typ, der selbst während eines Auslandsurlaubs noch krampfhaft nach englischem Bier, Pies und Cornflakes Ausschau hielt. Aber Steward hatte trotzdem auf der Verwirklichung des Planes bestanden, nachdem Britt – die naive Britt – ihn einmal zur Sprache gebracht hatte.
Steward ertrug Ray Mandells Gesellschaft nur, weil Britt und Sue Arbeitskolleginnen und Freundinnen waren. Abends traf man sich gelegentlich, und dann nahm Steward jede Gelegenheit wahr, um den biederen, spießbürgerlichen Mann auf die Palme zu bringen.
Natürlich ärgerte sich Mandell, dass seine Worte nicht den gewünschten Nachhall gefunden hatten.
»Calamari – lebend! Da lachen ja die Hühner!«, empörte er sich laut. »Und auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, das auf Englisch zu übersetzen! Als ob wir den Trick nicht kennen würden! Diese Mafiosi behaupten doch alle, ihren frischen Fisch täglich mit dem Jet aus Genua oder weiß der Teufel woher zu beziehen. Dabei holen sie ihn bloß aus der Tiefkühltruhe. Man müsste bloß mal hinter die Kulissen gucken, und der Schwindel flöge auf. Aber mit uns kann man's ja machen.«
»Ja«, erwiderte Steward. »Wir Engländer sind nun mal weltweit als Gaumenmuffel verschrien.« Sehnsüchtig wartete er auf Rays Trotzreaktion.
»Gaumenmuffel? Von uns haben die anderen erst das Kochen gelernt.«
»Und die meisten Leute in London gehen nicht in unsere einheimischen, sondern in die vielen ausländischen Restaurants, die hier nach dem Krieg wie Pilze aus dem Boden geschossen sind«, behauptete Steward.
»Denen würde ich die Konzession entziehen«, sagte Ray.
»Hör doch auf!«, sagte jetzt Sue, die bisher kaum den Mund aufgetan hatte. Immer wieder schaute sie sich im Lokal um, ob auch niemand mithörte.
Das Restaurant »La Cambusa« war wegen seiner vorzüglichen Spezialitäten renommiert. Die schicken Kellner waren allesamt richtige Italiener, und auch das übrige Personal stammte dem Vernehmen nach aus südlichen Gefilden. Sue hatte immer schon gern einmal hier zu Abend essen wollen. Sie hatte keine Lust, sich jetzt den Ausgang verderben zu lassen.
Sie legte ihrem Mann eine Hand auf den Unterarm. »Liebling, nun reg dich doch nicht so auf! Wir können ja was anderes bestellen. Es muss ja nicht unbedingt Fisch sein.«
»Richtig«, pflichtete Steward ihr scheinheilig bei und grinste immer noch. »Wer was auf sich hält, verzichtet auch beim Winzerfest nicht auf sein gewohntes Bier.« Er nahm Britt die Karte ab. »Wie wär's mit Roastbeef?«
Ray Mandell lief ein wenig dunkel an. »Ich will's wissen.«
Mit verbissenem Gesicht winkte er den Ober heran.
»Hallo – Sie!«, sagte er zu dem Ober, und es klang ziemlich ungehobelt. »Ich möchte Calamari – frischen Tintenfisch. Für uns alle.«
»Wobei allerdings fraglich ist, ob Tintenfisch die richtige Übersetzung ist«, warf Steward Drummond ein. »Ich glaube, Krake wäre wohl treffender.«
»Krake – uuhhh!«, machte Britt.
Der Ober verzog keine Miene. Er notierte die Bestellung auf einem kleinen Schreibblock.
»Vier Portionen«, fuhr Ray Mandell gereizt fort. »Aber ich weigere mich entschieden, zwei Pfund pro Nase auf den Tisch zu blättern. Ich weiß nämlich, dass die Viecher nicht frisch sein können. Die sind Monate alt. Bloß ahnt keiner außer mir, wie lange sie schon gefroren bei Ihnen in der Truhe lagern.«
Der Ober ließ ihn geduldig ausreden.
Steward raunte Britt zu: »Ich schätze, jetzt schmeißt er uns raus. Lass dich nicht durch die ruhige Art täuschen. Die Burschen können von einem Moment zum anderen aufbrausen. Das wird ein Spaß.«
Britt blickte ihn verständnislos an. Sie begriff die absonderlichen Scherze ihres Gatten sowieso nie.
Der Ober entgegnete: »Sie trauen uns also nicht? Bitte sehr, Signore, wir werden Ihnen die einzigartige Gelegenheit geben, sich von unserer Aufrichtigkeit zu überzeugen. Gewiss werden Sie Ihre Wahl nicht bereuen.«
Er servierte ihnen Weißwein, Mineralwasser und Brot. Dann verschwand er. Nach einer Weile erschien er wieder. Diesmal schob er ein aufwendig aussehendes Wägelchen vor sich her und wurde von einem sehr distinguiert gekleideten Mann mit Oberlippenbärtchen begleitet.
»Wahrscheinlich der Geschäftsführer«, sagte Steward gedämpft.
»Und das da?«, fragte Britt und zeigte mit dem Finger auf das Wägelchen.
»Das ist zum Flambieren, glaube ich«, meinte Sue.
Die Italiener brachten das Wägelchen zwischen sich und ihren vier Gästen zum Stehen. Der elegante Mann mit dem Bärtchen griff mit dem Besteck in eine Art Bassin und brachte etwas Lebendes zum Vorschein – etwas Glitschiges, träge Strampelndes, das nicht größer als beispielsweise eine Walnuss war.
»Un calamaro – ein Tintenfisch, Signori.«
Mandell konnte sich nicht beherrschen. Er musste einfach aufstehen und sich mit griesgrämiger Miene über das Bassin beugen. Ray sah Gebilde in dem klaren Wasser schwimmen oder unten auf dem Boden kriechen. Auf dem Boden lagerten außerdem runde, weißlich schimmernde Dinger.
»Und was ist das dort unten?«, erkundigte er sich verstört.
Der Geschäftsführer entgegnete: »Calamari-Eier. Die Tiere, die Sie hier sehen, sind heute früh frisch ausgeschlüpft. Sie wünschen sie doch frittiert, nicht wahr?«
»J-ja«, sagte Mandell. Er wusste nicht, ob er aufgebracht oder fasziniert sein sollte. »Donnerwetter!«, meinte er schließlich noch.
Er sah ein, dass er den Leuten Unrecht getan hatte. Sein Ärger war verflogen. Jetzt verspürte er nur noch Widerwillen.
Steward Drummond grinste. Britt machte große, runde Augen. Sue hielt sich tapfer, konnte ihren Abscheu aber schließlich auch kaum noch verbergen. Als der Kellner die schwabbeligen Kreaturen in Mehl wendete und schließlich in die auf dem Wägelchen stehende, über offener Flamme erhitzte Pfanne sinken ließ, stieß Britt einen leisen Schreckensschrei aus.
»O Gott, wie furchtbar!«
Sie wurden von den Nebentischen aus beobachtet. Einige Gäste lächelten schon abfällig. Sue wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ray fühlte sich auch nicht wohl, von Britt ganz zu schweigen. Der Einzige, der sich köstlich amüsierte, war Steward.
Die Meerestiere starben im siedenden Öl. Die erste Portion wurde von dem Ober mit Zitronenscheibchen garniert auf einem großen Teller serviert.
»Sie sind die Ersten, die diese Spezialität kosten«, erklärte der Geschäftsführer Ray Mandell. »Wir haben sie überhaupt erst seit heute auf der Speisekarte stehen. Nach langer Suche ist es mir endlich gelungen, die Tiere aufzutreiben. In London ist das nicht gerade einfach, wissen Sie.«
»Ja«, sagte Ray. »Ich – ich bestelle doch lieber was anderes, wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Aber nein«, erwiderte der Italiener lächelnd. »Bei uns ist der Gast König, Signore.«
»Her mit den Kraken!«, sagte Steward fröhlich. »Ich stelle mich nicht so an wie ihr. Ich verdrücke auch Schwalbennester, Schlangenragout und Affenleber.«
Er nahm dem Ober den Teller ab. Als er eine Zitronenscheibe über dem Gericht ausdrückte, gab Britt einen erstickten Laut von sich.
»Huch – da hat sich was bewegt! Die leben noch!«
»Iss das nicht!«, sagte Ray Mandell gepresst.
»Ach was«, meinte Steward. Er spießte zwei, drei Calamari auf seine Gabel und steckte sie sich in den Mund. Unter den teils wohlwollenden, teils amüsierten, teils entsetzten Blicken der Anwesenden zerkaute er den Happen, spülte mit Weißwein nach und sagte: »Fisch muss schwimmen – auch Oktopoden, oder?«
Die Italiener schoben mit ihrem Wägelchen ab, und wenig später stocherten auch Ray, Sue und Britt ziemlich lustlos auf ihren Tellern herum. Das Abendessen wurde mit Früchten und Espresso zum Abschluss gebracht. Alle außer Steward waren froh, als sie gegen zehn Uhr das Restaurant verließen. Steward schlug vor, noch eine Bar aufzusuchen.
»Es ist doch noch viel zu früh am Tag«, meinte er.
Er setzte sich ans Steuer seines Morris. Ray nahm neben ihm Platz, die Frauen setzten sich in den Fond. Steward Drummond steuerte sein Auto über den Piccadilly Circus und bog in die Shaftsbury Avenue ab.
Plötzlich stieß Steward würgend einen Laut aus. Er beugte sich etwas vor. Seine Augen weiteten sich. Es sah aus, als wollten sie jeden Augenblick aus den Höhlen fallen.
Britt und Sue hatten ein Gesprächsthema gefunden und plapperten munter vor sich hin. Sie hatten noch nichts bemerkt. Nur Ray Mandell wandte überrascht den Kopf um. »Du meine Güte, Steward!«
Steward Drummond wechselte die Gesichtsfarbe; es war im Schein der Straßenbeleuchtung deutlich zu sehen. Sein Hals verdickte sich, und er stieß wieder jenen seltsamen Laut aus.
Mandell glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. »Steward, ist dir nicht gut? So rede doch!«
»Waarrrghhh.« Das war alles, was der Mann am Steuer zu formulieren vermochte. Das Lenkrad machte sich selbständig; es schien plötzlich ein Eigenleben zu besitzen. Der Morris tanzte hin und her. Die Frauen schrien auf.
Steward drehte Ray sein Gesicht zu. Und jetzt sah Ray endgültig, was los war. In Stewards Hals wimmelte und pulsierte es. Steward schien unter Atemnot zu leiden. Er schnaufte durch die Nase, und die Nasenflügel blähten sich. In seinen aufgerissenen Augen stand blanke Angst. Wieder öffnete er den Mund. Etwas schoss daraus hervor, aber es handelte sich nicht um die Zunge.
Ray Mandell schrie auf. Er war zwar ein Spießbürger, aber kein ausgesprochener Angsthase, doch das hier ging über seine Kräfte. Er schrie gellend. Die Frauen stimmten mit ein; sie schrien alle drei.
Aus Stewards Mund pendelte ein Krakenarm, etwa so dick wie eine Bohne. Offenbar suchte er irgendwo Halt; er fingerte in der Luft herum. Eine oder zwei Sekunden später gesellte sich eine zweite schaurige Extremität hinzu. Beide Tentakel waren noch deutlich mit einem frittierten Mehlüberzug versehen. Sie zwängten Stewards Mundwinkel auseinander, sodass sein Mund weit aufklaffte und Ray die gesamte Scheußlichkeit sah.
Da arbeitete sich ein Monster mit acht Tentakeln aus Stewards Rachen hervor. Es stemmte sich mit zwei Fangarmen am Gaumen ab, mit vier anderen hielt es Stewards zuckende Zunge umklammert, die restlichen beiden drückten immer noch gegen die Mundwinkel.
Ray Mandell kreischte. Er glaubte, ein winziges Auge zu gewahren, das ihn tückisch aus dem Dunkel heraus anglotzte. Aber das war nicht das Schlimmste. Zwei Krebsscheren schossen jetzt aus dem glitschigen Geschöpf hervor. Sie packten zu.
Steward stöhnte, gurgelte und blutete plötzlich.
Der Morris brach aus. Er schleuderte über die Avenue und raste auf einen Ampelmast an der Kreuzung mit der Rupert Street zu.
Ray schrie, packte Drummond und schüttelte ihn, als könnte er damit das Unheil beseitigen. Natürlich fiel der Krake nicht aus Steward heraus; er schien die Mundhöhle nicht verlassen zu wollen.
»Er bringt Steward um!«, rief Ray.
Dann war es so weit. Blech wurde verformt und Glas klirrte. Der Morris wickelte sich mit seiner Frontpartie förmlich um den Ampelpfahl. Wie durch ein Wunder flog die linke Fondtür auf. Steward und Ray wurden nach vorn gerissen. Sie hätten sich beide gehörig die Köpfe angestoßen, wenn nicht vorher die gesamte Windschutzscheibe in Millionen Splittern aus der Fassung geplatzt wäre.
Britt und Sue kreischten und weinten und zwängten sich durch die offen stehende Tür. Draußen fluchte jemand.
Ray Mandell war durch den Aufprall benommen, aber er verfolgte dennoch ganz deutlich, wie sich Steward Drummond übergab. Das war seine Rettung. Das kleine Monster sprang aus seiner Rachenhöhle, flog ein Stück durch die Luft und hockte mit einem Mal böse und drohend um sich blickend auf der verbeulten Kühlerhaube des Morris.
Steward stöhnte.
Irgendwo begann eine Polizeisirene zu heulen. Ein Menschenauflauf entstand an der Unfallstelle. Eine Traube bildete sich um das Unglücksauto. Aber noch hatte keiner der Passanten begriffen, was die Ursache gewesen war.
Ray Mandell nahm sich ein Herz und packte zu. Er bekam die Kreatur an den Tentakeln zu fassen. Ray hatte Angst vor den Krebsscheren, doch sein Hass dominierte und lenkte sein Handeln. Im Affekt zerriss er das Geschöpf und warf die Teile auf die Straße. Er wollte aufatmen, aber in diesem Augenblick hörte er Steward wieder keuchen und würgen.
»Nein!«, sagte Ray Mandell schockiert.
Es ging alles sehr schnell, und eigentlich bekamen nicht einmal Britt und Sue richtig mit, was im Inneren des Autowracks geschah. Steward Drummond krümmte sich, dann bäumte sich sein Körper auf, und er spuckte aus, was er an diesem Abend zu sich genommen hatte: lebende Calamari.
Ray Mandell brüllte und fluchte und zerriss und zertrampelte die zuckenden Wesen, bis nicht mehr viel von ihnen übrig war. Dann zerrte er den wimmernden Steward auf den Bürgersteig und stützte ihn. Sie ertrugen das Palaver und die Verhöre der Polizisten und ließen sich bereitwillig Blut abzapfen. Alle hatten eine Fahne, aber der Promillegehalt reichte nicht aus, um sie vor den Richter zu bringen. Da glücklicherweise niemand verletzt worden war, lief die Sache letztlich noch ziemlich glimpflich ab.
Steward Drummond erzählte von seinem schaurigen Erlebnis. Doch obwohl er immer wieder auf seine noch leicht blutende Mundhöhle verwies, wurde er nur belächelt. Im Morris wurden keine Tintenfische gefunden. Ein Arzt stellte fest, dass Steward Drummond sich vor Schreck in die Zunge und die Innenseite der linken Wange gebissen hatte. Man erledigte sämtliche Formalitäten und sorgte für das Abschleppen des kaputten Wagens. Dann durften die beiden Männer den Bereitschaftswagen der Polizei verlassen und zu Britt und Sue zurückkehren, die bereits in einem Taxi auf sie warteten.
»Schöne Bescherung!«, sagte Ray Mandell. »Was unternimmst du jetzt, Steward?«
»Ich treibe nie wieder irgendwelchen Schabernack mit dir, Ray.«
»Wie bitte?«
»Ach, schon gut.«
»Ich meine, man sollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen«, sagte Ray Mandell. »Ich habe so meine Beziehungen und die werde ich ausnutzen.«