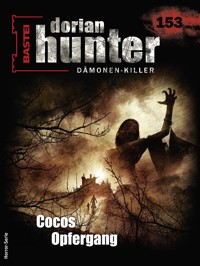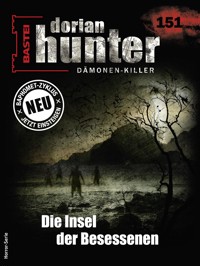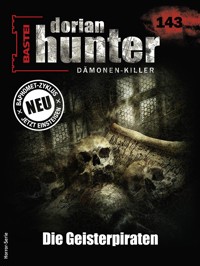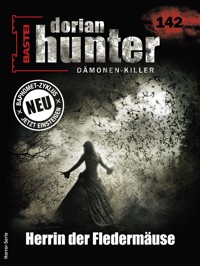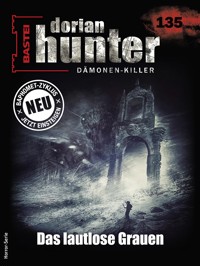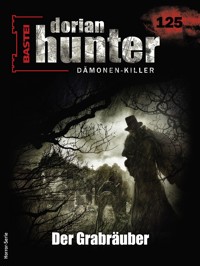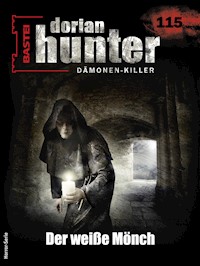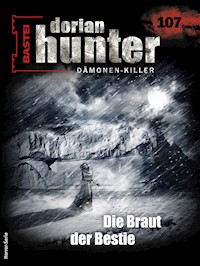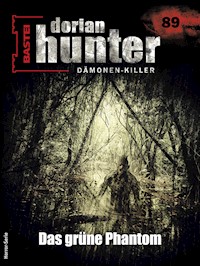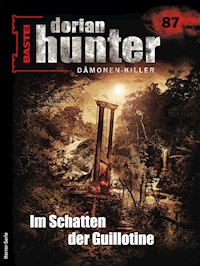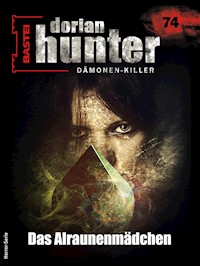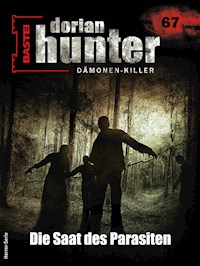Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Die Galeone trieb entmastet und steuerlos in der See. Kein Mensch zeigte sich an Deck, das sauber aufgeräumt war. Die dunklen Flecken auf den Decksplanken waren allerdings nicht zu übersehen. Hasard blieb mißtrauisch und befahl Big Old Shane, einen Brandpfeil auf das Schott zum Achterdeck zu schießen. Der Schuß saß, und als das Schott Feuer fing, wurde es auf der Galeone lebendig. Das Schott flog auf, auch das im Vordeck und ebenso die Oberdecksluken. Plötzlich wimmelte es von Zopfmännern auf der Galeone, und sie waren bis an die Zähne bewaffnet, was bewies, daß es sich nicht um friedliche Teetrinker handelte. Ihr Gebrüll hatte auch nichts mit Freude zu tun. "Feuer frei!", befahl Hasard...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2018 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-95439-860-7Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Roy Palmer
OhnePardon
Sie waren harte Kämpfer – bis sie auf die Seewölfe stießen
Zwei Zufälle trafen zusammen. Der eine beruhte darauf, daß Arne von Manteuffel, der Vetter des Seewolfs, in geheimer Mission und im Auftrag des Gouverneurs von Kuba nach Panama reiste, um dort herauszufinden, warum ein gewisser Hafenkapitän keine schmutzigen Gelder mehr an den Gouverneur zahlte. Und der andere Zufall wollte es, daß Sir John, der Papagei Edwin Carberrys, just zu der Stunde auf dem Gitter eines Zellenfensters saß, als Arne von Manteuffel mit seinem Gehilfen Jörgen Bruhn durch die Gasse schlenderte, an der das Gefängnis von Panama lag. Und weil Sir John mal wieder in übler Profos-Manier herumkrakeelte, wurde Arne aufmerksam und erfuhr, wer dort hinter Gittern saß. Alles andere war für den Deutschen kein Problem – er befreite die Freunde …
Die Hauptpersonen des Romans:
Julio de Rovigo – Kapitän einer spanischen Handelsgaleone, deren Schicksal besiegelt wird.
Simeon Castoro – ein spanischer Decksmann, dem seine Freßsucht zum Verhängnis wird.
Lu Schao Ling – der chinesische Piratenkapitän gerät vom Regen in die Traufe.
Dan O’Flynn – segelt einen Zweimaster mit seinen fünf Gefährten und bietet sich als Lockvogel an.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Eine große Leuchte war Simeon Castoro nie gewesen, weder was die Seemannschaft betraf noch im Hinblick auf den rühmlichen Heldenmut, der anderen Männern seiner Altersklasse zu Gold und Beförderungen verholfen hatte.
Er war ein unscheinbarer Mann, dieser Decksmann Castoro, der Ende Februar des Jahres 1595 an Bord der Handelsgaleone „Caballero“ in den Gewässern des Stillen Ozeans segelte. Große Taten hatte er nie vollbracht, seit er sich in der Neuen Welt aufhielt. Auch während des normalen Decksdienstes stach er nicht durch überragende Leistungen hervor.
Aber im Prinzip hatte er immer Glück gehabt. Längst hätte er tot sein können, im Sturm ertrunken oder von Piraten niedergemetzelt. Eine der gefürchteten Krankheiten, die hier wie anderswo auf der Welt grassierten, hätte ihm ein vorzeitiges Ende bereiten können, beispielsweise die Pest, die Cholera oder die Ruhr. Aber davor war er bewahrt geblieben.
Vielleicht lag es daran, daß er ein dickes Fell und eine robuste körperliche Natur hatte. Ja, und Unkraut verging bekanntlich auch nicht. Irgendwie hatte er sich immer durchgemogelt und erfreute sich bester Gesundheit.
Beispiele, wie man Pech haben konnte, hatte er ja genug vor Augen. Man konnte eine Hand einbüßen oder gar ein Bein, wenn man sich auf See mit irgendwelchem Freibeutergesindel herumschlagen mußte. Oder man konnte ein Auge verlieren wie Raoul Silva, der häßlichste Kerl an Bord der „Caballero“.
Ein anderer Kamerad hatte es auf der Lunge, er hustete ganz fürchterlich, besonders nachts, wenn alle in den Kojen lagen. Lange hätte dieser Mann nicht mehr zu leben, hatte der Bordarzt gesagt.
Die „Caballero“ war eine stattliche Dreimastgaleone.
Sie segelte in einem großen, stattlichen Konvoi mit, der sich – von Süden her kommend – an der Westseite von Neugranada entlangbewegte und den Isthmus von Panama ansteuerte. Ihr Name ergab sich praktisch von selbst, denn sie führte als Galionsfigur einen Reiter auf einem springenden Pferd. „Caballero“ bedeutete Reiter oder Ritter.
Im allgemeinen verliehen die Erbauer spanischer Segelschiffe ihren Galeonen, Karacken oder Karavellen die Namen von Heiligen oder von spanischen Städten, so daß die „Caballero“ im Grunde eine Ausnahme darstellte. Große Phantasie hatte man aber auch bei ihrer Taufe nicht bewiesen.
Über dieses und anderes machte sich ein Mann wie Simeon Castoro keine allzu großen Gedanken. Ob er auf diesem oder einem anderen Schiff fuhr, war ihm völlig gleichgültig. Nirgends war alles perfekt, auf jedem Schiff gab es etwas zu bemängeln. Entweder war der Capitán ein mieser Hund, oder die Mannschaft taugte nichts, oder das Schiff war ein Kahn, der schon lange hätte überholt werden müssen.
Auf der „Caballero“ war es der Capitán. Er hieß Julio de Rovigo und war ein echter Leuteschinder. Es fing damit an, daß bei ihm die Essensrationen außerordentlich knapp bemessen waren. Er knauserte sogar noch mit dem Wasser. Von Extra-Weinrationen konnte schon gar nicht die Rede sein. In der Suppe schwammen die Kakerlaken, und der Schiffszwieback entwickelte ein beängstigendes Eigenleben, weil es in ihm von Maden wimmelte. Die besten Speisen pflegte sich nun mal der Capitán einzuverleiben.
Über diese Art der Behandlung waren die Männer berechtigterweise empört. Aber Simeon Castoro regte sich gar nicht erst auf. Er wußte, wie er trotzdem satt wurde. Jede Nacht stattete er der Vorratskammer im Vorschiff der „Caballero“ heimlich einen Besuch ab.
Castoro war ein etwas untersetzter, kräftig gebauter Mann, der einen gesegneten Appetit hatte. Wenn er ein Essen mal nicht rechtzeitig genug erhielt, stellten sich Schwindelgefühle und ein gräßliches Magenknurren bei ihm ein. Von dem Fraß, den der Capitán seiner Mannschaft vorsetzen ließ, hätte er nie und nimmer satt werden können, auch dann nicht, wenn er alles hinuntergeschlungen hätte, was er aber natürlich nicht tat.
Die „Caballero“ segelte, gut bewacht von spanischen Kriegsschiffen, im Geleit, es konnte ihr nichts passieren. Das Bordleben nahm seinen gewohnten Gang. Hier und dort wurde gemurrt, aber die Männer hüteten sich, offen gegen den Capitán de Rovigo aufzubegehren.
Sie wußten, was es ihnen einbrachte: schwere Hiebe mit der neunschwänzigen Katze. Und Meuterer haßte der Capitán wie die Pest. Mit ihnen machte er kurzen Prozeß. Es hieß von ihm, daß er schon viele Menschenleben auf dem Gewissen hätte – alles Decksleute, die gewagt hatten, den Dienst zu verweigern, weil er sie so schlecht behandelte.
Die „Caballero“ war kein Kriegsschiff, aber de Rovigo benahm sich wie ein Kommandant der Armada. Das war sein Stil – und seine Offiziere und der Profos zogen mit. Sie waren auf seiner Seite. Folglich hatte es keinen Sinn, auch nur ein falsches Wort laut werden zu lassen.
Simeon Castoro hatte seine ganz persönliche Art, Probleme zu bewältigen. Wenn alle bis auf die Deckswache schliefen, stahl er sich nachts aus seiner Koje und begab sich auf den Weg zur Proviantkammer. Natürlich mußte man das geschickt anstellen. Kein Mensch durfte auch nur einen Laut hören. Man mußte sich natürlich auch darauf verstehen, so ein Schloß zu öffnen, das sich in dem Schott befand, welches den Hungerleider von den Gaben des Schlaraffenlandes trennte.
Eins war dabei Voraussetzung: Das Schloß mußte gut geölt sein. Der Proviantmeister war ein pedantischer, disziplinierter Mann, er ließ kein Schloß und keine Angel innerhalb seines Kompetenzbereiches rosten. Überhaupt, das ganze Schiff war bestens in Schuß, denn de Rovigo haßte Schmutz und Unordnung genauso wie Meuterei. Man konnte von den Planken essen, und nirgends war auch nur ein etwas fehlerhaft aufgeschossenes Fall zu entdecken.
Also konnte sich Castoro stets darauf verlassen, daß ihn kein verdächtiges Quietschen oder Knarren verraten würde. Er hatte viel Zeit und Mühe darauf verwendet, sich einen Ersatzschlüssel aus einem Stück Eisen zurechtzubiegen. Das war nicht so einfach gewesen. Aber es lohnte sich. Mit diesem im Prinzip sehr simplen Haken traute Simeon Castoro sich zu, fast jedes Schloß zu öffnen.
So war er auch an diesem frühen Morgen des 24. Februar wieder auf Wanderschaft im Schiffsbauch. Es war noch stockdunkel. Man mußte aufpassen, nirgends anzustoßen. Jedes noch so winzige Geräusch konnte einen Mann aufwecken, und wenn man ihm erst nachspionierte, war er erledigt. Keiner durfte erfahren, was er trieb.
Vorsichtig pirschte sich Simeon an das Vorratskammerschott heran. Er vergewisserte sich, daß niemand in der Nähe war und im Logis alles friedlich schlief. Drei, vier Kerle schnarchten, der Huster hustete mal wieder. Die anderen, die sich irgendwie daran gewöhnt hatten, wären auch durch Kanonenböller nicht zu wecken gewesen.
Geschickt öffnete Simeon das Schloß, drückte das Schott auf und befand sich nun im Allerheiligsten des Proviantmeisters, in dem es nach Herrlichkeiten wie Hartwurst, Dörrfleisch, Wein und anderem duftete. Hier war nichts madig, ranzig und faulig, und er war noch auf keine einzige Kakerlake gestoßen. Der Fraß – oder die Abfälle –, den man ihnen vorsetzte, befand sich in einem anderen Schiffsraum.
Es war Simeon Castoro unverständlich, wie ein so penibler Mann wie der Capitán solches Zeug überhaupt an Bord dulden konnte. Aber das gehörte zu den Widersprüchen im Wesen des Julio de Rovigo: Er war geizig und knauserte, wo er knausern konnte, sogar mit dem Öl für die Öllampen.
Simeon hatte sich vorgenommen, darüber keine unnötigen Gedanken zu verschwenden. Wichtig war, daß sein Hunger gestillt wurde. Sein Magen knurrte mal wieder. Im Dunkeln tastete er über die Vorratsregale und stopfte sich einiges in die Taschen: Wurst, Schinken, Käse, Brot und eine Flasche Wein.
Das reicht fürs erste, dachte er, und es darf ja nicht auffallen.
Noch hatte der Proviantmeister nichts bemerkt. Die Überfahrt bis nach Panama war nicht sonderlich lang, Bilanz würde er erst ziehen, wenn sie den Zielhafen erreicht hatten. Dann setzte das große Rätselraten ein: Wer hat den Proviant geklaut?
Simeon war ein guter Mime, keiner würde ihn durchschauen. Er war, wenn es darauf ankam, natürlich die Unschuld in Person.
Nein, und es fiel dem Herrn über die Vorratskammer auch nicht auf, wenn das eine oder andere fehlte. Schließlich hatte er den Kapitän und vielleicht auch die Offiziere mit dem Besten vom Besten zu versorgen, und da konnte man schon mal den Überblick verlieren. Besser hätte es Simeon gar nicht haben können.
Er verließ die Kammer, riegelte wieder sorgfältig ab und schlich zum Kabelgatt, wo er sich ebenfalls Zutritt verschaffte. Dies war sein heimlicher „Futterplatz“, hier pflegte er seine einsamen nächtlichen Einmanngelage abzuhalten.
Er wollte das Schott eben wieder hinter sich schließen, da spürte er plötzlich, daß er nicht allein war. Ein Schatten, einem unheimlichen Schemen gleich, bewegte sich auf ihn zu. Jemand drängte sich gegen ihn, schob ihn in das Kabelgatt und stieß ein drohendes Zischen aus.
„Halt bloß dein Maul, Simeon!“
„Silva – bist du’s?“ stammelte Simeon entsetzt.
„Ja. Das hättest du nicht gedacht, wie?“ Der Einäugige lachte leise, es klang hämisch und verächtlich zugleich.
„Was willst du?“ fragte Simeon, obwohl er es sich bereits vorstellen konnte.
„Ich hab’ bemerkt, was du treibst!“ zischte Raoul Silva. „Du klaust aus der Proviantkammer. Vielleicht schon seit Nächten.“
„Das ist nicht …“
„Sei still“, sagte der Einäugige mit dunkler, drohender Stimme. „Lügen hat keinen Zweck. Glaubst du, ich bin blöd?“
„Nein, das glaube ich nicht.“
„Weißt du, was das ist?“
„Was?“ Simeon Castoro suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Silva war als die gemeinste Ratte an Bord dieses Schiffes bekannt, wer ihm in die Hände fiel, war so oder so geliefert. Wie konnte er, Simeon, sich nur aus der Affäre winden?
„Spiel nicht den Begriffsstutzigen, es hat keinen Sinn“, brummte der Einäugige. „Also, was du tust, das ist Mundraub. Dafür hängt dich der Alte glatt an der Großrah auf, und wir können zuschauen, wie du rumzappelst.“
Simeon Castoro begann heftig zu atmen. Der Schweiß brach ihm aus. Der Einäugige hatte nicht übertrieben. Zu solchen und anderen drastischen Urteilen war ein Mann wie de Rovigo fähig. Aufhängen wegen Mundraubs, Erschießen wegen Diebstahls, Kielholen wegen Verrats am Kapitän und der Mannschaft. Wenn Silva ihn, Castoro, jetzt verriet, war er erledigt. Er würde Panama nicht mehr erreichen.
„Mann, Silva“, stieß Castoro mit flehender Stimme hervor. „Sag so was doch nicht.“
„Schrei nicht so! Willst du, daß alle aufwachen?“
„Nein.“
„Übrigens war es ein Zufall, daß ich dich erwischt habe. Ich mußte mal raus auf das Galion, da habe ich dich gesehen. Hast du ein Schwein, daß ich nicht der Profos bin.“
„Ja, ich habe wirklich Glück.“
„Und was machen wir jetzt, du Drecksack?“
„Wir können uns doch einigen …“
„Ja, ist gut“, sagte der Einäugige. „Los, wir setzen uns auf die Kabelrollen, und dann packst du erst mal aus. Ich will mitfuttern. Ich habe einen Kohldampf, der geht auf keine Kuhhaut mehr.“
Castoro begriff in diesem Augenblick zweierlei: Er hatte keine andere Wahl, als auf Silvas Vorschlag einzugehen. Und er war diesem Kerl ausgeliefert. Der Einäugige konnte ihn erpressen, wie er wollte, er hatte ihn in der Hand. Zeigte er Castoro beim Capitán an, dann würde dieser eine Untersuchung einleiten, die zu dem Ergebnis führte, daß in der Vorratskammer tatsächlich einiges an Proviant und Wein fehlte. Die Beweise ließen sich mit Leichtigkeit führen. Er, Castoro, war völlig hilflos und von Silvas Gnade abhängig.
Sie nahmen auf den Kabelrollen Platz. Castoro mußte mit seinem Diebesgut herausrücken. Silva entkorkte sofort die Flasche Wein, schnalzte leise mit der Zunge und führte die Öffnung an den Mund. Es gluckerte vernehmlich. Er schien großen Durst zu haben und setzte die Flasche erst nach einer Weile wieder ab. Es war im Dunkeln nicht zu sehen – doch Castoro schätzte richtig, daß der Kerl die Flasche bereits halb geleert hatte.
Nur ein Stückchen Wurst erhielt Simeon Castoro von dem gestohlenen Proviant, den Rest vertilgte Silva mit wahrer Freßgier. Castoro verspürte immer noch größten Hunger. Tränen der Wut stiegen ihm in die Augen. Aber er war machtlos gegen Silva. Der Kerl war mit dem Messer blitzschnell zur Hand, er würde ihn aufschlitzen, ehe er ihm auch nur einen Hieb verpassen konnte.
Daß Silva selbst vorgehabt hatte, in die Proviantkammer einzubrechen, verschwieg er tunlichst. Castoro brauchte es nicht zu wissen. Wahrscheinlich würden auch noch andere Decksmänner versuchen, etwas für sich auf die Seite zu schaffen. Ihre Sache, dachte Silva. Er hatte den richtigen Weg gefunden. Er würde sich versorgen lassen, ohne dabei selbst das geringste Risiko einzugehen.