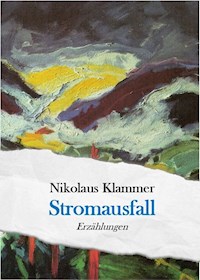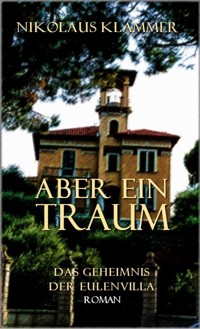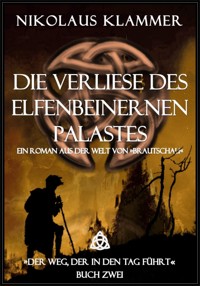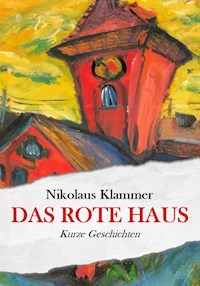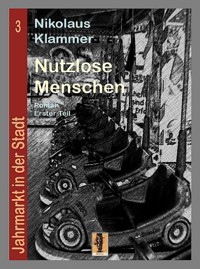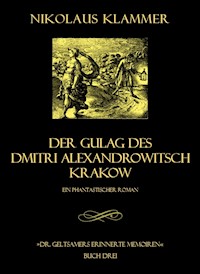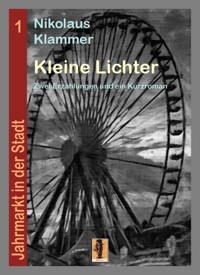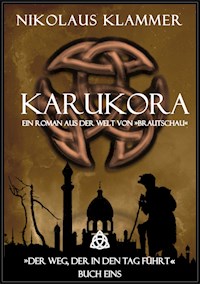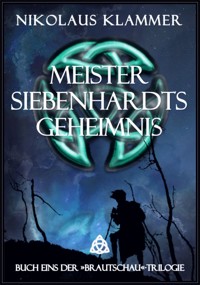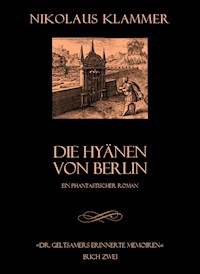
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Jagd nach dem geheimnisvollen "Buch der Bücher" geht weiter! Während der Schriftsteller Nikolaus Klammer verzweifelt versucht, seine verschwundene und vielleicht auch von finsteren Mächten entführte Tochter Isa zu finden und endlich in Rom eine Spur von ihr zu entdecken glaubt, hat sich das schwarze Buch erneut verändert, das man ihm in einer von einem Tag auf den anderen verschwundenen Buchhandlung unter mysteriösen Umständen zugespielt hat. Diesmal erzählt ihm das Buch die Geschichte von Sebastian Kerr, des Großvaters des Autors, der in den letzten Tagen der Weimarer Republik im vergnügungssüchtigen und brandgefährlichen Berlin der gegen eine Geheimorganisation kämpfen muss, die offenbar auch in der Gegenwart Klammer und seine Familie bedroht. Es sind die "Hyänen von Berlin". Wird Klammer die unglaubliche Verschwörung um die im Dschungel des Amazonas verschollene Ärztin Elena Kuiper und ihre eingeborene Freundin Lokwi aufdecken können? Und was hat es mit diesem merkwürdigen Pentagramm-Symbol auf sich, dem er überall begegnet? Auch im zweiten Teil seiner "Trilogie in 5 Teilen" gelingt es dem Autor, ein überaus spannendes und auch humorvolle Garn zu spinnen, das nahtlos an den ersten Teil anschließt und den Leser viele Stunden zu fesseln vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NIKOLAUS KLAMMER
DR. GELTSAMERS
ERINNERTE MEMOIREN
„Ein phantastischer Roman“
in 5 Büchern
2. Buch: Die Hyänen von Berlin
© Yvain Verlag, Keie a. T., 20**Satz: Fotosatz Galahad GmbH, CoelDruck & Bindung: Erec & Pelleas, BorsPrinted in GermanyISBN A-44-55536544-17-9
KAPITEL EINSNACHFOLGE
„Mich haben sie nicht gekreuzigt.“Oscar Wilde
Nur zwölf Stunden dauerte die Fahrt mit der Reichsbahn von Augsburg nach Berlin und es wäre schneller gegangen, hätte der junge Mann nicht in Nürnberg und Leipzig umsteigen und in den Hallen der Bahnhöfe eine längere Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Es waren zwölf Stunden Zeit, sich daran zu gewöhnen, von einer Welt in eine andere zu gelangen; viel zu wenig Zeit, um der Erschütterung zu entgehen, die der eines Bantu-Negers gleicht, der den heimatlichen Kral verlässt, um nach New York zu ziehen.
Aber schließlich stand Sebastian Kerr kurz nach neun Uhr morgens übermüdet, von Kopfschmerzen geplagt, verwirrt und allein gelassen mit seinem kleinen Koffer in der Hand auf dem weitläufigen Platz vor dem Anhalter Bahnhof und bestaunte selbstvergessen den großstädtisch brandenden und sprudelnden Verkehrsstrom, der sich vor seinen Augen ohne erkennbare Regeln oder Ziele über die breiten Straßen wälzte. Straßenbahnen fuhren quietschend vorbei und im Schaufenster einer nahen Apotheke machte eine große mechanische Reklamefigur Rasierbewegungen. Der gertenschlanke und noch sehr junge Augsburger konnte kaum fassen, dass er tatsächlich doch noch in der Hauptstadt angekommen war; das unbequeme, stickige Abteil und den Blick auf endlose Birken- und Kiefernwälder vor den zitternden Fensterscheiben in der Vergangenheit hinter sich gelassen und sich ohne ernsthafte Verletzung durch das Menschenchaos der Bahnsteige gekämpft, gestoßen, gequetscht, geschoben und gequält hatte.
Er war in diesem Moment sehr stolz auf sich und atmete begeistert die beißend vom Ausstoß der Verbrennungsmotoren durchtränkte Luft, als stünde er auf dem Gipfel eines Schweizer Berges, den er vorher mühsam erklommen hatte. Ein paar lyrische Zeilen, die er für diesen Anlass gedichtet hatte, kamen ihm in den Sinn.
Aber bin denn ich so traut verlassen im blut des tags sieh mich liegen tot …
Nach schier endlosen und bitteren Jahren des Zögerns war sein Leben endlich in Bewegung gekommen und allein die Schwerkraft würde bewirken, was ein Wille niemals schaffen konnte. Für immer, wie er dachte, hatte er jener Stadt den Rücken gekehrt, die ihm nicht länger Heimat sein sollte, deren fehlgeleiteter und dumpfer Bürgerstolz ihn so beengt hatte, dass er sich jede Nacht mit dem Gedanken in sein Lager legte, noch vor dem Morgen an seinem Ekel ersticken zu müssen.
Sebastian lachte befreit und stieß eine Dampfwolke über seinen Kopf, die sich in der kalten, stinkenden Luft schnell auflöste. Gleich darauf betrachtete er erschrocken seine Umgebung. Doch hier in Berlin interessierte niemanden, was in Augsburg ein Skandal gewesen wäre. Die eiligen Leute, die über den breiten Trottoir in seiner Nähe hetzten, sahen nicht einmal auf. Der Neuankömmling war nur ein lästiges Hindernis in ihrem Weg, ein Stolperstein. Niemand außer Sebastian stand, alle eilten ihren ihm noch geheimnisvollen, vielleicht niemals vollkommen ergründbaren Zielen entgegen. Dennoch schämte sich Sebastian über seine unpassende und unplatzierte Gefühlsäußerung und griff mit einem plötzlichen Schrecken in die Manteltasche. Der Umschlag mit dem wertvollen Empfehlungsschreiben knisterte jedoch beruhigend unter seiner tastenden Hand.
Der naive Jüngling aus der Provinz ist noch nicht gleich bei seiner Ankunft bestohlen worden, dachte er erleichtert.
Ungeachtet seiner nicht gerade prallen Reisekasse und in völliger Unkenntnis um die Größe der Stadt, fasste er seinen Koffer fester, machte einen entschiedenen Schritt nach vorn und winkte sich einen langsam vorbeifahrenden Mietwagen heran, dessen Fahrer auch prompt und dienstbereit vor ihm bremste. Sebastian setzte sich auf die Rückbank und nannte dem morgenmürrisch auf einem Zigarrenstummel kauenden Chauffeur, der seine Schirmmütze tief in die Stirn gezogen hatte, die Adresse, die auf dem Umschlag in seiner Tasche stand. Er musste dazu nicht nachsehen, er kannte sie längst auswendig, hatte sie sich während seiner Zugfahrt immer und immer wieder memoriert. Jetzt erst warf der Taxifahrer einen Blick zurück und musterte seinen neuen Fahrgast abschätzend, fast verächtlich. Wahrscheinlich taxierte er die Liquidität seines Kunden.
„Das ist draußen in Tegel“, ergänzte Sebastian mit entschlossener Stimme. Der Fahrer nickte, mit den Fingern gegen seine Schirmmütze tippend. Sein Automobil setzte sich zitternd in Fahrt und reihte sich hupend in den dichten Straßenverkehr ein. Trotz der so sprichwörtlichen Geselligkeit der Berliner, die wahrscheinlich nur auf einem Missverständnis beruhte, blieb der Chauffeur stumm. Er überließ den Fahrgast seinen aufgeregten Gedanken und Empfindungen. Sebastian lehnte sich auch bald schräg auf den Koffer neben sich und sah begierig hinaus, suchte den Blick auf eine der Sehenswürdigkeiten zu erhaschen. Doch sie verbargen sich geschickt vor ihm.
Der nebelgraue, kalte Tag, an dem Berlin mit Sebastian Kerr einen neuen, hoffnungsvollen Eroberer begrüßte, war Donnerstag, der 24. Januar des Jahres 1929. Er war am 10. Februar 1908 in der ehemals freien Reichsstadt zu Augsburg, jener uralten und berühmten bayerisch-schwäbischen Stoffhandelsmetropole am Lech, geboren und der Sohn von Walther Kerr, eines der leitenden Angestellten der G. Haindl’schen Papierfabriken. Als entarteter Spross eines ehrbaren Kaufmannsgeschlechts schrieb er Erzählungen, Gedichte und Dramen. Nun machen diese Daten jeden, der sich mit dem zeitgenössischen Theater beschäftigt, stutzig und dies war die Crux im Leben des aufstrebenden Dichters, der Sebastian war: Er war nur ein Wiedergänger.
Sah man einmal davon ab, dass er auf den Tag genau zehn Jahre jünger als Bert Brecht war, stimmten ihre Kurzbiografien doch frappierend überein. Obwohl sie einander nie bewusst begegnet waren, standen ihre Geburtshäuser nur wenige Straßenzüge auseinander am alten Stadtgraben Augsburgs und der jüngere Bruder von Bertolt und der ältere von Sebastian waren bis zu ihrem Notabitur im Jahre 1918 in die gleiche Klasse der Kreisoberrealschule in der Hallstraße gegangen. Bertolt und Sebastian wuchsen in der sogenannten ‘Bleich’ auf, spielten in den Büschen der Kahnfahrt zuerst verstecken und später mit den bezopften Bürgertöchtern heimlich Doktor, holten sich ihren ersten Rausch im Lueginsland-Biergarten und besuchten selbstredend dieselben Schulen - die Barfüßervolksschule und anschließend das Realgymnasium -, hatten dort ihre ersten literarischen Gehversuche unternommen und teilweise sogar das selbe Lehrpersonal erlitten.
„Während meines neunjährigen Eingewecktseins an einem Augsburger Realgymnasium gelang es mir nicht, meine Lehrer wesentlich zu fördern“, hatte Brecht einmal nach seinem dritten Bier resigniert festgestellt.
Ihre Viten begannen sich erst aufzutrennen, als B. B. zuerst nach München, anschließend nach Berlin zu Max Reinhard ging und inzwischen ein bekannter und anerkannter Theaterautor war. Sebastian Kerr jedoch brachte nie eines seiner Stücke auf die Bühne, obgleich er sich als zumindest ebenso begabt einschätzte wie sein berühmtes Vorbild. Er war jedoch nicht aus der erstickenden Enge Augsburgs geflohen, sondern hatte den bequemeren Weg gewählt und war unentschlossen in der pfahlbürgerlichen Stadt verblieben. Deshalb wühlte in ihm beständig ein dunkles Gefühl von Neid und Wut, wenn er an seinen erfolgreichen Konkurrenten dachte.
Das war der Grund, aus dem Sebastian endlich doch nach Berlin gefahren war: Er wollte jenen Schatten, der über seinem Leben hing, aufsuchen, sich durch eine Konfrontation mit dem, den er nie gesehen hatte, von ihm befreien. Er war sich bewusst, dass es ihm nicht leicht fallen würde, Brecht im Gewimmel der Metropole zu finden und mit ihm gar ins Gespräch zu kommen. Vom Bier abgesehen, hasste sein älterer Doppelgänger alles, was aus Augsburg kam und ihn an seine ungeliebte Geburtsstadt erinnerte. Aber Sebastian war willens, es trotzdem zu versuchen.
Die Anlaufadresse, die er bei sich trug, war die eines gewissen Dr. Eduard Gere, eines Kriegskameraden seines Vaters. Gere war als technischer Direktor für die Borsig-Maschinenbauwerke tätig und wohnte in einer großen, modernen Villa direkt am Tegeler See. Sebastian war diesem Mann erst einmal vor vielen Jahren begegnet und hatte ihn als einen strammen Deutschnationalen in Erinnerung, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit von seinen Erlebnissen in den Schützengräben der Westfront oder seinen Studentenjahren in Heidelberg berichtete. Gere war ein Mensch, der ihm nicht sympathisch, dessen ganze Lebensart und Einstellungen ihm zuwider waren. Der Herr Dr. mit seinem rot glänzenden Schmiss auf der linken Wange stammte übrigens aus einer konvertierten jüdischen Familie - sein Großvater hatte Aaron Gerson geheißen und Kessel geflickt - und entsprach genau dem Typus des Kapitalisten, gegen den der junge, glühende Sozialist in seiner Literatur Sturm lief. Dennoch hatte er keine Skrupel, diese Verbindung auszunutzen, hatte sich vom widerstrebenden Vater ein Empfehlungsschreiben anfertigen lassen und sich vom Vater auch telefonisch anmelden lassen.
Verachtung darf kein Hindernis sein, wenn man Hilfe und Logis benötigt, dachte Sebastian. Das Expropriieren der Expropriateure ist ein legitimes Mittel im Klassenkampf.
Er hoffte, nicht allzu lange auf den Direktor und seine Familie angewiesen zu sein, denn er träumte davon - nicht zuletzt mit der freundlichen und ein wenig beschämenden Unterstützung von Brecht – hier in der Reichshauptstadt bald eine große Karriere als Autor beginnen zu können.
„A nous deux maintenant, Berlin!“, murmelte der junge Eugène de Rastignac und lächelte zuversichtlich.
Die Taxifahrt dauerte bereits fast drei Viertelstunden und der Betrag, dem das Taxameter mit ruhigem Klicken entgegen kletterte, verursachte in Sebastians Unterleib ein unangenehmes Rumoren. Es stellte sich immer deutlicher als ein Fehler heraus, am Bahnhof einen Wagen zu mieten; er hätte versuchen sollen, mit der Untergrundbahn bis zur Seestraße oder mit der neugebauten S-Bahn bis Charlottenburg und von dort aus mit dem Bus weiter zu kommen. Oder noch besser zu Fuß zu gehen; auch wenn er keine Ahnung hatte, wie weit die Entfernungen waren. Doch sie schienen erheblich zu sein. Jetzt hatte er kein Interesse mehr für irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Er starrte nach vorn gebeugt durch die gläserne Trennscheibe auf das Taxameter und zuckte bei jedem der knackenden Zahlenradbewegungen zusammen. So entging ihm auch ein Blick auf das Charlottenburger Schloss und ihm fiel kaum auf, wie seine Umgebung langsam ihren großstädtischen Charakter verlor und nun eher seiner Heimatstadt glich. Schließlich ging die Fahrt auf einer Chaussee an einer größeren Wasserfläche entlang, die teilweise zugefroren war.
Das muss der Tegeler See sein, dachte Sebastian.
Das Taxi hielt schließlich doch noch in einem bourgeoisen Vorort direkt vor dem Vorgarten einer niedrigen Villa, die nicht viel älter als das Jahrhundert war. Sebastian zahlte mit einem bitteren Geschmack im Mund und der Taxifahrer lächelte zum ersten Mal, dabei freundlich die Mütze lüpfend.
Sebastian atmete noch einmal aufgeregt ein und stieg dann umständlich aus dem Wagen. Das Abenteuer seines Lebens begann …
❧
Sebastian sah dem Automobil hinterher, bis es an einer Straßenkehre aus seinem Blick bog, dann erst zuckte er resigniert mit den Schultern, nahm seinen Koffer auf und querte die gepflasterte Straße, auf der nur wenige Menschen und keinerlei Fahrzeuge unterwegs waren. Nach dem überhitzten Taxi-Innenraum war ihm nun trotz seines dicken Wollmantels kalt und er zitterte im Frost des Januarmorgens. Er wusste nicht, ob es an der Temperatur oder an seiner Aufregung lag.
Am niedrigen Türchen zum Vorgarten fand der junge Mann keine Klingel, aber es ließ sich problemlos öffnen, indem er darüber hinweg langte und die auf der Innenseite vorhandene Klinke niederdrückte. Er schob die Gartentüre auf, fasste noch einmal Mut und ging anschließend über einen gekiesten Weg auf das Haus zu. Dabei legt er sich noch einmal die Worte zurecht, mit denen er sich bei dem Freund seines Vaters einführen wollte. Er war zwar angemeldet - noch am Wochenende vorher hatte der Vater mit Gere telefoniert -, aber Sebastian Kerr wusste, wie wichtig der erste Eindruck war. Hoffentlich wirkten seine Manieren nicht zu kleinstädtisch und er konnte seinen schwäbischen Dialekt, den hier niemand verstehen würde, unterdrücken. Wie machte das eigentlich Brecht, wenn er mit den Hauptstädtern redete? Sprach er inzwischen Hochdeutsch?
Vor der Tür sammelte Sebastian sich kurz, dann betätigte er den hier vorhandenen Klingelzug. Es war kein Läuten zu hören. Er überlegte noch, ob er auf eine modische Verzierung hereingefallen war, da wurde die Tür endlich geöffnet. Ein sehr steif und förmlich wirkendes Mädchen in schlichtem, schwarzen Hauskleid und einer um die Taille gebundenen makellos weißen Schürze stand vor ihm und musterte den Fremden vor der Haustüre stumm und abschätzend. Verlockende Wärme drang aus dem Inneren ins Freie. Sebastian fingerte eilig mit seiner freien Hand nach der Empfehlung in seiner Jackentasche.
„Grüß Gott“, sagte er.
„Bitte?“ Die Stimme der - wenn sie sich ein Lächeln hätte abringen lassen - durchaus hübschen, weißblonden Hausangestellten war gepresst und abweisend, militärisch scharf und kurz angebunden. Das geht ja schon mal gut los!, dachte Sebastian. Aber eigentlich wäre sie ganz hübsch, wenn sie ein wenig mehr aus sich machen würde.
Er versuchte sein gewinnendes Lächeln, aber es misslang ihm. Wahrscheinlich hätte es eh keine Wirkung gehabt.
„Ich meine: Guten Tag … Morgen. Wie auch immer. Ich bin Herr Kerr, Sebastian Kerr. Zu Diensten. Der Hausherr erwartet mich.“ Er holte seinen Brief hervor und streckte ihn unsicher nach vorn. Die Leichenbittermiene seines Gegenübers hellte sich nicht auf.
Warum sind Bedienstete immer dünkelhafter und blasierter als ihre Herrschaft?, fragte er sich. An ihnen wird der Sozialismus scheitern, nicht an den Kapitalisten.
„Davon ist mir nüscht bekannt. Im Übrigen ist der Herr Direktor heute Morgen nicht zujechen“, entgegnete das Mädchen spitz mit nach vorne gestrecktem Kinn. Sie berlinerte stark und machte keine Anstalten, den Brief anzunehmen. Sebastian biss sich auf die Unterlippe und mahnte sich zur Geduld.
„Wäre es denn dann möglich, die Hausherrin zu sprechen?“, insistierte er.
„Zu dieser Tageszeit?“ Verblüffung war in der Stimme des Mädchens zu hören.
Tageszeit? Inzwischen ging es auf Mittag! Eine kleine Pause entstand, während sich die Gegner schätzten. Es musste doch eine Möglichkeit geben, an diesem Zerberus vorbei ins Warme zu gelangen.
„Ich wiederhole: Ich werde erwartet. Wenn Sie Frau Gere dann bitte mein Schreiben überbringen könnten“, sagte er schärfer und versuchte, ebenso hochmütig und bestimmt zu klingen. Er erreichte tatsächlich, dass das Mädchen unsicher wurde und zögernd seinen Brief in die Hand nahm. Dann schloss sie wortlos die Tür.
Sebastian ließ seufzend den Koffer fallen. Ich bin bei den Geres nicht willkommen. Aber das habe ich bereits erwartet, dachte er. Allerdings schon an der Eingangstür von einem Hausdrachen wie ein beliebiger Bittsteller behandelt zu werden, das war schon ein starkes Stück und kränkte ihn. Schließlich war er kein dahergelaufener Irgendwer, der sich ein paar Groschen erbetteln wollte. Er war der Sohn des Mannes, dem dieser technische Direktor der weltweit handelnden Borsig-Werke in den Schützengräben vor Verdun ewige Kameradschaft versprochen hatte und er stammte aus einem großbürgerlichen, durchaus wohlhabend zu nennendem Elternhaus, in dem man Wert auf eine standesgemäße Erziehung legte und gute Sitten pflegte!
Geraume Zeit verging, während der sich Sebastian erbost im wenig gepflegten Vorgarten umsah. Die Beete und Wege waren noch vom vorjährigen Herbstlaub der hohen Buchenhecken bedeckt, die die Vorderfront des Hauses gegen Blicke von der Straße schützten. Unter den Büschen lag feuchter Schnee. Einzig ein paar Christrosen blühten an einer geschützten Stelle. Der unerwünschte Gast schlenderte langsam auf und ab und war sich sicher, dass man ihn von drinnen beobachtete. Wahrscheinlich schätzte man den unerwünschten Gast ab. Einmal glaubte er aus den Augenwinkeln heraus eine Bewegung an der Gardine eines Fensters im ersten Stock zu bemerken. Er hob schnell den Kopf, konnte aber weiter nichts erkennen. Nach einer Weile kehrte er zurück zu seinem Koffer, den er vor dem Eingang hatte stehen lassen. Der Zeitpunkt war längst überschritten, an dem das Warten lassen zur puren Unhöflichkeit wurde.
Endlich öffnete sich wieder die Tür. Es war erneut das unterkühlte Hausmädchen.
„Sie können jetzt eintreten.“
Sebastian war nahe daran, beleidigt abzuwinken, auf der Stelle kehrt zu machen und zu gehen, aber die Hoffnung auf ein passables Unterkommen wog schwerer als sein Stolz. Er nahm schweigend den Koffer auf und trat hinter der Bediensteten in das Haus, putzte sich dabei eifrig die Schuhe am Schmutzfang ab. Sie gelangten in ein kleines Entrée, von dem einige Türen abgingen und eine breite Treppe ins obere Stockwerk auf eine Galerie führte. Das Mädchen wandte sich zu dem Gast und zog missbilligend die Stirn kraus, während sie seine groben und vom Straßenkot verdreckten Schuhe betrachtete. Sie forderte Sebastian allerdings zu dessen Überraschung nicht auf, sie auszuziehen. Ihr missfiel etwas anderes noch viel mehr:
„Würden Sie bitte die Haustür schließen? Wir haben jeheizt“, fragte sie kalt und klang nach Imperativ, der Gehorsam gewöhnt war und keine Widerrede duldete. Sebastian sah die Hausangestellte für einen Moment erstaunt an, wollte wütend auffahren. Dann ging er achselzuckend zurück und machte gehorsam die Türe zu. Anschließend folgte er dem Mädchen die Treppe empor. Bei jedem ihrer Schritte hörte er ein kleines, mechanisches Klicken. Sebastian fragte sich, ob es von ihren Schuhen kam oder von den Stufen erzeugt wurde. Das Hausmädchen sah sich nicht nach ihm um. Sie hatte seine Demütigung mit einem knappen Nicken akzeptiert und führte ihn nach der Treppe über die Galerie, an deren Seitenwand peinlich biedere Landschaftsgemälde hingen, hin zu einem Zimmer, in dessen Türrahmen sie stehen blieb.
„Der junge Herr Kerr“, sagte sie und bedeutete ihm, einzutreten. Gleichzeitig ergriff sie seinen Koffer, dessen recht ordentliches Gewicht ihr keine Probleme zu machen schien. Während Sebastian an ihr vorbeiging, warf sie ihm einen letzten Blick zu, der offensichtlich zu einem vernichtenden Urteil führte. Sie schüttelte stumm den Kopf.
Es war ein stark abgedunkelter und völlig überhitzter Raum, in den der junge Mann trat. Er sah sich um und überlegte. Es konnte nicht das Zimmer sein, von dem aus er gerade draußen beobachtet worden war. Falls die schweren Vorhänge vor den Fenstern jemals geöffnet waren, zeigten diese wahrscheinlich nach hinten auf einen parkähnlichen Garten. Sebastians Augen benötigen eine Weile, sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen, das eine einzelne, verhängte Stehlampe warf. Diesmal schloss das Mädchen hinter ihm Tür. Ein schaler, abgestandener Geruch nach Menthol und Arznei und süßlichem Schweiß schwebte in der muffigen, feuchten Luft. Es war ein schnell und oberflächlich zurechtgemachter Schlafraum, in dem er empfangen wurde, ein Boudoir wie aus dem Fin de Siècle. Er hatte gar nicht gewusst, dass es im modernen 20. Jahrhundert noch solche überladene Zimmer voller von intimen Wäschestücken begrabenen Stühlen und von Kissen und Pfühlen überquellenden Chaiselonguen gab. Das ließ sich ja alles überaus seltsam an. In der Mitte eines Fauteuils vor dem Bett saß in einen unachtsam übergeworfenen, festen Morgenmantel gehüllt eine ältere Frau, die dem jungen Gast erschreckend mager, ja, ausgezehrt erschien. Die Frau hatte ein zusammengefallenes, schmales Gesicht und kleine, fieberglänzende Augen und trug ein Wickeltuch wie einen Turban um den Kopf geschlungen. Sie schien ihm vor nicht allzu langer Zeit geweint zu haben. Sebastian verbeuge sich leicht vor der seltsamen Gestalt.
„Guten Morgen, Frau Dr. Gere. Ich muss entschuldigen, so früh am Tag zu stören“, sagte er galant, obwohl er wusste, dass es ein Wochentag und der Mittag inzwischen überschritten war.
„Ich bin Sebastian Kerr, der Sohn von …“, begann er sich vorzustellen, doch die Frau winkte müde ab, richtete sich etwas in ihrem voluminösen Armsessel auf und unterbrach ihn mit dünner, erschöpfter Stimme:
„Wir haben Sie erwartet“, flüsterte sie. „Wir haben gefürchtet und gehofft … so sehr gehofft … Ich hoffe, unser Mädchen war nicht allzu streng mit Ihnen. Sie müssen Karel …, ich meine, Karla entschuldigen, Sie ist ein wenig …“
Sebastian trat einen Schritt näher, damit er die Frau besser verstehen konnte. Er wusste nicht, was er antworten sollte.
„Sie werden wohl ebenfalls die Wartezeit und meinen Aufzug entschuldigen müssen … Ich bin leidend.“
„Nichts Ernstes, hoffe ich“, fuhr Sebastian nach einer respektvollen Pause fort. Frau Gere senkte als Antwort nur erschöpft ihr schweres Haupt.
Er ging noch näher heran. Die Krankheit schien ihm keine Ausrede zu sein, wenn er die bleiche, wächserne Haut der älteren Frau betrachte. Trotz der Hitze im Zimmer zog sie plötzlich eine Decke zu sich heran und bedeckte mit ihr ihre Beine.
„Ich möchte Sie keinesfalls … inkommodieren. Es wäre in diesem Fall vielleicht ratsam, wenn ich mir ein Hotel …“, führte Sebastian zögernd aus und wurde erneut unterbrochen. Obwohl er selbst nicht genau wusste, was er sagen wollte, bekam er eine energische Replik. Frau Gere richtet sich senkrecht in ihren Kissen auf und ihre erschöpfte Stimme wurde lauter:
„Aber nein, auf keinen Fall. Sie bleiben! Karla richtet Ihnen gerade eines der Zimmer. Sie sind uns ein lieber Besuch“, sagte sie und fügt nach kurzem Atemholen leise hinzu:
„Wir hatten schon lange keine Gäste mehr.“
„Ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Ich kann auch in eine Pension ziehen, das wäre kein Problem“, log Sebastian und begann unter seinem Wintermantel zu schwitzen.
„Aber das ist ja lächerlich! Es ist uns ein Vergnügen. Sie sind uns ein ganz besonderer und wichtiger Gast“, sagte die Kranke und lächelte plötzlich, ihre Gesichtszüge zu einer erschreckenden Totenmaske verzerrend. Beteiligt schob sie ihren Kopf nach vorn und ihre fiebernden Augen funkelten ihn im Trauerflor des kleinen Raumes an. Sebastian freute sich, dass Frau Gere plötzlich ein schier hysterisches Interesse daran entwickelte, ihn im Haus zu halten.
„In der Tat, den Sohn eines guten Freundes zu beherbergen, ist immer eine Freude. Leider ist mein Mann heute Morgen sehr früh zur Arbeit, aber er freut sich bereits auf Sie. Zum Mittagessen kommt er von der Fabrik herüber und Sie werden Gelegenheit haben, ihn und den Rest unserer kleinen Familie kennenzulernen. Vor allem Greta freut sich schon sehr darauf, Sie kennenzulernen.“
Sebastian erinnerte sich daran, dass Gere zwei erwachsene Söhne hatte und zudem seine Tochter Greta, die ein nur ein, zwei Jahre jünger war als er selbst. Auf dieses Mädchen war er ebenfalls schon sehr neugierig. Schließlich hatte er sich in seinem Heimatort einen gewissen Ruf als Charmeur erworben und diesen wollte er auch in die Großstadt hinüberretten. Das war einer der Aktivposten, die er auszunutzen gedachte.
„Aber wenn Sie mich nun entschuldigen würden.“, fuhr Frau Gere mit einem plötzlichen Aufstöhnen fort. „Sie wollen sich sicher nach der langen Bahnfahrt etwas frischmachen und zum Mittagessen umkleiden. Ihr Zimmer ist das letzte zur Rechten am Ende des Gangs. Karla wird Sie geleiten. Wir essen in einer halben Stunde. Leider werde ich nicht daran teilnehmen können, aber ich hoffe doch sehr, dass wir am Nachmittag die Gelegenheit finden, mit einander zu plaudern.“
Frau Gere lehnte sich erschöpft zurück in ihre Kissengruft und drückte eine elektrische Klingel, die zusammen mit Medikamentenfläschchen und einem Wasserglas direkt vor ihr auf einem kleinen Tisch ruhte. Sofort wurde die Tür hinter Sebastian aufgerissen und die Hausangestellte trat herein, als hätte sie die ganze Zeit vor der Tür gestanden und gelauscht. Wahrscheinlich hatte sie das auch getan.
Sebastian verbeugte sich erneut, diesmal etwas tiefer und verließ wie ein Diener rückwärtsgehend den Raum. Dabei fiel sein Blick auf einen Sinnspruch, der in einem Rahmen über dem Bett an der Wand hing. Er musste sich zusammenreißen, um nicht loszuprusten, so grotesk erschien ihm der Spruch in diesem Zusammenhang.
❧
Der so augenfällig ungelegene und vielleicht auch ungeliebte Gast ging nachdenklich hinter Karla, dem Hausmädchen her, das ihn zuerst weiter über die Galerie und dann einen kurzen Flur hinunter führte. Hier zweigten einige Türen in weitere Wohnbereiche der Villa ab; diese bildeten anscheinend die Zimmer der Familie, während sich im Erdgeschoss eher die repräsentativen und hauswirtschaftlichen Räumlichkeiten des Hauses befanden.
Das Mädchen erklärte Sebastian nicht, wozu diese Räume benutzt wurden oder zu wem sie gehörten und wandte sich auch mit keinerlei Erklärungen an den Gast. Sie wollte ihm wohl durch ihr verstocktes Schweigen weiter zu verstehen geben, dass er ihr hier nicht willkommen war und von ihr als Störenfried betrachtet wurde, der ihren Tageslauf in Unordnung brachte. Als sie schließlich vor der letzten Tür auf der rechten Seite stehen blieb und der junge Eindringling in ihrer Domäne sie höflich fragte, ob dies denn nun sein Gästezimmer sei, zuckte sie nur mit den Schultern.
„Das Lunch wird um ein Uhr dreißig serviert, bitte sein Se pünktlich. Die Wäsche bring ick Ihnen dann am Nachmittach“, murmelte Karla mit ihrem rohen Berliner Dialekt, zögerte und fügte unwillig hinzu:
„Jut. Falls Se Wünsche haben, läuten Se einfach. Eene Klingel befindet sich in Ihrem Zimmer neben dem Bett.“
Dann stellte sie den Koffer ab und ließ Sebastian allein. Verwundert sah er ihr hinterher. Dabei entdeckte er, dass sich weiter vorne eine Türe geöffnet hatte und sich ein neugieriger, schwarzgefärbter Bubikopf und eine nackte Schulter durch den Türrahmen schoben und sich eine junge Frau nach ihm umsah, die sich aber sofort wieder kichernd zurück zog, als sie bemerkte, dass Sebastian sie entdeckt hatte. Seine leichte Verbeugung kam zu spät. Mehr als den flüchtigen Eindruck eines hübschen Puppengesichts gewann er dabei nicht. Hatte er einen kurzen Blick auf die Tochter des Hauses oder nur auf ein weiteres Dienstmädchen erhascht, vielleicht ihre Zofe?
„Danke schön“, sagte Sebastian in den Rücken von Karla, die auf ihren flachen Schuhen mit festem Schritt genau in den Raum trat, vom dem aus man ihn beobachtet hatte.
Das ist ja die reinste Gespenstervilla, dachte der Gast, öffnete die Tür, in der kein Schlüssel steckte, nahm seinen Koffer auf und trat in die schmale Zimmerflucht hinein, die ihm für seinen Aufenthalt im Hause Gere zum Wohnen zur Verfügung gestellt worden war. Wie lang dieser wohl dauern würde, wusste er selbst nicht. Trotzdem hatte Sebastian auf unbestimmte Weise das Gefühl, endlich angekommen zu sein.
Viel gab es nicht zu sehen. Dies war nur ein kleiner Raum unter der Dachschräge mit einem noch nicht bezogenen Eisenrohrbett und einem wuchtigen, ja, bedrohlich aussehenden Schrankungeheuer an der Stirnseite. Diese Geschmacklosigkeit stammte wahrscheinlich aus den Gründerjahren des letzten Jahrhunderts, aber Sebastian verstand zu wenig von Kunststilen, um sie sicher einordnen zu können. Mochte der Teufel wissen, wie dieses auf Löwenfüßen ruhende und von geschnitzten Säulen eingerahmte Möbelstück in die moderne Villa der Geres und durch die engen Zimmertüren gelangt war. Sebastian jedenfalls hatte im Moment keine Lust, auszupacken, die gewaltigen Flügeltüren zu öffnen und dabei vielleicht auf die Überreste eines längst verschollenen Oheims der Familie zu stoßen.
Immerhin erhellten eine Balkontüre und daneben ein Fenster das Zimmer und vor diesem stand ein stabiler Schreibtisch, an dem er arbeiten konnte. Daneben führte ein weiterer Durchgang in ein winziges, fensterloses Bad mit einem Waschtisch und einem eigenen Watercloset. Das war ein großstädtischer Luxus, den Sebastian von Zuhause, wo auch die Häuser der Wohlhabenden nur Etagentoiletten kannten, nicht gewöhnt war.
Als Allererstes drehte er das schwarze Bakelit-Rad am eiskaltenHeizkörper soweit es eben ging auf und setzte sich anschließend noch im Mantel und den Straßenschuhen an den Schreibtisch, lauschte den gurgelnden Schlägen, mit denen die Heizungsrohre zum Leben erwachten. Gedankenverloren sah er durch die Glastüre hinaus auf einen umgitterten Vorsprung des Mauerwerks, den der Architekt wahrscheinlich euphemistisch zum „Balkon“ erhoben hatte und durch dessen weiß gestrichene Eisenstäbe hindurch auf einen Garten. Wie er erwartet hatte, erblickte er dort eine weitläufige Anlage mit Obstbäumen, Rasenflächen, Beeten und Hecken im sicherlich von einem Gärtner gepflegten englischen Stil, die im Sommer wahrscheinlich einladend lauschig und schattig, jetzt im trüben Licht des Januars allerdings trostlos und öde, fast menschenfeindlich abweisend auf ihn wirkte.
Sebastian, der in keiner Lebenslage je vergaß, dass er ein Dichter war, holte aus der Innentasche seines Mantels einen Bleistift und sein kleines, für teures Geld im Augsburger Kaufhaus Nill erworbenes Moleskine, in dem er seine spontanen Gedanken und Gedichte zu notieren pflegte.
„Gehe ich durch die Nacht?
Es ist finster um mich/meine Schritte im Schnee sind schnell.
Lichter blenden/Dampf steht über den Gullys/Geräusche der Kälte
Dringen dumpf durch den Shawl/er wärmt mich nicht.Trauer klebt an feuchten Häuserfronten/ist eine skurrile Zeit.
Januar/zwischen den Zeiten bewegungslos.
Ich eile zwischen Ferne und Verlassenheit/von Frau zu Frau zu Frau:
Unterwegs zum Nichts.
Heute ist die Nacht/in der ich ans Töten denke.“,
schrieb er eifrig ohne eine Gedankenpause zwischen den Worten einzulegen.
Gerade als er seine lyrischen Zeilen zu Papier gebracht hatte und ärgerlich die Stirn runzelte, weil sie ihm außer dem Schlusssatz wenig gelungen erschienen, wurde einmal kurz geklopft und eine schmale Gestalt huschte – ohne übrigens auf sein überraschtes „Herein!“ zu warten – in das Zimmer. Sebastian erkannte das Mädchen an ihrem Kichern, das sie wie eine Fahne vor sich her schwenkte.