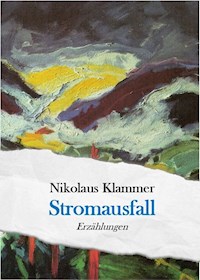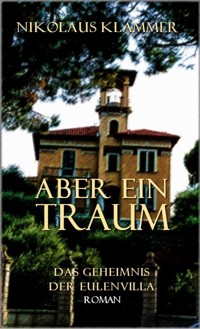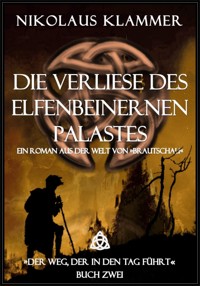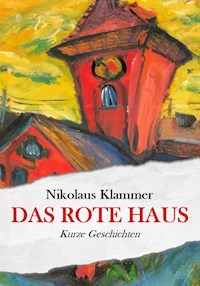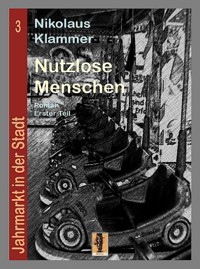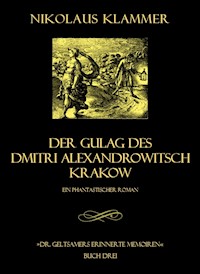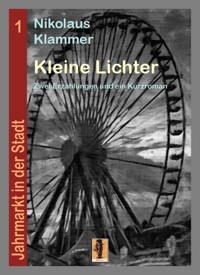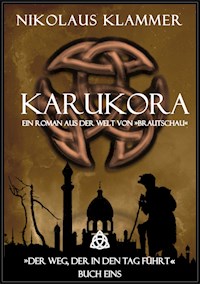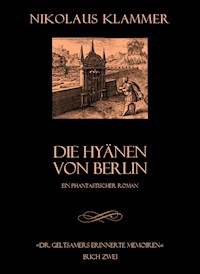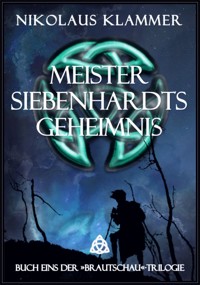Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jahrmarkt in der Stadt Band 2 Die Wahrheit über Jürgen Ein Roman von Nikolaus Klammer Der Mensch dürstet nach dem Bösen, aber er vermag es nicht, ihm seine Seele zu verschreiben. Deshalb schlägt er krumme Wege ein: Die Neurose, das Gelächter oder die Kunst. Eine Stadt Mitte der 90er Jahre in der bayerischen Provinz: Die Bilder des Malers Jonas Nix sind eine künstlerische Sensation und Tagesgespräch bei den Kulturschaffenden. Doch liegt der Erfolg wirklich in der Qualität seiner düsteren, blutigen Werke begründet oder eher an seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu einem Stadtrat und den oberen Zehntausend? Der junge Journalist und Maler Georg Hauser, der mit dem schwierigen Künstler in die Schule gegangen ist, beginnt nachzuforschen und Nix und die Personen in seinem Umfeld zu befragen. Hauser wird dadurch in ein Familiendrama verwickelt, das bald auch sein Leben bedroht und ihn vor die existenzielle Frage stellt: Wie weit würdest du für deine Kunst gehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NIKOLAUS KLAMMER
DIE WAHRHEITÜBER JÜRGEN
Ein Künstlerroman
JAHRMARKTINDER STADT
BAND 2
E-BOOK-AUSGABE
Texte und Bilder:© Copyright by Nikolaus Klammer
Tuschezeichnungen im Text:© Copyright by Bernhard Wurzer
Umschlaggestaltung:© Copyright by Nikolaus Klammer
Druck:epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Kunst ist etwas, was so klar ist,daß es niemand versteht.
Karl Kraus
Es ist an der Zeit, das Schweigen zu brechen. Dass ausgerechnet ich einen Text über Jürgen Niedermayer alias Jonas Nix veröffentliche, mag vielen, die uns beide kennen, seltsam erscheinen. Einige seiner engen Freunde haben mir dieses Unternehmen sogar zum ernsten Vorwurf gemacht. Sie warfen mir Sensationssucht vor, weil gerade ich, der ich Jürgen nur sehr oberflächlich kannte und von einigen zu seinen Feinden gerechnet werde, diese alte Geschichte erneut aufwärmen will. Damit würde ich all das wieder ins grelle Licht einer voyeuristischen Öffentlichkeit stellen, das nach ihrer Meinung besser verborgen bliebe. Denn letztlich sei es unfassbar.
Ich kann mich dieser Meinung keinesfalls anschließen. Vielmehr glaube ich, diese wohlmeinenden Freunde haben den Intensionen von Jürgen einen Bärendienst erwiesen. Wir dürfen nicht vergessen: Seine Tat war öffentlich, vor Publikum. Er wollte gesehen, beobachtet, rezensiert werden. Nun, im Abstand von drei Jahren, nachdem sich die durch die Medien aufwühlten Gemüter der Leute wieder beruhigt haben und längst andere Dinge das Gespräch in der Stadt bestimmen, wird es, denke ich, Zeit, Jürgens Beweggründe zusammenzufassen, sie ausführlich darzulegen und zu versuchen, in seine komplexe Psyche einzudringen.
Ich habe mich deshalb mit meiner literarischen Aufarbeitung von Jürgens Weg an den Verlag gewendet, für den ich früher tätig war. Nun erhoffe ich mir vom Herausgeber den Mut, diesen Text trotz des Drucks von gewisser Seite ohne Zugeständnisse, Eigenzensur und Streichungen zu veröffentlichen. Ich habe bewusst keine journalistische, sondern – soweit mir das möglich war – eine epische Form gewählt. Auch wenn sie sicherlich persönlich geprägt, fragmentarisch und episodenhaft ist, denk ich, nur eine Romanhandlung kann eine Annäherung an die Person, über die ich berichten will, möglich machen.
Ich will dieses Vorwort auch dazu nutzen, Jürgens Freundin Theresa Windisch zu danken. Obwohl erheblicher Druck auf sie ausgeübt wurde, unterstützte sie mich immer in meinem Entschluss. Ihre selbstlose Hilfe bei vielen Detailfragen war unschätzbar. Sie hofft, dass trotz der Abscheu vor Jürgens Tat durch meine Aussage endlich so etwas wie Verständnis für den ernsthaften Künstler, der er war, entstehen kann. Das ist auch meine Hoffnung. Jürgen ist nicht wie die meisten seiner Zunft wie eine Katze um den heißen Brei Wahrheit herumgeschlichen und war dabei vorsichtig bemüht, sich nicht das Maul daran zu verbrennen. Er hat sich seinen Dämonen gestellt. Er hat erbittert um Erkenntnis und mit seiner Kunst gerungen.Jonas Nix ist es wert, in der Erinnerung nicht nur als Ungeheuer, sondern auch als Mensch und großer Künstler bestehen zu bleiben.
Deshalb habe ich diesen Text geschrieben.
Georg Hauser, im Sommer 1998
Ich lernte Jürgen in der Fachoberschule kennen. Wir besuchten sie vor sieben Jahren gleichzeitig. Da er, wenn ich richtig informiert bin, auf Drängen seiner Eltern ausgerechnet den von ihm ungeliebten Wirtschaftszweig besuchte, gingen wir nicht in die gleiche Klasse. Wir wären wahrscheinlich nie aneinandergeraten, wenn nicht durch einen Zufall jemand bei einer Gemäldeausstellung der Kunstkurse unserer Schule seine Arbeit neben die meine gehängt hätte.
Jürgens Werk war eine Collage aus Zeitungsartikeln über die Wiedervereinigung und dicken, schwarzen Kreidestrichen, die ein grob skizziertes Pissoir andeuteten. Darüber war quer in Kreuzform wie mit einer Wasserpistole etwas unangenehm Bräunlich-Rotes gespritzt, das ich zuerst für Farbe hielt. Es handelte sich um ordinäres, eingetrocknetes Ketschup, wie ich bei genauerer Untersuchung erleichtert feststellen konnte. Es klebte auf dem Bild und roch sogar schwach nach Essig und faulen Tomaten. Dennoch war diese Collage gelungen, das musste ich ein wenig neidisch anerkennen. Soweit ich es damals überhaupt beurteilen konnte, war das eine ordentliche Arbeit. Sie war handwerklich überzeugend, das Werk hatte Tiefe und Inspiration. Es erregte sofort heftige Debatten bei den Besuchern der Ausstellung, die das Gemälde daneben - meine bunte, expressionistisch ausgeführte Fabrik, auf die ich sehr stolz war -, mit einem Achselzucken abtaten. Und wirklich, neben diesem durchaus als Geniestreich zu bezeichnenden, im Wortsinn originellen Werk war mein Bild unbedeutend, epigonenhaft und dilettantisch.
Wie bei allen anderen Ausstellungsstücken klebte auch neben dem von Jürgen ein Foto, das den Künstler zeigte. Ich sah mir das Bild an, um mir das Gesicht einzuprägen, denn es war wahrscheinlich eines, das man sich merken musste. Wie ich bald darauf Gelegenheit hatte festzustellen, glich ihm dieses Foto nur in groben Zügen, es war offensichtlich eine etwas ältere und auch noch unscharfe Aufnahme.
Während ich durch die Aula schlenderte und mir die anderen Kunstwerke ansah, wurde ich auf eine Versammlung von vielleicht acht oder neun jungen Männern aufmerksam. Sie hatten sich am anderen Ende des Raumes um ein etwas größenwahnsinniges, abstraktes Triptychon eines Freundes von mir versammelt. Es waren wohl Schüler der Fachoberschule, weil ich ein paar der Gesichter kannte, aber ich hatte noch mit keinem von ihnen gesprochen. Ich trat unauffällig näher, um ihre Meinungen zu erlauschen. Es gab unter ihnen allerdings nur eine einzige. Denn in der Mitte der Gruppe, direkt vor dem Bild, stand Jürgen in der Rolle des gnadenlosen Kritikers. Jetzt fiel mir auf, dass mir sein Charakterkopf schon häufig begegnet war. Ich kannte seine eindrucksvolle Erscheinung nicht nur vom Pausenhof und von einem Informatikkurs, den er allerdings regelmäßig schwänzte. Jeder hat das schon einmal erlebt: Er war für mich ein „öffentliches“ Gesicht, das ich immer wieder einmal gesehen hatte: Selbstredend auf dem Pausenhof, aber auch auf der Straße, im Bus, in einem Lokal, bei einer Vernissage. Es war schon ein seltsames Spiel des Zufalls, durch das wir uns nicht schon früher kennengelernt hatten. Dies hier ist schließlich eine sehr übersichtliche Stadt. Wie sich später herausstellte, besaßen wir sogar ein paar gemeinsame Bekannte.
Ich fand es irritierend, nun zum ersten Mal Jürgens tiefe Stimme zu hören. Bis jetzt war er für mich ein Gesicht in der Masse der alltäglichen Begegnungen gewesen. Es fällt mir schwer, ihn so zu beschreiben, wie ich ihn damals während der Ausstellung sah; als ich ihn zum ersten Mal wirklich aufmerksam musterte. Einiges mag sich jetzt in meine Beschreibung von ihm mischen, das mir damals noch nicht in den Sinn kam. Ich weiß aber noch, wie unproportioniert er auf mich wirkte, er war ein statisch nicht ganz ausgewogenes Bauwerk. In seinem schmalen, langgezogenen und hageren Schädel, der so aussah, als habe er ihn einem Bild von El Greco entliehen, brannten dunkle, in schwermütigen Höhlen liegende Augen mit einem ernsten, fast wahnhaften Feuer. In seinen Blicken war kein bisschen Humor zu finden oder auch nur ein Anflug von Ironie, die diesen Eindruck ein wenig hätten abmildern können. Auf der Bühne hätte wirklich einen wunderbaren „Misanthrop“ in dem Stück von Molière abgegeben. Dazu schaukelte sein Asketenkopf auf einem dünnen, zerbrechlichen Hals mit einem abnormen, spitz hervorstechenden Adamsapfel. Jürgens massiver, untersetzter Leib jedoch, der entschieden zur Korpulenz neigte, stand dazu in einem geradezu grotesken Gegensatz.
Ich sah auf seine Hände, die er erhoben hatte, um ein Detail des Triptychons näher zu erläutern. Der Anblick erschütterte mich. Seinem fetten Unterarm folgte ein breiter und grober Handteller, eine tiefe Speckfalte kennzeichnete die kaum sichtbare Abgrenzung. Aber Jürgens Finger waren dürr, lang und fein, er besaß Finger wie Jean Cocteau. Wenn der Schöpfer überhaupt jemandem jemals den Kopf und die Finger eines Künstlers geschenkt hatte, dann ihm. Der Rest seines Körpers war jedoch für einen ungeschlachten, primitiven Bauer gedacht. Ob mir damals schon der Gedanke kam, er müsse unter jenem Gegensatz leiden?
Er stand vor dem Triptychon und sprach kurze, wirkungsvolle Sätze mit seiner klaren, dunklen Stimme. Verblüfft registrierte ich, wie andächtig und – ich finde kein anderes Wort - „fromm“ihm die anderen zuhörten. Er hatte seine Jünger vollkommen in seinen Bann gezogen. Ich schob mich noch näher an die Gruppe heran und bemühte mich, Jürgens Worten zu folgen. Es war herablassend und gemein, was er sagte. Es mochte zwar im Kern wahr sein, aber mir missfiel der offensichtliche Genuss, den er dabei empfand, das wässrige Aquarell-Triptychon meines Freundes unter dem Beifall dieser Gruppe von Speichelleckern mit Worten zu zerfleddern. Diese Häme war unter Kollegen unnötig und vor allem war sie arrogant. Schließlich waren wir doch alle Anfänger und der Kritik schutzlos ausgeliefert. Was machte es da für einen Sinn, wenn wir uns gegenseitig ans Messer lieferten? Jeder von uns suchte unsicher nach einem Weg, den er beschreiten konnte und kopierte unbeholfen und frech falsch verstandene Vorbilder. Wie konnte Jürgen nur glauben, ausgerechnet er sei die geniale Ausnahme, die das Recht hatte, die anderen verächtlich abzuurteilen?
Er trat zum nächsten Ausstellungsobjekt, die anderen folgten ihm. Erneut vernichtete er Sinn und Gestalt des Bildes mit seiner herablassenden, leider jedoch auch zutreffenden und gerade in ihrer Kürze bösartigen Kritik. Dann gingen alle weiter zum folgenden Gemälde. Jürgen war ihr König, ihr Führer. Sie waren nur sein johlendes Gefolge ohne eine eigene Meinung. Jede Spitze von ihm fand lachenden und zustimmenden Beifall. Für einen Gänsehaut erzeugenden Moment sah ich statt JürgenJoseph Goebbels vor mir. Ein bitterer Geschmack lag plötzlich auf meiner Zunge.
Nachdem Jürgen auch mein Bild mit einem von einem herablassenden Schulterzucken begleiteten Verriss dem Gespött der Gruppe preisgegeben hatte, was ich, obwohl ich es erwartet hatte, wie einen Tritt in den Unterleib empfand, konnte ich mich auf keinen Fall mehr zurückhalten, als alle, vor Ehrfurcht erstarrt, ergriffen schwiegen und über das Wahre, Gute und Schöne meditierend vor seiner Collage standen. Ich musste mich rächen. Ich musste den weihevollen Augenblick kaputt machen. Das war ich den anderen Malern und der bohrenden Kränkung in meinem Herzen schuldig. Voller Abscheu stieß ich meine Worte wie Hagens Speer in Jürgens Rücken und hoffte, dass ich seine verwundbare Stelle fand:
»Schade, dem Bild fehlen ein paar vertrocknete Pommes frites. Dann wäre es gelungener und ausgewogener«, stieß ich zornig hervor. Zehn wütende Augenpaare wandten sich zu mir. Sie musterten mich feindselig und auch ein wenig unsicher. Ich empfand eine ehrliche Befriedigung dabei, ihnen ihre heilige Kuh geschlachtet zu haben. Jürgen zuckte erschreckt zusammen, fuhr herum und sah mich sehr überrascht an. Er bemerkte mich erst jetzt. Er kniff die Augen zu einem schmalen Schlitz zusammen und schob das Unterkiefer mit einem hörbaren Knacken nach vorn. Dadurch verwandelten sich seine vergeistigten Gesichtszüge plötzlich in eine brutale und aggressive Maske. Ein sezierender Blick glitt sehr langsam an mir herab. Ich wich unwillkürlich einen Schritt zurück, mich gegen einen körperlichen Angriff wappnend, der nun als eine unausgesprochene Drohung in der Luft lag. Doch dann lachte Jürgen überraschend auf. Dieses freudlose und kurze Lachen war ein Markenzeichen von ihm.
»Da hast du recht, ich hatte leider Angst vor Schmerzen und Konsequenzen«, stellte er wegwerfend fest. Dabei klang er äußerst unzufrieden. Ich verstand damals seine Bemerkung nicht. Aber ich verschränkte die Arme, hob die Augenbrauen und lächelte wissend. Wenn sich zwei Künstler unterhalten, hat der verloren, der zuerst seine Unwissenheit bekennen muss. Diese Regel hatte ich damals bereits gelernt und gut verinnerlicht. Ich wartete auf die unvermeidliche verbale Auseinandersetzung, die mir besser lag und bei der ich einige Punkte gut machen wollte. Doch mit Jürgen konnte man solche Spiele nicht machen. Er musterte mich noch einmal scharf und nickte einmal, zu einem sicherlich nicht schmeichelhaften Ergebnis kommend. Dann ließ er mich und die ganze Gruppe einfach stehen, ging mit schnellen Schritten aus der Aula. Fast rannte er. Seine Epigonen eilten nach einer Schrecksekunde hinter ihm her. Einer fand noch die Zeit, mir im Vorbeigehen ein Schimpfwort zuzuflüstern. Ich sah diesem ungeordneten Rückzug nach und glaubte, ich wäre als Sieger auf dem Schlachtfeld verblieben. So naiv war ich damals noch.
Das war meine erste Begegnung mit Jürgen. Ich hielt es auch nicht für besonders wahrscheinlich, dass ihr noch weitere folgen würden. Tatsächlich hörte ich längere Zeit nichts mehr von ihm. Übrigens zog er bereits am nächsten Tag beleidigt sein Bild von der Ausstellung zurück, was ich als eine äußerst kindische Reaktion empfand.
Ich habe ihn dann noch ab und an von der Ferne gesehen, immer von seinen Leuten umringt, die fast alle aus seiner Klasse waren. Einmal, vielleicht ein Jahr später, in einem Café, schnorrte ich ihn um eine Zigarette an, die er mir dann auch gab. Nach dem Fachabitur jedenfalls verlor ich seine Spur, bis ich von einem Bekannten Erstaunliches über ihn hörte. Das war vor nun fast vier Jahren.
Ich hatte wegen akuten Geldmangels mein Kunststudium unterbrochen; natürlich nur kurzzeitig, wie ich mir beruhigend einredete. Ich arbeitete, da meine Bilder keiner kaufen wollte, als freier und schlecht bezahlter Mitarbeiter bei der Stadtzeitschrift MegaSzene von Rainer Werner. Abends stand ich zusätzlich viermal in der Woche in einer Musikkneipe hinter der Theke und perfektionierte das gleichzeitige Einschenken von vier Weißbieren. Davon wurde ich zwar nicht reich, aber es genügte für das sparsame Leben, das ich damals führte. Zu jener Zeit war ich nur für mich selbst verantwortlich. Es gab für mich Wichtigeres als neue Kleidung und einen vollen Bauch. Freilich hatte ich meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben, dass ich einmal mit meiner Kunst groß herauskäme, aber die Umstände zwangen mich doch zu diesen Zugeständnissen. Immerhin musste ich nicht mehr bei der Post Briefe austragen.
Ich sah mich selbstbewusst durchaus als einen bildenden Künstler an. Nur wenn ich malte, fühlte ich mich mit mir und meinem Leben eins. Doch ich musste auch leben und so wurden die Dinge, die mir wichtig waren, durch eine immer weiter außer Kontrolle geratende, mir geradezu mystisch erscheinende Dynamik in eine immer knapper bemessene freie Zeit gedrängt, die zusätzlich durch eine sich langsam entfaltende, enge Partnerschaft mit meiner späteren Frau Christine noch einmal beschnitten wurde. Ich war nur noch ein Wochenend-, ein Sonntagsmaler und mir gelang es über Jahre hinweg nicht, mich in meiner Kunst weiter zu entwickeln: In der Rückschau betrachtet, dilettierte ich vor mich hin. Falls ich diese Tatsache damals überhaupt akzeptierte, litt ich jedoch noch nicht unter ihr. Ich hatte mich mit dieser Art zu leben arrangiert und hoffte, sie würde ewig währen.
Ich ging mit meinen Werken kaum an die Öffentlichkeit. Das lag vor allem in meiner Unsicherheit und Schüchternheit begründet. Anstatt der banalen Wahrheit ins Gesicht zu sehen, machte mir vor, mich würde in erster Linie die Prostitution bei irgendwelchen dummen Menschen, die dazu nötig gewesen wäre, ekeln. Es ist doch so: Schon um zu kleineren Erfolgen zu kommen, muss man sich als Künstler bei einer Anzahl von Leuten anbiedern; ihnen, um es einmal deutlich zu sagen, in den Arsch kriechen, um ein paar kleinere Gefälligkeiten zu erhalten: Vielleicht einen Raum, in dem man seine Bilder ausstellen kann, Genehmigungen, falls man sie verkaufen will, einen Rezensenten bei der Zeitung oder beim lokalen Rundfunk, eine Firma oder ein Lokal, die mit einem kleinen Zuschuss das Plakat zur Ausstellung finanzieren, eine Bank, die bei der Werbung hilft. Und dann ist man wie kein anderer der unqualifizierten Kritik von Personen ausgeliefert, die in unangreifbaren Stellungen sitzen und ernstgemeinte und tief empfundene Arbeiten mit einer nachlässigen Handbewegung als wertlos einstufen können.
Nun, bei Jürgen war das allerdings alles anders. Ihm gelang offenbar mühelos, woran sich andere ein Leben lang vergeblich abarbeiteten. Die wenigen Spötter - ich gehörte selbst zu ihnen - behaupteten, es läge an seiner Verwandtschaft mit dem Kulturreferenten Dr. Arno Pauli. Jürgen war, das ist inzwischen ein offenes Geheimnis, sein Neffe. Die Wohlmeinenden konterten, Qualität würde sich eben auch heutzutage noch durchsetzen. Wo die Wahrheit auch zu finden sein mag, Jürgens Aufstieg zu einer Berühmtheit ging atemberaubend schnell. Er benötigte nur drei Monate nach seinem ersten öffentlichen Auftritt, um die Kunst- und Kulturszene der Stadt zu überwinden und auch überregional unvermeidbarer Mittelpunkt und Gesprächsthema Nummer Eins zu werden. Er konnte seine Bilder, die auf dem Markt erstaunliche Preise erzielten, problemlos verkaufen.
Ein Bekannter, ich weiß nicht mehr, wer, erzählte mir Anfang Januar, dass bald ein gewisser Jonas Nix seine Bilder ausstelle und das, man höre und staune, im oberen Rathausfletz. Das ist bekanntlich ein altehrwürdiger, überladen barocker Gang von den Ausmaßen eines Saales, den höchstens alle Jubeljahre einmal, meist kurz vor der Wahl, der hiesige BBK für eine Sammelausstellung bekommt. Der Vorstand des Bundes Bildender Künstler, damals noch mit tatkräftiger Unterstützung der guten Margot Bittner-Bach, muss dafür jedes Mal von Neuem einen harten Kampf mit den Stadträten und den Betonköpfen der CSU-Fraktion ausfechten, die den Saal lieber für Tagungen und Gesellschaften, für den Ball des Sportes oder ähnlichen Unsinn benutzt sehen wollen.
Ich hatte für diese Mitteilung meines Bekannten nur ungläubiges Kopfschütteln. Ich konnte es erst recht nicht glauben, als ich erfuhr, dass dieser Nix ein junger Künstler aus unserer Stadt war. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Das geschah ausgerechnet mir, der ich mich immer als gut informiert betrachtete, für die MegaSzene Künstler-Porträts machte und dort mit spitzer Feder Ausstellungen rezensierte.
Nach ein paar Tagen tauchten allerdings überall in der Stadt schlichte Plakate auf, die auf die Ausstellung von Nix im Rathaus Anfang des nächsten Monats hinwiesen. Wie aus den Plakaten ersichtlich war, hatte er sie unter das seltsame Motto GrauSamen gestellt. Ich holte ein paar Erkundigungen ein, aber meine sonst recht zuverlässigen Quellen wussten nichts über den geheimnisvollen Phantomkünstler zu berichten, der ihnen so unbekannt wie mir selbst war. Natürlich fiel mir die semantische Bedeutung des Nachnamens auf: Es lag klar auf der Hand, dass Nix ein Pseudonym war. Es gab auch niemanden mit diesem Namen im Telefonbuch. Wer steckte also dahinter?
Nachdem ich also auf dem üblichen Wege durchaus nichts in Erfahrung bringen konnte, wollte ich mich direkt an das städtische Kulturreferat wenden. Denn über dieses Amt musste die Entscheidung gelaufen sein, das Rathausfletz für die Ausstellung bereitzustellen. Doch ich war wegen einiger unfreundlicher Artikel, in denen ich Dr. Paulis spießbürgerlich-konservative Haltung kritisiert hatte, in seinem Referat persona non grata und wurde bereits von einer unbedeutenden Sekretärin im Vorzimmer seines Stellvertreters, des schmierigen und absolut unfähigen Winfried Dieckmeyer, abgewiesen. Frustriert ließ ich deshalb dieses Geheimnis ein Geheimnis bleiben und widmete mich privaten und erfreulichen Dingen, bis mich Alfons Andernaj etwa eine Woche später über den Tresen, an dem ich ihm sein Dunkles zapfte, nebenhin ansprach:
»Du, Schorsch, i' hab' g'hört, dass du di' für den geheimnisvollen Jonas Nix interessiersch. Willsch du wissen, wer des is'?«, sprach er mich mit seinem furchtbaren „Augschburgerisch“ an. Ich hatte mich gut unter Kontrolle und verschüttete nur wenig Bier. Ich sah ruhig zu Andernaj hin, der jetzt freundlich grinste und dabei seine unappetitlichen Zahnruinen zur Schau stellte.
Alfons Andernaj war ein öffentlicher Alkoholiker und gehörte nicht gerade zum engen Kreis meiner Bekannten. Er war ein immer unrasierter, früh in Unehre ergrauter Mittvierziger, der schmutzige kleine Gedichte und Shortstorys im Stil von Bukowski schrieb und sie bei einem kleinen örtlichen Verlag veröffentlichte. Da ihm das jedoch nur wenig Geld einbrachte und er ein durch und durch arbeitsscheues Subjekt war, ließ er sich von älteren Frauen aushalten, die er sich mit seinem Holzfäller-Charme und seiner aufgesetzten Exzentrizität einfing. Sie lieferten ihm ihrerseits wieder ausreichend Stoff für seine unanständigen Gedichte. Da er es wegen seines Alkoholkonsums nie fertigbrachte, den schönen Schein eines genialischen Künstlers längere Zeit aufrecht zu erhalten, setzten ihn seine Damenbekanntschaften meist nach einem Vierteljahr angeekelt vor die Tür. So hatte er zwischendurch immer wieder Bettelphasen, in denen er bei gutmütigen Freunden oder im Nachtasyl sein Zwischenlager aufschlug, bis er seinen nächsten Fang machte. Er lebte in diesen Zeiten hauptsächlich von geliehenem Geld, das er selbstverständlich nie zurückzahlte. Seine Gedichtvorträge besaßen für die, die ihn noch nicht kannten, einen hohen Unterhaltungswert und waren für seine doch recht zahlreichen Fans ein absolutes Muss:
Er war pünktlich zu jeder seiner Lesungen stockbetrunken, so betrunken, dass er schon nicht mehr stehen konnte. Er lag dann quer über dem Tisch und schleuderte seinen teils entsetzten, teils amüsierten Zuhörern kaum verständliche Wortfetzen und Beschimpfungen und Speichel entgegen. Das machte er so lange, bis auch der Letzte angeekelt gegangen war oder er selbst erschöpft auf dem Tisch einschlief. In unserer kleinen Stadt lockten seine Exzess-Lesungen kaum mehr einen Hund hinter dem Ofen hervor, aber wenn er mit seinen dünnen Gedichtbänden über die Dörfer ging, war er immer wieder ein vieldiskutierter Skandal.
An jenem Abend in der Kneipe war er einmal mehr mitten in einer seiner Hungerphasen; er wirkte sehr verwahrlost und war angetrunken. Er versuchte, seinen Blick auf mich zu konzentrieren, aber er rutschte immer wieder ab.
»Schpendiersch' mir a Bier, dann verrat' is dir«, reimte er lachend und ich stellte ihm nickend sein Dunkles auf den Tresen. Während er sofort nach seinem Glas griff, beugte er sich nach vorne und hielt die andere Hand seitlich an den Mund. Sein fataler Atem schlug mir entgegen, er roch, als hätte er gerade ein überfahrenes Frettchen gefressen.
»Nix is a unversöhnlicher Feind von dir«, flüsterte er mit Verschwörermiene.
»Ein Feind? Du nimmst mich auf den Arm. Ich habe keine Feinde. Dazu bin ich zu unbedeutend und friedliebend«, erwiderte ich achselzuckend. Ich wollte mich kopfschüttelnd abwenden, aber er hielt mich flink am Ärmel fest.
»Doch, das behauptet er allen Ernstes! Ehrlich, Schorsch, interessiert dich das denn nicht? Du kennst ihn und er hasst dich.« Widerwillig drehte ich mich wieder zu dem Säufer. Andernaj konstatierte erfreut meine Aufmerksamkeit. Befriedigt ließ er mich noch ein wenig zappeln und trank zuerst genüsslich von seinem Bier.
»Jetzt? Was ist?«, fragte ich ungeduldig. Er genoss offensichtlich diese kleine Macht. Obwohl ich mich eigentlich über ihn ärgerte, tat er mir ein wenig Leid, weil er so etwas nötig hatte.
»Du kennst ihn«, sagte er nach seiner Kunstpause, in der er sich den Schaum vom Dreitagebart wischte. »Du warst mit ihm auf der Schule, hat er mir erzählt. Jonas Nix ist kein anderer als … tataaa! Jetzt halt dich fest ... als Jürgen Niedermayer.«
Für einen Moment hatte mich Andernaj tatsächlich sprachlos gemacht. Aber meine Reaktion war nicht die, die er erwartet hatte, das war ihm anzumerken. Denn ich überlegte stirnrunzelnd und versuchte eine Weile vergeblich, den Namen einzuordnen. Dann fielen mir Jürgen und das kleine Erlebnis während der Schulausstellung wieder ein. Wegen meiner damaligen kurzen und flapsigen Bemerkung, die ich längst wieder vergessen und auch nicht sehr böse gemeint hatte, hasste er mich? Konnte ein so gefestigt wirkender Mensch auf diese Weise empfindlich und nachtragend sein? Oder war ich ihm später noch einmal unbeabsichtigt auf die Füße getreten? Wenn ja, dann konnte ich mich nicht mehr entsinnen.
»Ich erinnere mich dunkel an den Niedermayer: Er ist ziemlich fett, hat aber ein auffallend mageres Gesicht, richtig? Aber das ist doch mindestens drei, was sage ich, vier, eher fünf Jahre her, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass er noch in der Stadt ist. Woher kennst du ihn denn?«, fragte ich. Andernaj strich sich durch seine Schmalzlocke. Es war ein Fehler von mir, ihn das zu fragen, denn eine von seinen Unarten war seine egomanische Geschwätzigkeit, die er auch sofort mit einer Wortflut unter Beweis stellte:
»Nun, vor, lass mich sagen, vier Wochen, kriege ich einen Brief. Die Post hat eine Weile gebraucht, bis sie ihn zu mir in meine jetzige Bleibe nachsandte. Ich bin nicht mehr so einfach zu finden, weil ich ja nicht mehr unter der Adresse wohne, die auf der ersten Seite meines letzten Gedichtbandes steht. Er heißt: Aus meiner Gesäßtasche. Toller Titel, nicht wahr? Leider habe ich ihn geklaut. Kennst du ihn? Das ist mein bisher bester! Verstehst du, da war ich ganz nah dran.« Er stellte sich in Position. Dann rezitierte er sich selbst mit zitternder Stimme, von seiner eigenen Wortgewalt ergriffen.
» Wo Beginneihr Ende schon in sich tragen,Sein nur Wille ist,da will ich sein,will Anfang und Wehe,Schmerz und Dich«,
begann er recht verheißungsvoll, landete jedoch bei der nächsten Strophe wieder bei seiner üblichen Pornografie. Eines muss ich ihm lassen: Als er bemerkte, wie peinlich ich berührt war und ungeduldig wurde, brach er sofort ab und nahm seine Erzählung wieder auf.
»Weißt du, da war ich noch mit Elli zusammen, das war eine Frau! Ich sage es dir: Elvira Böckelmann, Scheiße, Mann, ich sage es dir … Aber, na ja, du weißt ja, wie das bei mir ist, hehe. Die fühlte sich plötzlich ausgenutzt. Kannst du das verstehen, ich soll … dabei bin ich doch ein Künstler.« Andernaj geriet auf Abwege. Ich seufzte deshalb hörbar. Er richtete sich sofort in die Höhe.
»Wo war ich eben stehen geblieben?«
»Bei dem Brief, den du gekriegt hast«, erwiderte ich geduldig, aber auch etwas abgelenkt, weil ich nebenzu weiterhin meine Arbeit machte. Andernaj schien ich dabei nicht weiter stören zu lassen.
»Ja, genau. Also, stell dir mal vor, dieser Brief war die erste Fanpost, die ich je erhalten habe. Ich habe zwar schon mal einen Schrieb von Günter Grass …«
»Von Niedermayer?«, warf ich eilig ein, denn ich wollte die abendfüllende Geschichte von ihm und seinen Erfahrungen mit dem PEN-Club nicht noch einmal hören.
»Was? Ja, natürlich, von wem denn sonst? Wovon, glaubst du, rede ich hier? Er hat meine Gedichte gelesen und fand sie sehr gut. Die seien genau das, was er wolle. Die würden sein eigenes Empfinden formulieren, und so … Weißt du, er bat mich in dem Brief höflich drum, ob er nicht ein paar Zeilen von ihnen in seinen Bildern benutzen kann … Der macht so Collagen und so. Ich war natürlich begeistert, aber bevor ich ihm mein Jawort gebe, hehe, denk ich mir, schau ich mir erst einmal an, was er so macht. Bevor ich meinen guten Namen opfere, du verstehst schon. Sogar ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich habe ihn angerufen und wir haben uns in seinem Atelier getroffen. Na, ich hab‘ nicht schlecht gestaunt, mein Lieber! Sein Atelier hat er in einer Dachwohnung in der Bäckergasse, erste Adresse, piekfein, in einer …, wie heißt das noch einmal? Genau, in einer Mansarde. Ich geh da unten zur Haustür rein, so wie immer, diesen hier. Das musst du dir geben, da kommen mir ein paar verkackte Omas entgegen, Pelzmantel, Schmuck und die ganze Kacke. Schauen mich an, als würde mir was aus der Hose hängen und ich habe sogar nachgeschaut, ich Depp. Ich habe erst geglaubt, ich wäre im falschen Haus, dass der Kerl mich mit der Adresse verarscht hat. Aber oben, an der Tür zur Appartementwohnung, klebt so ein Messingschild: Jürgen Niedermayer, Kunstmaler. Boah, denke ich. Ich stehe da wie eine Jungfrau vorm ersten Mal und trau mich kaum, zu klingeln. Aber dann öffnet mir dieser Jüngling, du kennst ihn ja: Keine sehr beeindruckende Gestalt, wenn man mal von seinem Dichterschädel absieht. Aber ein Haufen Knete steht hinter ihm, so eine Wohnung hast du noch nicht gesehen. Die ist perfekt eingerichtet, wie aus einem Ambiente-Heft herausgeschnitten. Ich hab‘ mich gefühlt wie bei den Hempels unterm Sofa. Er hat mir natürlich nicht alles gezeigt, hatte wohl Angst, dass ich ihm seine Perser schmutzig mache, hehe. Wir sind auch gleich in sein großes Atelier gegangen. Unglaublich, sage ich dir, unglaublich, es sah wie in einem Film aus: Kennst du Ein Amerikaner in Paris? Diese endlos hohen, blütenweißen Ateliers, in denen noch nie einer gepennt oder gemalt hat? In denen man nicht ficken, sondern höchstens tanzen kann? Weißt du, solche großen, schrägen Dachfenster mit Blick aufs Münster, ein heller, weißgetünchter, bis aufs Malerwerkzeug und ein paar Leinwände leerer Raum, so ein Scheiß Parkettboden drin, rutschig vom Wachs. In der Mitte steht protzig die Staffelei mit dem Bild, an dem er malt. Großes Format, natürlich; drunter macht es der nicht. Er hat mir ein paar von seinen Arbeiten gezeigt. Du weißt, ich kann nicht viel damit anfangen, die ganze Klexerei ist nicht meine Welt, aber das, was der macht … das ist schon beeindruckend, irgendwie morbide und kaputt, aber beeindruckend. Na ja, und dann erzählt er mir, er würde bald im Rathaus ausstellen. Es sei die erste große Ausstellung in seiner Heimatstadt mit seinen Bildern. Bisher habe er sich nicht getraut, war sich unsicher wegen der Qualität oder so, aber jetzt macht er es doch. Fishing for compliments, kennst du ja. Ich frage ihn natürlich, wie er denn zu so einem Ausstellungsraum käme, die findet man ja schließlich nicht im Müll. Hehe, war ihm gar nicht recht, die Frage, habe ich ihm angemerkt. Er druckst ein bisschen herum, dann kommt es: Er ist der Neffe von dem alten Arschloch Pauli, weißt schon, unserem Kulturbonzen. Und der Wichser ist so überzeugt von dem, was Jürgen macht, dass er ihn kräftig unterstützt. Na, jetzt war klar, wie der zu so einer Wohnung gekommen ist: Der ist mit einem goldenen Pinsel im Mund geboren worden, hehe.«
Andernaj lachte und leerte nach seiner langen Ansprache erst einmal gierig sein Glas. Er konstatierte erfreut, dass ich ihm aufmerksam zugehört hatte. Er ist doch so etwas wie ein Schriftsteller, ging mir durch den Kopf, denn er war trotz seiner deftigen Ausdrucksweise und seinem grauenvollen Dialekt ein guter, bildhafter Erzähler. Ich habe seine Geschichte hier übrigens wörtlich niedergeschrieben, wie sie mir in der Erinnerung geblieben ist - ich habe nur die meisten der Kraftausdrücke weggelassen, die zwangsläufig jeden Satz begleiteten, der aus seinem Mund kam.
»Aber warum ist er dann mein Feind?«, fragte ich interessiert. »Ich habe doch nichts mit ihm zu tun.«
»Schpendiersch mir no 'a Bier, dann …«
»Ja, ich weiß«, winkte ich ab und zapfte ihm seine zweite Halbe. Einen Moment betrachtete er mich nickend, dann fuhr er fort:
»Er sagte, das Schlimmste für ihn sei die Ablehnung, der er überall begegne, das Missverstehen und vor allem der Neid seiner Kollegen. Die könnten ihm nicht einfach die Wahrheit sagen. Die würden sich lieber die Zunge abbeißen, als zuzugeben, dass da jemand besser ist als sie. Er hat ziemlich klug gelabert. Ich habe nicht alles verstanden. Aber ich hab‘ ihm natürlich nicht gesagt, dass ich das nicht konnte, hehe. Und als Beweis für die unfaire Ablehnung nennt er deinen Namen. Du kennst mich …« Er schlug sich nachdrücklich auf die Brust. »… ich halte zu dir, bist ein guter Kumpel. Ich weiß, dass er da ein Vorurteil hat. Du bist eine der ehrlichsten Typen in der Szene. Deine Kritiken sind zwar gefürchtet, aber nur selten unfair. Ich kann mich eigentlich nur an einen einzigen Fall erinnern; nämlich bei meiner Lesung mit Horst Favelka im Eiskeller. Es war wirklich nicht nett, was du da geschrieben hast. Gut, seine Texte waren beschissen, aber ich war doch mindestens so gut wie sonst. Weißt du, der Horst und ich, das ist eine ganz seltsame Beziehung. Er hat Geld und Ideen und ich das Genie.«
»Alfons, bitte, komm auf den Teppich. Diese Lesung war vor über einem Jahr. Damals trug ich noch meinen Gips«, unterbrach ich ihn und verfluchte mal wieder im Stillen Emilio Parma. Das tat ich immer, wenn ich an den komplizierten Bruch meines Beines im letzten Jahr dachte, an dem der Möchtegern-Journalist und Kabarettist nicht ganz unschuldig war.
»Ich will was über Nix hören. Wenn du redest, erstaunt es mich immer, dass du nur diese kurzen Verse und keine ausufernden Romane schreibst. Du kriegst von mir noch mal die Proustplakette.« Falls ich tatsächlich gehofft hatte, er würde nach diesem Einwurf zu unserem ursprünglichen Gesprächsthema zurückkehren, hatte ich mich geirrt.
»Ich hab‘ auch einmal einen Roman angefangen: Mea culpa. Toller Name. Dann hab‘ ich gemerkt: Romane sind tot. Verstehst du? Die Kürze ist die Kunst, Mensch! Das ist die radikalste Komprimierung, wie ein Musikvideo, darauf kommt es doch heute an. Nicht wahr?«, fuhr er fort.
Warum konnte ich nicht meinen Mund halten? Ich hatte ihn unbeabsichtigt mit der Nase auf sein Lieblingsthema gestoßen. Er begann mir detailreich auseinanderzusetzen, man könne heutzutage keine Romane mehr schreiben, ohne ein Lügner zu sein. Niemand habe mehr die Zeit, so etwas zu lesen. Wer kenne schon Krieg und Frieden, Doktor Schiwago, Moby Dick oder Die Brüder Karamasoff? Solche Literatur sei nur noch über zudem missglückte Verfilmungen bekannt. Romanverfilmungen seien wie Seilbahnen. Niemand mache sich mehr die Mühe, zu Fuß auf den Berg zu steigen. In unsere hektische, kurzatmige und reizüberflutete Welt passe eben nur die Art von Verbrauchslyrik, die er zu Papier bringe.
»Mein alter Kumpel Nikki Klammer ist auch der Meinung. Lesen, einen runterholen und dann ins Klo damit. Runterspülen«, brachte er seine Meinung auf den für ihn typischen, griffigen Nenner.
Das Mädchen, das neben ihm an der Bar saß, widersprach energisch. Der Möchtegern-Dichter ließ sich hocherfreut in einen heftigen, polemischen Disput verwickeln, ohne dass übrigens einer der beiden auch nur ein wenig literarisches Fachwissen zu erkennen gab. Ich fragte mich, ob das Gerücht, Alfons habe einmal Germanistik studiert, der Wahrheit entsprach. Ihm ging es bei dem Streitgespräch allerdings nicht um das Prinzip – wahrscheinlich wollte er seine neue Bekanntschaft nur nicht bloßstellen. Er nutzte die überraschende Gelegenheit zu einem Flirt und ließ sich von seiner hübschen Widersacherin zu einem Bier einladen. Er war wirklich der perfekte Schnorrer.
Nach einer ganzen Weile unterbrach ich kurz das inzwischen recht intime und weit fortgeschrittene Geturtel der beiden und ließ mir von Andernaj – solange er noch nicht zu betrunken dazu war – die genaue Adresse von Jürgen Niedermayer geben. Mir schwebte noch immer ein Interview mit dem Maler für meine Zeitung vor. Ich hoffte, ich würde es trotz der offensichtlichen Ablehnung meiner Person bekommen.
Gleich am nächsten Nachmittag ließ ich mir diesen Plan in der Redaktion der MegaSzene