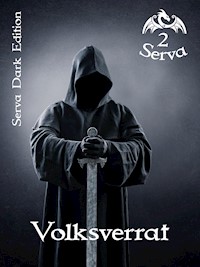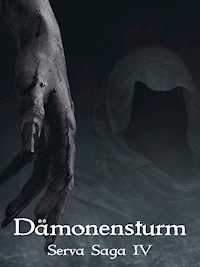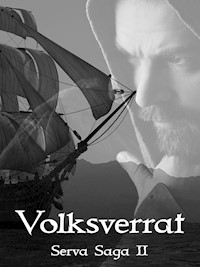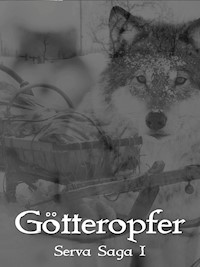Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Serva Reihe
- Sprache: Deutsch
Aus den Bergen kündigt sich Unheil an. Es stehen harte Zeiten bevor. Unheimliche Wesen kommen aus ihren Verstecken hinunter ins Tal zu den Städten und Dörfern. Sie verbreiten Angst und Schrecken. Die Zeitenwende hat längst begonnen ... Der dritte Teil der Serva Saga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Der 15. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 16. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 17. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 18. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 19. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 20. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 21. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Impressum
Hinweis
Für die Serva Saga und die Serva Chroniken gibt es ein umfangreiches Nachschlagewerk unter https://www.serva-wiki.de. Hier findest du wichtige Informationen rund um die Welt von Ariton, eine Übersicht über wichtige Charaktere, über die Völker, die Städte und vieles mehr.
Der 15. Tag
1
Shiva
Zwei Tage vorher ...
Apsara hatte ihre Unschuld vor gut einem Jahr verloren. Durch ihren zwei Jahre älteren Bruder. Sie wusste, dass es Sünde war. Aber sie hatte dem inneren Trieb, der langsam gewachsen war und sie zu einer Frau gemacht hatte, nachgegeben. Vor allem aber hatte sie ihm nachgegeben, ihrem Bruder. Der schon weiter war und dessen Sehnsucht nach sexueller Befriedigung bereits vor zwei oder drei Jahren gereift war. Auch heute hatten sie sich wieder davongeschlichen. Weg vom elterlichen Hof. In Richtung Berge. Als sie weit genug weg gewesen waren, hatte Apsara sich lachend ausgezogen und war dann ein paar Meter gerannt. Ihr Bruder hinterer. Grinsend und voller Vorfreude. Keine zehn Meter weiter hatte er sie zu fassen bekommen, sie auf den Rücken gedreht und war dann in sie eingedrungen. Ja, es war Sünde. Aber wo waren die Götter? Warum bestraften sie sie nicht einfach? Sie ließen es zu, also konnte es nicht so schlimm sein. Ihr Vater hatte immer gesagt, dass ein Blitz sie treffen würde. Oder der Boden aufgehen und sie beide verschlingen würde. Weil er längst geahnt hatte, dass seine beiden Kinder Inzucht trieben. Er schämte sich dafür. So sehr, dass er glaubte, dass ihn im nahegelegenen Galava jeder anschaute. Dabei konnte keiner etwas wissen. Zu weit war sein Hof weg. Niemand kam zu ihm. Er brachte seine Ware in den Tempelort und ging wieder. Keiner interessierte sich für ihn und erst recht nicht für seine Unzucht treibenden Kinder.
Apsara schloss die Augen. Sie spürte das Glied ihres Bruders, dass sich zwischen ihren Schamlippen rieb. Vergessen wir Vater. Er will mich doch nur selbst ficken. Davon war sie überzeugt. Und deshalb hörte sie nicht auf seine Moralpredigten. Sie liebte die Vereinigung mit ihrem Bruder.
„Du bist so der Hammer!“, stöhnte ihr Bruder. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn. Es war früh am Morgen.
Und dann war da dieses Geräusch. Ein Krächzen oder Brüllen. Ein unheimlicher, angsteinflößender langgezogener Laut, der von irgendwoher kam.
„Hörst du das?“, fragte sie. Panik erfüllte ihren Körper und verdrängte jegliche Lust.
Er schaute auf. „Ja! Bei den Göttern, was war das?“
„Ich weiß es nicht, aber es hörte sich furchtbar an!“
Bei ihm war es anders. Seine Lust war größer. Seine männliche Gier warf ihn nicht so schnell aus der Bahn. Rhythmisch bewegte er seine Hüfte auf ihr.
„Murali!“, sagte sie leise. „Hör auf!“
Doch er hörte nicht auf sie. Er ließ seinem Trieb freien Lauf.
„Murali!“, sagte sie nun deutlich lauter.
„Was, verdammt?“
„Oh, mein Gott!“, schrie sie.
Murali schaute in ihr Gesicht. Sie starrte an ihm vorbei. Und ihr Blick war voller Panik. So einen Ausdruck der Angst hatte er in ihr noch nie gesehen. Und dann spürte er den Luftzug. Ein kühler, immer wieder kehrender Strom. Als würde jemand hinter ihm stehen und ihm zufächeln. „Was ist?“
„Bei den Göttern!“, sagte sie erschrocken. Sie zitterte am ganzen Leib. Ja, sie sah die Gefahr. Und in ihren Augen spiegelte sie sich wieder.
Murali traute sich nicht sich umzudrehen. Er wusste, dass etwas hinter ihm war. Etwas so Angsteinflößendes, dass der Blick seiner Schwester ihm Panik bereitete. Er drückte sich dicht an sie. Sein Glied war längst nicht mehr steif, aber war noch immer in ihr. „Apsara, sag mir. Was ist da hinter mir?“
„Ein Drache!“ flüsterte sie fast unhörbar.
Apsara schrie. Sie schrie, so laut sie konnte. Aber es war zu spät. Das schreckliche Monster stürzte sich herab und seine Krallen vergruben sich in ihrem Bruder. Panisch versuchte sich dieser zu wehren. Schlug um sich. Blickte zu seiner Schwester. Für einen Moment lang schwebte der riesige Drache über Murali. Ein unglaublich heftiger Geruch nach einem wilden Tier stieg ihr in die Nase. Mit jedem Flügelschlag, mit dem er sich in der Luft hielt, wehte er ein wenig mehr von seinem Geruch in ihre Richtung.
Apsara sah den Blick ihres Bruders. Voller Panik und Furcht. Das Monster hatte ihn fest in den Krallen. In Angesicht des Todes kämpfte Murali gegen den Griff. Versuchte die Krallen, die sich in sein Fleisch gebohrt hatten, zu öffnen. Aber es gelang ihm nicht. Blut floss aus den offenen Wunden und tropfte auf seine Schwester.
Sie schrie. Noch immer. Sie hörte nicht auf zu schreien und für einen Moment lang sah es so aus, als würde der Drache sie fixieren. Aber dann, mit kräftigen Flügelschlägen, flog er davon. In der Gewalt seiner Fänge war der junge Shiva-Bauernsohn Murali.
Apsara rappelte sich auf. Nackt wie sie war. Sie konnte froh sein, dass ihr Geist sich in diesem Augenblick vollkommen abgeschaltet hatte. Dass sie nicht wirklich kapierte, was gerade geschehen war. Weil es so surreal, so unglaublich war. Der Schock saß viel zu tief. Und so sah sie auch nicht den zweiten Drachen. Der plötzlich da war und auch sie packte ...
Der 15. Tag
Die Welt würde nie wieder so sein, wie sie einmal war. Das wusste Richard. Der Priesterlord von Galava ahnte schon lange, dass harte Zeiten bevorstanden. Aus den Bergen kündigte sich Unheil an. Schon immer hatte er gewusst, dass seltsame Wesen dort oben lebten. Bergleute hatten immer wieder von Zwischenfällen berichtet. Aber noch nie waren irgendwelche unheimlichen Gestalten aus den Bergen herabgekommen. Aber nun war es soweit. Hödur hatte von den Bergdämonen gesprochen, die den Bauernhof überfallen und damit etliche Kilometer zurückgelegt hatten.
„Du willst also behaupten, dass du einen Drachen gesehen hast?“, fragte der Vizelord den Bauersmann, der vor ihm stand.
„Ja, Herr. Ich schwör bei dem einen Göttervater und seinen sieben Göttern. Ich habe ihn gesehen! Und meine beiden Kinder sind verschwunden.“
„Du bist ein Narr!“, sagte der Vizelord mit harten Worten. Er glaubte ihm nicht. „Drachen sind nur Legenden. Und das weißt du!“
„Bei meiner Familie und all meinen Ahnen. Ich habe ihn gesehen! Ich schwöre es!“
Priesterlord Richard stand auf und hob die Hand um seinen Vizelord aufzufordern nicht mehr zu antworten. Er ging näher an den Bauern heran und legte seine Hände auf dessen Schultern. „Du darfst niemandem verraten, was du gesehen hast!“
„Ihr glaubt mir also?“, fragte der Farmer unsicher.
„Ich glaube dir!“
Der Vizelord war außer sich. „Was? Die Legende spricht von Drachen, die in den Bergen südlich der Wüste leben. Und es sind nur Legenden. Aber noch nie sprach jemand von Drachen in den Bergen hier bei uns!“
„Sie kommen!“, sagte Richard ohne auf die Worte seines Vizelords einzugehen. „Sie kommen alle. Allesamt. Und sie werden Chaos, Schutt und Asche hinterlassen. Es wird Zeit, dass die Götteropfer den Tempel von Deux erreichen!“
„Ihr glaubt doch diesen Unsinn nicht?“, fragte der Vizelord. „Wir sind die Hüter des alten Wissens. Wir versuchen Dinge mit Sachverstand zu klären. Nicht mit Legenden!“
„Unsere Geschichte ist die eine Sache. Vieles können wir erklären. Und viele Legenden und Sagen über unsere Herkunft können wir als Märchen getrost in Bücher verschließen. Weil wir die Wahrheit kennen. Aber kennen wir die Wahrheit über diesen Planeten auf dem wir leben? Unser altes Wissen, das wir in unserer Bibliothek hüten, als wäre es ein großer Schatz, beschäftigt sich mit unserer Vergangenheit und unserer Herkunft. Nicht aber mit diesem Planeten. Nicht mit dem, was wir aktuell als unsere Heimat ansehen!“
„Weil es für uns irrelevant ist. Uns interessiert das, was in den Büchern des alten Wissens steht!“
„Wir leben im Jetzt und Hier. Ja, wir sind die Hüter des alten Wissens. Aber unser Wissen wird es nicht mehr lange geben, wenn wir uns nicht dem Stellen, was auf uns zukommt.“
„Was denn? Was kommt auf uns zu?“
„Kannst du uns alleine lassen?“, fragte Richard den Farmer.
Dieser schaute den Priester an. „Was ist mit meinen Kindern? Ich finde sie nicht ...“
„Wir werden dir Männer schicken. Sie werden dir helfen sie zu suchen!“
„Danke, Herr!“, meinte der Bauersmann und ging dann hinaus.
„Es kommen düstere Zeiten auf uns zu!“, sagte der Priesterlord leise. „Erkennt die Zeichen der Zeit. Aus den Bergen kommt das Unheil.“
„Ich habe die Geschichten über die Bergdämonen gehört. Man erzählt sie den Kindern um ihnen Angst zu machen. Sie sind falsch und widersprechen jeglicher Logik. Aber Drachen? Das ist noch viel verrückter. Ernsthaft. Daran glaubt Ihr doch nicht, oder?“, der Vizelord schüttelte den Kopf. „Ich jedenfalls nicht!“
„Ihr habt es nicht verstanden. Wir berufen uns auf das alte Wissen. Und ich wiederhole noch einmal. Das ist das Wissen unserer Vergangenheit. Es ist nicht einmal das Wissen dieser Welt, sondern aus einer anderen, unserer früheren Welt. Nichts, aber auch gar nichts, hat unser Wissen mit dem zu tun, was hier geschieht. Wollt Ihr das leugnen?“
„Das leugne ich nicht!“, sagte der Vizelord. „Aber wir müssen unserer Linie treu bleiben. Wir glauben nicht wirklich an die sieben Götter und an Regnator, den Göttervater. Weil sie nicht unsere Götter sind.“
„Was sind dann unsere Götter?“, fragte Richard. „Der, den unsere Vorfahren Jesus nannten? Oder Odin? Oder Zeus? Vielleicht Allah oder Jahwe? Das alte Wissen hat keine klare Linie und das wisst Ihr!“
„Es ist unsere Aufgabe Ordnung rein zu bringen!“
„Ach kommt!“, sagte Richard wütend. „Wir bringen keine Ordnung rein. Unsere Vorfahren waren sich uneins. Über Jahrtausende hinweg. Hier auf diesem Planeten glauben wir alle an die gleichen Götter, sprechen die gleiche Sprache ... und wir haben die gleiche Herausforderung zu meistern!“
„Das Unheil, das Ihr seht?“, fragte der Vizelord. „Die Dunkelheit, die aus den Bergen die Dämonen und Drachen ruft?“
„Was auch immer es ist. Habt Ihr den Himmel beobachtet? Habt Ihr die Monde beobachtet? Sie rücken näher. Immer näher. Als wollten sie miteinander verschmelzen. Seht Ihr das nicht?“
„Oh, doch, das sehe ich!“, der Vizelord nickte. „Aber wir wissen aus unseren alten Quellen unserer wirklichen Vorfahren, dass Planeten sich nun mal verschieben. Wir wissen nicht, warum unsere Vorfahren ihren Planeten verlassen haben und warum sie hier auf Ariton gelandet sind. Aber wir wissen, dass das alles eine logische Erklärung mit sich bringt. Die wir nicht immer kennen. Aber die Monde schieben sich nicht Nacht für Nacht aufeinander zu, weil die Götter zusammenrücken.“
„Glaube was du willst!“, sagte der Priesterlord Richard. „Das ist ja unsere Devise. Wir haben das alte Wissen und jeder kann damit tun, was er will. Unsere Aufgabe ist es dieses Wissen zu hüten, es aufzubereiten und daraus zu lernen. Ich persönlich habe jedoch auch die Aufgabe unseren Orden zu schützen. Wenn die Dämonen und Drachen unsere Welt Ariton verwüsten, dann geht auch uns das etwas an.“
2
Hingston
Einige Jahre zuvor ...
Es war draußen bereits dunkel und zwei der sieben Monde strahlten durch das kleine Fenster in die Gemächer der Prinzessin Katharina von Manis. Das siebenjährige Mädchen lag auf ihrem Bett. Eine Kerze brannte auf ihrem Nachttisch. Katharina schaute gespannt auf ihre Großmutter, die neben ihr auf dem Bett saß. Wie so oft erzählte sie Geschichten. Sagen, Legenden und Märchen. Manchmal waren die Geschichten so verrückt und unglaublich, dass sie recht leicht zu durchschauen waren. Ab und zu jedoch enthielten sie zumindest ein kleines Stück Wahrheit und erzählten aus der wirklichen Geschichte der Mani.
„Es war lange bevor du geboren wurdest, mein Liebes!“, erzählte Katharinas Großmutter. „Eine Zeit in der die Drachen von den Höhen der Berge und aus den Tiefen der Wälder hervorkamen um auf Frauen und Männer unseres Volkes Jagd zu machen. Sie stürzten sich wahllos auf unschuldige Bauern, nahmen sie mit sich und keiner ihrer Opfer wurde jemals wiedergesehen!“
„Das ist ja schrecklich!“, sagte Katharina leise. Die kleine siebenjährige Königstochter lauschte gerne den Geschichten ihrer Großmutter. Auch wenn sie manchmal unheimlich waren.
„Ja, das war eine schlimme Zeit! Wir, deine Großeltern, waren noch nicht einmal geboren. Und dein Urgroßvater, der Vater deines Großvaters, war noch jung. Er war gerade mal vierzehn Jahre alt!“, sie stupste ihrer Enkelin auf die hübsche Nase und erzählte dann weiter. „Aber er war ein mutiger junger Mann. Eines Tages ging er auf die Jagd. Mit einer Armbrust ging er hinaus in den Wald um einen Hasen zu erlegen!“
„Ich will auch schießen lernen!“, sagte Katharina.
„Oh, mein Schatz. Das wirst du noch früh genug. Ich kenne doch meinen Sohn. Er wird es dich schon lehren lassen. Aber nun hör weiter zu!“, sie deckte ihre Enkelin ein wenig besser zu. „In jedem Fall ging dein Urgroßvater alleine durch den Wald!“
„Alleine?“
„Ja, alleine. Er ging den Fluss entlang, bis er zu einer Lichtung kam. Der Wind war günstig und er hoffte dort auf der freien Fläche Hasen zu finden. Doch er hatte kein Glück. Alle kleinen Häslein hatten sich versteckt. Vielleicht hatte einer ihn bemerkt und es den anderen erzählt. In jedem Fall war kein Hase zu sehen!“
„Hasen können doch nicht miteinander reden!“, sagte Katharina ein wenig beleidigt. Sie mochte es nicht, wenn die Geschichten zu albern wurden.
„Nun, weißt du es? Vielleicht reden sie miteinander. Oder geben sich Zeichen!“
„Es sind Hasen!“, sagte Katharina. „Sie können nicht reden!“
„Nun gut. Dann haben sie eben alle mitbekommen, dass ein junger Jägersmann, ein Königssohn, über die Lichtung schlich und alle haben sich versteckt.“
„Sie haben ihn gerochen!“, meinte Katharina und war stolz etwas über die Jagd zu wissen.
„Ja, vielleicht. Vielleicht hatte der Wind gedreht!“, die Großmutter räusperte sich geräuschvoll und erzählte dann weiter. „Mein Vater, also dein Urgroßvater, war enttäuscht. Er setzte sich auf einen Felsen und ruhte sich aus. Doch es war kein Fels ...“
„Sondern?“, fragte Katharina leise. Ihre Großmutter konnte perfekt die Spannung erhöhen, in dem sie mit ihrer Stimme spielte.
„Es war ein Drache. Ein Urwesen aus einer alten Zeit.“
„Wirklich?“, Katharina schaute ihre Großmutter ein wenig unsicher an.
„Ja. Ein Drache. Und er erhob sich, richtete sich auf und stand groß und stark vor deinem Urgroßvater. Ein mächtiges gigantisches Wesen!“
„Bei den Göttern. Er hat ihm doch nichts getan?“
„Nein. Er war ein guter Drache. Und er wollte dem jungen Königssohn nichts tun. Er erzählte ihm sein Leid. Dass die Drachen einen neuen Führer hatten. Einen Mani aus unserem Land. Und das viele Drachen vom rechten Weg abgekommen waren!“
„Und deshalb haben sie getötet?“, Katharina lief es eiskalt den Rücken hinunter.
„Und der Drache verriet deinem Urgroßvater ein Geheimnis. Wenn er die Worte „Draco Labi“ aussprach, so konnte er jeden Drachen vom Himmel holen! Diese Worte alleine reichten aus um ihnen die Kraft zu nehmen zu fliegen!“
„Und?“, fragte Katharina neugierig. „Was hat Urgroßvater getan?“
„Erst einmal nichts. Er ging nach Hause. Er erzählte die Geschichte seinem Vater, dem König. Aber der glaubte ihm nicht. Niemand würde es jemals überleben, wenn er einem Drachen begegnete!“
„Aber er hat ihn doch gesehen!“, sagte Katharina. „Warum glaubten sie ihm nicht?“
„Nun ja. Weil man immer nur Geschichten hörte. Weil aus dem Volk Leute verschwanden und nie wiedergesehen wurden. Aber keiner jemals einen Drachen gesehen hatte und noch lebte.“
„Das ist nicht nett!“
„Würdest du jemanden glauben, dass er einen Drachen gesehen hat?“
Katharina überlegte und schüttelte dann den Kopf. „Nein!“
„Nun. Der Geschichte nach ging dein Urgroßvater viele Jahre später als Soldat durch das Land der Shiva!“
„Die auf der anderen Seite des Meeres!“, sagte Katharina.
„Ja, du hast gut aufgepasst!“, meinte ihre Großmutter.
Katharina grinste. „Ich habe eine Karte. Die hat mir Vater geschenkt!“
„Dein Urgroßvater wollte in die Wüste, weil er glaubte, dass es dort große Schätze gab. Doch er und seine Männer wurden, so erzählt die Geschichte, von einem Drachen angegriffen.“
„Bei den Göttern, wirklich?“
„Ja. Sie flohen vor ihm, doch sie hatten keine Chance. Er tötete alle Männer und schwebte dann vor deinem Urgroßvater, bereit auch ihn zu töten!“
„Da ist ja schrecklich!“
„Dein Urgroßvater erinnerte sich an die Worte des Drachen, den er als junger Mann getroffen hatte. Und er sprach die Worte aus. „Draco Labi“, sagte er und es geschah wirklich. Der Drache stürzte vom Himmel. Er versuchte sich wiederaufzurichten, aber sofort, wenn er sich in die Lüfte erhob, sprach dein Urgroßvater die Worte. Und so konnte er sich retten. Er rannte davon und versteckte sich!“
„Aber er hat den Drachen nicht getötet, oder?“
„Nein, das hat er nicht. Zumindest glaube ich das nicht!“, sagte die Großmutter der Prinzessin. „Und nun schlaf, mein Kind!“
„Was ist denn weiter passiert?“, fragte Katharina.
„Nichts. Er konnte sich retten. Er versteckte sich und dann floh er zurück in die Heimat. Es ist eine Geschichte, die gut ausging!“
„Aber die Männer die verstarben?“
„Ja!“, nickte die alte Frau. „Da hast du wohl recht. Ganz so gut ging es dann doch nicht aus. Aber der König konnte sich retten. Und das für unser Land wichtig. Vor allem gäbe es dich sonst nicht!“
Der 15. Tag
Keine Welt war schon immer da und keine Welt wird es immer geben. Alles hat seine Zeit. Alles ist vergänglich. Auch Ariton würde irgendwann nicht mehr sein. In den Völkern wurden neue Aritoner geboren und andere starben. Es war ein ewiger Kreislauf. Neue Mani, neue Shiva, neue Nehataner. Und im Gegenzug segneten Einige das Zeitliche.
Königin Elisabeth von Manis saß auf dem Balkon ihrer königlichen Gemächer und schaute nach Osten. Hinter der Stadt Hingston ging die Sonne auf. Es war erstaunlich still. Ihr Blick schweifte hinüber zum Marktplatz von Hingston, der von ihrem Balkon gut zu sehen war. Es war der Morgen nach dem großen Putschversuch. Nach dem Angriff ihres Vaters auf die Burg. War es nun vorbei? Würde alles wieder so werden wie früher? Nun, erst einmal nicht. Ihr Mann war noch immer nicht ansprechbar. Er, König Leopold, war noch immer in diesem äußerst merkwürdigen Zustand. In den sie ihn gebracht hatte. Was eigentlich nicht ihr Ziel gewesen war. Sie hatte ihn töten wollen. Das war ganz klar. Und nun? Nun hoffe sie auf der einen Seite, dass er wieder der Alte wurde, auf der anderen Seite hatte sie Angst davor, dass er die Wahrheit kannte. Dass er wusste, wer schuld an seinem Zustand war. Im Grunde war es sogar klar, dass er es wusste, es sei denn, er hatte die Erinnerung verloren.
Sie musste die Gedanken verdrängen. Musste sich auf das Wesentliche konzentrieren. In sechs Tagen war die Wahl des Götteropfers. Jetzt, wo ihr Vater endlich abgezogen war, konnten die Jungfrauen hier in der Stadt in Empfang genommen werden. Die meisten waren bereits seit Tagen unterwegs, viele hatten ja nicht einmal mitbekommen, was hier in der Hauptstadt geschehen war.
„Mutter?“, die Stimme ihrer Tochter riss sie aus den Gedanken.
Elisabeth drehte sich um. „Katharina! Was ist los?“
„Ich wollte dir sagen, dass ich bereit bin. Durch und durch. Wenn man mich als Götteropfer erwählt, dann bin ich bereit für die große Reise!“, meinte die Prinzessin.
Elisabeth nickte. Das waren genau die Worte, die sie nun aufmunterten. „Das ist gut, mein Engel. Das ist wirklich gut!“
„Eine Bitte habe ich aber!“, sagte Katharina.
„Alles, was du willst!“, erwiderte ihre Mutter. Auch wenn sie es so nicht meinte.
„Ich würde gerne meine Hofdame mitnehmen!“
„Das ist kein Problem!“
„Und zu meinem Schutz hätte ich gerne Lord Philipp von Raditon!“
„Nun!“, seufzte die Königin. „Das ist schon schwieriger! Er ist der Kommandeur der königlichen Palastwache. Und wir haben im Moment unruhige Zeiten!“
„Ihm vertraue ich ...“
„Was ist mit Lord Stephan, oder Lord Christoph ...“
„Nein!“, sagte Katharina und unterbrach ihre Mutter beim letztgenannten Namen der beiden Brüder barsch.
„Ich werde mit dem Lord sprechen!“, sagte die Königin. „Wir werden eine Lösung finden!“
„Wenn du mir Lord Philipp an die Seite gibst, dann habe ich keine Angst!“
Elisabeth nahm ihre Tochter in den Arm und drückte sie. „Und genau das ist es, was ich möchte. Dir die Angst nehmen. Ich werde mit den Offizieren sprechen.“
„Wird Vater jemals wieder so sein wie früher?“, fragte Katharina und in ihrer Stimme klang Angst.
„Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Aber er ist ein starker Mann! Ich hoffe es!“, aber ob sie es wirklich hoffte, dass konnte sie sich selbst nicht einmal richtig sagen.
Es war für Katharina nicht einfach ihrer Mutter zu vertrauen. Sie hielt sie für eine hinterlistige Frau. Aber sie war ihre Mutter und im Moment die einzige Familie, die sie hatte. Neben Onkel Thomas. Aber mit dem hatte sie noch nie allzu viel zu getan gehabt. Vieles hatte sich in den letzten Tagen verändert, viel war geschehen. Und so manches davon war nicht wirklich gut. Vor allem aber wusste sie nicht so recht, ob ihre Mutter es ernst meinte mit ihrer Sorge um König Leopold. Sie kannte ihre Mutter. Und sie war aus dem Alter raus, in dem sie ihre Mutter als Heilige ansah und immer nur das Gute erblickte. Jede Tochter und jeder Sohn kommt irgendwann einmal an den Punkt, wo er die Eltern aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Katharina hatte diesen Punkt schon eine Weile erreicht.
Lord Philipp von Raditon bekam von diesem Gespräch natürlich nichts mit. Er wusste nicht, dass er die erste Wahl für die Prinzessin war, wenn es um die Reise des Götteropfers ging. Er war gerade dabei in der Kommandeursunterkunft die Leistungen der Veteranen zu würdigen und traf dabei auch eine Entscheidung was den Begleitschutz für das Götteropfer anging.
Er klopfte Thores auf die Schulter. „Du warst eine gute Unterstützung und hast kluge Entscheidungen getroffen!“
„Danke, Lord!“, meinte der Veteran. „Eure Anerkennung ehrt mich!“
„Ich habe heute morgen eine Entscheidung getroffen. Gemeinsam mit den anderen Offizieren. Nun, diese Entscheidung ist vom König nicht abgesegnet, aber in Anbetracht der Vorfälle wird auch er sie unterstützen.“
„Das wäre?“
„Die Veteranen haben gut gekämpft. Die gehören nicht zum alten Eisen, wie wir immer geglaubt haben. Und deshalb möchte ich eine Einheit aufstellen. Die nur aus Veteranen besteht. Unter deinem Kommando!“
„Tatsächlich?“, fragte Thores. Seine Augen leuchteten. Das war durchaus ein attraktives Angebot. „Es wäre mir eine Ehre!“
„Vor einiger Zeit wollte man dich noch hängen sehen!“, sagte der Lord. „Vergiss das nicht! Du hattest eine Menge Glück.“
Nein, das würde Thores nicht vergessen. Aber an Glück glaubte er nicht. Er hatte sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Im Grunde genauso wie sein Bruder vor gut zwei Wochen es ebenfalls getan hatte. Allerdings war dieser anschließend verbannt worden. Und er, Thores, würde nun eine Einheit führen.
Es klopfte an der Türe zu den Räumlichkeiten des Kommandeurs.
Lord Philipp rief. „Herein!“
Es erschien Lord Stephan. „Verzeiht die Störung. Wir haben einen Toten. In der Stadt! In einem Haus!“
„Einen Toten?“
„Ja. Ihr müsst Euch das ansehen. Es ist ein grausames Bild. Irgendein Wahnsinniger scheint in der Stadt umherzugehen!“
„Nun gut! Ich komme!“, meinte Lord Philipp. „Ich erkläre unserem neuen Kompaniechef gerade sein Aufgabengebiet!“
Lord Stephan nickte. „Weiß er schon, um was es geht?“
„Noch nicht ganz!“, sagte der Kommandeur.
„In jedem Fall Glückwunsch!“, meinte Stephan und gab Thores die Hand. „Du bist kein Lord. Und damit der Erste, der jemals aus einem niederen Stand heraus eine Kompanie führt!“
„Und das auch nur bis der König wieder bei Bewusstsein ist!“, fügte Lord Philipp hinzu. „Wir werden ihm von deinem Engagement berichten. Aber entscheiden wird er wohl selbst!“
„Nun, ich werde mein Bestes geben!“, sagte Thores.
„Nun zum Auftrag deiner zukünftigen Veteranenkompanie!“, sagte der Kommandeur. Er nickte kurz Lord Stephan zu, der sich verabschiedete. Dann schaute er wieder zu Thores. „Du weißt, dass Ende dieser Woche das Götteropfer bestimmt wird.“
„Ja, das ist mir bekannt!“
„Die Lage hier in Manis ist verzwickt. Wir brauchen alle verfügbaren Kräfte um einem weiteren möglichen Aufstand durch Herzog Olaf entgegen zu treten. Wir müssen die Armee neu strukturieren, Ämter neu besetzen. Und wir sind deshalb nicht in der Lage dem Götteropfer eine adäquate Einheit mitzugeben!“
„Ihr wollt, dass ich das Götteropfer Richtung Tempel von Deux begleite?“
„Ja, gemeinsam mit einer Stärke von fünfzig Mann!“, sagte der Kommandeur. „Was hältst du davon?“
„Es wäre mir eine Ehre!“, meinte Thores. Obwohl er sich seinen ersten Auftrag anders vorgestellt hatte.
„Nun gut. Die Reise wird erst in gut zwei Wochen beginnen. Aber du solltest dir bis dahin deine fünfzig Mann aussuchen, sie trainieren und fit machen. Wir stellen dir hierzu im Feldlager vor der Stadt Baracken zur Verfügung. Deine Männer werden natürlich bezahlt. Jeweils am Wochenende.“
„Was ist mit Waffen?“
„Alle Männer werden selbstverständlich komplett ausgerüstet.“
„Gut!“, Thores schien zufrieden.
„Entschuldige mich nun!“, meinte Lord Philipp und öffnete die Türe. „Ich muss nach dem Leichnam sehen. Was auch immer der Tote in der Stadt zu bedeuten hat, wir müssen Ruhe in die Bevölkerung bringen!“
„Verstehe ich!“, sagte Thores und begleitete den Kommandeur dann hinaus auf den Hof des Palastes.
Lord Philipp wusste nicht, wer den Toten in diesem Haus gefunden hatte, noch wem das Haus gehörte. Er wusste nur, dass es ein grausamer Anblick war. Er starrte auf die Leiche. Er hatte etwas Vergleichbares noch nie gesehen. Der Tote war männlich. Man hatte ihn auf dem Rücken liegend auf einem Tisch festgebunden. Nackt wie die Götter ihn schufen. Dann hatte man auf seinen Bauch einen metallenen Käfig befestigt.
„Was ist das auf dem Käfig?“, fragte Philipp. Was auch immer es war, es rauchte ein wenig. Allgemein roch es ein wenig verbrannt.
„Kohle!“, meinte Lord Stephan.
„Verstehe ich nicht!“, sagte der Kommandeur. Erst jetzt schaute er auf den Bauch des Toten. Der Bauchraum war geöffnet und man konnte die zerfetzten Gedärme sehen. „Bei den Göttern! Was ist hier passiert?“
„Ratten!“, meinte einer der Wachsoldaten der königlichen Palastwache als Lord Stephan nicht antwortete.
„Was?“
„Man hat Ratten in den Käfig gesetzt und auf das Käfigdach glühende Kohlen gelegt. Die Ratten gerieten in Panik und versuchten zu entfliehen. Durch den Bauchraum des ... Toten!“
„Allmächtiger Regnator. Das ist ja grausam!“
„Einige Ratten waren noch hier im Raum. Sie haben es tatsächlich geschafft zu entkommen. Durch den Bauch und dann seitlich hinaus. Dieser Mann muss höllische Qualen gelitten haben!“, sagte der Soldat.
„Wer ist dieser Mann?“, fragte Philipp und richtete sich nun direkt an seinen Offizier Lord Stephan.
Der Lord aus Charleston starrte auf den Leichnam. Er hatte schon viel gesehen, aber das hier war mehr als grausam. Die Frage riss ihn aus den Gedanken und er schaute zu seinem Vorgesetzten. „Ein Priester!“
„Was?“, Lord Philipp schüttelte ungläubig den Kopf.
„Und das hier ...“, sagte Stephan und ging zur hinteren Wand des Hauses. „ ... ist das Zeichen des Ordens der Hüter des alten Wissens!“
Lord Philipp schaute auf das Zeichen. Ein vollständig blauer Kreis. Schlicht und einfach. Der Kommandeur ging näher heran. Die blaue Farbe war noch nicht einmal ganz trocken.
„Der blaue Planet!“, sagte Lord Stephan. „Das ist doch das Zeichen der Hüter des alten Wissens, oder?“
Der Kommandeur nickte. „Ja, das ist in der Tat deren Zeichen. Ich habe das mit dem blauen Planeten noch nie verstanden.“
„Wie dem auch sei!“, murmelte Lord Stephan von Charleston. „Das ist ein anderes Thema. Wir sollten in jedem Fall dieser Sache hier nachgehen. Die Hüter des alten Wissens befragen!“
„Allzu viele gibt es hier doch nicht!“, meinte Lord Philipp. „Nicht hier in der Hauptstadt. König Leopold hat den Orden zwar geduldet, aber sie dürfen weder predigen, noch dürfen sie sich öffentlich versammeln!“
„Ihr redet von unserem König, als wäre er bereits tot!“, kritisierte Lord Stephan.
„Vergebung. Das war keine Absicht!“
„Wir sollten raus hier!“, meinte der Kommandeur. Er konnte den Anblick des Toten nicht ertragen. „Und nehmt jeden fest, der irgendetwas mit dem Orden zu tun hat.“
„Wir sollten so wenig Unruhe wie möglich verursachen!“, murmelte Lord Stephan. „Die Bürger sind ohnehin schon durch die letzten Ereignisse panisch und ängstlich!“
„Ihr habt recht. Aber die Hüter des alten Wissens haben ohnehin nicht viele Befürworter. Sie sind Stadtprediger und Halunken. Keiner wird sie vermissen!“
3
Lios
Die größte pravinische Stadt südlich der Wüste Gory war in heller Aufregung. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gingen mehr oder weniger aufgeregt Richtung Marktplatz. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Kunde verbreitet, dass ein neuer Stadtmeister einberufen werden sollte. Was seltsam klang, denn der Stadtmeister der beiden Städte Lios und Laros wurden stets durch den König östlich der Wüste einberufen und in den Süden geschickt.
Fast die gesamte Garnison der Stadt war versammelt. Die Bürger drängten sich dicht an dicht auf den Marktplatz um die Stimme von Lelex, dem Hauptmann der Garnison, hören zu können.
Hauptmann Lelex war bereits dabei zum Volk zu sprechen. „... es ist mittlerweile gut zehn Jahre her, seit unser König in der pravinischen Hauptstadt Malos entschieden hat, dass die alten Fürstentümer aufgelöst werden und königliche Stadtverwalter auch in unseren beiden Städten südlich der Wüste eingesetzt werden. Ein Stadtverwalter für Lios und einer für Laros. Die Steuern, die wir an unsere Hauptstadt und unseren König entrichten, sind immer mehr gestiegen. Wir haben vor gut einem Jahr eine Delegation zum König geschickt. Fürst Roloxs von Lios, ihr kanntet ihn alle und habt ihn als weisen Fürsten geschätzt, wurde dabei hingerichtet. Als Verräter. Er hinterließ seine Tochter Rhea, die bis heute trauert. Nun aber ist diese Trauer zu Ende. Sie muss zu Ende sein. Weil wir nach vorne blicken müssen. Was haben wir dem König zu verdanken? Die Nehataner marschieren in unser Land ein. Kann uns unser König schützen?“
„Nein!“, schrien einige aus dem Volk und „Nieder mit dem Patriarchat des Königs!“, war aus den Reihen zu hören.
„Ihr seht hier Feldmarschall Mixtli. Den wir gestern aus den Reihen der nehatanischen Streitmacht gefangen genommen haben!“
Buh-Rufe erschallten aus den Reihen der Bürger.
Lelex hob die Hand. „Schweigt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Mixtli, ein ausgezeichneter Führer hat uns angeboten auf unserer Seite zu kämpfen ...“
Ein Raunen ging durch die Menge.
„... wir haben die ganze Nacht geredet. Über die Zukunft unserer Stadt. Unsere alten Fürstentümer südlich der Wüste Gory und über sein Land, das Land der Nehataner. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Feldmarschall Mixtli möchte keinen Krieg. Er möchte eine Stellung, die seinesgleichen würdig ist. Und wir haben ihm ein Angebot gemacht, ich habe ihm ein Angebot gemacht!“
Unruhiges Gemurmel ging durch die Reihen. Keiner wusste so richtig auf was Hauptmann Lelex hinauswollte.
„Mixtli, Feldmarschall der Nehataner, wird uns im Kampf gegen die nachrückenden Truppen unterstützen. Gegen König Atlacoya und dessen Bruder Chantico. Auch er hat die Bevormundung durch einen König satt. In dem Fall seinem König!“
Die Bevölkerung von Lios sprach wild durcheinander. Man diskutierte darüber, was der Hauptmann vorhatte.
„Ruhe!“, herrschte Lelex und wartet ab. Dann sprach er weiter. „Ich habe ihm ein Angebot gemacht.“ Er winkte von links eine Frau heran und ein erstauntes Raunen ging durch die Reihen. Dann sprach er weiter. „Das hier ist Rhea. Die Tochter unseres verstorbenen Fürsten Roloxs. Sie ist bereit Mixtli zu ehelichen!“
Die Stimmen unter den Bürgerinnen und Bürgern wurden wieder lauter.
„Ruhe!“, meinte Lelex erneut. „Es ist unsere Chance. Mixtli wird an der Seite von Rhea Fürst von Lios. Im Gegenzug hilft er uns nicht nur im Kampf gegen die nachrückenden Nehataner, sondern auch im Kampf für die Unabhängigkeit unserer beiden Fürstentümer gegen den König der Pravin. Wir werden ein neues Königreich erschaffen!“
Die Menge war erstaunt über die Worte. Man redete durcheinander, tuschelte. Nicht alle waren Feinde des Königs. Aber ein großer Teil der Bevölkerung wünschte sich tatsächlich die beiden Fürstentümer Lios und Laros zurück.
„Ihr traut ihm? Ihr traut einem Nehataner?“, rief einer aus den vorderen Reihen.
Lelex nicke. „Ja, das tue ich. Und wir werden ihn hier an Ort und Stelle mit Rhea vermählen.“
„Ihr habt recht!“, rief einer von den Bürgern. „Früher war alles besser. Die alten Fürstentümer würden uns guttun!“
Und ein anderer ging auf die Feinde ein. „Wir haben keine Chance gegen die Nehataner. Sie sind zu viele. Wenn der Feldmarschall sich mit uns verbündet, wäre das ein Gewinn für uns!“
Lelex hob die Hand. „Und genau deshalb wäre eine Vermählung mit der einzigen Erbin von Fürst Roloxs für alle ein Gewinn! Und deshalb soll es so sein. Wir werden hier an Ort und Stelle Mixtli mit Rhea vermählen. Möge es zum Wohle unseres Landes sein!“
Mixtli war zufrieden. Er war nun Fürst des Fürstentums Lios und damit natürlich nicht mehr Feldmarschall der nehatanischen Armee. Er wusste, dass es schwer werden würde gegen die nun angreifenden Truppenteile zu bestehen. Aber Chantico hatte nicht wirklich viel Erfahrung mit militärischer Strategie und im Grunde war er ohne ihn, den ehemaligen Feldmarschall, hilflos. Doch der Bruder von König Atlacoya war zweifelsohne auch nicht dumm. Er würde nicht unüberlegt angreifen. Spätestens wenn er begreifen würde, dass Mixtli die Flagge gewechselt hatte, würde er besonnen nachdenken und sich erst einmal sammeln. Aber es würde ohnehin noch eine Weile dauern, bis Chantico Lios erreichte.
„Was schlagt Ihr für die Verteidigung der Stadt, der Verteidigung Eurer Stadt, vor?“, fragte Lelex.
„Nun. Wir haben noch Zeit. Aber ich denke, dass Chantico die Stadt so lange wie möglich belagern wird. Er wird nicht sofort angreifen. Also würde ich vorschlagen, dass Ihr die nächsten Tage möglichst viele Vorräte hortet. Zieht in der Stadt alles zusammen was geht. Seine Taktik wird eher darauf beruhen, dass er uns aushungern und zur Aufgabe zwingen will!“
„Seid Ihr Euch da sicher?“
„Ja, bin ich. Wenn Ihr Chantico kennen würdet, dann würdet Ihr es verstehen. Er hat niemanden, der ihn wirklich zu einem tatsächlichen Angriff überreden kann. Und er selbst wird mehr Angst davor haben zu versagen. Also bleibt ihm vor allem die Methode einer langen Belagerung.“
„Also gut! Ich werde die Kornspeicher füllen lassen. Auch durch die Ernten der Dörfer in der Umgebung!“
„Das ist ein wichtiger Schritt!“, meinte Mixtli.
„Wie gefällt Euch Eure Frau?“, fragte Lelex plötzlich.
Mixtli nickte. „Gut!“
„Gut?“, fragte der Hauptmann überrascht. „Sie ist eine Augenweide, findet Ihr nicht?“
„Ja, ist sie!“, murmelte Mixtli. Sie war tatsächlich äußerst hübsch. Aber er bevorzugte nun mal etwas Anderes. Und er hatte es auch schon im Blick. Sein zukünftiges Opfer. Ein junges Pravin-Mädchen. Das seit kurzem ausgerechnet bei seiner Ehefrau angestellt war. Es war bei den Pravin durchaus üblich, dass Eltern ihre Kinder für eine Zeit zu höheren Herrschaften schickten und dafür Geld bekamen.
„Nun!“, meinte Lelex. „Ich werde dann mal Eure Männer in die Regeln unserer Armee einweisen!“
„Tut das!“, murmelte Mixtli und starrte auf das kleine Mädchen, das gerade Wasser aus einem Brunnen holte. Ja, das war es, was er begehrte. Ein hübsches, kleines Ding. Noch so unschuldig.
4
Lios
Tlaloc hatte sich das alles anders vorgestellt. Er, der Kompaniechef einer berittenen Einheit der Nehataner, war plötzlich Söldner der Pravin. Dass er gezwungen war nun auf der Seite des Feindes zu kämpfen war ihm nicht recht. Aber was sollte er tun? Mixtli würde ihn vermutlich ansonsten einsperren lassen. Dabei war er so stolz gewesen es in der nehatanischen Armee so weit gebracht zu haben.
Er fand es ungeheuerlich, dass sich Mixtli auf die Seite der Pravin gesellt hatte. Für Tlaloc war er ein Vaterlandsverräter. Ein Fahnenflüchtiger, der vor allem eines verdient hatte. den Tod. Dennoch schwieg der junge Kompaniechef, der im Übrigen auch weiterhin die Kompanie führen sollte. Das hatte Lelex, der Chef der pravinischen Garnison in Lios so entschieden. Gemeinsam mit Mixtli, dem neuen Fürsten von Lios.
„Bei allem Respekt, Kompaniechef!“, sagte einer der Unteroffiziere. „Wir können doch nicht diese Stadt gegen unsere eigenen Landsmänner verteidigen!“
„Seid still. Oder wollt Ihr hingerichtet werden?“, fragte Tlaloc.
Der Unteroffizier schüttelte den Kopf. „Natürlich will ich das nicht. Aber ich sterbe lieber als mich gegen unseren Feldherren Chantico zu stellen!“
„Ich bin deiner Meinung!“, sagte der Kompaniechef. „Aber wir sollten nun vor allem Ruhe bewahren. Und der Dinge ausharren, die da kommen. Tot bringen wir auch Chantico nichts. Vor allem aber wissen wir nicht, wem unserer eigenen Männer wir nun trauen können!“
„Die Männer stehen hinter Euch!“, sagte der Unteroffizier.
„Nun. Vor ein paar Tagen hätte ich genau diese Worte auch dem Feldmarschall gesagt!“
„Sie stehen vor allem hinter dem König! Und hinter Nehats!“
„Wir sollten vorsichtig sein. Wir sind hier in einer fremden Stadt und ... nun ja. Man wird uns hinrichten, wenn man Zweifel hat, dass wir hinter dem selbsternannten Fürsten Mixtli stehen!“
„Wir sollten uns aus der Stadt schleichen. So mit zwei Mann. Und die nachfolgenden Truppen warnen!“
Tlaloc nickte. „Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber leicht wird das nicht!“
„Ich weiß!“, murmelte der Unteroffizier. „Und ich kann mir vorstellen, dass es für Euch nicht leicht ist. Ihr seid im Grunde selbst nur ein Unteroffizier. Aber Ihr seid nicht einfach so zum Kompaniechef ernannt worden. Ihr seid ein guter Führer!“
Tlaloc nickte. „Habt Ihr Freiwillige?“
„Haben wir!“
„Dann holt sie!“, erwiderte er.
Was wiegt höher? Die Treue zu König und Vaterland, für das du eigentlich kämpfst oder aber zu deinem militärischen Führer? Nicht allzu viele Soldaten müssen eine derartige Entscheidung treffen, aber es kommt vor. Immer dann, wenn sich das Militär an einem Punkt befindet, an dem es andere Wege gehen will als die politische Führung. Sei es um gegen die korrupte Art der Politik vorzugehen und das Land von einem Tyrannen zu befreien, Rechte durchzusetzen oder das politische System zu kippen oder eben aus eigennützigen, selbstsüchtigen Gründen. Auch bei den Mani hatte man aktuell das Problem mit Herzog Olaf von Meraton. Allerdings wussten viele Soldaten gar nicht, um was es wirklich gegangen war. Sie glaubten dem militärischen Führer und man kann ihnen es nicht einmal vorwerfen. Es ist keine blinde Treue, die daran schuld war, sondern die geschickte Manipulation durch den Herzog.
Im Lande der Pravin war Tlaloc, der Kompaniechef der nehatanischen Truppenteile, ebenfalls an so einem Punkt. Allerdings war die Sache anders. Mixtli, der ehemalige Feldmarschall der nehatanischen Armee, hatte sich gar mit seiner gesamten verfügbaren Einheit den Pravin unterworfen. Er war einen Pakt eingegangen. Das Ziel war der Aufbau eines neuen Staates und damit sowohl der Widerstand gegen die Nehataner als auch gegen den Rest der Pravin. Zwei Fürstentümer, die es bereits einmal gegeben hatte, wollte man wiederaufleben lassen. Man musste das natürlich differenziert sehen. Für die Pravin, die sich gegen ihren König auflehnten, war es leichter dies zu rechtfertigen. Sie wollten nur das zurück, was man ihnen genommen hatte. Die Zeit bevor der König in allen Städten der Pravin Stadthalter eingesetzt hatte. Sie wollten ihre alte Ordnung zurück. Mixtli hingegen sah nur seinen eigenen Vorteil. Er, der nun der Fürst von Lios war, hatte keine höherwertigen politischen oder militärischen Ziele. Er sah nur die Macht. Und Tlaloc kämpfte in keiner Weise mit seinem Gewissen. Er wusste, dass das Unrecht war und er stellte sich, zumindest innerlich, bereits gegen Mixtli. Und den Männern ging es ähnlich. Keiner wollte gegen die eigene Armee kämpfen.
Es dauerte gut eine halbe Stunde. Dann standen die Freiwilligen vor ihm. Tlaloc saß stumm am Tisch und schaute die fünf Männer an, die sich bereit erklärt hatten die Truppen von Chantico zu warnen. Es war nicht klar, ob ihnen die Flucht gelingen würde, denn die Pravin waren natürlich darauf bedacht, dass kein Soldat der Nehataner die Stadt verließ.
Dann jedoch brach Tlaloc das Schweigen. „Ihr tut das Richtige, Soldaten!“
Einer der Männer nickte. „Es ist unsere Pflicht!“
„Ja, das ist es“, sagte Tlaloc. „Weil wir auf König und Vaterland unseren Schwur geleistet haben. Nicht auf einen Feldmarschall! Dennoch kann ich von niemandem erwarten diese gefährliche Mission zu beginnen!“
„Natürlich könnt Ihr!“, erwiderte einer der Soldaten. „Weil Ihr im Auftrag des Königs befehlt. Mixtli hingegen ...“
Tlaloc unterbrach ihn. „Ich möchte diesen Namen gar nicht hören. Und nun geht. Wir haben nur diese eine Chance. Ein letztes Mal werden Männer losgehen um die letzten Ernten in den umliegenden Höfen zur Stadt zu bringen. Mischt euch unter die Arbeiter. Und dann, wenn sich die Gelegenheit gibt, verschwindet ihr. Ich hätte euch ja gerne heute Nacht losgeschickt. Im Schutze der Dunkelheit. Aber die Chance dann die Stadt zu verlassen ist geringer. Die Tore werden gut bewacht.“
„Wir werden unser Bestes tun!“, sagte der verantwortliche Gruppenführer und schaute dann jeden seiner Männer an. „Zieht euch um. Bald geht es los!“
Die Sonne knallte unaufhörlich auf den großen Hof des fürstlichen Hauses von Lios. Mixtli hatte sich ein Schattenplätzchen ausgesucht und es sich dort mit Wein gemütlich gemacht. Vielleicht würde er irgendwann einmal die Aufgabe als militärischer Führer vermissen. Aber im Moment genoss er sein Leben, so wie es war. Vor allem aber genoss er den Anblick des jungen Mädchens, das neben ihm stand. In der Hand ein Krug Wein, um jederzeit bereit zu sein ihm nachzuschenken. Mixtli wusste, dass er sie früher zur Frau machen würde, als es die Natur vorgesehen hatte. Noch nicht jetzt. Er wusste nicht, wie die Pravin auf seine Neigung reagieren würden. Und er wollte sich hier keine Chancen verbauen.
„Herr!“, riss ihn plötzlich eine Stimme aus den Gedanken. Er drehte sich um und sah einen Burschen.
„Was gibt es?“, fragte Mixtli genervt.
„Hauptmann Lelex möchte Euch sehen. Es geht um einige Nehataner. Sie versuchten zu fliehen!“
„Zu fliehen?“, fragte er überrascht. „Fahnenflüchtige?“ Das Wort ging ihm relativ leicht über die Lippen in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich er der Fahnenflüchtige war und er seine Männer praktisch zur Fahnenflucht gezwungen hatte.
„Schaut es Euch selbst an. Der Hauptmann hält sie gefangen!“
Keine halbe Stunde später war Mixtli in den Kerkerräumen der Stadt Lios. Für ihn war die Lage klar. Die Männer hatten nicht nur fliehen wollen, sondern wollten auch Chantico warnen.
Hauptmann Lelex, Führer der Garnison in Lios, ging an den drei Männern vorbei. Alle drei waren kräftige, dunkelhäutige Nehataner. Im Zweikampf waren sie alle im Grunde jedem Pravin überlegen. Aber nun knieten sie auf dem kalten Boden des Kerkers, den Blick gesenkt.
„Sie verdienen den Tod!“, sagte Mixtli.
Lelex blieb stumm. Er wusste, dass er sie hängen musste um die anderen Nehataner in Schach zu halten. Um ihnen zu zeigen wer hier das Sagen hatte. Aber er wusste auch, dass es für die Soldaten des Nachbarlandes nicht einfach war. Und er hatte längst erkannt, dass die Loyalität der nehatanischen Kriegern mehr ihrem Land und ihrem König galt als ihrem Feldmarschall. Vielleicht war es besser sie alle einzusperren. Vor allem aber wusste er, dass er einen entscheidenden Fehler gemacht hatte. Die Soldaten hatten nichts von ihrem Verrat. Lediglich Mixtli profitierte davon. Die Männer hingegen kämpften plötzlich ohne Grund auf der anderen Seite. Zumindest sollten sie das.
„Was ist nun?“, fragte Mixtli ungeduldig.
Die Härte, die der ehemalige Feldmarschall gegenüber seinen Männern ausstrahlte, erschreckte Lelex. Aber er hatte diesen Pfad betreten und musste ihn nun auch weitergehen. Deshalb nickte er. „Ja, wir werden sie hängen lassen. Heute noch. Auf dem großen Platz. Alle sollen es sehen!“
„Gut!“, sagte Mixtli und schaute sich jeden der Männer genau an. „Ihr sollt dafür büßen, dass Ihr mich verraten habt!“
„Es ist kein Verrat einen Verräter zu verraten“, sagte einer der Männer und spuckte verächtlich aus.
Mixtli gab ihm eine Ohrfeige. So stark, dass der Mann nach hinten stürzte. „Bevor ihr sie umbringt, foltert sie. Ich will wissen, ob es noch mehr Verräter gibt!“
5
Hingston
König Leopold hatte nur einen Wunsch. Endlich aufstehen zu können, sprechen zu können, selbst essen zu können und vor allem selbst auf die Toilette gehen zu können. Es war erniedrigend. Er war nicht in der Lage auch nur einen Finger zu rühren. Er konnte jedoch froh sein, dass die Lähmung seines Körpers bestimmte Tätigkeiten nicht einschränkte. So zum Beispiel der Schluckreflex. Sonst wäre er längst verhungert.
Für ihn war es ein Lichtblick, dass es seine eigene Tochter war, die ihm den Brei aus klein zerhacktem Fleisch und Gemüse in den Mund schob. Löffel für Löffel schob sie das Mus in seinen Rachen. Man musste vorsichtig vorgehen, denn es gab insgesamt zwei Reflexe, die dicht beieinanderlagen. Der Schluckreflex und der Würgereflex.
„Die Wahl für das Götteropfer!“, meinte Katharina. „Sie steht bald bevor. Es sind nur noch wenige Tage. Ende dieser Woche ist es soweit! Und viele denken, dass ich gewinnen werde!“
„Ja, das wirst du!“, dachte sich König Leopold. „Weil du die Schönste und Bezauberndste bist, die man sich vorstellen kann!“
„Ich wünsche mir so sehr, dass du wieder gesund wirst, bevor ich irgendeine Reise antreten muss!“, sagte die Prinzessin weiter. In der Hoffnung, dass ihr Vater sie hörte. „Ich würde dich gerne noch einmal in den Arm nehmen. Ich möchte, dass du mich drückst!“
„Er versteht Euch!“, sagte plötzlich der Arzt, der die ganze Zeit danebengestanden war. „Bei den Göttern, er versteht Euch, Prinzessin. Seht!“
„Was meint Ihr?“, fragte Katharina überrascht. Aber dann sah sie es auch. Eine Träne rann an der Wange ihres Vaters entlang.
„Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist!“, sagte der Medicus aufgeregt. Für ihn war es das klare Zeichen dafür, dass der König jedes Wort verstand. „Ihr wisst, königliche Hoheit, was das heißen würde? Das er jedes Wort versteht!“
„Ja, tu ich, verdammt!“, dachte sich König Leopold. „Schon die ganze Zeit. Und deshalb weiß ich auch was Lord Christoph dir angetan hat. Ich kenne die Wahrheit!“
„Was soll ich tun?“, fragte Katharina.
„Sprecht mit ihm weiter. Sprecht ihm Hoffnung zu. Lasst ihn wissen, dass Ihr in liebt!“, meinte der Medicus. „Ich muss gehen und den Offizieren das berichten!“
„Nein!“, meinte Katharina leise.
„Was?“, der Arzt schaute sie verwundert an.
„Wir vertrauen niemanden!“, sagte die Prinzessin. „Behaltet es für Euch, Medicus. Nicht einmal meine Mutter darf es erfahren!“
„Aber ...“
„Kein aber!“, Katharina sprach nun mit gefestigter Stimme und klaren Worten. „Ihr müsst es mir schwören.“
„Tapferes Mädchen!“, dachte sich König Leopold. Er war stolz auf sie. Es war die richtige Entscheidung. „Vertraue niemandem, Katharina. Niemandem. Vor allem nicht deiner Mutter!“
6
Meraton
„Holt die Segel ein!“, rief der Kapitän des noatischen Handelsschiff laut und deutlich.
Das war sie also, die große Stadt Meraton. Herzogtum von Herzog Olaf von Meraton, dem Vater der Königin. Hedda schaute über die Reling. Sie hatte sich ihre Kapuze weit ins Gesicht gezogen, da es windig war. Außerdem regnete es. Dunkle Wolken standen auch über dem Festland.
„Warst du schon mal bei den Mani?“, fragte Hedda die Noatin Ailsa.
Diese schüttelte den Kopf. „Nein. War ich nicht.“
„Aber du hast schon welche gesehen?“
„Sie sind uns Noaten ganz ähnlich. Nicht ganz so kräftig und so wild!“, grinste die junge Noatin. „Aber es soll ein intelligentes Volk sein!“
„Nun ja, was ist schon intelligent ...“, murmelte Hedda und hielt sich dann an der Reling fest. Das Schiff drehte bei um direkt in den Hafen einzulaufen.
„Bist du aufgeregt?“, fragte die Noatin.
„Warum fragst du?“
„Nun ja, weil du vermutlich immer aufgeregt bist, wenn etwas Neues auf dich zukommt!“
„Ist das nicht verständlich?“
„Die Mutigste bist du nicht!“, grinste Ailsa.
„Kann nicht jeder so sein wie du!“, meinte Hedda ein wenig beleidigt.
„Tu mir einen Gefallen! Wenn dir jemand etwas zum Trinken anbietet, dann lehne ab!“
Hedda nickte. „Ja. Das werde ich.“
Das Volk der Noaten war ein geschicktes Seefahrervolk. Und das bewies der Kapitän durch sein Einlaufen in den Hafen. Präzise steuerte die Backbordseite direkt an die Anlegestelle. Das war gar nicht so einfach. Man musste Fahrt herausnehmen und im richtigen Augenblick eindrehen.
„Willkommen in Meraton!“, meinte eine in etwa dreißigjährige Frau, als die Passagiere des Schiffes von Bord gingen. Sie sprach direkt Königin Varuna an.
„Ihr seid?“, fragte die Königin der Ragni. Der Priester und ihr Kommandeur stellten sich neben sie. Und schließlich kam auch Sören von Bord. Der noatische Krieger, der zum Schutz von Ailsa die Reisetruppe begleitete, baute sich vor der manischen Frau auf. „Du bist Elli, richtig?“
Die Angesprochene nickte. „Und du Sören, der beste Krieger der Noaten!“
Sören grinste und schaute dann zu Königin Varuna. „Königliche Hoheit. Das ist Elli. Sie ist für die Handelsbeziehungen zwischen uns Noaten und den Mani zuständig. Eine schlitzohrige Frau, die uns oft übers Ohr hauen will!“
„Nun. Heute bin ich aus anderen Gründen hier!“, meinte Elli. „Herzog Olaf ist leider nicht in der Stadt. Ich soll Euch empfangen und im Land der Mani willkommen heißen! Ihr wart noch nie in Manis, königliche Hoheit?“
Varuna schüttelte den Kopf. „Nein!“
„Ich weiß, dass Ihr enge Beziehungen zu Ludwig von Battleton haltet!“, sagte Elli. „Ich dachte eigentlich, dass er mit Euch kommen würde? War er nicht in Ragnas?“
„Doch, war er“, sagte die Königin. „Aber als wir aufbrachen, war er noch im Ewigen Eis unterwegs ...“
Man sah Elli an, dass sie nachfragen wollte, was er dort tat. Aber sie unterdrückte ihre Wissbegierde. „Ihr wollt morgen sicherlich schon weiter Richtung Süden?“
Sören wartete nicht ab, bis die Königin antwortete. „Das ist richtig! So früh wie möglich!“
„Gut. Ihr bekommt eine Unterkunft. Ruht euch aus von den Strapazen auf dem Meer. Aber zuvor, königliche Hoheit, stelle ich Euch Euren Führer vor. Er wird euch über die Berge bringen!“ Sie ging voraus und die Königin folgte.
„Was ist mit dir?“, fragte Ailsa. „Wir sind wieder auf festem Boden. Aber du machst ein Gesicht, als hättest du ein Seeungeheuer gesehen!“
„Es ist nichts!“, sagte Hedda schnell und folgte dann der Gruppe. Es war der Name „Ludwig von Battleton“, der ihr Erinnerungen zurückbrachte. Vielleicht sollte sie es Ailsa erzählen. Mit irgendjemand musste sie ja irgendwann einmal darüber sprechen. Die Erinnerung lag unverarbeitet in ihrem Kopf.
Es war ein kleines Haus am Rande der Stadt in einem eher ärmlichen Viertel. Königin Varuna verstand nicht so Recht, was das hier sollte. Aber Elli hatte sie direkt hierhergeführt. Sie, die Königin der Ragni, ihre beiden Begleiter, den Kommandeur und den Priester der Ragni, den Krieger Sören und nicht zuletzt die beiden Götteropfer, Hedda und Ailsa.
Elli klopfte an die Türe des Hauses. Es dauerte ein wenig, bis ein weißhaariger Mann öffnete. Er war schon etwas älter. Sein Haar stand wirr zu Berge und sein zerzauster Bart wirkte wie Unkraut in seinem Gesicht. Er war lückenhaft und wirkte ungepflegt.
„Gustav. Darf ich dir Varuna, die Königin der Ragni, vorstellen?“
Der Angesprochene nickte. „Sicher darfst du das. Lass uns einen Termin machen und ...“
„Sie steht bereits vor dir!“, murmelte Elli.
„Bei den Göttern!“, sagte Gustav und ging auf Ailsa zu. „Aber sie sieht gar nicht aus wie eine Ragni.“
„Das ist auch Ailsa. Das Götteropfer der Noaten!“, sagte Elli und zeigte nun auf die Königin. „Hier ist sie. Königin Varuna!“
„Oh ...!“, meinte Gustav irritiert. „Nun denn ... willkommen, königliche Hoheit!
„Was wird das hier?“, fragte die Königin irritiert.
„Nun, er wird Euer Führer sein!“, erklärte Elli. „Er führt Euch sicher über die Berge!“
„Ich werde was?“, fragte Gustav überrascht.
„Du wirst die Königin und ihr Gefolge nach Hingston bringen. Wir haben das doch besprochen!“
„Moment!“, meinte Sören. „Es mag sein, dass die drei Bleichgesichter zum Gefolge der Königin gehören. Meine Königin ist sie jedoch nicht. Genauso wenig wie sie die Königin von unserem Götteropfer Ailsa ist! Wir sind Noaten!“
„Ernsthaft?“, fragte Elli. „Ihr wollt jetzt in diesem Augenblick den stolzen und unabhängigen Noaten raushängen lassen?“
„Wir haben alle das gleiche Ziel, aber nicht den gleichen König und ...“
„Genug!“, unterbrach die Königin den blonden Krieger barsch. „Wir haben dich verstanden, Krieger!“
„Mir ist es egal, wen ich führen soll“, murmelte Gustav. „Welchem König oder Gott Ihr auch folgt. Wenn es über die Berge geht, dann folgt Ihr mir. Lass mein Rosie vorbereiten! Ich werde packen!“
„Rosie?“
„Ja sicher, mein Pferd. Mein treuer Weggefährte!“
„Nun, Rosie ist tot!“, sagte Elli.
„Was? Bei den Göttern!“. sagte Gustav entsetzt. „Das sind keine guten Nachrichten!“
„Nun. Rosie ist seit gut fünf Jahren tot!“, Elli verzog das Gesicht.
„Das ist eine lange Zeit!“, murmelte Gustav. „Warum hat man mich nicht informiert?“
„Du hast sie selbst getötet!“
„Bei den Göttern. Was redest du?“
Elli nickte. „Sie hat sich das Bein gebrochen. Und du gabst ihr den Gnadenstoß. Ich war dabei!“
„Nun gut, dann besorgt mir ein anderes Pferd. Eines das genauso gut ist, wie sie es war. Meine treue Seele!“, meinte Gustav und schlug dann die Hände ins Gesicht. „Heute ist wirklich ein trauriger Tag. Der Verlust geht mir nahe!“ Dann ging er zurück ins Haus.
Ailsa starrte auf die Türe, die sich hinter Gustav schloss. „Okay ... er ist irgendwie ...“
„Verrückt?“, fragte Elli. „Ja, das ist er.“