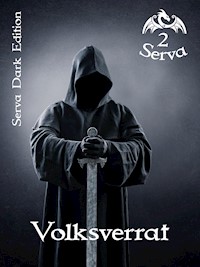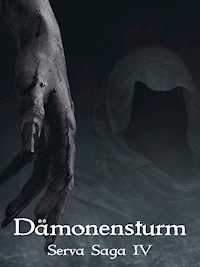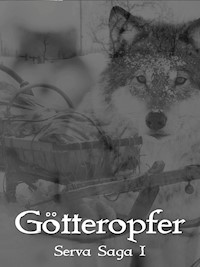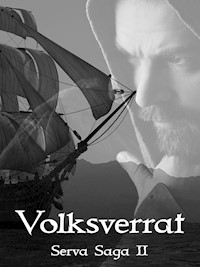
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Serva Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Götteropfer aus dem hohen Norden sind unterwegs. Überall in der Welt von Ariton kündigen sich die ersten Unruhen an. Kriege werden geführt. Und unheimliche Mächte kommen aus ihren Verstecken. Die Zeitenwende kündigt sich an. Nur die Götteropfer können das Unheil aufhalten. Doch zu welchem Preis? Die Serva Saga von Arik Steen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Der 8. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 9. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 10. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 11. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 12. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 13. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 14. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Impressum
Hinweis
Für die Serva Saga und die Serva Chroniken gibt es ein umfangreiches Nachschlagewerk unter https://www.serva-wiki.de. Hier findest du wichtige Informationen rund um die Welt von Ariton, eine Übersicht über wichtige Charaktere, über die Völker, die Städte und vieles mehr.
Der 8. Tag
1
Laros
Wenn du immer nur Frieden gekannt hast, dann kannst du dir den Krieg nicht vorstellen. Er ist nun mal nicht nur der Kampf zwischen Soldaten, was schon schlimm ist, sondern es steckt viel mehr dahinter. Mit ihm geht Gewalt und Terror einher. Krieg ist wie eine Krankheit, die dein Immunsystem lahmlegt und dafür sorgt, dass noch viele andere Krankheiten eine Angriffsfläche finden. Vergewaltigung, Mord, Unterdrückung, Plünderungen und vieles mehr. Krieg ist eine Seuche. Sie vergiftet die Herzen und das Land.
Der Hauptmann der Garnison in Laros starrte in Richtung Anhöhe. Gemeinsam mit einem Unteroffizier stand er auf dem einzigen Wachturm.
Dort oben vermutete er den Feind. Noch hatte er sich nicht in Stellung gebracht. Aber es war nur eine Frage der Zeit. Und dann würde Laros überrannt werden.
Seine Familie war längst weg. Er war nicht verheiratet, aber er hatte Eltern, eine Tante und einen Bruder. Sie waren schon los. Aufgebrochen Richtung Norden. Er würde sie nie wiedersehen, dessen war er sich bewusst. Er, der Befehlshaber der Truppen in Laros, würde heute sterben.
„Wir haben das Problem, dass nicht alle gehen wollen!“, meinte der Unteroffizier.
Der Hauptmann der Garnison schaute seinen Untergebenen irritiert an. „Was? Aber ... wir werden förmlich überrannt werden! Das muss allen klar sein!“
„Manche wissen das. Andere wollen es nicht wahrhaben. Unsere Stadt ist in einem Ausnahmezustand! Ich kann sie ja wohl schwer mit Peitschen aus den Häusern treiben!“
Der Hauptmann drehte sich um und blickte über die Dächer von Laros. Vor seinem inneren Auge sah er die Häuser bereits in Flammen aufgehen. Die Nehataner waren ein grausames Volk. Ja, es gab überall Gute und Böse. Aber das Volk der Nehataner hatte eine grausame Seele, die ihren König widerspiegelte. Und nun zog das Böse wie eine dunkle Wolke über Pravin.
Er konnte nichts tun. Wer in seinem Haus bleiben wollte, der musste eben mit dem Schicksal zurechtkommen. Er musste damit rechnen getötet oder versklavt zu werden. Vermutlich war Ersteres deutlich angenehmer.
Der Blick des Hauptmanns ging zum Stadtrand, wo seine eigenen Einheiten Stellung bezogen. Zweihundert Mann befehligte er hier. Ängstliche Männer, die den Tod vor Augen hatten. Ihre Familien mussten sie ziehen lassen. Die konnten vorerst noch fliehen. Sie selbst aber würden sich dem Feind entgegenstellen müssen. Und der Hauptmann wusste, dass sich in jedem dieser Soldaten innerlich die Hölle offenbarte.
Der Hauptmann starrte nun Richtung Norden. Direkt in die Stadt. Einige Bürger schienen es sich überlegt zu haben und flohen nun doch. Andere verbarrikadierten ihre Häuser. Als ob das irgendetwas brachte. Das war kein Sturm, der hier auf sie zukam, sondern eine mordende Horde von Männern. Und sie würden keine Gnade finden. Das einzige Sinnvolle für jeden Bürger war die Flucht. Er würde mit seinen Soldaten versuchen Zeit zu schinden. Selbst wenn sie kaum eine Chance hatten und es ein kurzer Kampf werden würde, so würde es doch den Angriffsschwung massiv eindämmen. Die Nehataner würden hier in der Stadt nicht nur ihren Sieg feiern, sondern auch ihre Wunden lecken.
„Steh uns bei, Regnator. Gott der Götter. In dieser schweren Stunde und an diesem finsteren Tag!“, murmelte er. „Bellumus, du Gott des Krieges. Gib meinen Männern die Kraft und den Mut sich dem Feind entgegenzustellen!“
„Von wo aus werden sie angreifen!“, meinte der Unteroffizier und unterbrach die Worte des Hauptmanns, die an die Götter gerichtet waren.
„Was?“, fragte der Befehlshaber der Garnison.
„Von wo werden sie angreifen?“
„Sicherlich vom Hügel aus!“, murmelte der Hauptmann. „Lasst die Schützen auf den Dächern Stellung beziehen. Aber so, dass sie möglichst nicht gesehen werden! Sie sollen sich bedeckt halten und erst zum Vorschein treten, wenn wir es befehlen!“
„Gut!“, sagte der Unteroffizier.
Es war vollkommen egal, ob Chantico als Feldherr erfolgreich den Küstenstreifen der Pravin einnehmen würde oder nicht. Sein Bruder würde in ihm niemals mehr sehen als ein Werkzeug. Sobald die Pravin südlich der großen Wüste besiegt waren, würde er weiterziehen müssen. Richtung Shivas. Und irgendwann würde er dort den Tod finden. Die Nehataner hatten keine Chance gegen die Shiva im Norden. Nicht einmal die Geringste. Er schaute Richtung Norden, wo man zahlreiche Menschen sah, die Laros verließen.
„Sie fliehen. Sie fliehen wie Lämmer vor den Wölfen!“, grinste Mixtli. „Das wird ein großartiger Sieg und stärkt die Moral der Truppe!“
Chantico nickte stumm. Ja, sie würden die Garnison der Stadt besiegen. Vermutlich ohne Probleme. Aber das, was dann kam, dass machte Chantico Angst. In der Zwischenzeit bereute er, dass er sich zum Feldherrn hatte machen lassen.
„Ihr sagt gar nichts, Feldherr?“, fragte Mixtli.
„Glaubt Ihr ernsthaft, dass das ein großer Sieg werden wird“?“, fragte Chantico.
Mixtli grinste noch immer. „Natürlich nicht. Aber ein Sieg ist ein Sieg.“
„Wie sieht unsere Strategie aus?“, der Feldherr ließ seinen Blick über die Stadt unter sich schweifen. Er wusste, dass er der Oberbefehlshaber war, aber im Grunde sein Feldmarschall derjenige war, der die Entscheidungen traf. Allerdings waren beide nicht kriegserfahren. Und für beide war es schwer einzuschätzen, welche Möglichkeiten es gab.
Mixtli zeigte auf die verteidigenden Truppen, die langsam, aber sicher, Stellung bezogen. Es waren in etwa einhundertfünfzig Schwertkämpfer.
„Wir marschieren mit fünf Kompanien von Schwertkämpfern auf. Und zwar unten durch das Tal. Sie sollen auf hundert Meter an den Feind ran und dann Stellung beziehen. Die Bogenschützen rücken nach. Dann beginnen wir die ersten Salven abzufeuern. Das wird den Feind auseinandertreiben. Sobald Chaos ausgebrochen ist, rücken die Schwertkämpfer vor und machen kurzen Prozess.
„Warum gleich fünf Kompanien? Das sind fünfhundert Schwertkämpfer gegenüber einhundertfünfzig auf der Seite der Pravin!“
„Feldherr. Wir müssen als Angreifer ein größeres Verhältnis haben.“
„Aber fünfhundert Mann?“, fragte Chantico. Er zweifelte, aber meinte dann doch. „Ihr habt recht. Wir machen es so.“ Er wusste, dass es keinen Sinn machte zu diskutieren. Sie waren im Krieg. Er fühlte sich wie ein Schuljunge an seinem ersten Schultag.
„Von wo aus wollt Ihr führen?“, fragte Mixtli.
„Können wir nicht von hier oben aus das Schlachtfeld im Blick behalten?“, fragte Chantico. Und wieder hörte es sich an, als wäre er ein kleiner Junge.
„Wie feige wäre das?“, fragte Mixtli. „Nein. Wir sollten direkt hinter den Schwertkämpfern stehen. Zu Pferde!“
Chantico nickte. „In Ordnung!“ Er hatte keine eigene Meinung. Aber im Grunde verstand er nicht, warum Mixtli nicht die sichere Anhöhe nutzte.
„Jara, komm her!“, befahl Mixtli.
Das junge Mädchen aus der ersten Siedlung, die sie eingenommen hatten, war gut zehn Meter hinter ihm gestanden. Sie hatte dort mit dem Pferd des Feldmarschalls gewartet. Ihre wohl einzige sinnvolle Bezugsperson. Immer wieder streichelte sie das Fell des Tieres. Ein Pferd, das dem wohl schlechtesten Mann gehörte, den sie kannte. Sie gehorchte und ging zu ihrem Herrn und Meister. „Mein Herr?“
„Seht Ihr, wie brav sie ist?“, grinste Mixtli in Richtung Chantico. Dann wand er sich an Jara. „Bring mir mein Pferd!“
Sie ging stumm wieder zurück zu dem schönen weißen Hengst.
„Was soll das mit der Kleinen?“, fragte Chantico. „Warum nehmen wir dieses Kind mit?“
„Weil sie mir gehört, Feldherr!“
„Ach ja? Sie gehört dem König!“
„Oh ...“, grinste der Feldmarschall. „Ich denke nicht, dass Euer Bruder etwas dagegen hat, wenn ich sie mir zu Willen mache. Sie ist mir eine wertvolle Hilfe!“
„Sie ist lästig wie ein Insekt!“, sagte Chantico. „Und sie stört nur!“
„Sie ist so süß. Ihr habt auch noch keine Kinder, oder?“
Der Feldherr schüttelte den Kopf. „Nein. Und wenn ich Kinder hätte, ich würde sie nie in Eure Nähe lassen!“
„Ach ja, ich vergaß. Ihr seid ja ein warmer Bruder. Im Bauch eines Schwulen wächst kein neues Leben ...“
„Fahrt zur Hölle!“, meinte Chantico und ging dann zu seinem Pferd.
2
Gunnarsheim,
Es war kein schöner Morgen in der nordischen Hauptstadt der Ragni. Dunkle Wolken zogen über das Land und in Bodennähe hatte sich dichter Nebel gebildet. Einzig und allein der weiße, reflektierende Schnee sorgte dafür, dass es nicht ganz so düster wirkte.
Hedda schaute hinaus in den Hof. Alle ihre Schlittenhunde waren dort nun untergebracht. Sie nickte zufrieden. „Ich danke Euch, meine Königin!“ Sie war froh, dass die Herrscherin ihr angeboten hatte die Hunde hier im Hof zurückzulassen.
„Ihnen wird es hier an nichts fehlen!“, meinte Varuna. „Mein Sohn wird sich um sie kümmern!“
Hedda nickte. Sie blickte auf den Jungen. Er war in etwa so alt, wie ihr Bruder bei seinem Tod gewesen war.
„Wie geht es nun weiter?“
„Das Schiff wird gerade vorbereitet. Wir segeln in Kürze los!“
„Ich war noch nie auf dem Meer, meine Königin!“
Varuna nickte. „Du wirst sehen. Es wird dir gefallen!“
„Wie lange werden wir unterwegs sein?“
„Zwei Tage, wenn der Wind günstig ist. Dann sind wir bei den Noaten.“
„Bei den Noaten?“
„Ein schreckliches Volk!“, murmelte die Königin. „Man nennt sie auch die Barbaren der Meere. Aber mit Schiffen können sie umgehen. Das muss man ihnen lassen!“
„Aber was wollt Ihr dort?“
„Nun!“, sagte die Königin. „Mit unseren Schiffen kommen wir nicht weit. Niemals so weit in den Süden. Also hoffe ich doch, dass die Noaten uns unterstützen!“
„Und wenn nicht?“
„Liebes. Du stellst zu viele Fragen!“, die Königin schmunzelte. Allerdings wusste sie, dass die Frage berechtigt war. Auch die Noaten mussten den Göttern ein Opfer bringen. Und sie hoffte, dass sie sich gemeinsam auf die Reise machen konnten. „Und nun geh hinunter. Verabschiede dich von deinen Hunden!“
„Werde ich sie wiedersehen?“, fragte Hedda ehrlich. Noch immer verstand sie nicht, wohin es ging und was ihr Auftrag war.
„Natürlich!“, meinte die Königin. Aber im Grunde wusste sie es nicht. Nicht einmal annähernd. Ihr war nicht einmal klar, ob Hedda dies alles überleben würde. Die Götter verlangten ein Opfer. Eine Jungfrau aus dem Volk. Was mit ihr geschehen würde, das wusste keiner. Nicht einmal die Priester, wenn Varuna es richtig verstanden hatte.
„Nun gut!“, nickte Hedda und ging dann vom Fenster weg. „Dann schaue ich mal nach meinen Hunden!“
Es hatte in der Nacht frisch geschneit. Es würde der letzte Schnee dieses Jahres werden. Hier im südlichsten Teil des nordischen Landes Ragnas schmolz der Schnee für einige wenige Monate. Eine große blühende Landschaft entstand deshalb nicht. Aber zumindest ermöglichte der kommende Sommer ein wenig neues Leben. Doch Hedda würde nicht da sein. Sie würde dieses Phänomen nicht erleben. Stattdessen würde sie weiter in den Süden fahren und Länder kennenlernen, die nicht einmal Schnee kannten. Länder, in denen es Hell und Dunkel gab. Tag und Nacht.
Sie stapfte durch den frischen Schnee.
„Hallo Hedda!“, grüßte der Prinz freundlich. „Sie sind toll, deine Hunde!“
Sie strich ihm über den Kopf. Es fiel ihr gar nicht so leicht mit ihm zu reden. Zu sehr erinnerte er sie an ihren Bruder. „Du wirst auf sie aufpassen?“
„Ja!“, er nickte. „Ich schwöre es bei den sieben Göttern und dem Allvater Regnator!“
„Gut!“, sagte sie und zeigte auf eine Hündin. „Sie ist ein wenig zickig!“
Er grinste. „Ich weiß!“
Ihr war es wichtig, dass es ihren Hunden gut ging. Vielleicht würde sie mit ihnen irgendwann einmal zurück nach Tornheim reisen und die Siedlung wiederaufbauen. Gab es Überlebende? Sie musste die Gedanken verdrängen.
Sie umarmte den Prinzen freundlich und ging dann zurück zur Burg.
„Hedda!“, hörte sie eine Stimme.
„Ja?“
Ein Mann mit weißem, wallendem Haupthaar ging auf sie zu. „Lass dich anschauen!“
„Wer seid Ihr?“
„Ich bin einer der Priester der Ragni!“, sagte er.
„Tut mir leid. Das wusste ich nicht!“, erwiderte sie und senkte den Blick.
„Ist schon gut!“, murmelte er. „Du bist also die Auserwählte. Du bist das Götteropfer. Die jungfräuliche Serva!“
Sie nickte stumm. So richtig verstand sie immer nicht, was ihre Aufgabe war, und sie erwartete.
„Du bist wunderschön. Die Königin hat recht!“
„Danke, ... Priester!“, erwiderte sie.
„Es wird eine lange Reise. Mögen die Götter dich beschützen!“, sagte er. „Mögen sie uns beschützen. Denn ich werde euch begleiten. Gemeinsam mit der Königin und dem Kommandeur unserer Streitkräfte!“
„Ich ... ich danke Euch!“
„Aber ich warne dich. Hüte dich vor der Königin. Ihre Ziele sind nicht immer gut. Wir wollen die Götter zufrieden stellen. Das hat Priorität. Vergiss das nie!“
„Werde ich nicht!“, murmelte sie. Allerdings wusste sie auch, dass die Königin ihre einzige Bezugsperson sein würde. Wieso sollte sie dann irgendetwas in Frage stellen? Zumal es ihre Königin war.
Eine gute Stunde später war es so weit.
Die Ragni hatten insgesamt nur zwei größere Schiffe. Einfache Einmaster, die nicht vergleichbar mit größeren Schiffen waren, wie sie andere Völker teilweise hatten. Es gab nicht einmal ein Unterdeck, was bedeutete, dass man Wind und Wetter erbarmungslos ausgesetzt war.
Die Ragni waren keine wirklich guten Schiffbauer. Doch für Reisen bis zu den Inseln der Noaten waren die Schiffe ausreichend.
Für Hedda, die noch nie ein Schiff gesehen hatte, war dieses Wassergefährt ein wahres Monstrum.
„Du wirst dich ganz vorne hinsetzen!“, sagte die Königin. „Nimm dir eine Decke und wickle dich damit ein. Es wird auf hoher See recht stürmisch!“
Hedda schaute auf die weiße Flagge mit der schwarzen Bärentatze. Das Wappen des Königs aller Ragni.
Die Besatzung bestand aus insgesamt zehn Mann. Acht Männer an den Rudern, ein Steuermann und ein Navigator. Zwischen den Männern konnten maximal zehn weitere Passagiere befördert werden.
Hedda betrachtete jeden einzelnen der Männer. Die hellhäutigen Ragni mit ihren schwarzen Haaren beachteten sie hingegen kaum. Sie, die Schönheit von Ragnas. Jeder war mit sich beschäftigt. Jeder richtete sich seinen Platz ein.
Hedda kletterte über die Reling ins Boot. Wie die Königin befohlen hatte, ging sie ganz nach vorne. Schon jetzt bewegte sich das Boot in den Wogen der Wellen. Hedda war augenblicklich klar, dass das kein Zuckerschlecken werden würde.
Für einen Moment starrte sie auf das offene Meer. Und damit gleichzeitig in eine ungewisse Zukunft. Durchaus auch mit Hoffnungen, die sie in sich trug. Sie wollte Tornheim hinter sich lassen. Ausgerechnet sie, die eigentlich nie das Ewige Eis hatte verlassen wollen. Aber nun hatte sich alles anders entwickelt. Aber auch mit Ängsten. Vielleicht mit mehr Ängsten statt Hoffnung. Weil es einfach eine ungewisse Zukunft war. Noch immer hatte sie nicht verstanden, was das Ziel dieser Reise war. Vielleicht auch etwas Furchtbares, Schreckliches. So dass sie sich wünschen würde in Tornheim mit den anderen gestorben zu sein.
Der Blick über das Meer war seltsam. Es war alles so weit. Ja, diesen weiten, schier unendlichen Blick kannte sie. Aus dem Ewigen Eis. Auch da sah alles immer ewig weit aus. Als würde das Eis nie enden. Nun ging es ihr mit dem Meer genauso. Und dieser Blick machte sie irgendwie froh. Weil sie ihn einfach kannte. Die Stadt hingegen war anders. War unfrei. Wohin man auch schaute, waren Mauern und Wände. Nein, Freiheit war ihr schon lieber. Allerdings wusste sie nicht, wohin es ging. Zumindest nicht wirklich.
Eine Reise zu den Noaten. Nie hatte in Tornheim jemand die Noaten erwähnt. Warum eigentlich nicht? Gab es über sie nicht genügend Stoff für Legenden?
„Du bist also die Auserwählte!“, meinte eine Stimme.
Sie schaute auf und blickte in die Augen des Kommandeurs. Sie nickte.
„Nun. Unsere erste Begegnung war nicht die Beste. Das gebe ich zu.“
„Ich mache Euch keinen Vorwurf, Herr!“, erwiderte sie.
Er schüttelte den Kopf. „Nein. Das tust du nicht. Das weiß ich. Dennoch. Ich bitte dich um Verständnis.“
„Ihr tatet nur Eure Pflicht!“, erwiderte sie.
Er nickte. „Ich bin Hamdir, der Kommandeur unserer Streitkräfte! Und das hier ist Vidolf. Unser Priester!“
Hedda nickte stumm. Dem Priester war sie ebenfalls schon begegnet. Am heutigen Tag.
„Hisst das Segel!“, rief der Navigator, der in gewisser Weise auch die Rolle eines Kapitäns hatte. Er befehligte die Männer und hatte das Kommando. Der Steuermann war sein Stellvertreter. Warum ausgerechnet der Navigator die wesentliche Führungsrolle übernahm war klar. Seine Rolle war die Schwierigste überhaupt. Er musste entscheiden, welchen Kurs man einschlug, was nicht so einfach war. Vor allem am Anfang. Man musste südwestlich aufs Kalte Meer hinausfahren, um dort schließlich den Westwind zu erwischen, um sich dann direkt in Richtung der Inselgruppe der Noaten treiben zu lassen. Gerudert wurde am Tag immer. Besonders wichtig war es jedoch am ersten Tag möglichst viele Kilometer zu machen. Man fuhr dabei so lange wie möglich die Küste entlang, was weitaus ungefährlicher war als auf dem offenen Meer.
„Hauruck, Hauruck ...“, tönte die Stimme des Steuermanns. Das Boot setzte sich in Bewegung. Das Segel blieb anfänglich still, nach einigen Minuten blähte es sich jedoch auf und unterstützte die Muskelarbeit der Ragni.
Eine unglaubliche Sehnsucht erfüllte Hedda. Seltsamerweise hatte sie ein erstaunlich gutes Gefühl. Die See vor ihr brachte ihr eine ungewisse Zukunft. Aber alles war besser als in der Stadt zu versauern. Wo sie sich hätte Arbeit suchen müssen oder aber einen Mann, der sie heiraten würde. Letzteres wäre vermutlich kein Problem gewesen, aber sie war noch nicht so weit. Männer waren für sie kein Thema.
3
Laros
Strahlend blauer Himmel. Keine Wolke war zu sehen. Es war ein unglaublich schöner Tag. Aber die Angst, die in der Luft lag, überwog. Der Hauptmann war sich sicher, dass er an diesem Tag sterben würde. Er wünschte sich Regen. Noch einmal die Tropfen eines warmen Regenschauers auf der Haut spüren, bevor er in die Ewige Sonne geholt wurde.
„Seht, Herr Hauptmann. Die Nehataner marschieren auf!“
Der Hauptmann schaute verwundert in das langgezogene Tal, das nach Süden führte. „Wieso greifen sie nicht von der Anhöhe her an?“
Der Unteroffizier zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung. Bis gerade war dort noch die Führungsriege versammelt. Aber sie sind abgezogen.“
„Nun, für uns ist das zweifelsohne besser. Eine Chance haben wir dennoch nicht! Wie viele Einheiten marschieren auf?“
„Ich zähle in etwa fünfhundert Schwertkämpfer. Dahinter vermutlich um die hundert Bogenschützen.“
„Keine Reiter?“
Der Unteroffizier schüttelte den Kopf. „Nein. Reiter sehe ich nicht. Bis auf die Führungsriege hinter den Schwertkämpfern. In etwa fünf Reiter. Vermutlich die Befehlshaber!“
„Zieht hundert Mann unserer Leute ab!“, meinte der Hauptmann plötzlich.
„Was?“
„Fünfzig sollen die Stellung halten. Plus die Bogenschützen auf den Dächern. Den Rest zieht ab!“
„Bei den Göttern ... wieso?“
Der Hauptmann antwortete nicht, sondern legte seine Hand auf die Schulter des Unteroffiziers. „Ihr wart mir ein treuer und ergebener Soldat. Und Ihr werdet auch jetzt treu sein. Treu auch zu Eurem Vaterland und gegenüber eurem Volk!“
„Sicher ...!“
„Ihr werdet die Verteidigung übernehmen!“, meinte der Hauptmann. „Ihr könnt das. Ihr verteidigt Laros bis aufs Blut. Ich lasse euch fünfzig Schwertkämpfer und unsere fünfzig Schützen ...“
„Ihr wollt fliehen?“, fragte der Unteroffizier.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. „Nein. Aber ich werde mit dem Rest die Anhöhe hinaufgehen und schließlich in die Flanke des Feindes angreifen!“
„Das ist Wahnsinn!“
„Es ist unsere einzige Chance!“, meinte der Hauptmann. „Aber es muss schnell gehen. Wir haben nicht viel Zeit.“
„In Ordnung!“, sagte der Unteroffizier.
„Ich werde die Männer abziehen, durch die Stadt führen und hinter der Bergkuppe auf die Anhöhe bringen. So dass es der Feind nicht sieht!“
„Er wird sehen, dass wir die Männer abziehen!“
„Umso besser. Sie werden denken, dass Teile unserer Truppen fliehen! Vielleicht werden sie dann leichtsinniger!“
„Lasst mich nicht im Stich, Hauptmann!“, murmelte der Unteroffizier.
Der Befehlshaber der pravinischen Garnison schüttelte den Kopf. „Nein. Ganz bestimmt nicht!“
Moral ist die Summe aller Werte, die man uns gelehrt hat. Moral ist das, was uns anerzogen ist. Oder gibt es doch ein natürliches Gewissen, das von Natur aus da war? Chantico war in der königlichen Familie mit Härte und Strenge erzogen worden. Er, der Bruder des Königs, hatte gelernt, dass die königliche Familie über allem stand und nichts so viel wert war wie königliches Blut. Und Feinde mussten vernichtet werden. Aber waren das überhaupt Feinde, die dort ihre Stadt verteidigten? Oder hatten sie die Nehataner nur zu Feinden gemacht, weil sie eigene Interessen verfolgten? Chantico hatte Zweifel. Er war anders als sein Bruder, auch wenn er die gleiche Ausbildung und Erziehung genossen hatte. Also musste es doch etwas wie ein natürliches Gewissen geben.
„Seid Ihr bereit?“, fragte Mixtli.
Chantico nickte stumm.
„Gut. Dann gebt den Angriffsbefehl. Die Schützen sollen die ersten Salven abfeuern!“
Erneut nickte Chantico. Dann gab er lautstark den Befehl. Und der wurde durch die untergeordneten Führer weitergegeben.
Die erste Pfeilsalve regnete auf die Soldaten der Pravin nieder. Ein paar wenige Männer schrien auf und brachen tödlich getroffen oder verwundet zusammen. Die restlichen Männer hielten ihre Schilde nach oben. Sie zitterten teilweise vor Angst. Man fühlte sich machtlos. Die Pfeile flogen durch die Luft und trafen dabei völlig willkürlich entweder einen der Schilde ober aber einen der Männer, wenn sie nicht genug geschützt waren. Nur wenige trafen auf den Boden auf. Zu dicht standen die Männer Seite an Seite.
„Fertig machen zum Gegenfeuer!“, schrie der Unteroffizier auf pravinischer Seite. Die Schützen auf den Dächern spannten nun ebenfalls ihre Bögen. Es war nun gut ein halbes Jahr her, seit die Pravin ihre erste Schützeneinheit aufgestellt hatten. Und der Unteroffizier war dankbar dafür. Lange hatte man diese Einheit belächelt. Vor allem, weil sie teuer war. Die Bogen kaufte man für nicht wenig Geld bei den Shiva.
„Und Feuer!“, hallte das Kommando.
Die Pfeilsalve der Pravin war die Antwort auf den nehatanischen Angriff.
„Bei den Göttern!“, rief Chantico aus. „Seit wann haben die Pravin Bogenschützen?“
Mixtli starrte auf die eigenen Reihen, in denen einige Soldaten zu Boden fielen. Nein, er hatte ebenfalls keine Schützen erwartet. Man war fest davon ausgegangen, dass die Pravin nur Fußsoldaten hatten. Das war schon immer so gewesen.
„Ich habe Euch gesagt, dass Bogenschützen auf den Dächern stehen!“, meinte einer der Offiziere, der mit seinem Pferd neben Mixtli stand. Er war für die Aufklärung zuständig.
„Das habt Ihr nicht, Idiot!“, meinte Mixtli und seine Worte duldeten keinen Widerstand.
Der Offizier schwieg. Er hatte es gesagt. Und keiner hatte ihm zugehört. Aber nun war es ohnehin zu spät.
„Was sollen wir tun, verdammt?“, rief Chantico. Immer mehr seiner Männer fielen. Die Schilde boten kaum Schutz gegen die Pfeile, deren Wucht weitaus stärker war als die der Eigenen. Die Langbogen der Shiva hatten nicht nur eine höhere Reichweite, sondern die Pfeile auch eine größere Durchschlagskraft.
Der Unteroffizier der Pravin schaute zufrieden in Richtung der feindlichen Linien. Die Pfeile seiner eigenen Leute sorgten für deutlich mehr Chaos. Und nun änderte er die Taktik. „Neues Ziel anvisieren. Fünfzig Fuß hinter den feindlichen Fußsoldaten. Direkt auf deren Schützen!“
Die Männer gehorchten. Sie legten die Pfeile an, zielten und feuerten. In hohem Bogen kam der nächste Pfeilregen.
„Verdammt!“, schrie Chantico, als er sah, dass die Pfeile in einem anderen Winkel kamen und über die Schwertkämpfer hinweg flogen. Er zog den Kopf ein. Aber die Führungsriege war nicht das Ziel. Die Pfeile flogen über die Köpfe von Chantico, Mixtli und den anderen Offizieren und trafen die eigenen Bogenschützen. Mit schmerzhaftem Verlust. Die Schützen waren vollkommen ungeschützt. Viele Männer fielen augenblicklich zu Boden. Ein Wehklagen ging durch die Reihen der Verletzten.
„Lasst uns das Feuer erwidern!“, schrie Chantico. „Schießt auf die feindlichen Schützen!“
„Unsere Pfeile reichen nicht so weit!“, erwiderte Mixtli. Verzweiflung machte sich breit. Er hatte sich die Sache anders vorgestellt.
„Was wollt ihr damit sagen?“
„Dass wir, götterverdammt, nicht so weit schießen können, Feldherr!“
„Versucht es trotzdem!“, schrie Chantico.
Mixtli schüttelte den Kopf. Aber er gab den Befehl. Und die Pfeile flogen über ihre Köpfe hinweg Richtung Feindeslinie. Sie verpufften zwischen den feindlichen Schwertkämpfern und den feindlichen Schützen im Nichts. Einige wenige Pfeile erreichten zumindest die Gebäude, prallten aber daran ab oder blieben, sofern es Holzhäuser waren, in den Wänden stecken.
Als Antwort kam eine Salve der Langbogenschützen.
Mixtli starrte hinter sich. Die meisten seiner hundert Bogenschützen waren tot. Er ritt zu einem seiner Offiziere und packte ihn am Arm. „Reitet los und schickt die nächste Schützenkompanie!“
„Wir sollten uns zurückziehen und neu formatieren!“, schrie der Offizier.
Mixtli schaute ihn Böse an. „Ihr könnt meinetwegen eure Vorhaut zurückziehen. Aber nicht unsere götterverdammten Truppen. Und jetzt holt die Verstärkung!“
„Aber ...“
„Nichts aber! Tut es!“
Der Offizier gehorchte und ritt los.
Mixtli drehte sich nun zu seinen Schwertkämpfern um. „Vorwärts Marsch!“
Er wusste, wenn er jetzt nicht angreifen würde, dann würde sich seine Truppe immer mehr minimieren.
Die Schwertkämpfer der Nehataner marschierten vorwärts Richtung Stadt. Von den einst fünfhundert Mann waren nur noch vierhundert Mann übrig. Der Rest lag tot oder verwundet an Ort und Stelle. Mit derart großen Verlusten hatte Mixtli nicht gerechnet. Aber er wusste, dass es noch mehr Tote auf der eigenen Seite geben würde, wenn er nicht handelte. Die Armee musste vorrücken. Und er konnte nicht warten bis seine Schützenreihen wieder aufgefüllt waren.
Er starrte Richtung Feind. Zwischen den eigenen Truppen und der feindlichen Linie lagen noch gut fünfzig Meter. Dazwischen lagen riesige Heuballen, die Bauern dort aufgebahrt hatten. Die nächste Salve von Pfeilen rauschte auf nehatanische Truppe und die Soldaten suchten verzweifelt Schutz hinter dem Heu.
Der Offizier, der die Schwertkämpfer der Nehataner anführte, suchte ebenfalls Schutz hinter den Heuballen. Er schaute nach hinten und sah wie weitere Männer seiner Einheit fielen. Er musste angreifen. Und zwar schnell. Das Heu gab zumindest die Möglichkeit kurz mal durchzuatmen.
„Riecht Ihr das, Kompaniechef?“, fragte einer der Soldaten.
Der Offizier schüttelte den Kopf. „Was meint ihr?“
„Es riecht nach Öl!“
„Tatsächlich!“, murmelte der militärische Führer der Schwertkämpfer. Er schnupperte. Der Soldat hatte recht. Verwirrt schaute er sich um. In der Zwischenzeit hatten sich die meisten seiner Soldaten hinter den Heuballen verschanzt. Bereit weiter anzugreifen.
„Die Heuballen!“, sagte der Soldat erschrocken. „Sie sind ... sie sind mit ...“
Die nächste Salve von Pfeilen donnerte auf die Einheit herunter. Aber dieses Mal waren es keine gewöhnlichen Pfeile. Die Pfeilspitzen waren mit ölgetränkten Tüchern umwickelt und anschließend angezündet worden.
„Bei den Göttern!“, schrie der Offizier. „Zurück, zurück!“
Doch es war zu spät. Der brennende Pfeilregen setzte sofort die mit Öl getränkten Holzballen in Brand.
Lebende Fackeln rannten umher. Soldaten die Feuer gefangen hatten und panisch davonliefen, anstatt sich auf dem Boden zu wälzen.
Mixtli starrte auf das Szenario vor sich. Er hatte die Pravin unterschätzt. Sehr sogar. Er hatte weder die Langbogenschützen erwartet noch diese hinterhältige Taktik mit den Strohballen. Aber es kam noch schlimmer. Nicht nur, dass die meisten Schwertkämpfer die Flucht ergriffen und direkt in seine Richtung rannten, auf der Anhöhe erschienen plötzlich weitere feindliche Soldaten.
„Ein Gegenangriff!“ schrie Mixtli. „Verdammt, ein Gegenangriff in die Flanke!“
Doch sein Ruf verhallte ungehört. Kaum einer bekam es mit.
Chantico konnte es nicht glauben. Hinter ihm lag eine halbzerschmetterte Schützenkompanie, vor ihm flohen die Schwertkämpfer in seine Richtung. Einige hatten ihn schon erreicht. Aber er hielt keinen auf. Er blickte einfach nur stumm auf die flammenden Strohballen vor ihm. Dann traf ihn ein Pfeil. Er stürzte zu Boden.
„Bei den Göttern. Was für eine verfluchte Scheiße!“, schrie Mixtli. „Schützt den Feldherrn. Schützt ihn mit Eurem Leben!“
„Was sollen wir tun?“, fragte einer der Offiziere.
„Übernehmt das Kommando über die Schwertkämpfer. Wehrt den Gegenangriff ab. Ich werde jeden töten, der weiter flieht als bis zu meiner Linie!“ Und er machte seine Drohung war. Der erste eigene Soldat, der in Panik an ihm vorbeirennen wollte, wurde mit seinem Schwert niedergestreckt.
Mixtli starrte auf die Angreifer in seiner linken Flanke. Sie kamen aus dem Nichts. „Bei den Göttern! Wenn schon Scheiße, dann aber auch bitteschön richtig dünnflüssig. Was für ein götterverdammter Dreck! Unsere Flanke wird angegriffen.“
Der Hauptmann der pravinischen Garnison schrie zum Angriff. Seine Männer rannten auf die nehatanischen Streitkräfte zu. Mit äußerstem Willen ihre Stadt bis aufs Blut zu verteidigen.
Die Pravin kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Doch der Feldmarschall hatte schnell den Überblick wiedergewonnen. Der Schock des Gegenangriffes saß tief. Mixtli musste sich aus ihm befreien. Für einen Moment lang schaute er zu Chantico, seinen Feldherrn. Er war verwundet, aber er würde überleben. Rund zwanzig Schwertkämpfer hatten sich um ihn herum positioniert und beschützen ihn. Für einen Moment überlegte Mixtli, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Chantico den Tod gefunden hätte. Vermutlich wäre dann er der Feldherr dieser Armee. Und nicht dieser arschfickende Bruder des Königs. Auf der anderen Seite musste er sich eingestehen, dass er selbst den entscheidenden Fehler in dieser Schlacht gemacht hatte. Und er schwor sich niemals wieder seine Flanke ungeschützt zu lassen. Und genau die galt es nun beim Feind anzugreifen.
Mixtli gab seinem Pferd die Sporen. Er ritt von den Schwertkämpfern weg Richtung einer seiner Kavallerieeinheiten. Schon von weitem schrie er.„Greift ihre Flanken an. Verdammt noch mal, greift ihre Flanken an! Eine Reiterkompanie linksherum und eine rechtsherum!“
Der Hornbläser der berittenen Einheit blies zum Angriff.
Während die nehatanischen Schwertkämpfer noch immer niedergemetzelt wurden, kam nun die notwendige Hilfe in Form der Kavallerie. Viel zu lange hatte es gebraucht, bis Mixtli aus seiner Schockstarre erwacht war. Aber nun holte er sich die Kontrolle wieder zurück. Die berittenen Einheiten griffen an. Mixtli mitten unter ihnen. Er hatte es sich nicht nehmen lassen selbst mit anzugreifen. Die Hufe der Pferde donnerte über den Boden.
Dann prallte die Kavallerie direkt in die feindliche Linie ...
Die pravinischen Soldaten fielen wie die Fliegen. Wer nicht durch die Pferde niedergetrampelt wurde, der wurde durch ein Schwert getroffen. Es war ein grausames Gemetzel.
Mixtli war in der Zwischenzeit mitten im Kampfgewühl. Er war wie von Sinnen und schlug mit seinem Schwert um sich. Und auch sein Pferd war in Rage. Todesangst erfüllte das arme Tier, das als militärisches Werkzeug missbraucht wurde. Panisch trat es um sich. Wer auf dem Boden lag wurde niedergetrampelt. Egal, ob Feind oder Freund. Denn nicht jeder Nehataner hatte sich auf seinem Pferd halten können und so wurde er schnell ebenfalls Opfer der Hufe.
„Lasst keinen am Leben!“, schrie Mixtli laut. Es war nicht von Anfang an seine Absicht gewesen jeden töten zu lassen. Aber nun war er so voller Wut und Hass, dass er nicht anders konnte.
Keiner der zweihundert Soldaten würde diesen Angriff überleben. Das war dem Hauptmann längst klar. Er ließ zum Rückzug blasen. Aber es war längst zu spät. Jedem Soldaten war bewusst, dass die Nehataner keine Gnade kannten. Sie würden alle töten.
„Wir ergeben uns!“, schrie der Hauptmann der Garnison laut. „Wir ergeben uns!“
Das Gemetzel ging weiter. Auch wenn einige Soldaten ihre Schwerter niederlegten.
Nein, es war keine Gnade, die der Feldmarschall der Nehataner in diesem Augenblick verspürte. Vielmehr die Genugtuung, dass sie sich ergaben. „Haltet ein!“, bellte Mixtli über das Schlachtfeld und zu seinem Hornbläser befahl er. „Lasst die Waffen ruhen!“
Das Horn ertönte. Nur langsam verstanden die Reiter der Nehataner, dass dieser Ruf ihnen galt und ihnen den Befehl gab den Kampf einzustellen. So sehr waren sie im Blutrausch. Aber nach und nach kehrte Ruhe ein.
„Treibt sie zusammen!“, sagte Mixtli. „Es darf keiner entkommen! Und der Rest der Reiter setzt den Angriff auf die Stadt fort!“
Zwei Reiterkompanien ritten auf die Stadt zu. Und auch hier setzte sich das Gemetzel fort. Keiner der Einheiten in der Stadt überlebte. Die Schützen auf den Dächern versuchten zu fliehen, wurden aber recht rasch von den Reitern eingefangen und getötet.
Viele Tote blieben auf dem Schlachtfeld. Die Lebenden wurden zusammengetrieben. Wer nicht mehr Aufstehen konnte wurde erlöst. Mit dem Hauptmann blieben rund zwanzig Mann der pravinischen Armee übrig.
„Der Sieg ist unser!“, schrie Mixtli laut.
Die Nehataner schrien lauthals vor Freude. Aber auch aus Erleichterung. Es war vorbei. Die erste richtige Schlacht war geschlagen ...
4
Hingston
Die kalten Mauern des Gefängnisses. Tamira würde sich nie daran gewöhnen. Sie verstand nicht, wie es Lord Philipp von Raditon auch nur eine Nacht hier drinnen aushielt. Kalt, düster, stickig. Das war kein lebenswerter Ort. Aber der Lord war nicht alleine. Gut zwanzig Männer waren hier eingesperrt. In vielleicht dreißig Zellen. Ob Frauen darunter waren, konnte sie nicht sagen. Sie hatte bislang keine gesehen. Aber das hieß nichts. Sie ging ohnehin immer an allen vorbei, ohne nach links oder rechts zu blicken. Sie vermied es die Gefangenen anzuschauen. Nicht weil sie diese geringschätzte, sondern einfach, weil sie Angst hatte. Der eine oder andere hatte es sicherlich verdient hier zu sein.
Die letzte Zelle hinten rechts. Dort war Philipp von Raditon untergebracht. Warum, das konnte keiner so genau sagen. Vielleicht weil er eigenhändig gehandelt hatte. Weil er ohne richterlichen Beschluss befohlen hatte einen Mann zu ermorden. Vielleicht weil er an dem Aufstand beteiligt war.
„Da bist du ja!“, sagte Philipp. „Wie geht es dir?“
„Gut, Lord von Raditon!“, erwiderte sie leise und setzte sich dann vor die Gitterstäbe. „Und Euch?“
„Den Umständen entsprechend!“
Sie wurde rot. „Tut mir leid. Natürlich. Das war dumm von mir!“
„Nein, du kümmerst dich um mich. Du denkst an mich. Das gefällt mir. Wie geht es der Prinzessin?“
„Den Umständen entsprechend!“, antwortete sie.
Er lachte. Es war eine unfreiwillig komische Antwort. Aber dann wurde er wieder ernst. „Kümmere dich um sie!“
„Das tu ich!“, sie schaute hinüber in die andere Zelle von Thores lag. Er schien zu schlafen. Oder zumindest tat er so. „Was ist mit seinem Plan?“
„Nichts!“, meinte Philipp von Raditon. „Er ist verrückt!“
„Er klang aber nicht verrückt!“
„Ich möchte darüber nicht sprechen!“
Sie nickte. „In Ordnung.“
„Du musst mir versprechen, dass du der Prinzessin folgst. Wenn sie tatsächlich das Götteropfer wird!“
„Ihr wärt dann wochenlang alleine hier eingesperrt!“, meinte sie traurig. „Und Ihr würdet hier Tag für Tag und Nacht für Nacht auf Eure Hinrichtung warten, ohne dass Euch jemand besucht!“
„Das ist mir bewusst. Aber ich denke, dass es deine Bestimmung ist bei der Prinzessin zu sein. Du dienst ihr, nicht meiner Wenigkeit!“
Sie nickte. „Ich weiß. Aber ...“
„Kein Aber!“, meinte er. „Tu es einfach. Und bis dahin sind es noch fast zwei Wochen. In denen du mich besuchen kannst!“
„Das werde ich. Das werde ich in jedem Fall!“
Die nächste, gut eine halbe Stunde, sprachen sie von anderen Themen. Von nichtssagenden Dingen, die dem Lord von Raditon jedoch die Möglichkeit gaben ein wenig aus dem Gefängnisalltag auszubrechen. Gedanklich. Der Lord sprach vor allem von seiner Heimat. Raditon ganz im Westen des Landes. Wie auch Hingston direkt am Meer gelegen. Allerdings war das dortige Ewige Meer weitaus rauer. Die See war deutlich wilder, da die meisten Winde von Westen herkamen Es waren bereits Schiffe weiter Richtung Westen aufgebrochen, aber nie zurückgekommen. Gab es weiteres Land und weitere Völker? Die Priester verneinten das vehement. Doch man wusste, dass der Planet rund war. Entweder man traf auf weiteres Land oder weitere Inseln, oder man kam eben wieder in Mani an. Im Osten von Mani.
5
Kaltes Meer
Das Festland des nordischen Landes der Ragni wurde immer kleiner. Hedda blickte zurück. Würde sie dieses Land jemals wiedersehen? Es war mühselig sich darüber Gedanken zu machen. Ihr Schicksal war unbestimmt. Keiner konnte voraussagen, wie alles enden würde.
Hedda betrachtete die rudernden Männer. Sie gehörten zu den Kriegern der Ragni. Treue Soldaten des Königs. Immer sechs von ihnen ruderten. Zwei machten Pause. Sie erholten sich, aßen oder schliefen. Hedda spürte durchaus den Blick einer der beiden ruhenden Krieger. Er hatte sich an den Mast gelehnt und starrte zu ihr hinüber. Sie erwiderte den Blick nicht bewusst, musste aber immer wieder zu ihm schauen. Warum starrte er so? Flirtete er sogar mit ihr?
Die Königin, die neben ihr saß, hatte den Blick durchaus bemerkt. Sie schaute erst zu Hedda, dann zu dem Soldaten. „Wie kannst du es wagen sie so anzuschauen? Sie ist die Serva unseres Gottes!“
„Vergebt mir!“, sagte der Soldat. Hastig packte er aus seiner Tasche eine Decke. Er legte sie sich um und rollte sich dann zusammen. Es war ohnehin wichtig für ihn zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Er musste für seine Schicht fit sein. Zwei Stunden hatte er hierzu Zeit. Dann musste er sechs Stunden fast durchgängig am Ruder verbringen. Wenn auch nicht sechs Stunden komplett durchgerudert wurde, so war es doch anstrengend.
„Meine Königin!“, fragte Hedda leise.
Varuna schaute sie an. „Was ist, mein Kind?“
„Was ist, wenn ich mal ...“
„Wenn du musst?“, fragte die königliche Hoheit. Sie schaute ernst drein. „Dann mach über die Reling!“
„Über die Reling?“, Hedda war sichtlich irritiert. „Aber ...“
„Es gibt kein aber, Hedda! Wir sind mitten auf dem Ozean. Und wenn du groß musst, dann ...“
„Nein! Muss ich nicht!“, wehrte sie ab.
„Nun, in jedem Fall musst du über die Reling machen!“
„Lass dir aber nicht von Haien in den Arsch beißen!“, grinste Hamdir der Kommandeur.
Hedda wusste nicht so richtig, was sie von ihm halten sollte. „Haie?“
„Hör nicht auf ihn!“, meinte der Prediger. Er saß in einer Ecke. Zusammengekauert wie ein kleines Paket. Seinen Kopf hatte er gesenkt. Er schaute nicht auf, sondern starrte nur gedankenversunken zu Boden.
So viel ließ sie zurück. Ihr Land, ihre Vergangenheit, das Ewige Eis. Vor allem aber den Ewigen Tag. Es sollte bald dunkel werden, hatte die Königin verraten. Nicht für allzu lange aber doch so, dass es für ein paar Stunden stockfinster werden würde. Eine unheimliche Vorstellung für Hedda.
„Erzählt uns, alter Mann. Was erwartet sie? Was erwartet uns?“, fragte der Kommandeur und setzte sich neben den Priester.
Vidolf, der weißhaarige Priester, schaute immer noch nicht hoch. Sondern sprach einfach vor sich hin. „Es ist unsere Aufgabe sie zum Tempel von Deux zu begleiten und sie dort den Göttern zu opfern.“
„Opfern im Sinne von …“, Hamdir stockte und schaute zu Hedda. Er wollte die Worte nicht in ihrem Beisein aussprechen.
„Nein, ich glaube nicht!“, murmelte Vidolf.
„Ihr glaubt nicht?“, fragte Hamdir verwirrt. „Nun, wenn Ihr es nicht wisst, wer dann?“
„Es gibt eine Gruppe!“, sagte Vidolf leise. „Eine geistliche Gruppe, die weitaus höhergestellt ist als wir Priester. Und auch höher als die Könige!“
„Tatsächlich? Und wer soll das sein?“
„Es sind die Wissenden!“, murmelte der Priester.
„Nun, wenn Ihr derjenige seid, der nur glaubt, dann ist es gut zu erfahren, dass es auch die Wissenden gibt!“, spottete der Kommandeur grinsend.
„Ihr seid ein kleingeistiger Soldat!“, Vidolf schaute nun erstmals hoch. „Die Wissenden sind die Jünger des Großmeisters!“
„Ihr werdet immer wirrer. Wer ist der Großmeister?“
„Das ist derjenige, der über uns Priestern steht. Alle sieben Jahre, wenn wir uns versammeln, dann steht er uns vor. Allen Priestern der sieben Länder. Und er alleine hört die Stimme der Götter!“
„Und die Wissenden, seine Jünger?“
„Die stehen zwischen dem Großmeister und uns Priestern!“
„Woher kommen sie? Aus welchem Volk?“, fragte Hamdir ungläubig. „Ich höre davon zum ersten Mal.“
„Weil Ihr nicht zuhört!“, murmelte der Priester.
„Oh, ich höre sehr wohl zu. Aber von einem Großmeister war nie die Rede.“
„Es sollte für Euch als Kommandeur auch keine Rolle spielen. Wir, die Priester, sind die Sprachrohre des Großmeisters und damit auch der Götter.“
„Dennoch könnt Ihr mir meine Frage nicht beantworten. Was geschieht mit der Serva? Mit diesem jungen, hübschen Ding?“
„Wenn ich es wüsste, würde ich es Euch sagen. Aber ich weiß es nicht. Wir haben den Auftrag aus jedem Volk eine Serva zum Großmeister zu senden. Mehr weiß ich nicht!“
„Nun gut!“, nickte der Kommandeur und öffnete seine Tasche. Er holte sich eine Decke heraus und wickelte sich ein. „Dann möchte ich Euch nicht weiter nerven. Wir werden schon sehen, was uns die Zukunft bringt.“
6
Hingston
Die Türe zum Balkon war weit geöffnet. Katharina war froh, dass sie so wenigstens einen Ausblick aufs Meer hatte. Knapp zwei Wochen würde sie hier gefangen sein. In diesem Turm außerhalb von Hingston. Eine Fluchtmöglichkeit gab es nicht. Durch die Türe ging es ohnehin nicht. Die war abgesperrt und zwei Wachen standen davor. Und über den Balkon? Darunter war nur schroffer Fels. Der Turm war direkt an einer Klippe gebaut worden, die hinunter zum Strand führte.
Aber an fliehen dachte die Prinzessin ohnehin nicht. Wohin sollte sie schon gehen?
Sie hörte die Türe und hoffte, dass es ihre Hofdame war. Tamira. Und ihre Hoffnung wurde erfüllt. Es war tatsächlich die junge Frau aus dem Veteranenviertel.
„Ich bin froh dich zu sehen!“, meinte Katharina.
Tamira nickte und legte einen Korb auf den Tisch. „Ich habe Euch Essen mitgebracht, königliche Hoheit!“
„Danke!“, murmelte Katharina und ging hinaus auf den Balkon. „Es ist wunderbares Wetter!“
„Ja, das ist es wohl!“, nickte Tamira. „Übrigens, der Priester kommt. Ich war schneller als er, aber er wird bald da sein!“
„Was will dieser Widerling?“, Katharina schüttelte sich. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie er sie behandelt hatte.
„Ich weiß es nicht. Er kommt mit seiner Magd!“
„In die Ewige Verdammnis soll er fahren!“, schnaubte die Prinzessin. Ihr Blick schweifte über das Meer. „Eigentlich ist die Vorstellung weiter in den Süden zu reisen gar nicht so übel. Ich habe es mir immer gewünscht. Und nun? Nun werde ich vielleicht dazu gezwungen und schon hat es seinen Reiz verloren!“
Die Türe ging auf. Schwer atmend kam der Priester hoch. Zacharias, der oberste Priester aller Mani. Mit seinem rauschenden weißen Bart und seiner roten Robe.
„Was wollt Ihr?“, fragte Katharina.
„Nach Euch sehen!“, grinste er. „Ich bin für Euch verantwortlich, königliche Hoheit!“
„Das seid Ihr nicht!“, die Prinzessin drehte sich von ihm weg und schaute erneut auf das Meer.
Zacharias schaute die Prinzessin von oben bis unten an. Sie war jung. Bildhübsch. Schlank. In ihm tobte ein Kampf. Auf der einen Seite die Verantwortung die schönste Jungfrau zum Tempel zu bringen, auf der anderen Seite seine Gier. Seine unersättliche perverse Gier nach frischem, jungen Fleisch. Viele Jahre war er dieser Lust nicht nachgegangen. Aus Prinzip. Aus Treue gegenüber den Göttern. Aus Verantwortung als Priester. Aber als er die Jungfräulichkeit der Prinzessin geprüft hatte, da war in ihm Feuer entflammt worden. Die Glut war schon immer dagewesen. Sie war in seinem Kopf, aber vor allem in seinen Lenden. Und ihr Anblick hatte diese Glut entfacht. Er hatte seine Magd vergewaltigt. Sie sich einfach genommen. Benutzt wie ein Stück Fleisch. Und es sehnte ihm nach mehr.
„Es gibt eine Möglichkeit!“, meinte der Priester. „Eine Möglichkeit, dass Ihr, Prinzessin, die Reise nicht antreten müsst!“
„Tatsächlich?“, fragte Katharina. „Nennt sie mir. Bitte!“
„Nun. Wenn Ihr die Auserwählte seid und Ihr Euch Eure Unschuld willentlich rauben lasst, dann wäre das Sünde gegen die Götter. Nicht aber wenn ...“
„Wenn was?“, fragte Katharina.
„Wenn ein Priester Euch die Unschuld raubt!“
Katharina erbleichte. „Das meint Ihr nicht ernst?“
„Oh doch! Das meine ich!“
„Ihr seid ein ...“, sie sprach nicht weiter.
Er grinste sie an. „Es ist mir egal, was Ihr denkt, königliche Hoheit. Ihr seid ein kleines Mädchen und die Götter mögen Euch Eure blasphemischen Gedanken verzeihen.“
Tamira starrte den Priester an. „Ihr meint also, wenn die königliche Hoheit Euch ihre Unschuld schenken würde, dann wäre sie frei?“
Zacharias nickte lüstern. Ja, er würde schon eine andere Jungfrau finden. Vielleicht würde sie nicht so schön sein. Aber sie wäre dann die schönste Jungfrau, da die Prinzessin dann ihre Unschuld verloren haben würde.
„Ihr seid ein Widerling!“, schüttelte Katharina den Kopf. Alleine der Gedanke, dass der alte Mann sie erneut anfasste, löste in ihr ein ungutes Gefühl aus.
Noch immer stand Katharina auf dem Balkon. Zacharias schaute sie sich an. Sie hatte ein weißes Kleid an, dass sich perfekt an ihren Körper schmiegte. An ihren schlanken, jungen Körper. Er ging zu ihr hinaus und stellte sich neben sie. Langsam fuhr er ihr mit der Hand über die Wange. „Ihr seid wunderschön. Und ich würde es genießen. Im Namen der Götter!“
„Das können die Götter nicht wollen!“, meinte Tamira. Erinnerungen kamen auf. An ihren Vater. Der sie so oft missbraucht hatte. Sie misshandelt und gedemütigt hatte. Vergewaltigt. Immer und immer wieder.
„Was weißt du schon, dummes Kind!“, sagte Zacharias und schaute sie spöttisch an. Er griff nach Katarinas Kleid und mit einem Mal zerriss er es an ihrem Ausschnitt.
Die Prinzessin schrie auf. Fasste schnell an die zerrissene Stelle. „Wagt es nicht mich anzufassen!“
„Oh, Prinzessin. Ihr werdet euch doch nicht gegen den Willen der Götter stellen ...“
„Ich dachte, ich wäre die Auserwählte und ...“
Seine schmierigen, alten Finger griffen nach ihr. Er war scharf auf sie. Er war nicht mehr Herr seiner Gedanken. Ja, sie war die Auserwählte. Noch. Aber nicht, wenn sie keine Jungfrau mehr sein würde. Und er wollte sie. Wollte sie mehr als alles andere.
„Lasst sie in Ruhe!“, schrie Tamira.
„Halt den Mund, du dreckige Göre!“, fauchte der Priester sie an. „Der Prinzessin wird wenigstens die Ehre zuteil für einen Mann der Götter die Beine breit zu machen und nicht für ihren Vater wie du ...“
Seine Worte verstummten. Sein Gesicht verriet Überraschung und Entsetzen zugleich. Er sah Tamira. Wie sie auf ihn zu stürmte. Sah ihre Hände. Sah ihr zorniges Gesicht. Er blickte zur Prinzessin. Noch immer hielt sie ihr zerrissenes Kleid. Auch sie schien verwundert.
... und dann fiel er. Er stürzte über die Brüstung. Kein Laut kam über seine Lippen. Er fiel einfach nur und tausende von Gedanken gingen durch seinen Kopf. Sterben, er würde sterben. Für einen Moment lang sah er seine Mutter. Wie sie ihn in den Armen hielt. Wie sie ihn hin und her wog. Seinen Vater. Eine Reitgerte in der Hand ... dann das Kloster, das er als Kind besucht hatte. Weggesperrt im Auftrag seines Vaters. Der in ihm einen Nichtsnutz sah. Die Schule. Die Klosterschule und der strenge Lehrer. Die Weihe zum Priester ... die Ernennung zum höchsten Priester ... und er sah die Prinzessin. Nackt. Wie er sie von hinten nahm. Durchvögelte ...sie drehte sich zu ihm um. Blickte ihn an. Aber ihr Gesicht. Das war nicht sie. Das war Regnator. Seine Augen leuchteten rot. Er war wütend. Und er brüllte ... dann prallte er auf dem Felsen auf.
„Bei den Göttern. Was hast du getan?“, fragte Katharina entsetzt.
„Ich ... ich weiß es nicht. Ich habe ...“, Tamira stotterte. Sie schaute zum Balkon und Panik ergriff sie. „Bei den Göttern. Ich habe den Priester getötet!“
„Nicht irgendeinen Priester! Den Obersten Priester aller Mani!“, die Prinzessin lief aufgeregt hin und her.
„Sie werden mich töten. Sie werden mich hängen!“, jammerte Tamira. „Prinzessin, verzeiht mir.“
„Sei still!“, sagte Katharina. „Hast du ihn Schreien gehört?“
„Ihr glaubt, er lebt noch?“
„Unsinn. Aber die Wachen stehen auf der anderen Seite. Vielleicht haben sie es nicht mitbekommen!“
„Ich verstehe nicht ganz ...“
„Du musst hinuntergehen. Und den Leichnam wegschaffen!“
„Was?“, Tamira schaute die Prinzessin mit großen Augen an. „Das meint Ihr doch nicht ernst, oder?“
„Willst du hängen?“
„Nein!“
„Dann tu was ich sage. Bring den Leichnam weg.“
„Aber ... ich schaff das nicht!“
„Du brauchst Hilfe. Um ihn ganz weg zu schaffen benötigst du Hilfe. Aber erst einmal musst du den Leichnam verstecken. Irgendwo hier in der Nähe!“
Tamira schüttelte den Kopf. „Ich bin euch zutiefst zu Dank verpflichtet, dass Ihr mich decken wollt. Aber ich habe gerade den Oberen Priester getötet. Die Götter werden mir das nie verzeihen!“
„Vielleicht war es der Wille der Götter ...“
„Ja, das war es!“, meinte plötzlich eine Stimme an der Treppe.
Die beiden jungen Frauen drehten sich überrascht um und erblickten die Magd des Priesters.
„Du hast alles mitbekommen?“, fragte die Prinzessin.
Die Magd nickte. „Ja, das habe ich!“
Tamira seufzte. „Jetzt ist alles aus!“
„Wieso?“, fragte die Magd und ging dann vor Prinzessin Katharina auf die Knie. „Verzeiht. Es war respektlos von mir Euch nicht angemessen zu begrüßen!“
„Steh auf!“, meinte Katharina.
„Erlaubt mir, dass ich Eurer Hofdame helfe, den Priester fortzuschaffen!“
„Warum tust du das?“, fragte Tamira. „Ich verstehe das nicht!“
„Er hat mich vergewaltigt!“, meinte die Magd. „Nachdem Ihr, Prinzessin, im Tempel wart. Ich habe Euch dafür gehasst, Prinzessin. Vergebt mir dafür! Er hatte Euch gewollt und mich genommen. Und dafür habe ich Euch gehasst. Aber Ihr könnt nichts dafür. Und nun hat er seine gerechte Strafe bekommen!“
„Er hat Euch ...“, Katharina schloss für einen Augenblick die Augen. „Er ist unser Oberster Priester ... war unser Oberster Priester. Wieso hat er das getan?“
„Die Welt ist nicht so, wie Ihr es euch vorstellt!“, murmelte die Magd des Priesters. „Und ich glaube nicht, dass die Götter das gewollt haben!“