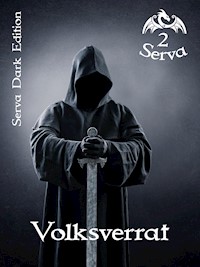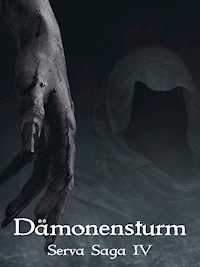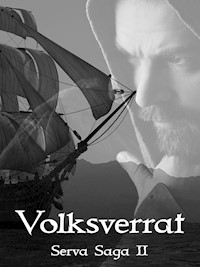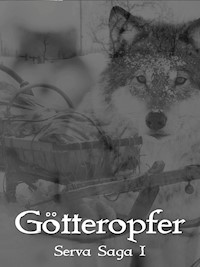Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Serva Dark Edition
- Sprache: Deutsch
Sieben auserwählte Jungfrauen machen sich auf dem Weg um den Göttern als Serva zu dienen. "Serva 1 - Götteropfer" ist die unzensierte Ausgabe von "Götteropfer" der Serva Saga mit einigen expliziteren erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Der 1. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 2. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 3. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 4. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 5. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 6. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Der 7. Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Impressum
Hinweis
Für die Serva Saga und die Serva Chroniken gibt es ein umfangreiches Nachschlagewerk unter https://www.serva-wiki.de. Hier findest du wichtige Informationen rund um die Welt von Ariton, eine Übersicht über wichtige Charaktere, über die Völker, die Städte und vieles mehr.
Der 1. Tag
1
Ewiges Eis
Für Hedda und ihren Bruder war es völlig normal. Unentwegt wanderte die Sonne entlang des Horizontes und ging nie unter. Noch nie hatte es einen Zeitpunkt in ihrem jungen Leben gegeben, wo sie die Sonne einmal nicht gesehen hatten. Noch nie hatten sie völlige Dunkelheit erlebt. Hier in der kalten Landschaft aus Eis und Schnee gab es keine Nacht. Hier in Ragnas, dem nördlichsten Teil der bislang bekannten Welt des Planeten Ariton. Es war immer Tag. Dennoch hatten sie einen Tagesrhythmus und richteten sich dabei genauso nach der Sonne, als wenn es Tag und Nacht gäbe.
Es war ein klarer heller Tag. Keine Wolke und kein Dunst vernebelten die Sicht. Die Sonne strahlte aus dem Süden. Ein leichter Wind wehte vom Westen. Die Luft war trocken, was die nordische Kälte angenehmer erscheinen ließ.
„Du glaubst mir nicht?“, fragte der Junge und trat wütend mit dem Fuß auf. Der lederne und fellbesetzte Schuh machte ein dumpfes Geräusch, als er auf dem Eis auftraf.
Seine Schwester Hedda lachte. „Doch, ich glaube dir schon!“ Hedda strich sich eine Strähne ihres schwarzen Haares aus ihrem Gesicht und verbarg diese unter der Kapuze. Sie war eine unglaubliche Schönheit unter den Ragni. Wie alle in diesem Land hatte sie makellose elfenbeinfarbene Haut, schwarzes Haar und stahlblaue, wache Augen. Das waren die wichtigsten Merkmale für dieses Volk.
„Nein, du glaubst mir nicht!“, sagt Hodi sauer. Er mochte es nicht, wenn seine ältere Schwester ihn wie einen kleinen Jungen behandelte. Auch wenn er das zweifelsohne war.
Hedda packte ihren Bruder an den Schultern. „Natürlich glaube ich dir. Ganz ehrlich. Großvater hat mir die Geschichte schon so oft erzählt!“
„Die Sonne wandert nicht am Horizont entlang“, meinte Hodi. „Sie kommt auf der einen Seite hoch, wandert dann direkt über die Köpfe hinweg und auf der anderen Seite wieder hinunter. Und dann wird es stockfinster! Ist das nicht verrückt?“
„Man nennt das die Nacht!“, sagte Hedda. „Glaub mir. Großvater hat mir die Geschichte wirklich schon so oft erzählt. Ich kann es gar nicht mehr zählen!“
„Aber ich frage mich, wohin die Sonne dann geht?“
Hedda grinste und warf die Fische in den großen ledernen Beutel auf dem Schlitten. „Ich weiß es nicht. Aber sie kommt ja immer wieder.“
„Aber, wenn sie verschwindet“, meinte Hodi, „dann sieht Regnator doch die Völker nicht mehr? Und er kann sie dann auch nicht beschützen?“
„Die Völker dort!“, flüsterte Hedda. „Die sehen nicht nur einen Gott. Sie sehen in der Nacht alle sieben weitere Göttersitze!“
„Wirklich?“
„Ja!“ sagte sie, trotz ihrer behandschuhten Hände verschloss sie geschickt den Beutel mit den Fischen. „Wenn die Sonne, der Sitz unseres Gottes Regnator, verschwindet, dann erscheinen Monde. Insgesamt gibt es sieben davon.“
„Was sind Monde?“, fragte Hodi irritiert. Er packte fein säuberlich das Angelzeug zusammen. Er wusste, dass sein Vater nach der Ankunft sehr genau kontrollierte, wie der Zustand der hölzernen Spule, der Schnur aus Lindenbast und des Angelhakens war. Vor allem der Lindenbast war teuer und musste mit viel Aufwand in der Hauptstadt besorgt werden.
„So etwas wie Sonnen. Nur nicht so hell!“, meinte Hedda. Sie hatte selbst noch nie einen Mond gesehen und auch sie wusste nicht, dass die Leuchtkraft jedes einzelnen Mondes wiederum durch die Sonne kam.
„Sie scheinen und dennoch wird es dunkel?“, fragte Hodi aufgeregt.
„Ja, weil sie nur niedrige Götter sind!“, meinte seine Schwester und legte die Leine des Schlittens um ihren Bauch. Wie auch auf der Herfahrt zog sie den Schlitten allein hinter sich und ihr Bruder ging dahinter.
„Warum kommen diese Götter nie zu uns?“
Hedda zuckte mit den Achseln. „Ich weiß es nicht. Aber sie sind für uns da. Ganz gewiss.“
„Vielleicht ist es ihnen bei uns zu hell!“, grinste der Junge und zog sich seine Schneeschuhe an. Zwei runde hölzerne Ringe in denen ein Netz aus Leder eingeflochten war. Es diente dazu die Auftrittsfläche im Schnee zu erhöhen, damit man weniger einsank. „Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich in den Süden!“
„Was willst du dort?“, fragte Hedda kopfschüttelnd.
„Die Nacht sehen!“, murmelte Hodi verträumt. „Und Gras!“
„Gras?“
„Großvater hat von großen grünen Flächen erzählt!“
Hedda lachte. „Er erzählt gerne und viele Geschichten. Nicht alles ist wahr!“
„Aber die großen grünen Flächen schon!“, sagte Hodi. Er schaute Richtung Norden und erblickte als erster den Mann, der auf sie zukam. Gut hundert Meter war er noch von ihnen weg. „Da kommt wer!“
Hedda schaute sich um und sah die Gestalt. Viel erkennen konnte man nicht. Sie nahm ihren Bruder am Arm. „Lass uns zurückgehen!“
„Willst du ihn nicht fragen, was er hier will?“, fragte Hodi.
Hedda schüttelte den Kopf. „Du weißt, was Vater über Fremde gesagt hat, oder?“
„Wir sollen mit keinem sprechen!“, meinte ihr Bruder. „Aber vielleicht benötigt er Hilfe oder will wissen, wohin er gehen muss!“
„Er sieht nicht aus, als bräuchte er Hilfe!“, meinte Hedda und ging los. Das Seil zwischen ihr und dem Schlitten spannte sich. Das hölzerne Transportmittel setzte sich in Bewegung.
„Wartet ihr beiden. Wartet auf mich!“, hörte man den Mann schreien. Seine Stimme war deutlich zu hören. Der Wind kam günstig aus Norden und trug jede Silbe klar zu ihren Ohren. Der Schall ließ sich von der strömenden Luft förmlich tragen.
„Hör nicht auf ihn!“, meinte Hedda und blieb für einen Moment lang stehen. Sie schaute hinüber zu dem Fremden, der immer näherkam.
„Er benötigt unsere Hilfe!“, sagte Hodi. „Sonst würde er nicht nach uns rufen. Vielleicht hat er sich verirrt!“
„Dann soll er uns zur Siedlung folgen!“, erwiderte seine Schwester und stapfte weiter. „Aber wir reden nicht mit ihm!“
Immer wieder drehte sich Hodi um. Der Abstand zwischen ihnen und dem fremden Wanderer verringerte sich nicht, aber er wurde auch nicht größer. Er folgte ihnen bis zu der kleinen Siedlung Tornheim, in der Hedda und ihr Bruder wohnten.
Gut dreißig Familien lebten auf der felsigen Anhöhe in Häusern aus Stein. Nur wenige Siedlungen in Ragnas hatten Steinhäuser. Viele Bewohner der nordischen Gegend außerhalb der großen Hauptstadt waren Nomaden und lebten in Zelten oder Iglus. Vor gut zwanzig Jahren hatte der König der Ragni befohlen mehrere Siedlungen aus Steinhäusern zu errichten. Tornheim war eine davon. Die Siedlung selbst war allerdings viel älter. Tornheim wurde bereits im aritonischen Jahr 236 besiedelt, im Jahr 710 hatte man die Haupthalle gebaut.
„Geh du voran!“, meinte Hedda. „Wir müssen die Dorfbewohner informieren, dass ein Fremder kommt! Das kannst du schon mal tun!“
Hodi nickte. Rasch zog er sich die Schneeschuhe aus und verschwand dann in einer Türe.
Man darf sich Tornheim nicht als Siedlung vorstellen, bei der verschiedene Häuser in bestimmtem Abstand zueinanderstanden. Vielmehr bestand das Dorf aus einer großen gemeinschaftlichen Halle in der Mitte, die mit den Häusern der einzelnen Familien verbunden war. Acht Schmale Gänge führten von diesem zentralen Haus sternförmig weg, durch die man in die kleineren Häuser gelangte. Zwischen diesen Gängen gab es immer vier dieser kleineren Gebäude. Insgesamt kam Tornheim neben der Haupthalle also auf zweiunddreißig weitere Häuser. In dreißig davon lebten die Familien, zwei weitere waren gemeinschaftliche Vorratshäuser. So war es möglich selbst bei widrigsten Umwelteinflüssen zwischen den Häusern zu wechseln. Das zentrale Haupthaus war der Mittelpunkt der Siedlung und des dörflichen Lebens. Im Endeffekt wie ein überdachter Dorfplatz.
Der junge Ragni rannte schnurstracks durch den langen Gang an insgesamt jeweils vier Familienhäusern zu seiner Linken und seiner Rechten vorbei und direkt in die Haupthalle.
Einige Frauen waren dabei Kleider zu nähen. Hellhäutige Ragni mit schwarzen Haaren, die sie meist offen und lang trugen. Ein paar wenige Frauen hatten graue oder gar weiße Haare, weil sie schon älter waren. Die schwarzen glatten Haare waren jedoch typisch für eine junge Ragni.
Eine weitere Frau legte in einen der acht Öfen, die sich jeweils zwischen den Gängen an den Seiten der Halle befanden, Holz. Die vier Familien des rechten Ganges neben den Holzöfen waren jeweils gemeinsam dafür verantwortlich, dass das Feuer ihres Kamins nicht ausging.
Hodi beachtete die Frauen nicht, sondern ging schnurstracks an den großen runden Tisch in der Mitte. Es gab mehrere Tische, er jedoch war der größte und nur den Männern vorbehalten. Ein paar Ragni saßen dort und unterhielten sich.
„Ein Fremder!“, rief Hodi laut. „Er kommt aus dem Norden!“
Die Männer standen sofort auf. Es war äußerst selten, dass jemand Tornheim besuchte. Und wenn, dann waren es keine Fremden, sondern Boten des Königs oder Händler aus der Hauptstadt Gunnarsheim, dem Königssitz. Beide würde der junge Ragni jedoch als solche erkennen.
Die Ernährung der Siedler in Tornheim bestand hauptsächlich aus Fisch. Der Fang war mühevoll. Zwar lag Tornheim direkt am Meer, doch das war zugefroren. Eine bis zu knapp ein Meter dicke Eisschicht trennte das Meerwasser von der Oberfläche. Das Eis isolierte jedoch auch das darunterliegende Wasser in der Weise, dass das Meer darunter nicht weiter einfror. So war die Schicht des sogenannten Packeises über dem Meer immer gut einen Meter dick. Außer an Stellen, wo es Meeresströmungen gab. Dünner als einen halben Meter war das Eis allerdings nie. Wer an die reichen Fischbestände heranwollte, musste sich einen Zugang schaffen. Hierzu schlug man Wuhnen ins Eis. Löcher, die man mit einem Eispickel mühevoll täglich offenhielt.
Zwanzig Fische hatte Hedda gemeinsam mit ihrem Bruder gefangen. Eine recht ausgiebige Beute. Ihr Vater würde stolz auf sie sein. Seit dem Tod ihrer Mutter nahm die junge Ragni eine wichtige Rolle ein und musste viel Verantwortung übernehmen. Für die Familie. Für ihren Vater und ihren Bruder. Sie war die Frau im Haus, obgleich sie selbst eigentlich sehr jung war.
Hedda nahm den Beutel mit den Fischen. Sie wollte gerade hineingehen, als der Fremde plötzlich neben ihr stand. „Sei gegrüßt, junge Dame!“
Sie schaute ihn erschrocken an. „Wer seid Ihr?“. Sie betrachtete den Mann von oben bis unten. Er hatte keine fellbesetzte Kleidung, sondern trug einen ledernen Anzug, der mit Schafswolle ausgekleidet war. Der Fremde war definitiv kein Ragni.
„Ich bin auf der Durchreise!“, meinte der Mann und schaute sich Hedda genauer an. Sie hatte ihre Kapuze nun nach hinten gezogen und ihr wunderschönes Gesicht kam zum Vorschein. „Du bist Hedda, richtig?“
Sie nickte überrascht. „Woher kennt Ihr meinen Namen?“
„In ganz Ragnas spricht man von der Schönheit der Tochter von Loros!“, sagte der Mann.
Sie wurde rot. „Verzeiht, mein Herr, dass wir nicht gewartet haben!“, entschuldigte sie sich.
Er schüttelte den Kopf. „Es ist hier Brauch keinen Fremden dort draußen im Eis zu begrüßen oder sich ihm zu nähern, es sei denn er ist verwundet. Und ihr habt mich nach eurer Sitte zu eurer Siedlung geführt. Das ist Gastfreundschaftlichkeit genug!“
„Ihr seid kein Ragni!“, meinte Hedda. Ihre stahlblauen Augen fixierten den Mann. Er hatte kurzgeschorenes Haar und einen Vollbart. Kein einziger Ragni trug je einen Bart und das Haar wurde nie kürzer als bis zur Schulter geschnitten.
„Ich bin ein Mani!“, sagte der Fremde.
Es war der erste Mani, den die junge Ragni sah. Ihr Großvater hatte viel vom Land Manis erzählt. Von den stolzen Männern und Frauen, die wohl eines der am weitesten entwickelten Völker ausmachten. Ihr Großvater hatte einige Zeit in einer der Städte dort gelebt.
Die Türe zur Siedlung ging auf und vier Ragni erschienen. Darunter auch Loros, der Stammeshäuptling von Tornheim und Vater von Hedda und Hodi.
„Geh hinein!“, befahl Loros seiner Tochter.
„Ihr seid der Bürgermeister dieser Siedlung?“, fragte der Mann aus Manis.
Loros schüttelte den Kopf. „Wir haben keine Bürgermeister, so wie Ihr es kennt. Ihr seid ein Mann aus Manis, nehme ich an. Ich bin der Häuptling dieser Siedlung!“
„Es kommt aufs Gleiche raus!“, sagte der Fremde. „Mit dem Unterschied, dass unsere Dorfvorsteher gewählt werden. Ihr hingegen sicherlich nicht!“
Loros verneinte. „Nein! Das bin ich in der Tat nicht. Was treibt Euch hierher? Wir haben nicht häufig Gäste.“
„Ich bin auf dem Weg nach Gunnarsheim!“, meinte der Mann im ledernen Anzug.
Der Stammeshäuptling schaute ihn verwundert an. „Woher kommt Ihr? Bis nach Gunnarsheim seid Ihr gut drei Wochen zu Fuß unterwegs. Und auf dem direkten Weg kommt keine Siedlung mehr.“
„Deshalb wollte ich Euch bitten meine Vorräte auffüllen zu lassen! Ich brauche Angelzeug. Und wenn Ihr habt etwas Fett!“
Loros schaute ein wenig missmutig drein. Doch dem Fremden zu misstrauen war vermutlich falsch. So allein war er keine Gefahr. Deshalb nickte er. „Gut. Ihr könnt es haben!“
„Ich bezahle euch auch!“, meinte der Fremde aus Manis. „Ich habe Gold- und Silbertaler!“
„Das ist gut!“, sagte Loros. Für die Bewohner der Siedlung waren die Taler eine einfache Möglichkeit in Gunnarsheim, der Hauptstadt der Ragni, Waren zu bekommen. „Kommt herein. Ihr könnt euch in der Haupthalle ausruhen!“
„Du vertraust ihm, Papa?“, fragte Hodi und riss am Ärmel seines Vaters.
„Warum nicht?“, Loros schaute dem Fremden hinterher. Dieser folgte den anderen drei Männern ins Innere von Tornheim.
„Hedda hat ein ungutes Gefühl!“, meinte der Junge.
Sanft kniff der Häuptling seinem Sohn in die Wange. „Deine Schwester macht sich immer irgendwelche Gedanken. Mach dir keine Sorgen. Der Mann ist allein. Er kann uns nichts tun!“
2
Xipe Totec
Am anderen Ende der bekannten Welt von Ariton lebte das Volk der Nehataner. Weit weg von den im Norden lebenden Ragni. Südlich der großen Wüste Gory. Viele glaubten, dass die Ragni auf der einen Seite von Ariton waren und die Nehataner auf der anderen Seite dieser Welt. Das war im Grunde falsch, denn weiter südlich gab es das tatsächliche Gegenstück zum Land Ragnas, wo es ebenfalls nur Eis und Schnee gab. Und ewige Dunkelheit. Aber auf keiner bekannten Karte des Jahres 799 war dies verzeichnet. Noch nie war einer derart weit in den Süden vorgedrungen. Allgemein war die Welt noch nicht komplett erforscht. Auch, was auf der anderen Seite des Planeten war, wusste niemand. Auch nicht, ob es dort noch weiteres Leben gab.
Die Nehataner waren oft von großer, kräftiger Statur. Ihre Hautfarbe war von sehr dunkler, fast schwarzer Farbe. Die Frauen, meist füllige Damen, trugen langes dickes Haar. Die Männer scherten ihre Haare in der Regel recht kurz oder sogar ganz ab. Für viele andere Völker waren die Nehataner grobschlächtige Riesen. Barbaren, die sich gerne prügelten und literweise Wein tranken. Händler, die das Land der Nehataner besuchten, erzählten von großen Festen, wo man riesige Ochsen briet und sich gegenseitig zum Spaß prügelte. Wo Frauen mit nacktem Oberkörper vor den Männern tanzten und es immer wieder zu öffentlichen sexuellen Ausschweifungen kam. Die Händler übertrieben des Öfteren mit ihren Darstellungen, um ihren eigenen Geschichten noch mehr Würze zu verleihen. Aber vieles war wahr. Die Nehataner waren ein grobschlächtiges Volk.
König Atlacoya war einer der kräftigsten Männer in der gesamten Welt. Der gut zwei Meter große Herrscher des schwarzen Volkes, so wurden sie von den anderen Völkern meist genannt, saß in seinem Thronstuhl.
Vor ihm kniete eine junge Nehatanerin und besorgte es ihm mit dem Mund. Sie war eine Sklavin aus einem kleinen Dorf. Ihr Vater schuldete dem Königreich die Abgaben von zwei Jahren und so hatte der König kurzerhand die Tochter in Zahlung genommen.
„Atlacoya, ich muss mit dir reden!“, sagte ein Mann, der neben dem König stand und das bizarre Spiel mit anschaute, nun aber nicht mehr schweigen konnte. Es brannte ihm etwas gewaltig auf der Seele, das spürte man. Der Mann, der ebenfalls nur einen Lendenschurz trug, sah dem König verdammt ähnlich. Und das nicht ohne Grund. Chantico war nicht nur der höchste militärische Führer der Nehataner, sondern auch der Bruder von König Atlacoya. Allerdings war er nicht so kräftig und durchtrainiert.
„Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin?“, stöhnte der Herrscher unter dem Einfluss der weiblichen Liebkosung seines männlichen Geschlechts.
Chantico schwieg und starrte auf die Szene vor sich.
Immer wieder glitten die Lippen der jungen Sklavin über den Schaft seines Bruders.
„Nimm sie dir von hinten, während sie mich bläst!“, meinte Atlacoya gönnerisch. Er hatte die Augen geschlossen. Sein kahlrasierter schwarzer Schädel mit den breiten Wangenknochen und der platten Nase lehnte am Thron. Mit seinen kräftigen Armen, die von gewaltigen sichtbaren Adern durchzogen waren, hielt er sich an der Armlehne fest. Sein Oberkörper war nackt, was nicht untypisch für die Nehataner war. Bis auf den Lendenschurz trugen sie in der Regel keine Kleidungsstücke. Die Frauen hingegen trugen lederne Kleider. Doch diese vor dem König kniende Frau war komplett nackt.
Chantico verdrehte die Augen.
„Möchtest du, dass sie dich auch verwöhnt?“, fragte der König.
Chantico schüttelte stumm den Kopf. Er hatte keine Lust die Spielchen seines Bruders mitzuspielen. Auch er, als der höchste militärische Führer von Nehats, konnte sich alle Frauen nach Belieben nehmen. Egal ob verheiratet oder nicht. Das war das gute Recht der königlichen Familie. Allerdings gab es dabei ein kleines Problem. Chantico fand Frauen in keiner Weise sexuell attraktiv. Er bevorzugte die jungen, nackten Leiber von zierlichen Männern. Richtig ausleben konnte er diese Neigung nur schwer. Denn jegliche gleichgeschlechtliche Liebe war bei den Nehatanern verpönt.
Chantico schaute zu, wie sein Bruder zum Höhepunkt kam.
Er sah, wie dieser seinen dicken Phallus tief in die Kehle der jungen Sklavin trieb und abspritzte. Die Nehatanerin hustete und würgte. Sperma rann an ihren Mundwinkeln herab und tropfte auf den kalten Boden vor dem Thron.
„Oh, ist das gut!“, seufzte der König.
„Hast du es dann?“, fragte der militärische Führer genervt.
Sein Bruder, der König, grinste. „Ja!“ Er gab der Sklavin einen Wink, um ihr zu verdeutlichen, dass sie sich zurückziehen sollte.
Diese wischte sich den Mund ab und verschwand dann zügig.
„Herrgott, Bruderherz. Deine Armee steht auf dem Platz des Krieges bereit und du hast nichts Besseres zu tun, als es dir von einer jungen Sklavin besorgen zu lassen.“
Atlacoya stand auf. Sein schlaffes Geschlecht wurde wieder unter dem ledernen Lendenschurz verborgen und der König streckte sich. Der zwei Meter Hüne ging langsam die Stufen vom Thron herunter und sein Bruder folgte ihm. Dann meinte Atlacoya. „Bruderherz. Das ist gut. Ich werde meine Ansprache halten und dann könnt ihr losziehen!“
„Du bist dir also sicher?“, fragte Chantico. „Du willst gegen die Pravin ziehen?“
„Wir werden uns nehmen, was uns zusteht!“, nickte der hünenhafte König. „Wir werden uns das fruchtbare Land an der Küste nehmen!“
„Nun!“, meinte sein Bruder. „Meine Armee steht bereit. Also warte nicht länger. Halte deine Rede!“
„Meine Armee!“, betonte der König mahnend. Er wusste, dass Chantico sich als Führer mit der Armee sehr stark identifizierte. Aber er war „nur“ der eingesetzte General. Jederzeit austauschbar.
„Deine Armee, Bruder, deine Armee!“, nickte der Feldherr.
Der Platz des Krieges hatte seinen Namen vom zwanzigjährigen Krieg gegen die Shiva. Gut hundert Jahre war das schon her. Keiner der beiden Völker war im Grunde als Sieger aus den Schlachten gegangen. Allerdings hatten die Shiva die Western Insel für sich beansprucht. Eine Insel auf die der damalige König der Nehataner gut verzichten konnte.
Viele hatten ihr Leben verloren. Atlacoyas Urgroßvater hatte den Platz danach erbaut und ihn zur Erinnerung an den Krieg so genannt.
Dreihundert Männer füllten den Platz mitten im Zentrum von Xipe Totec, der Hauptstadt der Nehataner. Darunter waren hundert Schwertkämpfer, hundert Bogenschützen und hundert Reiter. Rund viertausendsiebenhundert weitere Krieger waren vor den Toren der Stadt versammelt. Insgesamt umfasste die Armee also fünftausend Mann. Bis auf wenige junge Krieger, die noch in der Ausbildung waren und die wenigen Einheiten, die die Städte und die Häfen bewachten, war das die gesamte Armee der Nehataner. Chantico hatte entschieden keine Reserven in den Städten zurückzulassen. Seine Offiziere hatten ihm davon abgeraten. Jeder Feldherr musste eine Reserve bilden, egal was ihn mit seiner Armee erwartete. Aber Chantico plante lediglich eine mobile Reserve, die unmittelbar in seiner Nähe war. Er wollte nicht alle Truppen gleichzeitig in Pravin einmarschieren lassen, sondern einen Teil an der Grenze stationieren und später nachrücken lassen. Was völlig überzogen war. Die Pravin, so berichteten Späher, hatten in dem schmalen Landstreifen an der Küste ohnehin nur gut fünfhundert Mann stationiert. Insgesamt hatte die Armee der Pravin gerade mal zweitausend Mann und die meisten waren im östlichen Teil des Landes stationiert. Ein großes Gebirge machte eine schnelle Mobilisation der Truppen an der Küste entlang schlichtweg unmöglich. Die Einheiten aus der Hauptstadt der Pravin mussten durch die große Sandwüste. Es würde Wochen benötigen, bis sie den Küstenstreifen, auf den es die Nehataner abgesehen hatten, erreichen würden.
Hundert Treppen führten vom Platz des Krieges hinauf zum Vorplatz des Königspalastes. Ein gewaltiges monströses Bauwerk aus grob gehauenen sandfarbenen Steinen, die man im nahegelegenen Gebirge im südlichen Ausläufer der Wüste in den Steinbrüchen gehauen hatte. Die Nehataner waren vor allem für ihre erfahrenen Steinmetze bekannt. Der königliche Palast war ein Meisterwerk der Architektur. Viele Sklaven waren nötig gewesen, um dieses Monstrum zu erschaffen.
Atlacoya stand ganz oben auf dem Vorplatz seines Palastes. Stolz stand er da. Der Hüne von einem Mann, von dem alle glaubten, dass er mit seinen großen Händen ohne Probleme den Kopf eines jeden Feindes zerdrücken konnte. Und Feinde hatte Atlacoya viele. Vor allem im eigenen Land. Die hohen Abgaben waren ein Grund. Ein weiterer die Willkür der Armee, die im Endeffekt ganze hundert Jahre keinen Krieg mehr erlebt hatte. Ihre Aufgabe war vor allem der Kampf gegen Aufständische und politische Gegner. Auch Atlacoyas Vater war nicht für seine Gnade bekannt gewesen. Aber Atlacoya übertraf dessen politische Härte um Weiten. Und dennoch wurde er wie ein Gott verehrt.
„Nehataner, Volk von Nehats!“, begann König Atlacoya seine Rede. „Die Götter meinten es in den vergangenen zwei Jahren nicht gut mit uns. Erst viel zu viel Regen und die Ernte verschimmelte und dann war es zu heiß und die Felder verdorrten. Unsere Kornspeicher sind so gut wie leer. Unser Volk steht in Gefahr hungern zu müssen. Die Pravin hingegen fressen sich auf ihrem kleinen Landstreifen zwischen der Wüste und dem Meer satt. Ihnen waren die Götter gnädig. Warum auch immer. Zwanzig Jahre ist es nun schon her, dass die Pravin von meinem Vater diesen kleinen Landstreifen bekommen haben und sie sich dort ansiedelten. Aber rein rechtlich gehört dieses Stück fruchtbare Land uns! Und wir werden es uns wiederholen!“
Die Soldaten jubelten.
„Wir werden in Pravin einmarschieren. Und ich sage euch, jeder Pravin, der Widerstand leistet, wird getötet. Alle aber, die sich uns unterwerfen, dürfen uns dienen.“
Erneut jubelten die Krieger, während der König eine Pause machte.
„Die Frauen und Kinder sollen unserem Volk als Sklaven dienen und die Männer Kriegsdienst leisten!“
Ein drittes Mal jubelte die Armee der Nehataner.
Und auch das Volk jubelte. Auf den Flachdächern rund um den Platz des Krieges hatten sich die Stadtbewohner, Bauern aus den umliegenden Gegenden und Händler, Steinmetze, Frauen, Kinder und Alte versammelt, um Zeuge dieses Spektakels zu werden. Es war seltsam. Gerade so als würde der ganze Zorn, den das Volk durch ihren König zu spüren bekam, sich nun auf den Nachbarn verlagern. König Atlacoya schaffte für sich ein neues Feindbild, das nicht im eigenen Land war. Das kein politischer Gegner oder Aufständischer war. Und das Volk genoss diese Verlagerung der Gewalt.
Feldherr Chantico stand neben seinem Bruder. Er liebte ihn, so gut er konnte. Er war sein Fleisch und Blut. Aber viel gemeinsam hatten sie nicht. Chantico war weder ein brillanter Stratege, was das Militär anbelangte, noch war er ein großer Krieger. Aber er tat sein Bestes, um seinen Bruder zufrieden zu stellen. Die Aussicht auf einen Krieg gegen die Pravin jedoch machte ihm Angst.
„Und, wie waren meine Worte?“, fragte Atlacoya. Es war keine Frage, auf die er eine ehrliche Antwort erwartete, sondern vielmehr nach Bestätigung verlangte. Der König ließ kaum Kritik zu. Auch nicht durch seinen Bruder.
„Vater wäre stolz auf dich gewesen, Bruderherz!“, sagte Chantico.
„Oh, er ist stolz. Dort oben in der Ewigen Sonne sitzt er neben Regnator und schaut auf uns herab. Und er schaut auf dich, mein Bruder. Auf den großen Feldherrn!“
„Ich werde mein Bestes geben!“
„Das Beste ist nicht genug für mich und mein Volk. Du musst mehr geben!“, grinste Atlacoya. „Und nun lasse die Truppen abziehen!“
Chantico nickte. Er schaute hinüber zu seinem Feldmarschall und gab den Befehl den Platz zu räumen. Die Truppen sollten zurück in ihr Feldlager. Der König hatte gesprochen und war nun fertig.
3
Tornheim
Hedda hatte sich ihrer Fellkleidung entledigt und hängte sie an ihren persönlichen Haken in der Gemeinschaftsunterkunft. Die Kleidung eines Ragni war sein vermutlich wertvollster Besitz und sicherte sein Überleben in der eisigen Kälte des Ewigen Eises. Die Fellkleidung bestand aus graubraunem Rentierfell. Man jagte die Tiere im Süden nahe den Wäldern der Hauptstadt Gunnarsheim. Die Felle boten einen guten Schutz vor Kälte und Nässe. Sie waren wasserabweisend und schafften zudem einen guten Windschutz. Doch das recht brüchige Haar war nicht lange haltbar. Um die dreißig Fälle benötigte eine durchschnittliche Familie in Tornheim pro Jahr. Sie dienten nicht nur als Kleidung, sondern auch als Decken. Ältere, nicht mehr ganz so gute Felle, wurden auf dem Boden der Gebäude ausgelegt und dienten in gewisser Weise als Teppich. Über die Jahre hinweg war so der gesamte Boden von Tornheim mit Fellen ausgekleidet worden.
Im Inneren der Siedlung war es angenehm warm. Traditionell trugen die Ragni innerhalb des Gebäudekomplexes lediglich ihre Unterkleidung. Dünne Hosen und Hemden aus Leinen. Man ging grundsätzlich barfuß, was angesichts des ausgelegten Fellteppichs kein Problem war.
„Wer ist der Mann?“, flüsterte Hedda.
Loros schaute seine Tochter an und schüttelte dann den Kopf. „Ich weiß es nicht. Er kommt von weit her. Er ist ein Mani!“
„Aber wieso kommt er dann aus dem Norden?“, fragte Hedda irritiert und schaute zu dem Fremden, der gierig den Fisch aß, den die Bewohner ihm angeboten hatten.
„Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und jetzt geh raus und versorge die Hunde. Bringe ihnen Fisch, sie sind hungrig!“
„Kann das nicht Hodi machen?“, fragte sie beleidigt.
„Er soll bei uns Männern sitzen. Das Füttern der Hunde ist Frauenarbeit!“, meinte Loros streng.
Hedda schaute ihn böse an. Sie arbeitete hart und viel. Und sie fand es ungerecht, dass ihr jüngerer Bruder oft besser behandelt wurde und bei den Männern sitzen durfte. Aber dann gehorchte sie. Rasch nahm sie erneut ihren Mantel und ihre Schuhe. Missmutig stapfte sie Richtung Ausgang und kam dabei an dem Mani vorbei.
„Sie ist Eure Tochter, richtig?“, grinste der Fremde und packte Hedda am Arm. „Sie ist wunderschön!“
„Lasst sie!“, sagte Loros.
„Verkauft Ihr sie mir?“
Loros stand auf und griff zu seinem Dolch, den er an einem Gürtel trug. „Ich weiß, dass die Mani sich Sklaven halten. Genauso wie die Nehataner, die Pravin und die Shiva. Aber wir nicht. Bei uns sind alle Ragni frei.“
„Sehr bedauerlich!“, grinste der Fremde und schaute in die stahlblauen Augen von Hedda. Schüchtern wich sie seinem Blick aus. Dann ließ er sie los und schaute ihr hinterher. „Sie würde Euch viele Taler bescheren!“
„Wie gesagt, wir Ragni haben diese Unart nicht andere zu unserem Eigentum zu machen!“
„Unart?“, lachte der Mani. „Es gibt sieben Völker. Aber wir haben nur einen Gott.“
„Es gibt acht Götter!“, korrigierte Loros.
„Wir haben einen Gott und sieben Nebengötter. Wie wir auch nur eine Sonne und sieben Monde haben. Aber der Punkt ist, dass wir auch nur ein Gesetz haben. Und dieses Gesetzt erlässt Regnator. Und das erlaubt uns Sklaven zu halten!“
„Es mag sein, dass wir die gleichen Götter haben. Aber dennoch hat jedes Volk seine eigenen Regeln!“
„Die Gesetze von Regnator stehen über den Regeln und Gebräuchen der Völker!“, meinte der Fremde und stand auf. „Oder irre ich mich?“
„Wir alle wissen, dass die Gesetze unseres Gottes Regnator von einem Mani aufgeschrieben wurde. Vor Hunderten von Jahren.“
„Sie sind dennoch für alle bindend!“
„Aber sie sind von einem aritonischen Wesen verfasst worden.“
„Gott Regnator persönlich hat die Worte diktiert.“, sagte der Mani. Er wusste, dass die Ragni ihren Götterglauben durch Erzählungen, Mythen und Sagen aufrecht hielten, nicht durch geschriebene Worte. Die wenigsten Ragni konnten lesen oder gar schreiben.
Loros schüttelte den Kopf. „Es spielt keine Rolle. Ihr sucht doch nur einen Grund meine Tochter zu … zu kaufen! Vergesst es. Ich lasse diesen Handel nicht zu.“
Der Mani ging einmal um den Tisch herum, an dem gut zwanzig Männer saßen. „Warum sitze ich an einem der anderen Tische ringsherum? Warum nicht an eurem großen Tisch in der Mitte?“ Er schaute sich um. An den anderen Tischen saßen Kinder und Frauen.
„Ihr seid keiner von uns!“, sagte Loros. „Nur Männer unseres Stammes dürfen an der großen Tafel Platz nehmen.“
„Ihr seid ein zurückgebliebenes Volk!“, spottete der Fremde und öffnete dann einen Beutel. Er legte drei Taler auf den großen runden Tisch.
„Was tut Ihr?“, fragte das Stammesoberhaupt.
„Oh, ich darf als Fremder nicht einmal euren Tisch berühren?“, grinste der bärtige Mann. Aber er scherte sich nicht um die Regeln der Ragni und zeigte auf die Münzen. „Das sind drei Silbertaler. Vielleicht hat einer der anderen anwesenden Väter eine hübsche Tochter und würde sich gerne diese drei Taler verdienen?“
Es war still im Raum. Loros schaute sich um. Ein paar der Männer schienen tatsächlich zu überlegen. Drei Silbertaler waren in der Stadt Gunnarsheim viel Wert. Er durchbrach die Ruhe, nahm die Taler an sich und drückte sie dann dem Fremden in die Hand. Bevor jemand seiner Leute antworten konnte. „Nehmt Euer schmutziges Geld. Hier geht keiner auf Euer Angebot ein!“
„Äußerst bedauerlich!“, meinte der Fremde. „Wie dem auch sei. Ich bräuchte ein Nachtlager. Oder besser ein Ruhelager. Eine Nacht gibt es hier ja nicht.“
Loros gefiel der Ton des Mannes nicht. Man merkte deutlich, dass er das Gefühl hatte etwas Besseres zu sein. Es war tatsächlich so, dass die Mani die wohl fortschrittlichste Kultur besaßen. Dennoch waren vor Regnator, dem Gott aller Völker, alle gleich. Eine Herrenrasse gab es nicht. Aber er wollte den Fremden auch nicht verärgern. „Wir stellen Euch ein Bett zur Verfügung!“
„Das ist nett!“, grinste der Fremde.
Draußen vor den Gebäuden ging Hedda auf die Hunde zu. Sie jaulten laut. Das Alphatier fing an und nacheinander stimmten die einzelnen Mitglieder des Rudels in den Gesang ein. Durch das markante Heulen festigte jeder einzelne Schlittenhund seine Zugehörigkeit zum Rudel. Zudem markierten sie damit ihr Territorium. Jetzt jedoch signalisierten sie Bereitschaft für die Jagd. Die im Grunde keine war. Denn es war Hedda, die kam und die Beute bereits erlegt hatte.
Hedda verteilte den getrockneten Fisch. Der frische Fisch des heutigen Tages war für die Ragni bestimmt. Den Hunden schien das nichts auszumachen. Gierig stürzten sie sich auf die Fleischbrocken.
Wer war dieser Mann? Hedda fröstelte bei dem Gedanken an ihn, obwohl sie warm eingepackt war. Er hatte sie kaufen wollen. Als Sklavin. So richtig war ihr nicht bewusst, was das bedeutete. Aber ein wenig konnte sie es sich denken. Aber warum? Warum kam er hierher und bot Geld für sie?
Die junge Ragni verdrängte den Gedanken. Diese Welt, in der sie lebte, war ein Paradies aus Eis und Schnee. Hier kamen normalerweise keine Fremden her. Hier gab es wenig Streit. Und wenn, dann war der schnell geschlichtet. Man musste sich zusammenraufen, um zu überleben. Jede Familie half mit. Jeder einzelne Ragni trug seinen Beitrag bei. Fremde hatten hier nichts verloren.
Vor der Siedlung Tornheim gab es einen großen säulenförmigen Stein, der gut zwei Meter hoch war. Um ihn herum hatten die Bewohner lange Stäbe in den Boden gehauen. Für die Ragni war dies eine Art Sonnenuhr. Je nachdem auf welcher Seite der Stein seinen Schatten warf, wussten sie, welche Tageszeit sie hatten.
Im Grunde war die Ruhezeit der Ragni immer dann, wenn die Sonne vom Westen über den Norden nach Osten wanderte. Sagte man den Kindern, dass die Sonne bereits den Westen durchlaufen hatte, dann wussten diese, dass es Zeit für das Bett war. Nicht immer konnte man die Sonne sehen. Oft war sie durch Wolken verdeckt oder ging in einem Schneesturm unter. Dann funktionierte natürlich auch das Spiel von Schatten und Licht nicht. Aber der Sonnenstein, wie ihn die Ragni nannten, war ein wichtiges Hilfsmittel. An diesem Tag war die Sonne jedoch deutlich zu sehen.
Einundzwanzig Stunden hatte ein Tag. So lange brauchte der Planet um sich um seine eigene Achse zu drehen. Die Ragni hatten einen klaren Tagesablauf. Sieben Stunden wurde geschlafen oder zumindest geruht, sieben Stunden gearbeitet und sieben Stunden verbrachten sie für sich oder mit ihrer Familie.
Nachdem Hedda mit den Hunden fertig war, ging sie wieder hinein. Schnurstracks steuerte sie auf ihren Bruder zu.
„Du solltest nun schlafen gehen!“, meinte Hedda zu ihm.
Hodi schnaubte böse. Er hatte keine Lust ins Bett zu gehen. Der fremde Mann erzählte Geschichten und einige Männer standen um ihn herum und hörten ihm zu. „Warum darf ich nicht von den fremden Ländern hören?“
„Hör auf deine Schwester!“, meinte sein Vater streng und schaute dann misstrauisch in die Richtung des Fremden. Zumindest seinen Namen hatte er nun genannt. Ludwig von Battleton. Allzu viel brachte dieses Wissen Loros allerdings nicht. Dennoch hätte er zumindest vom Namen her wissen wollen, mit wem er es zu tun hatte. Aber er ging stark davon aus, dass er nicht ehrlich war.
„Du traust ihm doch nicht?“, fragte Hedda.
„Bring deinen Bruder ins Bett!“, meinte Loros. Er hatte keine Lust darüber zu diskutieren. Dann ließ er seine Tochter und seinen Sohn stehen und ging zu dem Fremden.
„Ihr kommt aus dem Norden!“, sagte Loros. Es war eine Feststellung, keine Frage.
Der Fremde nickte. „Ja. Das ist richtig!“
„Im Norden gibt es nichts als Eis und noch mehr Eis!“, meinte der Häuptling von Tornheim kritisch. „Es kommt mir einfach nicht in den Sinn, was Ihr da oben verloren hattet!“
„Ich war dort oben bei den Nomaden!“, antwortete der Mann, der sich selbst Ludwig von Battleton nannte.
„Was wolltet Ihr dort oben? Fische gegen Gold tauschen? Versteht mich nicht falsch, Sir. Aber da oben gibt es wirklich nichts, was sich lohnt zu besitzen.“
„Ich verstehe, dass Ihr misstrauisch seid! Aber das ist nicht nötig. Ich bin nur ein einsamer Wandersmann, der das Land entdecken möchte!“
„Nun gut!“, erwiderte Loros. Er hatte keine Lust mehr mit diesem Herrn zu diskutieren. Weil er ihm ohnehin nur das erzählte, was er auch wirklich erzählen wollte. Die Wahrheit würde er nicht erfahren. „Ich gehe schlafen, nachdem ich noch einmal meine Runde um die Siedlung gemacht habe. Ihr habt Euer Lager. Das sollte reichen!“
„Sehr großzügig!“, sagte der Mani. Seine Worte hatten aber einen deutlichen ironischen Beigeschmack.
Währenddessen zog sich Hedda aus. Ihr Bruder betrachtete sie dabei.
„Schau weg!“, meinte sie zu ihm.
„Dein Busen ist groß geworden!“, sagte er grinsend.
„Schau weg!“, sagte sie erneut.
„Gibst du damit irgendwann Milch?“
„Herrje. Hör auf zu fragen!“, meinte sie und nahm sich ihr Fell, dass ihre Bettdecke war. Sie bedeckte damit ihren nackten Körper.
„Warum sagst du es nicht einfach? Was ist schon dabei?“
„Nichts ist dabei! Aber es ist unhöflich eine Frau so anzustarren!“
„Streichelst du dich da unten manchmal?“
Sie wurde rot. „Natürlich nicht. Und jetzt hör auf!“
„Jede Frau streichelt sich dort unten!“
„Wer sagt denn das, bitte?“
„Die älteren Jungs erzählen sich das. Die dunkelhäutigen Frauen machen es sich sogar gegenseitig, sagt man!“
„Es gibt drei dunkelhäutige Völker!“, sagte sie und stieg auf ihr Bett. „Und ich glaube, die Jungs erzählen nur dummes Zeug. Selbst haben sie es noch nie gesehen!“
„Freilich haben sie es selbst noch nie gesehen. Aber sie waren in Gunnarsheim. Und da hat man das erzählt. Die Seeleute erzählen das.“
„Toll!“, sagte Hedda. „Und trotzdem kann es nur Gerede sein. Auch von den Seeleuten. Außerdem habe ich noch nie gehört, dass ein Schiff der Ragni so weit in den Süden gefahren ist. Die fahren doch nur bis Manis!“
„Und auch dort erzählt man sich Geschichten!“, grinste ihr Bruder.
„Sicher. Auch dort. Überall erzählen die Männer Geschichten. Und wenn die Geschichten dann hier oben angekommen sind, dann sind sie plötzlich voller blühender Fantasie!“
„Darf ich zu dir ins Bett?“, fragte er.
Hedda schüttelte den Kopf. „Nein, darfst du nicht.“
„Früher durfte ich immer in dein Bett!“
„Früher, ja. Da war ich auch noch keine Frau. Die Zeiten ändern sich und jetzt schlaf, Bruderherz!“
„Die Jungs reden über dich!“, meinte Hodi.
„Ach tatsächlich? Was reden sie denn?“
„Man sagt, du bist die schönste Ragni der ganzen Welt!“
„Hör nicht drauf!“, erwiderte sie. Aber es machte sie Stolz. Unglaublich stolz sogar.
„Ganz ehrlich. Das sagt man sogar in Gunnarsheim!“
„Woher wollen die das denn wissen?“, fragte sie.
„Keine Ahnung ...“
„Von Erzählungen. Und die Erzählungen kommen von Leuten, die wieder Erzählungen gehört haben. So geht das immer weiter!“
„Nun, unser Volk ist nicht so groß!“, meinte Hodi. „Da spricht sich das schnell rum! Vielleicht ist der Mann wegen dir hier!“
„Wie meinst du das?“, fragte Hedda irritiert. Sie richtete sich auf und das Fell rutschte ein wenig hinunter.
„Du hast wirklich schöne Dinger!“, grinste er.
Sie bedeckte rasch ihre Brüste. „Was meintest du mit diesem Mann?“
„Ich habe nur ein Witz gemacht!“, sagte Hodi. „Aber irgendwann wirst du wegziehen. In eine andere Siedlung. Zu einem Mann!“
„Ja!“, sagte Hedda. „Irgendwann!“
„Oder in die Stadt!“
„Nein, ich möchte nicht in die Stadt. Ich will hier oben im Ewigen Eis leben. Für immer!“
„Ich nicht. Ich möchte irgendwann mal in den Süden ...“
„Weißt du, Bruderherz. Der Süden ist nicht so toll, wie alle sagen. Es gibt dort Länder, da ist es immer heiß. Da schwitzt man wie verrückt!“, sie grinste. „Würde dir das gefallen? Immer zu schwitzen?“
Er antwortete nicht.
„Hodi?“, fragte sie und richtete sich zum zweiten Mal auf. Sie lauschte und hörte den ruhigen Atem ihres Bruders. Er war eingeschlafen.
Glaubte sie zumindest. Doch in Wirklichkeit war er noch wach. Er wusste, dass sie eine Träumerin war. Sie gingen immer zur gleichen Zeit ins Bett, aber sie konnte noch nicht schlafen. So auch an diesem Abend. Er beobachtete sie, wie sie aufstand. Nackt wie sie war, ging sie zum Kamin. Sie setzte sich davor und schaute auf das prasselnde Feuer.
Die Jungs hatten recht. Sie sah gut aus. Aber sie wussten nicht, wie gut sie aussah. Noch nie hatte sie einer nackt gesehen. Er schon. Es war nicht so, dass er auf seine Schwester scharf war. Dafür war er zu jung. Aber neugierig war er schon. Sie war die einzige Möglichkeit für ihn einen nackten weiblichen Körper zu sehen. Brüste zu sehen. Titten, wie die älteren Jungs sagten. Sie sprachen oft über die „Titten“ seiner Schwester. Wenn sie ihn fragten, ob er sie jemals gesehen hatte, dann hatte er es immer geleugnet. Weil er Angst davor hatte, dass er dafür bestraft wurde. Dass man ihn dafür verurteilen würde, dass er seine Schwester beobachtete. So wie jetzt zum Beispiel. Natürlich würde das keiner. Vielleicht würde sein Vater ihm eine Ohrfeige geben, aber mehr auch nicht.
Hodi spielte an seinem Penis. Er wusste nicht warum. Es gab keine direkte Verbindung zwischen seiner Schwester und seinen unruhigen Fingern, die an seiner Vorhaut spielten. Oder doch? Es war die Tatsache überhaupt etwas Nacktes zu sehen. Nackte weibliche Formen zu sehen. Dabei war es vollkommen egal, ob es seine Schwester war oder jemand anderes.
Es fühlte sich gut an, wenn er mit seiner Hand die Vorhaut vor und zurückschob. Er wusste nicht, dass es Selbstbefriedigung war. Er spürte nur, wie sein Penis dabei steif wurde und es angenehm war sich dort unten anzufassen. Er machte es nicht um sich bewusst zu befriedigen, sondern weil es sich einfach gut anfühlte.
Hedda saß vor dem Kamin und starrte in die Flammen. Sie war noch nicht müde. Und sie saß gerne vor dem Feuer. Sobald ihr Bruder eingeschlafen war, konnte sie sich nackt davorsetzen. Ohnehin hatten die Ragni der Siedlung Tornheim stets recht wenig an. In den Gemeinschaftsräumen meist nur ein Hemd und eine leichte Hose. Die Frauen leichte Gewänder. Trug man zu viel am Körper und musste raus, dann würde man außerhalb der Gebäude ziemlich schnell frieren. Denn der Temperaturunterschied war enorm. Bis zu 50 Grad Unterschied konnte es zwischen draußen und drinnen haben. Also zog man sich im Haus aus.
Fasste sie sich dort unten an? Sie fand die Frage ihres Bruders reichlich unverschämt. Und dass sich jede Frau dort unten streichelte, dass glaubte sie nicht. Aber sie hatte es tatsächlich schon getan. Schon ein paar Mal hatte sie ihren Körper erkundet. Auch schon als sie jünger gewesen war. Deutlich jünger. Das war doch normal, oder? Aber sich bewusst streicheln? Nicht jede Frau machte das. Ganz bestimmt nicht. Oder doch?
Sie streichelte sich die blanke Scham. Die Evolution hatte ihnen jegliche Schambehaarung genommen. Aber das wusste sie nicht. Wie auch alle anderen Bewohner von Ariton das nicht wussten. Weil es für sie schon immer so gewesen war.
Sie teilte ihre Schamlippen und fuhr mit dem Mittelfinger zwischen der Spalte hoch und runter. Es fühlte sich gut an. Und sie spürte, wie sie automatisch feuchter wurde. Warum auch immer ihr Körper in dieser Weise reagierte. Sie wusste es nicht.
Was tat sie? Hodi lauschte. Seine Schwester atmete schwerer. Zumindest hörte es sich so an. Es war schwer es auszumachen. Immer wieder knisterte das Feuer. Er betrachtete ihren Körper. Sie saß schräg von ihm abgewandt. Ein wenig konnte er ihre linke Brust sehen. Im Schein des flackernden Feuers. Aber mehr nicht. Wo war ihre Hand? Sie streichelte sich doch selbst. Sie hatte ihn angelogen. Fühlte es sich ähnlich an wie bei ihm? Wenn seine Finger die Vorhaut vor und zurückschoben?
Wie gerne würde er sie berühren. Aber das war nicht mehr möglich. Seit sie älter worden war, durfte er ihr nicht mehr zu nahekommen. Früher hatte er in ihr Bett kommen dürfen. Aber jetzt war sie reifer und ließ es nicht mehr zu. Warum auch immer. Was war schon dabei?
Es war eigenartig. Die anderen Jungs sprachen häufig über sie. Er selbst nahm sie auf eine andere Weise wahr. Ja, er interessierte sich für ihren Körper. Weil er der einzige weibliche Körper war, den er zu Gesicht bekam. Aber er fand die anderen Mädchen der Siedlung toller. Die hübsche Kleine, die zwei Häuser weiterlebte, zum Beispiel. Die war viel schöner und viel interessanter. Aber er hatte sie eben nicht nackt gesehen. Das konnte er nur bei seiner Schwester.
Seine Hand bearbeitete weiter sein Glied. Es war angenehm. Und plötzlich passierte es. Alles zog sich zusammen. Sein Penis fing an zu zucken. Oh, bei den Göttern. Was war das? Er spürte, wie er eine milchige Substanz abspritzte. Sofort hörte er auf. Er war viel zu erschrocken. Es war kein unangenehmes Gefühl gewesen. Aber bei diesem ersten Mal viel zu intensiv. Und vor allem ungewohnt. Und er war sichtlich geschockt.
Er drehte sich um. Versuchte seinen Puls zu beruhigen. Er hatte seinen ersten Orgasmus gehabt. Aber so richtig bewusst war es ihm nicht.
Hedda hörte auf. Sie schaute zu ihrem Bruder. Er war unruhig. Schlief er doch nicht so tief, wie sie vermutet hatte? Zügig ging sie hinüber zum Bett. Nun war sie doch müde.
4
Xipe Totec
Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel. Anders als bei den Ragni im hohen Norden wanderte sie recht hoch am Himmel entlang.
Chantico und Atlacoya standen noch immer auf dem Vorplatz des Palastes. Die Reihen der Soldaten lichteten sich. Einheit um Einheit rückte ab, um sich vor der Stadt im dortigen Feldlager auf den Marsch Richtung Norden vorzubereiten. Die Schwertkämpfer kämpften seit jeher mit nacktem Oberkörper und nur ihrem Lendenschurz bekleidet. Seit hundert Jahren hatte sich das nicht geändert. Chantico wusste natürlich, dass zum Beispiel die Mani mit Rüstungen kämpften und die Shiva zumindest Lederharnische trugen. Aber die Pravin, die sie bei ihrem Kampf erwarteten, kämpften ebenfalls ungeschützt. Und waren deutlich schlechter bewaffnet. Die Pravin kannten keine Bogenschützen und auch keine Reiter. Sie hatten nur ihre dreitausend mit Speeren bewaffneten Krieger. Sie würden nicht lange gegen die Schwertkämpfer der Nehataner bestehen. Davon war Chantico überzeugt. Aber seine Hoffnung lag vor allem in der schnellen Aufgabe. Er glaubte fest daran, dass sich die Pravin schnell ihrem Schicksal ergaben und die Waffen niederlegten.
„Die Palastwache und die Stadtwache. Mehr bleibt nicht zurück!“, meinte Chantico.
Atlacoya nickte seinem Bruder zu. „Das reicht. Hier in der Heimat wird es ruhig sein, während ihr auf Eroberungszug seid! Oder hast du Bedenken?“
Chantico schüttelte den Kopf. Es war seine Idee gewesen alle fünftausend Männer der Streitkraft mitzunehmen. Allerdings mehr aus Unsicherheit. Der junge Führer der Streitkräfte hatte noch nie einen Krieg erlebt. Er hatte noch nicht einmal einen Mann getötet. Deshalb war er sichtlich nervös. Die Pravin hatten vor gut zwanzig Jahren gegen die Shiva gekämpft. Und vor acht Jahren gab es Krieg zwischen den Shiva und den Mani. Die Nehataner hingegen hatten die letzten hundert Jahre keine Schlacht geführt. Abgesehen vom Kampf gegen einige Nomadenstämme, die aus der Wüste heraus immer wieder die Bergwerke im Norden von Nehats attackierten. Und den Kampf gegen eigene Aufständische, die mit der Politik ihres Königs nicht einverstanden waren. Davon gab es eine Menge.
Atlacoya sah den Reitern hinterher, die in Zweierreihen aus dem Tor der Stadt Xipe Totec ritten. Für einen Moment lang dachte er nach und fragte dann seinen Bruder. „Glaubst du, es kommt zum Kampf?“
„Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch schwer, dass sie sich sofort ergeben!“, sagte Chantico. Beide waren unerfahren, was den Krieg anging. Der König war zwar für seine Unbarmherzigkeit und gnadenlose Vorgehensweise gegenüber Feinden bekannt, aber eine tatsächliche Schlacht gegen eine andere Streitmacht, das war schon etwas Anderes.
„Ich hoffe es auch!“, sagte Atlacoya. „Es wäre gut, wenn wir aus den Kriegern der Pravin eine neue Einheit aufstellen könnten.
„Eine neue Einheit für was?“, fragte Chantico. „Um diese Küstenregion gegen ihre eigenen Landsleute zu verteidigen? Kein Pravin wird gegen einen anderen Pravin seinen Speer erheben. Das glaube ich nicht!“
„Nun!“, sagte Atlacoya leise. „Vielleicht für den Marsch weiter Richtung Norden!“
„Durch die Wüste?“
„Durch die Wüste und dann gegen die Shiva.“
„Du willst auch Krieg gegen die Shiva führen?“, fragte Chantico verwirrt.
Sein Bruder nickte. „Ich denke, das wird unsere nächste Aufgabe!“
„Das ist verrückt!“, meinte der militärische Führer der Nehataner. „Und das weißt du. Ein Marsch durch die Wüste wird uns viel Kraft kosten. Und die Shiva warten dann am Ende der Wüste mit einer ausgeruhten Armee. Lass uns doch erst einmal den ersten Schritt tun!“
„Deshalb bist du nicht der König!“, meinte Atlacoya wütend. „Weil du nicht weiter in die Zukunft denkst. Und jetzt scher dich raus aus der Stadt, Bruder. Geh ins Feldlager. Kümmere dich um deine Männer!“
Atlacoya ging hinein in den Palast. Er schaute sich nicht um. Er ließ Chantico, seinen Bruder, einfach stehen. Einem Burschen, der im Eingangsbereich stand und rasch den Kopf senkte, gab er einen Wink. Er wollte Wein. Sofort reagierte der junge Mann. Demütig rannte er davon, um das gewünschte zu holen.
„Mein Gemahl, wie lief es?“, fragte plötzlich eine Stimme.
Atlacoya war wütend. Doch die Wut wich, als er seine Frau hörte.
„Gut!“, sagte er. „Die Truppen sind bereit. Ich weiß nur nicht, ob es auch Chantico ist!“
„Er liebt dich!“, meinte sie. „Und er wird sein Bestes geben!“
Für einen Moment lang überlegte Atlacoya, ob er nicht auch ihr sagen sollte, dass das Beste einfach nicht genug war. Chantico musste über sich hinauswachsen. Aber er sagte es nicht. Stattdessen ging er zu ihr und strich ihr über die Wange. „Wie geht es meiner Königin? Der schönsten Blume in ganz Nehats?“ Er strich ihr über die schwarzglänzenden Wangen.
„Es geht mir gut, mein Gemahl und König!“, erwiderte sie. „Mit Freude registriere ich, dass du große Ziele hast und sie umzusetzen weißt!“
„Die Pravin werden vor unserer Armee erzittern!“, sagte er.
Sie nickte. „Das werden sie. Und vielleicht fällt die eine oder andere Sklavin für mich ab!“
Er grinste. „Ja, das wird wohl so sein!“ Er fasste ihr an den Po und zog sie näher zu sich. „Du willst eine hübsche, junge pravinische Sklavin? Du weißt, dass sie kleiner sind als wir und kleinere Titten haben?“
„Ja, das weiß ich, mein Gemahl!“, seufzte sie und schmiegte sich an ihn.
„Dreh dich um!“, befahl er und drängte sie zu einer Säule.
Sie gehorchte. Drehte sich um und krallte sich dann an dem sandfarbenen Stein fest.
Grob und gierig lupfte er den Rock ihres Kleides. Fasste ihr an den dunkelhäutigen Hintern. Mit seinen eigenen Beinen drängte er die ihrigen etwas weiter auseinander. Sie streckte ihm indes den Hintern zu.
„Nimm mich, mein Herr und Gebieter. Mein König!“, hauchte sie.
Er entledigte sich seines Lendenschurzes geschickt mit einer Hand. Sein Schwanz stand wie eine Eins und drängte sich nach vorne. Und dann drang er von hinten in sie ein.
„Ich werde deinen Wunsch erfüllen“, grinste er. „Mein Bruder wird die schönste Pravin für dich aussuchen, die er findet.“
5
Tornheim
Tornheim war noch nie angegriffen worden. Aber es gab immer wieder räuberische Nomaden, die in die Siedlungen schlichen und versuchten die Bewohner auszurauben. Deshalb waren die Eingänge des miteinander verzweigten Gebäudekomplexes von innen fest verschlossen. Zudem sorgte eine Wache auf dem Dach der Haupthalle für Sicherheit. Wenn sich Banditen näherten, dann würde sie Alarm schlagen und ganz Tornheim sich in den Verteidigungsmodus begeben.
Die zwei jungen Burschen, die sich an diesem Tag die Wache teilten, hatten sich in ihre Felle eingehüllt. Es war verboten während des Wachdienstes Alkohol zu trinken, aber allzu oft wurde dagegen verstoßen. In den letzten zehn Jahren konnte sich keiner auch nur annähernd daran erinnern, dass etwas Größeres vorgefallen war. Ein wildgewordener Eisbär auf der Suche nach Nahrung oder ein hungriges Rudel Wölfe, das an die Vorräte wollte. Solche Sachen kamen öfters vor. Der schlimmste Vorfall war vor drei Jahren passiert. Da hatten zwölf Wölfe die Siedlung heimgesucht und einige Schlittenhunde getötet oder zumindest verletzt. Die treuen Arbeitstiere waren ein wesentlicher Bestandteil bei der Jagd. Ihr Verlust war wahnsinnig gewesen. Die Wache hatte sofort Alarm geschlagen und die Einwohner von Tornheim hatten die wildgewordenen Verwandten ihrer Hunde vertrieben.
Über derartige Probleme oder gar Schlimmeres machten sich die beiden Ragni keine Gedanken. Sie tranken den Wein, den sie teuer in Gunnarsheim erworben hatten. Noch nie in ihrem Leben hatten sie Trauben gesehen und auch in der Hauptstadt des Reiches gab es die Früchte, die als Grundlage für dieses berauschende Getränk dienten, nicht. Selbst die Landschaft der Mani war nicht geeignet für einen guten Weinanbau. Viele Kilometer wurde der Wein von den Shiva mit Schiffen hier in den Norden gebracht und kostete entsprechend viel. Günstiger war das Bier, das von den Mani kam. Aber das schmeckte den Ragni bei weitem nicht so gut. Die Inselbewohner und Seeleute, die Noaten, brauten Honigwein, aber sie verkauften ihn nicht an die Nordleute. So war der Wein aus dem Land der Shiva die teure Alternative und ein enormer Luxus.
Weinbeseelt lachten und feixten die beiden jungen Männer.
„Es gibt ein Land im Süden!“, sagte Einer von ihnen. „Da ist es so warm, dass die Frauen fast nackt herumlaufen!“
„Das wäre ein Traum!“, grinste der Andere und trank aus dem tönernen Gefäß. Teuer erstanden auf dem Markt in Gunnarsheim und tagelang über Eis und Schnee hier hochgebracht nach Tornheim.
„Hast du Hedda heute gesehen?“, fragte der eine der beiden Wachmänner.
„Du meinst, als sie zurück kam vom Fischen?“
„Ja. Als sie sich ihrer Felle entledigte und im Unterrock am Feuer wärmte, bei den Göttern, da hatte ich einen Steifen!“
„Kein Wunder. Sie ist ein geiles Ding!“, grinste sein Kamerad.
„Zu gern würde ich mich mal an ihrer süßen Muschi laben. Von ihren Säften kosten. Bei den Göttern. Das muss herrlich sein!“
„Sie wird dich nicht ranlassen!“
Der Andere grinste. „Vielleicht muss ich sie einfach nur eindrücklich überzeugen.“
„Dann tötet dich ihr Vater. Das weißt du. Und er ist unser Oberhaupt!“
„Ich muss pissen!“, sagte Einer der beiden. Er kletterte aus dem hölzernen Verschlag, der die Wachen ein wenig vor dem Wetter schützen sollte, kletterte über die Dächer und pinkelte dann von einem der Familienhäuser hinunter.
Als er zurückkam, erstarrte er vor Schreck. Sein Kamerad lag leblos am Boden. Schnell kletterte der junge Mann zurück in den Verschlag und packte seinen Freund am Arm. Gerade als er mit Erschrecken feststellen musste, dass er tot war, spürte er selbst die Klinge am Hals. Der kalte Stahl fühlte sich schmerzhaft an.
Viel zu spät kapierte er, dass in diesem Augenblick sein Hals aufgeschlitzt wurde. Mit einem sauberen Schnitt. Er versuchte zu schreien, aber man konnte nur ein leises Gurgeln hören.
Panisch griff er nach seiner Kehle. Das Blut, das aus der Wunde schoss, fühlte sich warm an. Angenehm warm. Doch mit dem Verlust des Blutes wich auch das Leben aus ihm.
Mit aufgeschlitzter Kehle lagen die beiden hellhäutigen Männer mit den schwarzen Haaren da. Ihre stahlblauen Augen waren erloschen. Das Leben aus ihrem Körper gewichen.
Der fremde Mann aus Manis wischte in Ruhe sein Messer an einem der Felle, die einer der beiden Toten trug, ab. Er nickte zufrieden und stieg dann die hölzerne Leiter wieder hinunter in die Haupthalle. Dann begab er sich an den Eingang und öffnete eine der Türen zur Siedlung.
6
Xipe Totec
Das Feldlager der nehatanischen Armee lag vor den Toren der Hauptstadt Xipe Totec. Langsam näherte sich die Sonne über Nehats dem Horizont. Es würde bald dunkel werden auf dieser Seite des Planeten. Alle sieben Monde würden dann im Laufe der Nacht über das Firmament wandern. Nicht alle waren zur gleichen Zeit am Himmel. Manche erschienen früher, andere später in der Nacht. Zu bestimmten Zeiten im Jahr waren einige von ihnen auch verschwunden. Warum das so war, konnte sich keiner der Nehats erklären. Zu gering war ihr Wissen über die Planeten und das eigene Sonnensystem. Sie wussten nur von der Existenz ihrer Monde, die so unterschiedlich waren, wie sie nur sein konnten. Einer leuchtete gelblich wie die Sonne. Ein anderer rötlich. Wieder ein anderer hatte einen weißen Kern und drum herum einen bläulichen Schimmer. Jeder Mond hatte eine andere Erscheinungsweise.
„Macht Platz für den General!“, meinte einer der Unteroffiziere zu seinen Männern. Die Meisten von Ihnen waren kräftig gebaute Männer, die ihr Leben lang nichts Anderes taten als zu trainieren. Für den Kampf, der niemals kam. So hatten sie zumindest gedacht. Immer gerüstet für den Ernstfall. Keiner hatte erwartet vom König selbst in den Krieg geschickt zu werden.
Chantico ritt in gemäßigtem Tempo zwischen den Zelten hindurch. Die Unruhe der Männer war deutlich zu spüren. Keiner freute sich auf den Kriegseinsatz. Die Erzählungen über die kriegerischen Auseinandersetzungen der Vorfahren waren hier bei den Nehatanern eher Schauergeschichten und keine Legenden. Es gab keine Helden aus Kriegszeiten. Ohnehin waren die letzten Krieger aus dem Krieg vor hundert Jahren bereits vor einigen Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Wenn sie den Krieg überlebt hatten.
„General!“, meinte einer der Offiziere. „Wir haben drei Deserteure gefangengenommen! Sie wollten fliehen.“
„Tatsächlich?“, fragte Chantico missmutig. Die Angst vor dem Krieg war bei den Männern groß, auch wenn sie wussten, dass sie nur gegen eine kleine Armee antraten. Das Verhältnis zueinander stand eindeutig auf der Seite der Nehatanern. Zudem hatten sie ihre Bogenschützen und ihre berittenen Soldaten. Es würde ein leichtes Spiel werden. Also warum sein Leben dann als Deserteur riskieren? Die Chance, von der Truppe gefangen genommen zu werden, war hoch. Und für alle Feiglinge gab es nur eine Strafe. Den Tod.
„Was sollen wir mit ihnen tun?“, fragte der Offizier.
Chantico überlegte nicht allzu lange. „Vierteilt sie!“
Der Offizier nickte und winkte einen Soldaten herbei. „Ihr habt es gehört. Bereitet die Pferde vor ...“