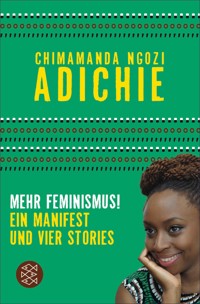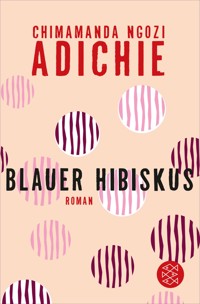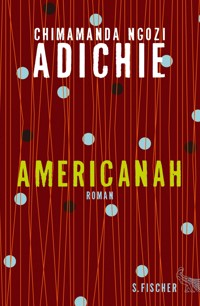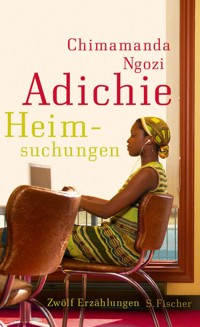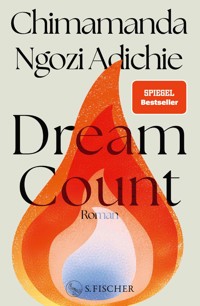
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Frauen, vier Leben und die Sehnsucht nach Sichtbarkeit, Liebe und Selbstbestimmung. Der lang erwartete neue Roman von Chimamanda Ngozi Adichie. Spiegel-Bestsellerautorin, literarischer Superstar und feministische Ikone. Chiamaka ist Reiseschriftstellerin, navigiert zwischen ihrer nigerianischen Heimat und ihrem amerikanischen Zuhause und versucht, sich im Rückblick auf die Männer ihres Lebens zu erklären, wann genau ihr ihre Träume abhandengekommen sind. Zikora ist Anwältin und lebt in Washington D. C. Sie hat Erfolg und sich schon vor langer Zeit von ihrer Mutter distanziert; bis sie - plötzlich selbst Mutter und alleinerziehend - merkt, wie nahe sie ihr in ihrer vermeintlichen Schwäche ist. Omelogor lebt in Nigeria. Als Bankerin hilft sie, Korruption zu verschleiern, aus Idealismus versucht sie, Frauen und ihre Unternehmen zu fördern. Doch eines Tages kündigt sie ihren Job, um in den USA zu studieren. Kadiatou ist Chiamakas Haushälterin. Außerdem arbeitet sie in einem Hotel, wo ein mächtiger Gast sie schwer belästigt. Ein entwürdigender Prozess von Beweisaufnahme und Verfahren beginnt, in dem alles im Zentrum steht, nur nicht Kadiatous Schicksal. Mitreißend, dringlich und klug spannt Chimamanda Ngozi Adichie über Kontinente hinweg die Geschichten von vier Frauen, die einander immer wieder die Hand reichen, und erzählt wie keine andere von existentieller weiblicher Erfahrung, die oft in den ganz kleinen Augenblicken zutage tritt: im Schwangerschaftstest auf dem Badewannenrand, in Tagträumen nach einem Augenkontakt im Flugzeug, im Warten auf einen Anruf oder im Moment plötzlich zusammengenommenen Mutes. Ein wegweisender, gegenwärtiger Roman über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Frauen in einer Welt, die es immer noch schwer macht, sich zusammenzutun. Zehn Jahre nach dem Weltbestseller »Americanah« der neue große Roman von Chimamanda Ngozi Adichie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Chimamanda Ngozi Adichie
Dream Count
Roman
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »Dream Count« bei Alfred A. Knopf, a division of Penguin Random House LLC, New York, and in Canada by Alfred A. Knopf Canada, a division of Penguin Random House Canada Limited, Toronto.
Copyright © 2024 by Chimamanda Ngozi Adichie
All rights reserved
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung/-abbildung: Schiller Design, Frankfurt, nach einer Idee von Jo Thomson © HarperCollinsPublishers Ltd 2025
ISBN 978-3-10-492116-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Chiamaka
Eins
Zwei
Drei
Vier
Zikora
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Kadiatou
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Omelogor
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Chiamaka
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Anmerkungen der Autorin
In Erinnerung an meine wunderschöne geliebte Mutter
Grace Ifeoma Adichie (geborene Odigwe)
29. NOVEMBER 1942 – 1. MÄRZ 2021
Uwa m uwa ozo, i ga-abu nne m
Chiamaka
Eins
Ich habe mich immer danach gesehnt, von einem anderen Menschen erkannt zu werden, wirklich erkannt. Manchmal hegen wir jahrelang Sehnsüchte, die wir nicht benennen können, bis sich ein Riss im Himmel auftut, durch den wir uns selbst erkennen, wie eine Offenbarung – so wie in der Pandemie, denn während des Lockdowns fing ich an, mein Leben zu durchforsten und den lange Zeit unbenannt gebliebenen Dingen Namen zu geben. Anfangs schwor ich mir, das Beste aus dieser kollektiven Abkapselung zu machen: Wenn mir nichts anderes blieb, als drinnen zu bleiben, würde ich täglich meinen dünner werdenden Haaransatz mit Öl pflegen, acht große Gläser Wasser trinken, auf dem Laufband joggen, lange luxuriöse Stunden mit Schlafen verbringen und meine Haut mit reichhaltigem Serum betupfen. Ich würde aus alten, nicht verwerteten Notizen neue Reiseberichte bauen, und wenn der Lockdown lange genug dauern würde, hätte ich vielleicht endlich die Kraft für ein Buch. Doch schon nach wenigen Tagen fiel ich in einen Brunnen ohne Grund. Worte und Warnungen wirbelten herum, und mir kam es vor, als würde sich der gesamte Fortschritt der Menschheit umkehren und in einem historischen Stadium der Verwirrung münden, das eigentlich längst überwunden sein sollte. Berühren Sie Ihr Gesicht nicht; waschen Sie sich die Hände; gehen Sie nicht nach draußen; benutzen Sie Desinfektionsmittel; waschen Sie sich die Hände; gehen Sie nicht nach draußen; berühren Sie Ihr Gesicht nicht. Zählt es als Berührung, wenn man sein Gesicht wäscht? Ich benutze immer ein Reinigungstuch, aber eines Morgens streifte meine Handfläche meine Wange, und ich erstarrte, während das Wasser weiterlief. Das konnte doch nicht ins Gewicht fallen, schließlich war ich noch nicht einmal draußen gewesen, aber was bedeutete schon »Gesicht nicht berühren« und »Hände waschen«, wenn niemand wusste, wie es angefangen hatte, wann es enden würde oder was es überhaupt war? Jeden Tag wachte ich panisch auf, mein Herz raste ohne meine Erlaubnis, und manchmal presste ich meine Handfläche gegen die Brust und hielt sie dort fest. Ich war allein in meinem Haus in Maryland, in der Stille der Vorstadt, in den unheimlichen Straßen, von Bäumen gesäumt, die ebenfalls in der Stille zu erstarren schienen. Kein einziges Auto fuhr vorbei. Ich schaute hinaus und sah ein Rudel Rehe über die Lichtung im Vorgarten schreiten. Etwa zehn waren es, vielleicht auch fünfzehn, nicht zu vergleichen mit dem einsamen Reh, das ich von Zeit zu Zeit scheu im Gras kauen sah. Ich hatte Angst vor ihnen, vor ihrer ungewöhnlichen Kühnheit, als würde meine Welt nicht nur von Rehen, sondern auch von anderen lauernden Kreaturen, von denen ich mir noch keine Vorstellung machte, überrannt werden. Manchmal aß ich kaum, wanderte nur in die Speisekammer, um Cracker zu knabbern, und andere Male kramte ich Tüten voll vergessenem Tiefkühlgemüse hervor und kochte scharfe Bohnen, die Kindheitserinnerungen in mir wachriefen. Die formlosen Tage gingen ineinander über, und mich überkam das Gefühl, die Zeit drehe sich nach innen. Meine Gelenke pochten und die Muskeln meines Rückens und mein Nacken ebenso, als wüsste mein Körper nur zu gut, dass wir Menschen für ein solches Leben nicht geschaffen sind. Ich schrieb nicht, weil ich nicht schreiben konnte. Ich schaltete das Laufband nie ein. In den Zoom-Calls hallten unsere Stimmen, unsere Hände streckten sich nacheinander aus, ohne sich berühren zu können, zwischen uns allen dehnte sich der Abstand weiter aus.
Meine beste Freundin Zikora, nicht weit weg in D. C., rief eines Nachmittags an und sagte, sie sei bei Walmart, um Toilettenpapier zu kaufen.
»Du bist rausgegangen!«, schrie ich fast.
»Ich trage zwei Masken und Handschuhe«, sagte sie. »Die Polizei ist da, um die Schlange vorm Toilettenpapier zu organisieren – kannst du dir das vorstellen?« Zikora fiel ins Igbo und fuhr fort: »Die Leute bellen sich gegenseitig an. Ich hab echt Angst, dass jemand gleich eine Waffe zieht. Dieser weiße Mann vor mir ist seltsam; er kam in einem riesigen Truck an und trägt eine rote Mütze.«
Wir sprachen nie reines Igbo – immer streuten wir englische Wörter in unsere Sätze ein –, aber Zikora hatte sorgfältig darauf geachtet, kein Englisch zu sprechen, für den Fall, dass Fremde sie belauschten, und jetzt klang sie gekünstelt, als spielte sie eine Rolle in einem miesen Fernsehfilm über vorkoloniale Zeiten. Ein Mann, der ein prächtiges Gefährt steuert und einen blutfarbenen Hut trägt. Ich fing an zu lachen, und sie fing auch an zu lachen, und ich fühlte mich kurz befreit, wiederhergestellt.
»Wirklich, Zikor, du hättest nicht rausgehen sollen.«
»Aber wir brauchen Toilettenpapier.«
»Ich glaube, es ist endlich an der Zeit, dass wir anfangen, unsere Hintern zu waschen«, sagte ich, und im nächsten Moment riefen Zikora und ich im Chor: »Ihr seid nicht sauber!«
Ich hatte im Laufe der Jahre so oft die Geschichte von Abdul, unserem Pförtner in Enugu, erzählt – der schlanke Abdul in seiner langen Dschallabija –, der sich eines Abends auf dem Weg nach hinten zur Latrine mit seiner Plastikkanne in der Hand umdrehte, um mir in aller Ruhe zu erklären: »Ihr Christen benutzt auf der Toilette Papier. Ihr seid nicht sauber.«
In unserem Familien-Zoom-Gespräch sagte ich: »Das größte Verbrechen, das man heute in Amerika begehen kann, ist es, im Supermarkt die langen Warteschlangen vor dem Toilettenpapier zu stören. Die Polizei ist jetzt sehr damit beschäftigt, die Toilettenpapierschlangen im ganzen Land zu bewachen.«
Ich hatte gehofft, dass alle lachen würden – früher hatten wir so viel Spaß gehabt –, aber nur mein Vater lächelte. Meine Zwillingsbrüder standen kurz vor einem weiteren Streit.
Meine Mutter sagte: »Ich habe nie verstanden, warum die Amerikaner es Papier nennen. Toilettenpapier. Das klingt hart. Warum nicht Toilettentücher oder Toilettenrollen?«
Wir sprachen jeden zweiten Tag über Zoom – meine Eltern in Enugu, mein Bruder Afam in Lagos und sein Zwilling Bunachi in London. Jeder Anruf war wie ein bewölkter Tag, trostlos und von den neuesten schlechten Nachrichten beschwert.
Meine Eltern sprachen vom Sterben und vom Tod, von den Sterbenden und von den Toten, und meine Brüder waren kalt und gemein zueinander, nicht länger darum bemüht, meine Eltern vor ihrer Feindseligkeit zu schützen. Es war, als könnten wir nicht mehr wir selbst sein, weil die Welt nicht mehr sie selbst war. Wir sprachen über die steigenden Fallzahlen in Nigeria, die sich von Tag zu Tag, von Staat zu Staat in einem makabren Wettlauf befanden. Erst hatte Lagos die höchsten, dann war Cross River dran. Afam schickte uns das Video eines Krankenwagens, der sich schreiend seinen Weg durch die Straßen seiner Siedlung bahnte, und betitelte es mit »Einer weniger«. Bunachi sagte, dass britische Ärzte bald keine Schutzkittel mehr erhalten würden, weil die Leute, die sie in China hergestellt hatten, tot seien. Ich schaltete mich immer als Letzte dazu und tat so, als käme ich aus anderen Zoom-Calls mit Redaktionen, obwohl ich in Wirklichkeit nur auf mein Handy gestarrt und mich dafür gewappnet hatte, auf »Teilnehmen« zu klicken. Kurz vor dem Lockdown waren meine Eltern von Paris nach Nigeria zurückgekehrt, und meine Mutter sagte oft: »Stellt euch vor, wir wären in Europa gestrandet. Dort tötet es unsere Altersgenossen wie die Fliegen.«
»Stellt euch die Katastrophe vor, wenn wir Fallzahlen wie in Europa hätten«, sagte mein Vater.
»Gott rettet Nigeria; es gibt keine andere Erklärung«, sagte Afam.
»Wunder gibt’s«, sagte Bunachi bissig. Dann fügte er hinzu: »Europa ist einfach ehrlich bei der Erfassung von Coronavirus-Todesfällen.«
»Nein, nein, nein«, sagte mein Vater. »Wenn wir eine hohe Sterblichkeitsrate hätten, könnten wir das nicht verbergen. Wir sind nicht organisiert genug; wir sind nicht China.«
»Jesus, Maria und Josef. All diese Zahlen sind Menschen, Menschen«, sagte meine Mutter, die ihr Gesicht abgewandt hatte und fernsah.
»Ich habe heute Morgen einen Löffel zum Geldautomaten mitgenommen«, sagte Afam.
»Einen Löffel?«, fragte meine Mutter wieder der Kamera zugewandt.
»Ich wollte den Automaten nicht anfassen, also habe ich meine Geheimzahl mit dem Löffel eingegeben und ihn dann weggeschmissen«, sagte Afam.
»Du hast keine Handschuhe getragen?«, fragte meine Mutter.
»Hab ich, aber wer weiß, ob es nicht durch Handschuhe dringen kann?«, sagte Afam.
»Auf glatten Oberflächen stirbt das Virus in Sekunden. Du hast einfach einen Löffel verschwendet«, sagte Bunachi, allwissend wie immer. Ein paar Tage zuvor hatte er erklärt, dass Beatmungsgeräte nicht die richtige Behandlung für das Coronavirus seien. Er war Betriebswirt.
»Aber du hättest gar nicht erst rausgehen sollen, Afam«, sagte mein Vater. »Wofür brauchst du überhaupt Bargeld? Ihr habt euch doch gut eingedeckt.«
»Ich brauche Bargeld. Lagos ist sehr angespannt«, sagte Afam.
»Wie angespannt?«, fragte Bunachi, und Afam ignorierte ihn, bis mein Vater fragte: »Was meinst du mit angespannt?«
»Überall auf der Insel rotten sich Menschen in den Siedlungen zusammen und wollen Geld und Lebensmittel. All diese Leute, die von einem Tag zum nächsten leben; sie haben nichts, kein bisschen Erspartes. All die Straßenhändler. Ich habe ein Video gesehen, in dem einer aus der Menge erklärt, dass sie den Lockdown nicht wollen, dass es die Reichen sind, die ins Ausland gingen und sich das Coronavirus einfangen würden, und dass es jetzt die Pflicht der Reichen sei, die Leute durchzufüttern, die vor dem Lockdown ihre Klamotten gewaschen und Autoreifen aufgepumpt haben. Um ehrlich zu sein, da steckt schon eine gewisse Logik dahinter.«
»Da steckt keine Logik dahinter. Das sind einfach nur Kriminelle«, sagte Bunachi.
»Sie haben Hunger«, sagte Afam. »Ich bin sogar zu Fuß zum Geldautomaten. Ich habe gehört, dass sie dich mit Stöcken jagen, wenn du es wagst, in einem teuren Auto rauszufahren.«
Er lebte in einer Siedlung mit großen Häusern und elektrischen Toren, für die Besucher einen Code brauchten. Am nächsten Tag berichtete er, der Mob habe die Wachen zusammengeschlagen, hämmere gegen die Tore und versuche, das Sicherheitssystem zu deaktivieren.
»Sie haben direkt am Eingang Feuer gelegt«, sagte er. »Ich habe unsere WhatsApp-Gruppe noch nie so aktiv erlebt. Wir alle spenden Geld und versuchen herauszufinden, wie wir es ihnen am besten zukommen lassen können.«
»Glaubst du immer noch, dass sie harmlos sind?«, spöttelte Bunachi.
»Ich hab nie gesagt, dass sie harmlos sind. Ich sagte, sie haben Hunger«, erwiderte Afam.
Wir sahen auf dem Bildschirm, wie hinter ihm grauer Rauch in den Abendhimmel aufstieg. Er wirkte zerbrechlich und unvorbereitet, wie er da auf seinem Marmorbalkon neben einer hohen Topfpflanze stand. Die Pflanze war so sattgrün, die Blätter waren genauso üppig wie in jener Zeit, in der das Leben noch normal gewesen war und mein Bruder einfach seine Geschäfte geführt hatte, Herr seiner Tage gewesen war, ein junger, machtbereiter Lagos Big Man. Nun stand er da, während seine Frau die beiden Kinder in der Küche verbarrikadierte, weil dort die stabilste Tür war. Er versuchte, sorglos auszusehen, was ihn nur sehr besorgt aussehen ließ, und ich dachte daran, wie zerbrechlich wir alle sind und wie leicht wir das vergessen. Ein lauter Knall zerriss die Luft, und ich zuckte zusammen, weil ich mir einen Moment lang nicht sicher war, ob er von Afam oder von draußen vor meinem Fenster kam.
»Habt ihr das gehört?«, sagte Afam. »Irgendeine Explosion am Tor.«
»Das ist nichts Ernstes«, sagte mein Vater. »Die haben sicher eine Dose Insektengift ins Feuer geworfen.«
»Afam, geh rein und schließ alle Türen ab«, sagte meine Mutter.
Um das Thema zu wechseln, sagte ich, dass hoch dosiertes Vitamin C im ganzen Internet ausverkauft sei. Bunachi wusste natürlich schon wieder Bescheid und sagte, dass Vitamin C das Virus nicht aufhalte, und er würde uns ein Rezept schicken; wir sollten täglich frisches Basilikum aufbrühen und inhalieren.
»Niemand hat frisches Basilikum«, schnauzte Afam.
Bunachi fing an, die neuesten Statistiken der Todesfälle in den einzelnen Ländern aufzuzählen, und ich sagte: »Mein Akku ist gleich tot«, und legte auf. Ich schickte Afam eine Nachricht, die mit einer Reihe roter Herz-Emojis endete: Halte durch, Brüderchen, ihr schafft das.
Meine Cousine Omelogor sagte, in Abuja gebe es keine vergleichbaren Vorfälle, Abuja sei sanfter als Lagos, wie immer, ein von der Sonne ausgebleichtes Lagos, dem die Nährstoffe ausgingen.
»Menschen sterben, und Menschen feiern Geburtstage«, sagte sie.
»Was?«
»Der Stabschef des Präsidenten ist gestern an Corona gestorben, und heute Morgen hat mich Ejiro zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. Ich habe ihr gesagt, wenn ich meinen Tod riskieren wolle, dann würde ich mir dafür was Besseres aussuchen als ihre Geburtstagsparty.«
Omelogor »gestorben« und »Tod« sagen zu hören, war verwirrend; sie sprach kaum über Symptome oder Todeszahlen. Sie sprach über Instantnudeln in Kartons, die sie mit extrastarkem Klebeband wieder verpackte, bevor sie sie an der Pforte eines Kinderheims hinterlegte; oder davon, dass seit dem Lockdown die Besucherzahlen auf ihrer Website For Men Only sprunghaft angestiegen waren; mehr Besucher aus mehr Ländern, von denen viele sie bitten würden, ein Video zu drehen, in dem sie sich endlich offenbarte. »Fühlt sich fast intim an die Bitte, ein Video zu machen«, sagte Omelogor mit einem Lachen in der Stimme. Von allen Menschen, die ich liebte, war Omelogor trotz Corona noch am ehesten sie selbst geblieben, unbesiegt von diesem gemeinsamen Unbekannten; sie sah immer wach und geduscht und voller Elan aus. »Chia, diese Sache wird vorübergehen. Die Menschen haben im Laufe der Geschichte schon viele Seuchen überlebt«, sagte sie oft, meine Niedergeschlagenheit spürend, und ihr Ton machte mir tatsächlich Mut, auch wenn mich das Wort »Seuche« aus irgendeinem Grund an Blutegel erinnerte.
»Nenn es nicht so«, sagte ich.
Manchmal sagten wir auch nichts, lehnten unsere Telefone gegen ein Buch oder eine Tasse und teilten die Stille und unsere Hintergrundgeräusche miteinander. Nur mit Omelogor war Stille auszuhalten. In Zoom-Calls mit anderen Freundinnen und Freunden fühlte sich Stille an, als würde ich versagen, also redete und redete ich und dachte darüber nach, wie schnell wir uns angepasst hatten oder vorgaben, uns anzupassen, an dieses auf Bildschirme und Töne reduzierte Leben. Zikora sagte, dass sie gern von zu Hause aus arbeitete, in ihrem Bett, ein paar Kissen im Rücken, weil sie im Wohnzimmer Chideras lautes Weinen und die sanft-tröstende Stimme ihrer Mutter hören konnte. Chidera hatte lange geweint, weil er auf den Spielplatz wollte, bis sie ihn schließlich zum ersten Mal in seinem Leben Trickfilme schauen ließ; bei der ersten Sendung hatte er noch erschrocken geguckt, aber jetzt saß er wie hypnotisiert vor dem Fernseher und fing an zu heulen, wenn seine Mutter ihn ausschaltete. LaShawn in Philadelphia backte Sauerteigbrot und stellte ihrer Mutter, die im Obergeschoss in Quarantäne war, Teller mit gebratenem Hähnchen auf den Treppenabsatz, um kein Risiko einzugehen. Hlonipha in Johannesburg sagte, sie schalte oft ihr WLAN aus und male Aquarelle, die sie aber traurig machten, weil sie ihr zu verwässert, zu blass erschienen. Lavanya in London trank ständig Rotwein und hielt die Flasche ins Bild, wenn sie ihr Glas nachfüllte. Ihre Nachbarin war an Corona gestorben, eine alte Dame, die allein mit ihrem Hund gelebt hatte, und niemand hatte den Hund mitgenommen. Lavanya hörte ihn bellen, und es brach ihr das Herz, aber sie wusste nicht, ob Hunde sich auch mit dem Coronavirus anstecken konnten.
Bald wurden die Zoom-Calls zu einer Melange aus halluzinatorischen Bildern. Am Ende eines jeden Anrufs fühlte ich mich einsamer als zuvor, nicht weil der Anruf zu Ende war, sondern weil er überhaupt stattgefunden hatte. Reden bedeutete, sich an alles zu erinnern, das verlorengegangen war. Ich sehnte mich danach, einen anderen Menschen in meiner Nähe atmen zu hören. Ich träumte davon, meine Mutter im Vorzimmer unseres Hauses in Enugu zu umarmen, und ich wachte überrascht auf, weil ich nie bewusst daran gedacht hatte, sie zu umarmen. Ich wünschte, ich wäre nicht allein. Hätte Kadiatou doch nur zugestimmt, mit Binta zu mir zu kommen und gemeinsam in Quarantäne zu gehen. Aber ich verstand, dass sie in ihrer Wohnung sein wollte, auch wenn ich mir große Sorgen um sie machte. Ein paar Tage vor dem Lockdown hatte sie gesagt: »Ich warte in meiner Wohnung.« Warten. Wir warteten wirklich alle. Der Lockdown war ein unbekanntes Warten auf ein unbekanntes Ende, und der unbändige Schmerz machte es für Kadiatou noch schlimmer. Ich rief sie täglich an, und wenn sie nicht abnahm, rief ich Binta an, um sicherzugehen, dass es Kadiatou gut ging. Wir sprachen per WhatsApp-Video, weil sie kein Zoom hatte. »Wie geht es dir, Kadi?«, fragte ich, und sie antwortete: »Wir sind okay, wir danken Gott.« Manchmal sagte sie: »Miss Chia, machen Sie keine Sorgen um mich«, ihre Stimme war ruhig, verwehrte sich dagegen, dramatisch zu klingen. Und doch hatte dieselbe Stimme nur wenige Wochen zuvor panisch am Telefon geschrien: »Er wird Leute schicken, um mich zu töten! Er wird Leute schicken, um mich zu töten!« Sie hatte eine Therapie abgelehnt, den Kopf geschüttelt und gesagt: »Ich kann nicht mit Fremden reden, ich kann nicht mit Fremden reden.« Sie wollte bloß, dass der Prozess zu Ende ging, aber nun wurden Gerichtsverhandlungen ausgesetzt, und ich machte mir Sorgen, dass sie, gefangen in der Vorhölle des Lockdowns, der Dunkelheit erliegen würde.
»Wie kriege ich nach alldem wieder einen Job? Wie kriege ich wieder einen Job?«, fragte sie mich, und sie klang so verzweifelt, dass ich hätte weinen können.
»Du kannst dein Restaurant aufmachen, wenn der Prozess vorbei ist, Kadi«, sagte ich.
»Niemand geht wieder in Restaurant nach Corona«, sagte sie.
Während eines unserer Telefonate erschreckte mich Kadiatou, sie wurde auf einmal aggressiv. »Schicken Sie kein Geld mehr, Miss Chia. Sie geben genug für mich.« Sie hatte noch nie in diesem Ton mit mir gesprochen. Eine unterdrückte Anspannung entstand über den Abstand zwischen den Bildschirmen hinweg.
»Okay, Kadi«, sagte ich schließlich. Sie legte auf, ohne sich zu verabschieden, und ich wartete ein paar Tage, bevor ich sie wieder anrief. Immer wenn ich Binta fragte: »Wie geht es deiner Mutter?«, gab sie mir dieselbe Antwort: »Sie weint nachts.«
Niemand geht wieder in Restaurant. Ich konnte mir diese neue, isolierte Realität, in der die Menschen nicht mehr zum Essen ausgingen, nicht vorstellen, weil ich daran glauben musste, dass die Welt wieder zu einem verzauberten Ort werden konnte.
Die Stille draußen machte mir Angst. Die Nachrichten machten mir Angst. Ich las von alten Männern und alten Frauen, die einsam starben, als seien sie nicht geliebt worden, während die Menschen, die sie liebten, weinend hinter Glasscheiben standen. Im Fernsehen sah ich Leichen, die wie steife, in Weiß gehüllte Schaufensterpuppen abtransportiert wurden, und ich betrauerte den Verlust von Fremden. Ich durchsuchte Twitter nach Coronavirus-Hashtags und las mit Hilfe von Google Translate die Tweets italienischer Ärzte, die zu wissen schienen, wovon sie sprachen. Was nicht viel war, denn letztlich wussten alle so wenig, alle tappten im Dunkeln. Bei jedem neuen Symptom, von dem ich erfuhr, bildete ich mir ein, dass ich es hatte, und die Symptome änderten sich ständig – jeden Tag eine neue Überraschung, von Ausschlägen im Gesicht bis hin zu wunden Füßen, wie eine unkontrollierte Apokalypse ohne Anzeichen eines Endes. Ein Juckreiz am Zeh oder ein heiserer Hals am Morgen, und ich geriet in Panik und musste mir sagen: »Atme, atme«, in Nachahmung der Meditations-Apps, die ich bis dahin nie ernst genommen hatte.
Oft spürte ich, wie eine dumpfe Teilnahmslosigkeit mich vollständig betäubte, dann wieder, wie eine unruhige Hitze in mir aufstieg. Zoom-Calls waren mühsam, weil wir alle versuchten, gute Laune zu verbreiten, besonders die Gruppenanrufe mit Freundinnen, bei denen jede ein Glas Wein in der Hand hielt. Ich begann, sie zu meiden, und auch unseren Familienanrufen blieb ich immer öfter fern. Sogar Omelogors Anrufe ignorierte ich. Niemand stand mir näher als sie, aber mit ihr zu sprechen wurde zum Kraftakt, denn überhaupt zu sprechen war ein Kraftakt. Ich lag im Bett und tat nichts, und ich fühlte mich schlecht, weil ich nichts tat; ich tat trotzdem nichts. Ich schickte Mitteilungen an Freundinnen und Freunde, dass ich mit Schreiben beschäftigt sei, und weil ich log, schmückte ich alles zu sehr aus, statt mich kurzzuhalten. Um mein Gefühl der Verzweiflung zu lindern, beschloss ich, keine Nachrichten mehr zu verfolgen. Ich ignorierte das Internet und das Fernsehen und las Agatha-Christie-Krimis, in deren vornehme Unglaubwürdigkeiten ich mich flüchtete. Dann wieder verschluckten mich die Nachrichten vollständig. Ich trank Ingwer in warmem Wasser und fügte Zitronensaft aus einer rissigen alten Flasche, die hinten in meinem Kühlschrank stand, hinzu, und Cayennepfeffer und Knoblauch und gemahlene Kurkuma aus meinem Gewürzschrank, bis mir von der Mischung übel wurde. Jeden Morgen zögerte ich, den Tag zu beginnen, denn das Bett zu verlassen bedeutete, sich erneut der Aussicht auf Leid zu stellen.
In diesem neuen, angehaltenen Leben entdeckte ich eines Tages ein graues Haar auf meinem Kopf. Es war über Nacht erschienen, an meiner Schläfe, eng gewunden, und im Badezimmerspiegel dachte ich zuerst, es sei ein Fussel. Ein einzelnes graues Haar, leicht glänzend. Ich zog es in all seiner Länge glatt, ließ es los und zog es dann wieder lang. Ich riss es mir nicht aus. Ich dachte: Ich werde alt. Ich werde alt, und die Welt hat sich verändert, und ich bin nie wirklich erkannt worden. Ein ungefilterter Anflug von Melancholie trieb mir Tränen in die Augen. Alles, was bleibt, ist dieses fragile Ein- und Ausatmen. Wo sind all die Jahre geblieben, und habe ich das Beste aus meinem Leben gemacht? Doch wie bemisst man endgültig, ob man das Beste aus seinem Leben macht, woher sollte ich wissen, ob es mir gelungen war?
Wenn ich auf die Vergangenheit blickte, wurde ich von einer Welle des Bedauerns erfasst. Ich weiß nicht, was zuerst kam – ob ich anfing, Bedauern zu empfinden, und dann die Männer aus meiner Vergangenheit googelte oder ob das Googeln der Männer aus meiner Vergangenheit mich mit Bedauern überflutete. Ich dachte an all die Anfänge und an die Leichtigkeit des Seins, die mit diesen Anfängen einhergegangen war. Ich trauerte um die Zeit, die ich im Hoffen darauf verloren hatte, dass sich das, was sich mir da bot, in ein Wunder verwandeln würde. Ich trauerte um etwas, von dem ich nicht einmal wusste, ob es existierte, um eine Person da draußen, die mich gestreift hatte, die mich vielleicht nicht nur geliebt, sondern wirklich erkannt hatte.
Ich erinnerte mich an den koreanischen Jungen in dem Musikkurs, den ich im ersten Studienjahr belegt hatte, vor so langer Zeit, in meinem ersten Jahr in Amerika, als alles noch neu gewesen war. Einführung in die Musik. Die kleine weiße Professorin war voller Enthusiasmus, redete schnell, und ihr amerikanisches Englisch mit dem starken regionalen Akzent war mir so fremd gewesen wie ein nicht enden wollender knirschender Ton, dass ich mich oft verloren fühlte. Eines Tages blickte ich zu dem Studenten, der neben mir saß, um zu schauen, ob er mitbekommen hatte, was sie zuletzt gesagt hatte, und auf seinem Papier standen keine mir bekannten Buchstaben, sondern zarte Bilder, die aus kürzesten, schwer zu fassenden Linien bestanden. Ich starrte ihn an, fasziniert von der Schönheit koreanischer Schrift, beeindruckt davon, dass er so schreiben und ihm eine Bedeutung geben konnte. In meiner Erinnerung ist er mir da zum ersten Mal aufgefallen, aber Erinnerungen lügen. Woher wusste ich, dass es Koreanisch war, schließlich kannte ich die Unterschiede zwischen Japanisch, Chinesisch und Koreanisch nicht? Ich weiß nicht, woher ich es wusste, aber ich wusste es, und ich wusste auch, dass er, wenn er auf Koreanisch schrieb, aus Korea kommen musste; er war kein Amerikaner, wir waren uns ähnlich, und so mussten seine Tage, wie meine, von Einsamkeit geprägt sein. Ich erhoffte mir seine Aufmerksamkeit, tat aber nichts, um sie zu erregen. Er war gut aussehend, stämmig und kräftig, sein kurz geschnittenes Haar wirkte auf mich wunderbar trotzig. Er kam immer mit gesenktem Blick durch die Tür, als wäre er schüchtern oder beschäftigt, und ließ seinen Rucksack zu Boden rutschen, bevor er sich setzte. Ich stellte mir vor, wie wir uns an den Händen hielten und auf jenem Rasen saßen, auf dem amerikanische Studierende in der Sonne ihre Sandwiches aßen. Wie sie würden wir mit dem Auto zum Strand fahren und dann angetrunken und sorglos, überall Sand und Salz, vor dem Wohnheim parken. Jeden Mittwoch und Freitag vor dem Musikseminar nahm ich mir vor, meine Telefonnummer auf ein Stück Papier zu schreiben; es kam mir gewagt und aufregend vor, wie etwas, das Leute in Filmen machten, Leute, die wussten, wie es läuft. Wochenlang saßen wir nebeneinander, seine Nähe wirkte wie elektrische Spannung auf mich, aber ich schrieb die Nummer erst in der Woche vor den Abschlussprüfungen auf. Ich fügte hinzu: Wollen wir uns später treffen? Dann zerriss ich den Zettel, und bei unserer Prüfung schrieb ich nur meinen Namen und meine Telefonnummer auf die Rückseite eines Kassenzettels. Ich habe ihm den Zettel nie gegeben. Ich gab mein blaues Buch ab und ging. Ich habe ihn nie wiedergesehen, meinen gutaussehenden Koreaner mit den stacheligen Haaren. Im nächsten Semester suchte ich die Klassen und Flure ab, und ein- oder zweimal sah ich einen Asiaten mit kantigen Gesichtszügen, und ich schaute ihm nach, bis ich erkannte, dass es jemand anderes war. Vielleicht ist er zurück nach Korea gegangen. Könnten wir jetzt zusammen sein, mein Koreaner und ich, mit ein oder zwei Kindern, die in Seoul und Lagos Urlaub machten und in New York lebten? Ich mag New York nicht. Die Luft ist säuerlich, die Anonymität sengend. Ich fühle mich dort richtungslos, wie ein Steinchen, das in einem großen gleichgültigen Kürbis herumklappert. Gleich nach dem College lebte ich ein Jahr lang in einer Einzimmerwohnung an der Ecke zwischen 42nd und Lex, nachdem ich meinen Vater davon überzeugt hatte, dass angehende Schriftstellerinnen in New York leben müssen. Was hatte es mit dieser Stadt auf sich, dass ich den Drang verspürte, mich zu verstecken? Tagelang verkroch ich mich in meiner Wohnung, bestellte Essen und mied den Blickkontakt mit dem freundlichen Pförtner unten in meinem Block. Irgendwann gab ich den Roman auf, nahm einen Werbejob an und zog weg, ohne je zurückkehren zu wollen. Dennoch tauchte New York oft in meinen imaginierten Leben auf, vielleicht weil die Stadt für imaginierte Leben bestimmt ist. Auch Paris kam vor, ein anderer Ort, den ich nicht mag. Paris trägt schwer an seiner Einzigartigkeit, deshalb fehlt der Stadt die Anmut; sie geht davon aus, dass sie einen bezaubert, bloß weil sie bezaubernd ist. Und die Schwarzen Menschen aus Paris wirken grau, als habe die freundliche Verachtung, die das Land den Schwarzen Französinnen und Franzosen entgegenbringt, Asche auf ihrer Haut hinterlassen. Dieses Bild der Schwarzen Pariser stammt von einem Mann, den ich drei Jahre meines Lebens zu lieben glaubte. Nein, von einem Mann, den ich drei Jahre lang geliebt hatte; und als es vorbei war, wünschte ich mir, ich hätte ihn nie geliebt. Darnell. Sein Name war Darnell.
»Sie sehen grau und verwaschen aus. Die Franzosen behandeln ihre Schwarzen wie Scheiße, aber wenn man Afroamerikaner ist, lassen sie einen irgendwie in Ruhe«, sagte er.
Er erzählte mir eine Geschichte darüber, wie er in Paris aus einem Zug gestiegen war, in den uniformierte Männer stürmten und anfingen, ausschließlich die Papiere der Schwarzen Leute zu kontrollieren – Les papiers! Les papiers! Ein kurzer Blick auf seinen blauen amerikanischen Pass, und sie winkten ihn durch, und er schaute zurück und sah vier Schwarze Franzosen, die gedemütigt und zusammengekauert an einer Bahnhofssäule standen, während alle anderen unbekümmert vorbeiliefen. Ich wollte von Darnell hören, dass die Sache ihn bewegte oder ihm das Herz brach oder ihn wütend machte, aber er sagte, es handele sich um die Verdinglichung des subjektiven kulturrassistischen Paradigmas. Oder so was in der Art.
Zwei
Wir lernten uns bei einem Geburtstagsessen kennen. Meine Freundin LaShawn sagte, die Leute würden ihn den Denzel Washington der akademischen Welt nennen, für seine Kunstgeschichtskurse gäbe es lange Wartelisten, und zu seiner Sprechstunde würden bewundernde Studierende sein Büro belagern. Er sah nicht aus wie Denzel, aber natürlich war Denzel nur eine Chiffre für Männer wie ihn, Männer, die über eine komprimierte Schönheit verfügten. Als ich ihn das erste Mal sah, löste die Schwerkraft sich auf, ich entglitt ihr. Die Anziehung, die ich spürte, war unmittelbar, verzehrend, urgewaltig, plötzlich wollte jedes kleinste Teilchen von mir auf ihn zustürzen. Dieser Moment war weniger einer des Verlusts als vielmehr der Kapitulation. Er war dunkel und hatte dunkle Augenbrauen. Ein paarmal trafen sich unsere Blicke, aber er wandte sich jedes Mal ab und beachtete mich dann kaum noch. Er trug seine Überlegenheit lässig zur Schau; er wusste, dass er sich nicht besonders anstrengen musste, denn die Welt gab sich seinem Licht willig hin. Wenn er sprach, schienen alle am Tisch wie gebannt, als säßen sie ihm zu Füßen und warteten nur darauf, dass ein paar Krümel seiner außergewöhnlichen Einsichten auf sie herabfielen.
»Er war gegen die Bürgerrechte und für die Apartheid in Südafrika, und ich soll um ihn trauern?«, sagte er sehr langsam, als hätte sein Publikum besser daran getan, dieses Thema gar nicht erst aufzuwerfen. »Haben wir seine Wahlkampfrede über die ›Rechte der Staaten‹ vergessen? Nicht zu sprechen von seinem katastrophal-ineffektiven Kampf gegen Drogen. Mann, Reaganomics hat uns zerstört.«
Ich hatte das Wort »Reaganomics« noch nie zuvor gehört, und noch Jahre später überkam mich jedes Mal, wenn es jemand sagte, ein ebenso wehmütiges wie bittersüßes Gefühl. Das Abendessen war vorbei, und alle verabschiedeten sich, aber Darnell machte noch immer keinen Zug. In mir kam der Wunsch auf, ich wäre mutig genug, selbst den ersten Schritt zu machen, so wie Omelogor es getan hätte, aber ich wusste nicht, wie ich Männern gegenüber diese Art von Frau sein konnte, eine, die Dinge in Gang setzt. Schließlich fragte er mich nach meiner Nummer, nicht begierig, sondern so, als sei es ihm gleich, ob er sie bekäme oder nicht, und trotzdem triumphierte ich.
Ich habe in meinem Leben noch nie so oft gelogen wie vor Darnell. Ich habe gelogen, um ihm zu gefallen, um die Person zu sein, die er in mir sehen wollte, und manchmal habe ich gelogen, um ihm einen erbärmlichen Fetzen Aufmerksamkeit abzuringen. Ich bin krank, schrieb ich, um eine Antwort zu erzwingen, nachdem ich ihm tagelang Nachrichten geschickt hatte, die unbeantwortet blieben. Manchmal schrieb er sofort zurück, andere Male wartete er ein oder zwei Tage. »Werd gesund«, mehr schrieb er nicht; keine Frage, die ein Gespräch ermöglichte, nicht: »Wie geht es dir jetzt?«, oder »Was ist los?«. Meine Tage lösten sich in Leere auf, bis ich ihn wiedersah. Mein Handy lag immer neben mir auf dem Schreibtisch, war nie auf lautlos gestellt, aus Furcht, ich könnte seinen Anruf verpassen. Wenn es piepte, nahm ich es in die Hand und ärgerte mich über die Person, die mir eine Nachricht geschickt hatte, als habe sie den Platz eingenommen, der für ihn bestimmt war. Sein Schweigen verblüffte mich; wie konnte die Kraft meiner Gefühle keine vergleichbare Besessenheit in ihm auslösen? Ich stellte mir vor, wie er in den Eingeweiden der Bibliothek durch Kisten mit Unterlagen stöberte, vom Staub niesen musste und nicht an mich dachte, während ich jeden Augenblick in Gedanken an ihn versunken verbrachte. Ich versuchte damals, wieder einen Roman zu schreiben, und war bereits dabei, daran zu scheitern, aber noch deutlicher scheiterte ich an seinem Schweigen. Ich fing immer wieder von vorne an und dann wieder von vorne, stellte in allem, was ich las, klägliche Verbindungen zu Darnell her und verweilte bei Sätzen, die mit Liebe oder Männern oder Beziehungen zu tun hatten, als könnten sie das Rätsel, das Darnell für mich war, lösen.
»Ich habe mir Sorgen um dich gemacht«, sagte ich, als er endlich wieder auftauchte.
»Aber ich verbringe jede freie Minute im Archiv, und du arbeitest an deinem Roman.«
»Wir können uns doch trotzdem jeden Tag kurz melden, oder? Selbst wenn es nur ein kurzes Hallo ist, bevor du zu deinem Unterricht gehst oder eine Pause machst, um aufs Klo zu gehen«, sagte ich, unfähig, meine Verzweiflung zu unterdrücken. Er antwortete nur mit einem Blick, diesem vernichtenden Blick, der in seiner herrschaftlichen Enttäuschung so vielsagend ausdrückte: Deine Bedürfnisse sind zu gewöhnlich. Ich wollte Liebe, altmodische Liebe. Ich wollte, dass meine Träume mit seinen im Einklang waren. Treu sein, unser wahres Ich teilen, streiten und kurz den Verlust spüren, wohl wissend, dass die süße Versöhnung bevorstand. Aber das sei zu gewöhnlich, sagte er, diese Vorstellung von Liebe, bürgerliche Kindereien, mit denen Hollywood die Menschen seit Jahren füttere. Er wollte, dass ich ungewöhnlich bin, interessant, und es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was das bedeutete.
»Was hast du Verdorbenes angestellt?«, fragte er. »Erzähl es mir.«
Ich erzählte ihm Dinge, die nie passiert waren, aus der Luft gegriffene, mit vielen Details ausgeschmückte Geschichten: vom Masseur mit den geschickten Händen, der mitten in der Massage innehielt, um einen in silbernen Stoff eingewickelten Dildo auszupacken. Sex, diese primitive Verflechtung der Körper, war für mich immer mit der Hoffnung auf Verbindung, Bedeutung, Schönheit, ja sogar Glückseligkeit verbunden. Aber ich habe Darnell angelogen, weil er mehr Interesse am Ungewöhnlichen als am Wahrhaftigen hatte. Bei jeder Geschichte musterte er mich, als prüfe er ihren Wert. Manchmal wollte er, dass ich ihm die Geschichten, die ihm gefielen, noch einmal erzählte, und jedes Mal schmückte ich sie weiter aus. Ich hatte immer das Gefühl, mir würde etwas entgleiten. Wir waren zwei Erwachsene, und Darnell verdiente seinen Lebensunterhalt damit, Erwachsene zu unterrichten, aber es lag eine schreckliche Unreife in meinen Lügen und seinen Erwartungen. Er erzählte mir, seine Exfreundin habe sich mit Rasierklingen blutige Schnitte in die Oberschenkel geritzt. Eine somalische Frau namens Sagal. Allein der Name. Sagal. Ich stellte sie mir vor, rank und schlank, wie sie durch einen Raum glitt. Er sagte, sie sei brillant und abenteuerlustig gewesen, aber er sagte nicht, was er mit abenteuerlustig meinte. Ich wollte nicht fragen, was aus ihr geworden war. Sie war ein Geist, der nur existierte, um mich zu verunsichern.
Einmal meldete er sich nach einer Woche Schweigen und erzählte, er sei in Alabama gewesen und habe sich afroamerikanische Lithographien angesehen.
»Was? Davon wusste ich nichts«, sagte ich.
»Na ja.« Er zuckte mit den Schultern, lehnte sich zurück, als sei er gelangweilt von unserem Gespräch, und ließ den Blick über die Leute schweifen, die am Tresen des Cafés anstanden. Auf mich wirkte er nicht wie eine Person, die sich je vollständig erschließen ließ, sondern wie ein Rätsel, das mit jedem Tag unlösbarer wurde.
»Ich meine, ich dachte, du würdest mir Bescheid geben, wenn du unterwegs bist und den Staat verlässt«, sagte ich.
»Warum, welchen Unterschied macht das? Ich hätte auch einfach in der Bibliothek sein können.«
Aber es machte einen Unterschied. Was, wenn er mit dem Flugzeug abgestürzt wäre oder es einen Tornado oder Wirbelsturm gegeben hätte? Und auch wenn nichts passierte, ich wollte, nein, ich hatte es einfach verdient zu wissen, dass er nicht wie sonst auf dem Campus war, nur ein paar Meilen von mir entfernt. Ich hatte es sogar verdient zu wissen, ob er irgendwo außerhalb von Philadelphia unterwegs war – aber außerhalb des Staates, den ganzen Weg nach Süden, tausend Meilen nach Alabama zu reisen und mich eine Woche lang zu ignorieren? Tränen schossen mir in die Augen.
»Was ist das zwischen uns? Bin ich deine Freundin?«, fragte ich. Ich hörte den nasalen Ton in meiner Stimme und hasste ihn.
»Was ist das zwischen uns?«, wiederholte er mit diesem schnellen einseitigen Zucken seines Mundes. Manchmal bedeutete es Irritation, andere Male Verachtung. »Das ist eine abgedroschene Frage aus dem zeitgenössischen, popkulturellen Morast. Diese Art zu sprechen ist der Feind des Denkens.«
Ich schaute weg und versuchte, meine Tränen wegzublinzeln. An der Wand des Cafés hingen fröhliche Zeichnungen: ein gebogenes Weinglas, an dessen Rand eine Erdbeere steckte, ein Kaffeebecher, aus dem ein Lutscher ragte.
»Was zählt, ist, dass ich hier bin«, sagte er, sein Gesicht wurde kurz weich, und unter dem Tisch drückte er sein Bein gegen meines.
»Ich liebe dich«, sagte ich. Er antwortete nicht, natürlich nicht, also sagte ich: »Darnell, ich möchte hören, wie du sagst: ›Ich liebe dich.‹«
»Ich wäre nicht hier, wenn es nicht so wäre.«
»Aber sag es, bitte. Ich will es hören.«
»Ich liebe dich«, sagte er. Ein Murmeln und dennoch ein Erfolg. Ich war eine Bettlerin ohne Schamgefühl.
»Das würde ich gern im Bett hören«, sagte ich.
»Was?«
»Wenn du ›Scheiße, Scheiße, Scheiße‹ sagst, fühlt sich das zu unromantisch an.«
»Kleines, bekommst du deine Tage?«
Ich lachte. Immer hatte ich zu schnell ein falsches Lachen parat. Ich hatte ihm davon erzählt, dass ein Arzt mir endlich geholfen hatte, einen Namen für das Grauen zu finden, mit dem ich jahrelang gelebt und unter dem ich gelitten hatte, sehr gelitten, ein paar Tage im Monat, mein Geist stumm vor Selbsthass, mein aufgeblähter Körper bar jeglicher Energie und Hoffnung: prämenstruelle Dysphorie.
»Wie unterscheidet sich das vom prämenstruellen Syndrom?«, war die einzige Frage, die Darnell mir dazu stellte, und er klang dabei so klinisch, als wäre ich nichts weiter als eine seelenlose Fallstudie. Jedes Mal, wenn ich ihm von intimen Dingen erzählte, antwortete er in distanziertem Ton oder mit heiterem Spott, der mich verletzte. Aber ich versteckte meine Verletzung hinter meinem Lachen, denn sie würde mich bedürftig wirken lassen, und er fand Bedürftigkeit langweilig. Aus meiner Liebe für ihn war jegliche Vernunft gewichen. Selbst das Körperliche war kein Trost. Für einen Mann, der so sehr auf ungewöhnliche Geschichten stand, war er ziemlich selbstzentriert und unberührt von Bedürfnissen, die nicht seine waren; kurz vor dem Höhepunkt, wenn er »Scheiße, Scheiße, Scheiße« sagte, verschloss ich meinen Geist vor seinen Worten, was wiederum meinen Körper dazu brachte, sich zu verschließen. Liebe kann selbstzerstörerisch sein, wenn es sich überhaupt um Liebe handelte. Vielleicht braucht es einen anderen Namen für diesen Zustand der beklemmenden Euphorie? Diese glühende Abwesenheit eines Wohlgefühls. Ich suchte im Internet nach Darnell und las Dinge, die ich längst gelesen hatte, und betrachtete Fotos, die ich längst betrachtet hatte. Ich richtete falsche E-Mail-Konten ein und schickte ihm Nachrichten, in denen ich mich als verliebte Studentin ausgab, und ich war erleichtert, als er nicht darauf antwortete, aber auch besorgt, dass er es vielleicht doch irgendwann tun würde. Inzwischen bin ich erstaunt, wenn ich an das Ausmaß des Wahnsinns denke, das meine Gefühle erreicht hatten.
Jedes Jahr nahm mein Vater uns alle mit in den Urlaub nach Portugal, nach Lissabon und Porto und dann nach Madeira, der einzige Anlass, für den er großzügig Geld ausgab. Er sagte, er wolle Portugal damit seinen Dank erweisen, weil es Biafra im Krieg unterstützt hatte. Aus dem gleichen Grund verlagerte er bei der Fußballweltmeisterschaft seine Unterstützung auf Portugal, sobald die Schwarzen afrikanischen Mannschaften ausgeschieden waren. Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, wie Lissabon sich veränderte. Früher waren wir die einzigen afrikanischen Menschen, die auf der Avenida da Liberdade einkauften, und die Ladenbesitzer sprachen Englisch, sobald wir ihre Läden betraten. Dann kam der angolanische Ölboom, und die Straßen waren voller Angolanerinnen und Angolaner in Gucci und Prada, die noch mehr Gucci und Prada kauften, und die Ladenbesitzer fingen an, Portugiesisch mit uns zu sprechen, in der Annahme, dass auch wir aus Angola waren.
»Geschichte als Pointe: Angola rettet die portugiesische Wirtschaft«, sagte mein Bruder Bunachi, als wir gerade beobachteten, wie eine portugiesische Verkäuferin sich hinkniete und einer eleganten Angolanerin dabei half, ein Paar Designerschuhe anzuprobieren. Ich machte heimlich Fotos von der Angolanerin, ihr geglättetes Haar zurückgekämmt, ihr Blick hochmütig mit halb geschlossenen Augen, als ihr die Schuhe angezogen wurden. Ich schickte Omelogor die Fotos mit dem Kommentar: Portugal auf Knien, und sie antwortete: So lustig, leg den Roman zur Seite und versuch es mit Reiseberichten. Das war ein Scherz, aber er brachte mich auf eine Idee. In allen möglichen Texten und Empfehlungen für Touristen ging es immer vor allem um die Vergangenheit, aber was war eigentlich mit der Gegenwart? Man erfuhr schließlich in Restaurants und im Nachtleben viel mehr über einen Ort als durch seine Museen und alten Schlösser. Ich kündigte meinen Job, berauscht von wachsender Vorfreude, und malte mir schon meine Artikel und das Anschreiben an die Redaktionen aus, in dem stand: »Unbeschwerte Beobachtungen aus einer afrikanischen Perspektive«.
Ich reiste bequem, fuhr mit Taxis, ging allein einkaufen und spazieren. Ich schrieb darüber, wie ich in einem berühmten Pariser Hotel ein versalzenes Omelett aß, wie ich mit ein paar anderen alleinreisenden Frauen einen Rave in Budapest besuchte und wie ich in Rom die Kleidungsstücke zählte, die an den Wäscheleinen in den Kopfsteinpflasterstraßen von Trastevere trockneten. Meine Artikel wurden von allen Reisemagazinen abgelehnt. Eine der Zeitschriften schickte mir mein Anschreiben zurück, darauf stand in Großbuchstaben das Wort »NEIN«, gefolgt von einem Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen brachte mich aus der Fassung. So aggressiv, dieser Strich und der Punkt. Ich las meinen Artikel noch einmal, auf der Suche nach Hinweisen, weshalb er eine solche Ohrfeige verdient hatte. Ein schlichtes »Nein« hätte gereicht, auch wenn es immer noch übertrieben wirkte, die Großbuchstaben über die ganze Seite zu ziehen. Andere Zeitschriften reagierten dezenter, sie schrieben zwei allgemein gehaltene Zeilen, die sagten, dass mein Artikel nicht der Richtung des Hefts entspräche.
Online fragte ich eine Gruppe Leute, die auch Reiseberichte schrieben, ob jemand je ein »Nein« mit Ausrufezeichen erhalten hatte. Niemand. Aber sie erzählten von ihren Erfahrungen mit Absagen, eine kam von einem Redakteur, der einen Artikel annahm, um ihn nach der letzten Überarbeitung dann doch abzulehnen. Eine Person vermutete, das Ausrufezeichen sei ein Tippfehler. Nein, erwiderte ich, es war mit der Hand geschrieben. Eine andere sagte, dass man seine Skizzen und Exposés sowieso immer häufiger digital schickte, also bald niemand mehr unfreundliche, mit der Hand geschriebene Rückmeldungen von Redakteurinnen und Redakteuren, die einen schlechten Tag hatten, bekommen würde. Eine schrieb: Redaktionsurteile über deine Arbeit sind nie in Stein gemeißelt. Dieser Ausrufezeichen-Redakteur findet deinen nächsten Beitrag vielleicht sogar gut und veröffentlicht ihn.
Danke, antwortete ich. Im Dschungel des Internets gab es noch die Güte von Fremden. In diesen Gruppen fand ich Tipps und Anregungen und schloss Online-Freundschaften mit Leuten, die in echten Reisemagazinen veröffentlichten, und manchmal reiste ich an Orte, die auch sie bereist hatten.
Auf Rückflügen fühlte ich mich immer energiegeladen, mein Geist war wach, die Seiten meines Notizbuches füllten sich. Ideen schwirrten mir im Kopf herum, aber sobald ich in meinem Arbeitszimmer saß und versuchte, sie zu Sätzen zusammenzuflechten, rauschten sie davon, stießen sich hartnäckig voneinander ab und weigerten sich zusammenzufinden. In diesem Frustnebel schrieb ich Sätze, die nicht ganz das ausdrückten, was ich sagen wollte, und ich spürte, dass meine wirklichen Worte zum Greifen nahe waren, und doch kriegte ich sie nie zu packen.
»Jetzt also Reiseschriftstellerei?«, fragte meine Mutter. »Du bist Entdeckerin fremder Länder geworden?«
»Nein, eher Beobachterin von Menschen und Probiererin von Speisen in fremden Ländern«, sagte ich und lächelte.
Meine Mutter blickte zum Himmel und klatschte in die Hände – Wunder gibt es immer wieder! Ich nahm keinen Anstoß an ihrer Skepsis. Da tauchte ich schon wieder auf mit einem neuen Anflug von Selbstüberschätzung, nachdem ich seit meinem Abschluss so viele Jobs angefangen und wieder geschmissen hatte, statt nach Hause zurückzukehren und das Familienunternehmen zu führen, gemeinsam mit meinem Vater und Afam.
»Du verdienst kein Geld, bis dein Artikel veröffentlicht ist? Wie willst du das ganze Beobachten und Probieren bezahlen?«
»Mit meinem eigenen Geld.«
»Du meinst mit dem Geld deines Vaters, das er auf dein Konto einzahlt.«
»Mummy, wenn jemand Geld auf dein Konto einzahlt, ist es dann nicht dein Geld?«
»Du hast nicht dafür gearbeitet.«
Sie arbeitete auch nicht für ihr Geld, und sie gab mehr vom Geld meines Vaters aus als er selbst. Aber das würde ich natürlich nie laut sagen. Später hörte ich meine Eltern reden, und der theatralische Tonfall meiner Mutter verriet mir, dass sie wollte, dass ich mithörte.
»Erst Romane, jetzt Reisen. Was, wenn wir es uns nicht leisten könnten, all diese Dinge zu finanzieren?«
»Aber das können wir.«
»Du musst aufhören, dein Nesthäkchen so zu verwöhnen. Es tut ihr nicht gut; sie war schon immer zu dünnhäutig, du hilfst ihr so nicht.«
Mein Vater summte einen neutralen, um Frieden bemühten Ton. Irgendwo hinter seiner Klugheit und seiner Vorsicht war er ein Träumer; einer, der Träume erkannte und andere träumen ließ. Meine Mutter beschützte mich auf die einzige ihr vertraute Weise, mit den Versatzstücken ihres pragmatischen Denkens, das bewährt und richtig war, der Norm entsprechend. Häufig bemerkte ich, wie sie mich beobachtete, ihre Augen glasig vor lauter Fassungslosigkeit, ihr Baby, ihr einziges Mädchen, das sich weigerte, nach Hause zu kommen, das umherschwirrte wie ein vertrocknetes, vom Wind davongetragenes Blatt. Mir fehlte jener Ehrgeiz, der ihr vertraut war, und dafür gab sie Amerika die Schuld. Es dauerte Jahre, bis sie aufhörte, mich zu fragen, wann ich wieder nach Nigeria ziehen würde, als sei mein Leben hier bloß ein Prolog. Aber Amerika war wie eine Party, deren Gastgeberin sich auf alle Eventualitäten vorbereitet hatte, auf alle. Ich wollte bleiben, weil ich hier nie zu fremd sein würde, doch das sagte ich ihr nicht, weil ich es unfair fand, Verständnis von ihr zu erwarten.
Darnell googelte meinen Vater und sagte: »Heilige Scheiße. Ist das wirklich sein Nettovermögen?«
»Du weißt doch, dass bei diesen Sachen immer übertrieben wird«, sagte ich.
»Nein, das weiß ich nicht. Manche von uns haben Eltern, die noch nicht einmal wissen, was ›Nettovermögen‹ bedeutet. Ich meine, ich wusste, dass du eine Prinzessin bist, dass du eine schicke Wohnung in Center City hast und dass du deinen Job geschmissen hast, um Reiseberichte zu schreiben«, sagte er und setzte mit seinen Zeigefingern Anführungszeichen in die Luft, als er »Reiseberichte« sagte. »Aber das? Himmel.«
Seitdem machte er sich oft über den Reichtum meiner Familie lustig, mit witzigen Bemerkungen, die immer Stacheln trugen. Sein Freund in New Jersey helfe ehrenamtlich einer afrikanischen Familie mit den Einwanderungspapieren, sagte er und fügte hinzu: »Eine echte afrikanische Familie, nicht so wie deine«, als würde Wohlstand Leute zu unechten afrikanischen Menschen machen.
Wenn er Alkohol trank, entbrannte sein scharfzüngiger Humor, der nicht wirklich witzig war. Nach ein paar Drinks mit seinen Freunden sagte er manchmal: »Wusstet ihr, dass Chias Eltern vermutlich meine Leute verkauft haben? Sie stammt von jahrhundertealtem Igbo-Geld ab. Die haben an dieser westafrikanischen Küste weitaus mehr an die Weißen verkauft als bloß Palmfrüchte.«
Die Gesichter seiner Freunde verharrten in einem Dazwischen, als könnten sie nicht lachen, aber auch nicht nicht lachen. Am Anfang sagte ich scherzhaft: »Der Biafra-Krieg hat das alte Igbo-Geld vernichtet, also ist alles nagelneu jetzt.« Aber der Witz ging daneben, und so setzte ich irgendwann bloß noch ein Lächeln auf, das Reue versprach. Alles, um das Brodeln in Darnell zu beruhigen. Es handelte sich um eine seltsame Art des Grolls, denn er bestand zum Teil aus Bewunderung. Auf einer Spendengala in New York, zu der uns einer seiner Freunde eingeladen hatte, prahlte er vor dem reichen Ostküsten-Weißen, der für unseren Tisch bezahlt hatte: »Die schicke Seife, die Ihre New Yorker Vorfahren in den 1880ern in London bestellten, wurde hergestellt mit dem Palmöl, das Chias Familie aus Igbo-Land exportierte.«
»Phantastisch«, sagte der Mann, während er unaufhörlich nickte, sein Gesicht gerötet vom Alkohol, darum bemüht, seine Verwirrung zu verbergen.
Mich verstörte das, aber ich sagte mir, dass es zumindest nicht ganz so schlimm war wie bei diesem einen Mal, als die Uniberaterin für ausländische Studierende ihre Kollegin in meiner Anwesenheit gefragt hatte: »Wie schmutzig ist das Geld ihrer Familie denn?« Ich wartete gerade darauf, ein Formular auszufüllen.
Der Schock verschlug mir die Sprache. Erst als ich später den Flur hinunterging, fiel mir eine Antwort ein, die ich mich nie auszusprechen getraut hätte: »Der Reichtum meiner Familie ist sauberer, als Ihr Körper es je sein wird.«
Ich verschob meine erste Reise nach Indien, weil Darnell plötzlich aus seinem Schweigen auftauchte. Nach tagelang unbeantwortet gebliebenen Nachrichten stand er vor meiner Wohnungstür, seine schwarze Tasche hing quer vor seinem Oberkörper. Sobald ich ihn sah, standen Himmel und Erde im Einklang miteinander, und alles war gut. Meine Aufregung machte mich so zappelig, als hätte ich zu viel Kaffee getrunken. Ich flatterte umher und fragte, was er vorhatte, ob ich Essen bestellen oder wir ausgehen sollten und ob ich seinen Kapuzenpulli, auf dem vorne ein Fleck war, in die Waschmaschine stecken sollte? Er lag auf meiner Couch, und ich setzte mich neben ihn und berührte zärtlich seine Wange. Normalerweise berührte ich ihn nicht, es sei denn, er tat es zuerst, denn mein Verlangen nach Körperkontakt hätte als weitere Schwäche verstanden werden können. Er zog meine Handfläche an sein Gesicht, und einen Moment lang hatte ich das Gefühl, dass wir uns vertraut waren und unsere Zukunft sicher schien. Etwas später an diesem Tag fragte ich ihn, ob er sich meinen Artikel ansehen würde. Ich hatte so etwas nie zuvor gefragt, aber dieser Tag fühlte sich besonders an, ich war voller Hoffnung. Der Titel des Artikels war: »Die Reise vor der Reise. Was es heißt, als Nigerianerin die Welt zu erkunden«, und erzählte von den Hindernissen, die mein Pass mit sich bringt, von den abgelehnten Visa, den zusätzlichen Wartezeiten und dem Misstrauen der Beamten in der indischen Botschaft. Der nigerianische Reisepass als Verdachtsobjekt.
»Er ist ein bisschen anders als meine anderen Texte. Ich möchte wissen, was du denkst«, sagte ich.
»Du brauchst jemanden, der objektiv ist«, sagte er. Er schaute nicht auf den geöffneten Laptop, den ich ihm hingeschoben hatte. Zu sagen, ich bräuchte eine objektive Person, war seine Art, nein zu sagen.
»Aber du schreibst doch auch Peer-Reviews für deine Freunde«, sagte ich.
»Das ist was anderes«, sagte er knapp.
Ich habe ihn nie wieder darum gebeten, genauso wie ich ihm nie meine Ängste anvertraute, um ihn vor der Last zu bewahren, die ich sein konnte.
Ich war gerade dabei, mein Hotel in Delhi umzubuchen, als er fragte: »Kann man überhaupt von Reiseberichten sprechen, wenn du so luxuriös reist?«
»Das ist doch kein Luxus.«
»Für dich vielleicht nicht. Manche Leute sind mit dem Rucksack unterwegs und übernachten in Hostels und so einen Scheiß.«
»Aber es gibt Leute, die so reisen wie ich. Ich glaube nicht, dass Reiseberichte nur von Billigreisen handeln sollten.«
»Leserschaft, erkenne deine Klasse! Die Elite hat zur Weihe gerufen!«, spottete er.
»Wenn man meine Texte lesen würde, wüsste man, dass das so nicht wahr ist.«
Er schaute mich an, und ich merkte, dass er meine Antwort trotzig fand, was nicht meine Absicht war.
»Ich meinte ein allgemeines ›man‹, nicht dich«, sagte ich und lachte. »Ich meinte, wenn jemand liest, was ich schreibe, wird schon klar sein, dass ich nicht so hochmütig bin.«
»Okay, okay«, sagte er, und sein Mund zuckte und machte mein Selbstwertgefühl zunichte. Ich fing an, mir Sorgen darüber zu machen, dass ich herablassend sein könnte. Ich schaute mir meinen letzten Artikel wieder und wieder an und strich den Absatz über das Taxi, mit dem ich gefahren war, um stundenlang die Landschaft um Zürich herum zu erkunden. Es mag elitär sein, Taxi zu fahren, statt in den Reisebus zu steigen. Aber so ist es gewesen, also warum lügen? Ich fügte den Absatz wieder ein und löschte ihn dann wieder. Ich war ähnlich verunsichert wie damals in meinem letzten Schuljahr, als ich zum Spring Break mit Freundinnen und Freunden nach Mexiko gefahren war. Ein Mädchen, das ich nicht sehr gut kannte, fragte mich: »Du fährst mit dem Taxi nach Tulum? Wer macht denn so was? Mit dem Fahrpreis könnte man die Kinder aus dem Bergland ein Jahr lang durchfüttern.« Ich erinnerte mich an ihre blassen Augenbrauen, ihr vorwurfsvolles Gesicht, als hätte ich das Geld, das für die Kinder aus dem Bergland bestimmt war, irgendwie an mich gerissen. Ich wusste nicht einmal, von welchen Bergen sie sprach. Aber ich bestellte das Taxi ab und stieg mit den anderen in den Bus. Später sagte LaShawn: »Warum hast du das getan? Wir wären voll gerne mit dir im Taxi gefahren.«
In mir kam der Wunsch auf, ich hätte mich damals behauptet. Ich fügte den Absatz über meine fast siebenstündige Fahrt durch das Umland von Zürich wieder ein, mit meinem warmherzigen, gesprächigen Fahrer, der aus einer Bauernfamilie in Vnà stammte und dessen Muttersprache Rätoromanisch gewesen war, eine Sprache, von der ich bis dahin nicht gewusst hatte, dass sie existierte. War es auch herablassend, über ihn zu schreiben?
Ich löschte den Absatz wieder.
Darnells Freunde gehörten zu jener Art von Menschen, die glaubten, sie wüssten Bescheid. Ihre Gespräche waren immer gespickt mit Beschwerden; alles war »problematisch«, sogar Dinge, die sie guthießen. Sie hielten sich an ihre Clique, aber angstvoll, sie umkreisten einander, beobachteten einander, um einen Fehler zu erschnüffeln, ein Versagen, einen aufkeimenden Akt der Sabotage. Sie begegneten den Dingen, die sie mochten, mit Ironie, aus Furcht, etwas zu mögen, das sie nicht hätten mögen sollen, und sie waren unfähig darin, Bewunderung zu empfinden, sie kritisierten deshalb lieber Leute, die sie einfach hätten bewundern können. Keiner kommt so schnell an Fördergelder, es sei denn, du fickst einen weißen Glatzkopf. Die Hälfte des Buches ist so was von ein Plagiat. Er hat den Scheiß zu schnell fertiggekriegt, das ist doch keine richtige Forschung, der ist total pseudo.
In ihrer Gesellschaft fühlte ich mich hoffnungslos unterlegen. Die Tochter eines reichen Mannes mit zwei veröffentlichten Texten in einem Online-Magazin, von dem noch nie jemand gehört hatte. Wenn ich doch nur richtige Artikel in bekannten, in angesehenen Magazinen schreiben würde.
»Darnell sagt, du bist durch Mittel- und Südamerika gereist?«, sagte Shannon, die Schwarze Frau, die Amerikanistik unterrichtete. Sie wirkte viel jünger als die anderen, sie trug immer bedruckte T-Shirts und hatte ihre hübschen kupferfarbenen Sisterlocks hochgesteckt in zwei mädchenhafte Dutte.
»Ja«, sagte ich.
Sie sah mich an und wartete auf mehr.
»Ich habe entdeckt, wie divers viele lateinamerikanische Länder sind«, sagte ich und dachte sofort, dass ich idiotisch klang.
»Es ist interessant, wenn man sich vor Augen führt, auf welche Arten und Weisen die Schwarze Diaspora Lateinamerikas unsichtbar bleibt«, sagte Shannon. Sie sprach sehr oft von »den Arten und Weisen«. Das taten sie alle.
Ich dachte an meinen Brasilientext, in dem ich zwei Restaurants verglich: »Sei sorglos in Rio oder selbstherrlich in São Paulo.« Ich hatte den Satz für clever gehalten, aber jetzt erkannte ich, wie substanzlos der gesamte Artikel war. Aber Shannon würde sowieso nie ein unbekanntes Online-Magazin mit Sitz in Neuseeland lesen.
»Ich konnte nicht fassen, dass die Hälfte der Bevölkerung Brasiliens Schwarz ist. Auf den gängigen Bildern von Brasilien sieht man nie Schwarze Leute«, sagte ich und hoffte, dass das etwas mehr Substanz hatte.
Darnell verlagerte sein Gewicht und schürzte die Lippen; ich merkte, dass er unbeeindruckt war, vielleicht ärgerte er sich sogar. Wenn ich nur so reden könnte wie seine Freundinnen und Freunde.
»Es ist eine strukturelle Auslöschung, ein symbolischer Genozid, weil man nicht existiert, wenn man nicht gesehen wird«, sagte er.
»Ganz genau. Nur dass der Genozid nicht nur symbolisch ist«, sagte Charlotte, die Weiße, die Soziologie unterrichtete.
»Ich hab den Genozid überlebt«, sagte Thompson trocken, der Garifuna-Mann aus Belize, ein bildender Künstler, dessen Bart wie eine auf sein Kinn aufgemalte schwarze Landkarte wirkte. Ich lachte, dankbar, denn Thompson gelang es immer, ihre strengen Urteile abzufedern.
Als wir uns das erste Mal trafen, fragte er, ob »Chia« eine Abkürzung für irgendetwas sei, und wiederholte dann »Chiamaka« auf eine Weise, die mir das Gefühl gab, dass ich vielleicht interessant sein könnte.
»Apropos Reiseschriftstellerei«, sagte er, »wäre es eine Beleidigung, wenn ich sagte, dass du zu schön bist, um Reiseschriftstellerin zu sein, Chia? Du hättest Schauspielerin werden können.«
Ich schaute zu Darnell. Er wirkte amüsiert, also lachte ich und sagte: »Ich kann beim besten Willen nicht schauspielern.«
»Das können auch viele Schauspielerinnen nicht«, sagte Thompson.
»Eilmeldung, Thompson. Eine Frau kann schön sein und einen Beruf ausüben, der nichts mit ihrem Aussehen zu tun hat«, sagte Shannon, völlig ernst, als hätte Thompson keinen Scherz gemacht. »Außerdem brauchen wir mehr Reiseliteratur von Frauen. Als Frau zu reisen, stellt dich vor sehr eigene Herausforderungen.«
»Stimmt«, sagte Thompson.
»Reiseschriftstellerei ist ein selbstverliebtes Genre«, verkündete Charlotte und sah mich dabei an. Sie war klein und hager mit dem verkniffenen, humorlosen Gesicht einer Person, der Missstände Auftrieb gaben.
»Ich verstehe, was du meinst«, sagte ich schnell. »Aber ich hoffe, meine Texte sind nicht zu selbstverliebt. Ich bin gerade von den Komoren zurückgekommen, ein wirklich interessanter Ort.«
»Ein Freund von mir an der Brown hat dort eine Weile gearbeitet«, sagte Charlotte.
»Ach wirklich«, sagte ich. Sie sprach von Afrika immer nur als einem Ort, an dem ihre Freunde »arbeiteten« – Der-und-Der hat in Tansania, in Ghana, in Senegal, in Uganda gearbeitet –, und ich stellte mir ihr Afrika voller Weißer vor, die ohne Dank in der prallen Sonne schufteten. Es war unglaublich komisch, aber ich versuchte immer aufmerksam und interessiert zu wirken.
»Nettes Shirt«, sagte Thompson zu Shannon.
»Dieses olle Ding«, sagte Shannon und schaute auf ihr T-Shirt, auf dem Mary J. Blige mit Hut zu sehen war, die Hälfte ihres Gesichts im Schatten.
»Liegt es an mir, oder wird die Schönheit von Mary J. nicht ausreichend gewürdigt? Ein Thema, das einer Untersuchung bedarf«, sagte Thompson.
»Was hat es heute eigentlich mit deiner misogynen Besessenheit vom Schönsein auf sich?«, fragte Shannon.
»Warum ist das misogyn?«, antwortete Thompson.
»Die Frage sollte lauten: Warum wird das Talent von Mary J. Blige nicht ausreichend gewürdigt?«, sagte Charlotte.
»Ihr Talent ist unbestritten. Sie ist schön, aber es ist offensichtlich, dass die Musikindustrie das Aussehen von gewissen Schwarzen Frauen nicht würdigt«, sagte Thompson.
»In Zusammenarbeit mit jenen Frauen, die für schön befunden werden«, sagte Charlotte, als missbillige sie nicht nur, dass Frauen zu Objekten gemacht würden, sondern dass Frauen überhaupt attraktiv sein konnten. Sie wollte mir damit vermutlich zu verstehen geben, dass Fragen des Schönseins unter ihrem Niveau lägen, dass Schönheit an sich problematisch und dass Schönheit offensichtlich das Einzige sei, was ich vorzuweisen hatte. Sie sah mich an, und ich sah weg und schnitt, vorsichtig, in mein gut durchgebratenes Steak, gebremst von meinem schwindenden Selbstvertrauen.
»Ich kann nicht fassen, dass ich mir ein iPhone zugelegt habe. Apple ist so problematisch«, sagte Shannon und hielt das Telefon wie ein unerwünschtes Geschenk in ihrer Handfläche.
»Das Ziel von Apple ist die Homogenisierung unseres Denkens und Handelns. Es geht nicht darum, Kreativität freizusetzen oder Probleme zu lösen; das Ziel ist Massenkonformität und Massenbanalisierung. In gewisser Weise läuft das parallel zur Heteronormativität«, sagte Charlotte. Dann drehte sie sich zu mir um und sagte: »Du isst den Tod.«
Ich versuchte krampfhaft, einen Zusammenhang zwischen Apple, meinem Essen und dem Tod zu finden.
»Oh. Du meinst mein Steak. Nun, ich schätze, der Tod schmeckt gut«, sagte ich und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Ich wollte, dass Darnell mich verteidigte – er aß ebenfalls Fleisch, auch wenn er an diesem Abend einen Bulgur-Salat bestellt hatte –, aber er sagte nichts.