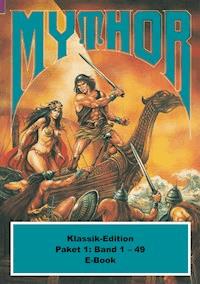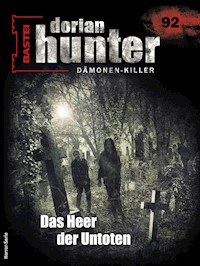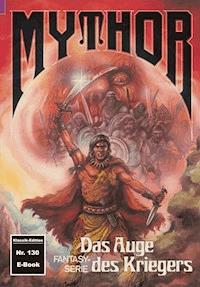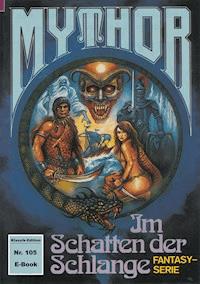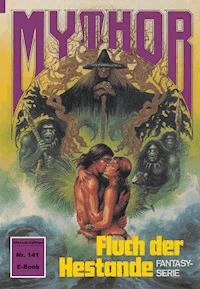4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Liebe Leser, sitzen Sie gemütlich? Die Herren bei einem Glas Whisky, die Damen bei einem blutroten Rotwein und Kerzenlicht? Sind die halbwüchsigen Kinder im Bett? Vielleicht regnet es draußen oder ein Gewitter ist im Anmarsch – das Smartphone ist endlich ausgeschaltet.
Kommen Sie mit ins 20. Jahrhundert. Ich nehme Sie gern an die Hand. 1973 erschien Hugh Walkers VAMPIRE UNTER UNS, als erster Band einer Reihe mit Horror-Erzählungen verschiedener Autoren.
1983 folgte in der feinen Reihe »Die unheimlichen Bücher« bei Heyne die Veröffentlichung der deutschen Erstübersetzung eines Exorzismus-Romans in der Tradition des nur wenige Jahre zuvor erschienenen »Der Exorzist« mit dem Titel IM GARTEN SATANS. In dem hier vorliegenden Band wurde dafür eine Neuübersetzung mit dem Titel IM GARTEN DES INCUBUS verwendet.
Abgerundet wird diese kleine Anthologie durch den Kurzroman DIE BRUT DES GRÜNEN ABGRUNDS, eine Geschichte, die bislang nur im amerikanischen Original vorlag und den Bogen von den Vampiren und weiter zum Exorzisten zu Lovecrafts Universum schlägt. Bei Insel und später Suhrkamp erlebten die Romane H. P. Lovecrafts in Deutschland eine erste Blütezeit.
Da darf C. Hall Thompsons Novelle nicht fehlen.
Den kurzweiligen Reigen beschließen zwei längere Erzählungen des neuen deutschen Autors Stefan Lochner, der sich den Themen der Vampire sowie des Exorzismus angenommen hat und auch in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts spannend zu unterhalten weiß.
In diesem Band sind folgende Beiträge enthalten:
› Vampire unter uns – von Hugh Walker
› Die Brut des Grünen Abgrunds – von C. Hall Thompsons
› Im Garten des Incubus – von John Tigges
› Lamaštu – von Stefan Lochner
› Gneva, die Vampirjägerin – von Stefan Lochner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hugh Walker / C. Hall Thompson /
John Tigges / Stefan Lochner
Dunkelrot
&
Tiefschwarz
Unheimliche Erzählungen
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv für diese Ausgabe
Cover: © by Steve Mayer, Layout Kerstin Peschel, 2022
»Vampire unter uns« von Hugh Walkermit freundlicher Genehmigung von EMMERICH Books & Media
»Im Garten des Incubus« (OT: Garden Of The Incubus) von John Tigges; Übersetzung: Christian Dörge, Lektorat: Birgit Rehberg; mit freundlicher Genehmigung des Apex-Verlages
»Die Brut des Grünen Abgrunds« (OT: Spawn Of The Green Abyss) von C. Hall Thompson Übersetzung: Bärenklau Exklusiv/Jörg Martin Munsonius, entnommen dem Band »A Mountain Walked« von S.T. Joshi
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Vampire unter uns
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Die Brut des Grünen Abgrunds
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Im Garten des Incubus
Prolog
Erster Teil: NON SEQUITUR
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Zweiter Teil
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Dritter Teil
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Vierter Teil:
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Epilog
Addendum
Lamaštu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gneva, die Vampirjägerin
Das Buch
Liebe Leser, sitzen Sie gemütlich? Die Herren bei einem Glas Whisky, die Damen bei einem blutroten Rotwein und Kerzenlicht? Sind die halbwüchsigen Kinder im Bett? Vielleicht regnet es draußen oder ein Gewitter ist im Anmarsch – das Smartphone ist endlich ausgeschaltet.
Kommen Sie mit ins 20. Jahrhundert. Ich nehme Sie gern an die Hand. 1973 erschien Hugh Walkers VAMPIRE UNTER UNS als erster Band einer Reihe mit Horror-Erzählungen verschiedener Autoren.
1983 folgte in der feinen Reihe »Die unheimlichen Bücher« bei Heyne die Veröffentlichung der deutschen Erstübersetzung eines Exorzismus-Romans in der Tradition des nur wenige Jahre zuvor erschienenen »Der Exorzist« mit dem Titel IM GARTEN SATANS. In dem hier vorliegenden Band wurde dafür eine Neuübersetzung mit dem Titel IM GARTEN DES INCUBUS verwendet.
Abgerundet wird diese kleine Anthologie durch den Kurzroman DIE BRUT DES GRÜNEN ABGRUNDS, eine Geschichte, die bislang nur im amerikanischen Original vorlag und den Bogen von den Vampiren und weiter zum Exorzisten, zu Lovecrafts Universum schlägt. Bei Insel und später Suhrkamp erlebten die Romane H. P. Lovecrafts in Deutschland eine erste Blütezeit.
Da darf C. Hall Thompsons Novelle nicht fehlen.
Den kurzweiligen Reigen beschließen zwei längere Erzählungen des neuen deutschen Autors Stefan Lochner, der sich den Themen der Vampire sowie des Exorzismus angenommen hat und auch in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts spannend zu unterhalten weiß.
In diesem Band sind folgende Beiträge enthalten:
› Vampire unter uns – von Hugh Walker
› Die Brut des Grünen Abgrunds – von C. Hall Thompsons
› Im Garten des Incubus – von John Tigges
› Lamaštu – von Stefan Lochner
› Gneva, die Vampirjägerin – von Stefan Lochner
***
Vampire unter uns
von
Hugh Walker
1
Ich blickte die Reihen der erleuchteten Fenster hoch. Das symmetrische Lichtmuster des Hochhauses verschwamm vor meinem Blick und ich kniff die Augen zusammen. In diesem Moment verfluchte ich den Anfall von Mut, der mich dazu verleitet hatte, dem unheimlichen Besucher eine Falle zu stellen.
Ich fröstelte.
Deutlich sah ich die beiden Schatten hin und her schwanken, den zierlichen Marthas und einen größeren, den eines Mannes.
Es war das vierte Mal, dass Martha ihn empfing, obwohl sie es heftig bestritt und diesmal wohl wieder bestreiten würde. Das verblüffte mich umso mehr, als ich sogar seine Stimme vernommen hatte, eine Stimme, die mir irgendwie bekannt vorkam. Aber alles Nachdenken hatte mich nicht weitergebracht.
Jedes Mal während seiner drei Besuche war ich dazugekommen und hatte niemanden vorgefunden. Nur eine erstaunte Martha, die mich ansah, als wäre ich nicht ganz richtig im Kopf.
Alle Logik sprach dafür, dass sie recht hatte. Wir wohnten im sechsten Stock eines Hochhauses mit glatten Mauern, vor denen selbst ein genialer Fassadenkletterer passen musste. Nur eine einzige Tür führte in die Wohnung. Deutlich hatte ich seine Stimme durch diese Tür gehört. Ich hatte geöffnet – aus! Stille! Martha kam mir aus der Küche entgegen, unbefangen, frei von Schuldbewusstsein, verwirrt über meine unverhohlene Neugier, mein offen zur Schau getragenes Misstrauen. Natürlich war niemand hier gewesen! Wer sollte auch?
Zum Teufel, dachte ich. Dort oben ist jemand. Und diesmal kommt die Wahrheit ans Licht. Ein Tonbandgerät lief, und wenn dieser gespenstische Besucher auch nur eine Silbe sprach, konnte ich wenigstens in einer Beziehung beruhigt sein: Ich war nicht verrückt.
Grimmig beobachtete ich eine Weile das Fenster. Konnte das tatsächlich noch Halluzination sein?
Wo blieb nur Hammerstock? Beunruhigt blickte ich die abendlich dunkle Straße entlang.
Es war dabei nicht so sehr der Gedanke, dass Martha mich betrog, der mich aufwühlte, sondern die unheimliche Art und Weise, in der es geschah. Ich war nicht eifersüchtig. Ich liebte Martha. Eifersucht ist etwas für Narren, die besitzen wollen oder selbst besessen sind. Die drei Jahre unserer Ehe waren recht harmonisch verlaufen, und ich hatte nicht das Gefühl, dass Martha unzufrieden war und nach Abenteuern dürstete. Sie war auch ihrem ersten Mann treu gewesen, der vor fünf Jahren starb. Ich hatte ihn nur flüchtig gekannt.
Was mich auch verblüffte, war Marthas plötzliches schauspielerisches Talent. Sie hatte ihre Regungen nie besonders gut verbergen können. Aber ihre Entrüstung, ihr Erstaunen, als ich sie zur Rede stellte, waren verdammt echt gewesen.
Ein Wagen näherte sich dem Haus und hielt. Aufatmend sah ich den Detektiv und einen zweiten Mann aussteigen. Ich winkte kurz. Sie liefen über die Straße auf mich zu.
»Hammerstock und Co.«, begrüßte mich der Detektiv schnaufend und deutete auf seinen Begleiter. »Das ist Witters, mein Mitarbeiter. Keine Angst, Herr Mertens, Diskretion garantiert. Aber es schien mir notwendig, da Sie am Telefon erwähnten, das Haus hätte auch noch einen Ausgang in den Hof.«
»Diesmal haben wir ihn!«, sagte ich aufgeregt und deutete zu dem Fenster hinauf.
Die beiden blickten in die Höhe.
»Sechster Stock, drittes von links, sagten Sie?«
»Ja«, stimmte ich zu. »Das mit den rotbraunen Vorhängen.«
Aber es war nicht viel zu sehen. Beide Schatten waren verschwunden. Der Detektiv schüttelte den Kopf.
»Ich hoffe, Sie irren sich nicht«, meinte er. »Behalten Sie das Fenster im Auge, Witters.«
»Nein, ich irre mich nicht«, sagte ich heftig.
Er antwortete nicht. Er zog eine Kamera hervor, steckte umständlich ein Teleobjektiv auf und visierte das Fenster an.
»Wie lange ist er schon oben?«
»Genau …« Ich warf einen Blick auf meine Uhr. »Genau siebzehn Minuten.«
»Ah, da sind sie«, sagte er. Er hatte die Kamera ans Auge gepresst.
Rasch sah ich hoch. Ja, da waren sie wieder, die beiden Schatten.
»Sie haben recht, es sind zwei«, stellte Hammerstock fest. »Witters, gehen Sie zum Hofausgang.«
»Gut, Boss«, erwiderte Witters mit dünner Stimme, die bei seinem mächtigen Körperbau ein wenig seltsam anmutete. Als er im Haus verschwand, hielt ich es nicht mehr aus.
»Was geschieht jetzt?«, drängte ich.
»Geduld«, mahnte der Detektiv ruhig. »Geben Sie ihm noch ein wenig Zeit. Er kann uns nicht mehr entwischen. Wenigstens nicht, ohne dass wir ihn sehen.«
Er machte ein paar Aufnahmen von dem Fenster. »So«, sagte er dann, »das ist zwar noch nicht viel, was wir da haben, aber ich fange an, Ihnen zu glauben. Nach der Pleite vom letzten Mal …« Er grinste. »Aber geben Sie sich keinen Hoffnungen hin. Selbst wenn wir die Dinger so gut entwickeln, dass man die beiden Schatten deutlich erkennt, ist das noch kein Beweis. Sie machen sich nur Ärger, wenn Sie damit zum Kadi rennen.«
»Ich sagte Ihnen doch schon«, brauste ich auf, »dass ich nichts Derartiges vorhabe. Ich will nur Gewissheit!«
Er grinste wieder. »Das wollen sie alle. Nur Gewissheit!« Er schüttelte den Kopf. »Die verdammte Neugier ist ein kleiner Teufel, hm?«
Ich sah ihn wütend an. Er wollte es nicht wahrhaben.
Gehen Sie jetzt«, sagte er dann. »Wir halten die Augen offen. Moment …«
Er begann mich fachgerecht abzutasten, und ich brauchte einen Augenblick, bis ich begriff, dass er nach Waffen suchte. Bevor ich dazu kam, zu protestieren, war er bereits fertig und sagte entschuldigend: »Es ist wohl uns beiden lieber, wenn Sie keine Dummheiten machen.«
»Sie glauben mir noch immer nicht«, sagte ich seufzend, »dass ich nichts weiter will, als herausfinden, ob der Besucher wirklich existiert oder nur in meiner Einbildung.«
»Berufsphlegma«, antwortete er freundlich »Gehen Sie jetzt. Aber bleiben Sie ruhig. Wenn wirklich einer oben ist, versuchen Sie Zeit zu gewinnen und warten Sie auf meinen Anruf. Wenn nicht, kommen Sie sofort wieder herunter. Sofort, hören Sie? Ich habe nicht Lust, hier den ganzen Abend …«
»Ja, ja«, unterbrach ich ihn verärgert. Schließlich bezahlte ich ihn dafür, dass er sich um meinen Fall kümmerte.
Ich ließ ihn stehen und über lief die Straße. Mein Ärger verrauchte rasch und machte einer brennenden Neugier Platz. Im Treppenhaus hielt ich an. Nein, ich durfte nicht den Lift nehmen. Er stand im zwölften Stock. Ich drückte auf den Rufknopf und wartete, bis der Aufzug herunterkam. Die Türen öffneten sich, und ich sah, dass er leer war. Dann hastete ich die Stiegen hoch, wobei ich den Aufzug nicht aus den Augen ließ. Aber er bewegte sich nicht.
Als ich schließlich keuchend vor der Wohnungstür stand, hörte ich die Stimme wieder. Erneut hatte ich das Gefühl, sie zu kennen.
Eine ungeheure Spannung wuchs in diesen Sekunden in mir. Selbst wenn mir die Phantasie jetzt diese Stimme vorgaukelte, das Tonband würde alle Zweifel beseitigen.
Ich schloss die Tür leise auf. Auf Zehenspitzen schlich ich durch den Vorraum und lauschte. Die männliche Stimme war deutlich zu hören.
Die Stimmen kamen aus dem Schlafzimmer, an dessen Fenster ich die Schatten gesehen hatte. Erst die des Mannes, dann die Marthas. Ich verstand nicht, was sie sagten. Aber es war unverkennbar, dass sie miteinander sprachen. Oder konnte es sein …? Nein, wir hatten weder ein Fernsehgerät noch ein Radio im Schlafzimmer.
Es gab nur diese eine Tür. Und ich stand davor. Ich war noch nie so nah gewesen.
Ich stieß sie auf.
Da war eine Bewegung, kaum fassbar für das Auge, eine Art Nebelschleier, der blitzschnell verschwand.
Dann Marthas ruhiges Lächeln.
»Hallo, Pet! Du kommst früh …« Sie kam auf mich zu und küsste mich.
Hinter ihr war niemand. Wir standen allein im Zimmer.
Ich begriff es nicht. Hatte mir das alles die Aufregung vorgegaukelt – die Schatten, die Stimmen? Ich war völlig nüchtern, aber das bittere Gefühl der Enttäuschung ließ mich wünschen, ich hätte getrunken.
»Hallo, Martha«, sagte ich lahm.
Sie sah es mir an. »Wieder …?«, begann sie. »Glaubst du, er ist wieder hier gewesen?«
In ihrer Stimme schwang ein Unterton von Mitleid mit, der mich rasend machte. Ohne Antwort schritt ich zum Schrank, in dem ich das Tonbandgerät versteckt hatte. Es lief noch. Ich spulte das Band zurück und stellte das Gerät auf Wiedergabe. Meine Hände zitterten vor Aufregung. Das war der Augenblick der Wahrheit.
Eine Weile kam kein Laut, und mein Mut begann schon zu sinken. Aber plötzlich erklang Marthas Stimme.
Sie sagte: ›Frühestens in einer Woche werde ich es wissen.‹
Wieder folgte eine längere Pause, dann erneut Marthas Stimme: ›Ich habe es mir immer gewünscht.‹
Ich hörte Schritte neben mir und blickte in Marthas bleiches Gesicht. Sie schien nicht zu begreifen, was geschah.
Ihre Stimme erklang wieder von dem Band: ›Ja, ich werde bereit sein.‹
Es hörte sich irgendwie leblos an – ein kraftloses Flüstern ohne psychischen Anteil.
»Was ist das?«, fragte sie atemlos.
»Die letzten Minuten in diesem Zimmer«, sagte ich, während ich ein Grauen in mir wachsen fühlte. Es war, als ob eine kalte Hand mich berührte und mir eisige Schauer den Rücken hinabjagte. Das Band gab nur Marthas Stimme wieder. Keine weitere. Aber deutlich konnte ich erkennen oder glaubte ich zu erkennen, dass sie jemandem antwortete. Auch ihr entging dies nicht.
»Mein Gott!«, hauchte sie. Langsam schien es in ihr Bewusstsein zu dringen. Als ich aufblickte, sah ich die nackte Angst in ihren Zügen. »Pet!« Sie klammerte sich mit aller Kraft an mich. »Halt mich fest!«
Ich nahm sie beruhigend in die Arme und gemeinsam lauschten wir.
›Ja, ich werde es tun.‹
Pause.
›Nein.‹ Diesmal eine Spur von Erschrecken in ihrer Stimme.
Pause.
›Ja.‹ Leblos.
Gleich darauf ein Geräusch das Öffnen der Tür. Dann Martha: ›Hallo, Pet! Du kommst früh.‹
Und meine Stimme: ›Hallo, Martha!‹
Und sie: ›Wieder? Glaubst du, er ist wieder hier gewesen?‹
Schritte und das Abschaltgeräusch.
Eine Weile saßen wir schweigend. Keiner fand Worte.
Dann erhob ich mich und durchsuchte methodisch das ganze Zimmer. Es war ein sinnloses Unterfangen, das wusste ich. Aber es würde mir später wenigstens die eine Gewissheit geben, dass ich mich gründlich überzeugt hatte. Als ich damit fertig war, sagte ich zu Martha, ich käme gleich zurück, und stürzte aus der Wohnung. Jetzt konnte nur noch Hammerstock und Co. helfen.
Auf der Straße befand sich niemand mehr. Auch der Wagen war verschwunden. Ich lief in den Hof, aber von Witters keine Spur. Das war seltsam. Dann wurde mir klar, was das bedeutete: Sie hatten eine Spur! Aber das war noch absurder. Wessen Spur konnten sie haben?
Als ich in die Wohnung zurückkam, hatte sich Martha nicht von der Stelle gerührt. Wie erstarrt saß sie vor dem Tonbandgerät. Sie blickte nicht auf. Ich setzte mich schweigend zu ihr und ließ das Band zurücklaufen. Nach einigem Vor- und Rückspulen fand ich die ersten Worte Marthas.
›Komm herein, Willie.‹
Ich hielt den Atem an, und neben mir sog Martha scharf die Luft ein.
Willie! Ihr erster Mann hieß Willie. Aber der kam nicht in Frage. Er war seit fünf Jahren tot. Ich wusste, dass sie ihn sehr geliebt hatte und über alles bedauerte, dass ihre Ehe kinderlos geblieben war. Konnte es sein, dass sie einfach nicht loskam von ihm? Dass ihr das Unterbewusstsein einen Streich spielte? Dass sie an dem Wahn litt, Willie besuche sie?
Nein, denn ich hatte ja Anteil an diesem Wahn! Auch ich hatte die Stimme gehört. Wenn es eine Illusion war und die Tatsache, dass das Band keine männliche Stimme aufgezeichnet hatte, sprach stark dafür, dann betraf sie uns beide. Ich war aber ziemlich sicher, dass mich weder bewusste noch unbewusste Bande an Willie Martin knüpften.
Marthas Finger krallten sich in meinen Arm. »Oh, Pet!«
In Gedanken versunken wie ich war, hatte ich einen Augenblick lang nicht auf das Band geachtet. Ich ließ es ein Stück zurücklaufen.
›Komm herein, Willie.‹
Dann folgten Geräusche: Schritte, ein Knarren, als das Fenster geöffnet wurde.
Das Fenster!
Wahnsinn! Niemand konnte durch dieses Fenster kommen oder gehen.
Dann das Schließen des Fensters und Marthas Stimme: ›Ich bin froh, dass du gekommen bist.‹
Pause.
Und wieder Martha: ›Ja, Willie.‹
Pause.
Immer wieder Martha. Immer nur Martha.
›Ja, Willie.‹
›Ja.‹
›Ja.‹
Und dann Geräusche, die uns beiden das Blut ins Gesicht trieben, ein sich stetig steigerndes Keuchen – Marthas Keuchen, und das Knarren des Bettes. Ein eindeutiger Rhythmus lag in den Geräuschen. Martha schluchzte neben mir und wollte nach dem Gerät greifen. Aber ich hielt sie fest. Es durfte jetzt keine Rücksichten geben, weder mir noch Martha gegenüber. Rücksichten würden nur neue Zweifel bringen. Doch welcher Trost lag in der Wahrheit?
Es dauerte eine ganze Weile, und dass die Laute nur von Martha kamen, machte es gespenstisch. Danach war eine lange Zeit Schweigen.
Martha saß bleich und mit geballten Fäusten neben mir, dankbar, dass ich schwieg, dankbar, dass ich sie hielt, dankbar, dass ich sie nicht anblickte.
Endlich, nach langer Zeit, wieder ihre Stimme.
›Ja, morgen.‹
›Ich werde schweigen.‹
›Ja, Willie.‹
›Frühestens in einer Woche werde ich es wissen.‹
›Ich habe es mir immer gewünscht.‹
›Ja, ich werde bereit sein.‹
›Ja, ich werde es tun.‹
›Nein!‹
Das Öffnen der Tür.
›Hallo, Pet! Du kommst früh.‹
Und wie eine Befreiung aus diesem Monolog meine Stimme: ›Hallo, Martha.‹
Sie: ›Wieder …? Glaubst du, er ist wieder hier gewesen?‹
Das Schaltgeräusch nach meinen Schritten.
2
Nach einer Weile unterbrach ihr Schluchzen die Stille.
»Wenigstens hältst du mich jetzt nicht mehr für verrückt«, sagte ich leise.
»Verzeih mir«, flüsterte sie.
Ich nickte und erhob mich. Unruhig schritt ich auf und ab. Wo blieb Hammerstocks Anruf? War er ungeduldig geworden und weggefahren? Ich war von nagenden Zweifeln erfüllt. Als ich in seinem Büro anrief, meldete sich niemand. Aber das mochte nichts bedeuten. Die reguläre Dienstzeit war längst um.
»Wer war es?«, fragte ich Martha unvermittelt.
Sie blickte mich aus verweinten Augen an. Es drehte mir das Herz um.
»Willie?«, fuhr ich fort. »Willie Martin?«
Sie zuckte die Achseln.
»Wie lebendig ist er noch in dir?«
Sie gab keine Antwort.
»Was wirst du frühestens in einer Woche wissen?«, fuhr ich fort, ohne eine Antwort zu erwarten. »Und was, vor allen Dingen, hast du dir immer gewünscht?«
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und fuhr über ihr braunes Haar. Langsam schien sie ihre Fassung wiederzugewinnen.
»Ich bin glücklich mit dir, Pet«, antwortete sie schließlich. »Ich habe nie einen Gedanken an andere Männer verschwendet. Willie ist nicht lebendiger als andere Erinnerungen auch.«
»Dann ist alles nur ein Traum«, sagte ich.
»Nein«, rief sie heftig und presste ihre Hände an den Schoß. »Nein, ich spüre deutlich, dass es kein Traum ist!«
Plötzlich empfand ich Mitleid mit ihr und schämte mich dafür. Ich wollte sie in die Arme nehmen, aber sie wich mir aus. Bleich sah sie mich an.
»Etwas geschieht mit uns, Pet. Ich habe Angst!« Sie brach erneut in Tränen aus. »Mein Gott, ich habe solche Angst!«
Ich fühlte sie auch, diese Angst. Mit einem Mal.
»In einer Woche werde ich meine Tage haben«, drang Marthas Stimme in meine wirbelnden Gedanken. Sie sah mich mit weit aufgerissenen Augen an, in denen tiefstes Erschrecken über eine plötzliche Erkenntnis stand. »Dann werde ich wissen, ob ich schwanger bin oder nicht.«
Ich hatte das Verlangen, sie zu beruhigen, ihr zu sagen, wie absurd, wie verrückt ihre Worte waren, aber ich konnte es nicht. Stattdessen lauschte ich wie gebannt, als sie fortfuhr:
»Und ich weiß jetzt auch, was ich mir immer gewünscht habe:
Ein Kind von Willie!«
3
Wir hörten das Band ein Dutzend Mal an diesem Abend, und immer wieder bedeutete es neue Qual, neues Entsetzen und neue Phantastereien. Und stetig wuchs das Grauen in uns, eine Kälte, die auch nicht schwand, wenn wir einander in den Armen hielten und die physische Wärme des anderen fühlten. Mehrmals versuchte ich, den Detektiv zu erreichen, doch niemand meldete sich.
Wir sprachen schließlich über Willie Martin, und nach und nach konnte ich mir ein Bild von ihm machen. Wie er ausgesehen hatte, wusste ich ja. Über eins neunzig groß, muskulös, rothaarig. Aber trotz seiner athletischen Erscheinung wirkte er unsicher. Vielleicht hatte ich mir das auch nur eingebildet. Schließlich hatte ich ihn vor seinem Tod nur ein paar Mal kurz gesehen. Aber was Martha mir nun berichtete, schien diesen Eindruck zu bestätigen. Mehr noch, seine ganze Unsicherheit schien in der Kinderlosigkeit der Ehe mit Martha zu liegen, für deren Ursache er sich selbst hielt. Sie mussten beide sehr darunter gelitten haben: Martha, weil sie hilflos war, und Willie wohl, weil er von der fixen Idee, er sei impotent, besessen war wie von einem Dämon. Und wie von einem Dämon hatte er auch Befreiung gesucht bei Wunderheilern und Scharlatanen in magischen Zirkeln. Vergeblich hatte Martha versucht, ihn davon abzubringen. Dann begann seine Krankheit. Und wenig später kam der Tod. Den kümmerte der Dämon wenig. Mit dem einen erlosch auch das andere.
Kurz vor Mitternacht klingelte das Telefon.
Es war Hammerstock. Endlich! Er war sehr aufgeregt.
»Herr Mertens!«, rief er. »Ich habe ihn gesehen. Und was sich hier abspielt, ist unglaublich!«
»Wer ist es?«, fragte ich hastig.
Er lachte, oder wenigstens klang es so. »Das weiß ich noch nicht. Ich hab ihn nur gesehen und bis hierher verfolgt.«
»Können Sie ihn nicht beschreiben?«
»Ein großer Bursche …« Ich hielt den Atem an, als er das sagte. »Sieht ein wenig bleich aus«, fuhr er fort. »Aber das tun sie alle hier. Ungesund bleich!«
»Weiter«, drängte ich, »was haben Sie noch gesehen?«
»Nicht viel. Es war zu finster.«
»Das Gesicht, Hammerstock. Wie sieht es aus?«
»Ah, Sie haben sich überlegt, wer es sein könnte.« Er lachte. »Nein, darauf kommen Sie nie!« Das mitternächtliche Geläute einer Turmuhr kam durch das Telefon, ein ferner, einsamer Dreiklang.
»Haben Sie sein Haar gesehen? Ist es rötlich?« Martha sah mich überrascht an.
Der Detektiv schwieg einen Augenblick. Es mochte Verblüffung sein, aber auch nur einfach eine Überlegungspause. »Ja«, sagte er schließlich, »das wäre möglich …« Er brach ab, als ein heftiges Pochen ertönte, so als hämmerte jemand an eine Tür. Hastig flüsterte er: »Ich melde mich später!«
»Wo sind Sie?«
»Später! Ich muss hier verschwinden!«
Klick!
Bleich starrte ich auf den Hörer.
»Wer war das?«, fragte Martha.
Einen Moment erwog ich, zu lügen, dann sagte ich beschämt: »Hammerstock und Co., Detektei. Ich habe sie engagiert.«
Sie nickte nur. Vielleicht verstand sie nun, dass meine Motive nicht im Misstrauen wurzelten. Ich legte den Hörer auf und hielt wie elektrisiert inne.
»Hypnose«, sagte ich.
Martha blickte mich an.
»Hammerstock sagte, er hätte eine Spur von unserem Besucher. Wenn das stimmt, muss er ihn gesehen haben, als er das Haus verließ. Das bedeutet, dass der Besucher die Wohnung entweder durch das Fenster oder durch die Tür verlassen hat, als ich kam. Wahrscheinlicher erscheint es mir nun durch die Tür …«
»Du meinst«, unterbrach mich Martha, »er hat dich hypnotisiert?«
»Nicht nur mich«, erwiderte ich. »Deine Stimme auf dem Band, sie hört sich an, als seiest du in Trance gewesen.«
Sie schwieg. Dann nickte sie zögernd und schüttelte gleich darauf den Kopf. »Aber das ergibt keinen Sinn. Wer immer es auch ist, warum sollte jemand das tun?«
»Das war auf dem Band deutlich zu hören«, antwortete ich mit einer Spur von Sarkasmus, den ich sofort bereute.
Sie senkte den Blick »Es muss jemand sein, der mich gut kennt und der Willie kannte!«
Ich nickte erleichtert. Natürlich, das war es! Das Problem war damit noch nicht aus der Welt, aber wir hatten die erste plausible Erklärung, die alle anderen phantastischen Vorstellungen in den Hintergrund drängte.
4
Wieder klingelte das Telefon. Diesmal meldete sich Witters.
»’Tschuldigen Sie, dass ich noch störe«, sagte er etwas verlegen.
»Wir schlafen noch nicht«, erklärte ich ihm kurz.
»Dachte ich mir – hm, haben Sie was von meinem Boss gehört?«
»Ja, kurz vor Mitternacht. Er sagte, er wäre jemandem gefolgt.«
»Und verdammt eilig noch dazu«, berichtete Witters. »Als das Ding von ihrem Fenster herunterkam.«
»Als was …?«, entfuhr es mir.
»Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat«, sagte Witters rasch. »Es ging so schnell. Er kam so rasch herab, dass es wie ein verwischter Schleier aussah, wie auf einem verwackelten Foto, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Ja, ja«, sagte ich und fühlte das Grauen wieder wachsen.
»Ich dachte, da ist einer abgerutscht. Der steht nicht wieder auf«, fuhr Witters fort. »Aber plötzlich stand er am Gehsteig, so als wäre er nur aus dem Haus getreten und nicht im sechsten Stock, wenn Sie wissen, was ich meine …«
»Ja, ja. Weiter Witters. Was geschah dann?«
»Er setzte sich sofort in Bewegung. Stadtauswärts. Ungefähr in die Richtung, wenn Sie wissen, was …«
»Ja, ich weiß es«, unterbrach ich ihn ungeduldig.
»Tja, Herr Mertens, er legte ein flottes Tempo vor, und ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich verlor ihn nach ein paar Straßen aus den Augen. Aber der Boss blieb ihm mit dem Wagen auf den Fersen. Jetzt ist aber bereits verflucht viel Zeit vergangen, und ich spüre da so ein Jucken im Knie, wenn Sie wissen, was ich meine …«
»Auch das weiß ich, Herr Witters«, antwortete ich ihm. »Nur zu gut. Aber er machte keine Angaben über seinen Aufenthaltsort. Er sagte nur, er würde wieder anrufen. Er müsse weg. Aber, warten Sie da war etwas, das mir auffiel. Ich hörte eine Turmuhr schlagen. Sie klang wie die in Elbenburg. Genau dieselbe Folge von drei Tönen bei jedem Schlag, wenn Sie wissen, was ich …« Unwillkürlich grinste ich. »Sie haben mich schon angesteckt, Witters!«
»Tut mir leid, Herr Mertens«, meinte Witters entschuldigend. »Aber Sie könnten recht haben. Es sind gute vier Marschstunden nach Elbenburg. Ist Ihr Besucher bei der Infanterie oder so was?«
»Ich habe ihn nie gesehen«, sagte ich schwach, als mir mit einem Mal die Konsequenzen dämmerten, die sich aus den Worten des Detektivgehilfen ergaben.
»Kein Wunder«, erwiderte Witters lachend. »Bei der Geschwindigkeit, mit der er aus dem Fenster kam, ist sicher nicht viel mehr als ein Kondensstreifen zurückgeblieben.« Er seufzte. »Ich werde jetzt nach Elbenburg fahren. Das Detekteitelefon ist auf Band geschaltet. Rufen Sie an, wenn Sie etwas Neues wissen.«
»Ja, das werde ich tun«, sagte ich.
»Gute Nacht dann, Herr Mertens.«
Ich gab keine Antwort. Ich wartete, bis es klickte und die Leitung tot war. Dann hängte ich ein und blickte in Marthas blasses Gesicht.
»Er ist aus dem Fenster«, sagte ich leise. »Aus dem sechsten Stock, und es ist ihm nichts passiert.«
»Das ist noch nicht alles«, erwiderte sie mit kaum vernehmbarer Stimme. »Am Viktoria-Friedhof in Elbenburg liegt Willie begraben.«
5
Am nächsten Tag ging ich nicht ins Büro. Ich hätte es nicht ertragen. Nicht nach dieser Nacht voll quälender Gedanken und Gespräche. Von den Albträumen ganz zu schweigen, die die kurzen Perioden des Schlummers unerträglich machten.
Erst der Morgen brachte Ruhe und Ernüchterung. Wir kamen überein, uns nicht mit oberflächlichen Vermutungen zufriedenzugeben, sondern der Sache nachzugehen, und zwar mit allem Nachdruck.
Irgendetwas Unheimliches, Bedrohliches war im Begriff zu geschehen. Irgendein Wahnsinn war dabei, sich in unser Leben zu drängen, und wir wollten uns beide dagegen wehren.
Ich ging methodisch vor. Die Polizei einzuschalten war zu früh. Dazu brauchten wir Hammerstocks Aussage. Wir mussten warten, bis er sich meldete. Ich informierte meinen Teilhaber, dass ich nicht ins Büro kommen würde. Er versprach, sich um die Illustriertenverträge zu kümmern, deren Erneuerung für heute vorgesehen war. Damit war ich entbehrlich. Dann rief ich die Firma an, bei der ich das Tonbandgerät gekauft hatte, und fragte, ob es möglich sei, dass bei einem Gespräch von zwei Personen nur die Stimme der einen aufgezeichnet wurde. Er erklärte mir, dass man wohl bestimmte Frequenzen ausfiltern könne, aber nur mit großem technischem Aufwand und sicher nicht mit dem Gerät, das ich erstanden hatte.
Ich berichtete ihm, dass ich das Gespräch eines Mannes und einer Frau aufgenommen hätte und dass beim Abspielen des Bandes nur die weibliche Stimme zu hören sei.
Er fragte mich, ob der Mann vielleicht stumm gewesen sei und sich in der Zeichensprache unterhalten habe.
Wütend hängte ich ein. Aber es war klar: Auf verrückte Fragen konnte man keine ernsthafte Antwort erwarten. Ich hatte auch nur angerufen, weil ich keine Möglichkeit außer Acht lassen wollte.
Der nächste Schritt brachte uns auch nicht weiter. Wir fuhren nach Elbenburg. Die Fahrt dauerte zwanzig Minuten. Vor dem kunstvollen Gittertor des alten Friedhofs parkte Hammerstocks Wagen. Hatte er die gleichen absurden Schlüsse gezogen wie ich? Wohl kaum. Aber woher wusste er überhaupt von Willie Martin? Die Frage war leicht zu beantworten. Als guter Detektiv hatte er natürlich seine Erkundigungen eingezogen. Dennoch erschien es mir seltsam, dass er sich für den Friedhof interessierte. Welche Gründe mochten ihn hierhergetrieben haben? Dass er an einem Grabstein Namen und Daten lesen konnte, die er im örtlichen Amt ebenso erfahren hätte?
Aber genauso schwer zu beantworten wäre die Frage nach den Gründen gewesen, die mich hierhergetrieben hatten. Vielleicht, um Martha zu beruhigen, um ihr zu zeigen, dass ihr Albtraum hier begraben lag.
Der Friedhof war ein romantischer kleiner Garten, in dem die Gräber wie steinerne Blumen wuchsen. Aber niemand wandelte darin, in diesem Garten der Toten. Wir standen eine Weile vor dem Grab und blickten auf den schwarzen Stein. In meinem Kopf hämmerte nur ein einziger Gedanke:
Willie Martin ist tot! Willie Martin ist tot!
Als gäbe es irgendeinen Zweifel an dieser Tatsache.
Martha stand bleich und stumm neben mir. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass die Macht der Toten vielleicht größer war, als wir alle glaubten.
»Unheimlicher Gedanke, nicht wahr?«, sagte eine helle Stimme hinter uns.
Wir fuhren herum und sahen Witters, der unbemerkt herangetreten war und uns forschend musterte.
»Witters!«, entfuhr es mir. »Sie hier?«
Er nickte.
»Was meinen Sie damit? Was ist ein unheimlicher Gedanke?«
Er schüttelte den Kopf. »Erscheint es Ihnen nicht seltsam?«
»Was zum Teufel?«, rief ich.
»Wie der Boss ausgerechnet hierherkam?«
»Aber er verfolgte …« Ich brach ab, und nicht nur, weil Martha mich beruhigend am Arm ergriff.
»Wen?«, schnappte Witters. »Den hier?« Er deutete auf das Grab und lachte freudlos. »Wusste er, dass der verstorbene Mann Ihrer Frau hier begraben liegt?«
»Nein. Ich wusste es bis heute Morgen selbst nicht.«
»Was führte ihn dann ausgerechnet auf den Friedhof von Elbenburg?«
Ich gab keine Antwort.
»Er war hier«, stellte Witters fest. »Und er müsste meiner Meinung nach auch noch hier sein. Sein Wagen steht draußen. Ich fand seinen Hut im Gebäude der Totenhalle. Nicht weit von einem Telefon.«
Das nächtliche Telefongespräch kam mir in den Sinn, und ich schüttelte mich unwillkürlich. »Als guter Detektiv«, sagte ich ein wenig heiser, »müsste er gewusst haben, dass Herr Martin hier begraben ist.«
Witters nickte. »Vielleicht.« Er sah mich unverwandt an. »Er verfolgte jemanden, der aus dem sechsten Stock Ihres Hauses sprang, und landete auf einem Friedhof.« Er entblößte seine Zähne zu einem Grinsen »Es ist nicht so ungewöhnlich, dass Leute, die aus dem sechsten Stock springen, auf dem Friedhof landen. Nur, dass sie selber hinlaufen, Herr Mertens, ist das nicht erstaunlich?«
Marthas Hand verkrampfte sich um meinen Arm. Ich hörte, wie sie den Atem anhielt.
»Woher wissen Sie, dass …?«, begann ich mit gepresster Stimme.
Er spreizte abwehrend die Finger. »Ich weiß nichts. Gar nichts. Ich weiß nur, dass mir das alles nicht gefällt. Mein Boss ist verschwunden. Da draußen steht sein Wagen. Dort drinnen«, er deutete auf das Friedhofsgebäude, »liegt sein Hut. Und hier stehen Sie vor einem Grab! Da soll einer klug daraus werden.« Plötzlich schien ihm aber ein Gedanke zu kommen, und er sagte: »Was hat Sie wohl ausgerechnet heute hierhergetrieben?«
Einen Augenblick lang war ich entschlossen, alles für mich zu behalten, aber Hammerstock befand sich vielleicht in Gefahr. Es war besser, wenn ich redete, so verrückt das auch alles für Witters Ohren klingen musste.
»Ich sah niemanden, als ich in die Wohnung kam, aber ich hörte deutlich eine männliche Stimme – seine Stimme!« Ich deutete auf das Grab.
Witters schwieg. Nach einer Weile sagte er: »Ich habe das Gefühl, dass jemand versucht, Sie gründlich reinzulegen. Und Sie haben schon ganz schön angebissen.«
»Vielleicht sollten wir uns doch an die Polizei wenden«, meinte Martha neben mir.
»Womit?«, erwiderte ich heftiger als beabsichtigt. »Mit einer so verrückten Geschichte, dass jeden Abend im sechsten Stock einer zu dir ins Fenster steigt, um dich zu vergewaltigen?«
»Er hat sie …?«, begann Witters.
Ich berichtete ihm von dem Tonband und von unseren Vermutungen bezüglich Hypnose. Er wurde sehr nachdenklich. Das Band interessierte ihn brennend. Ich zögerte erst. Schließlich war er nur Hammerstocks Gehilfe. Konnte ich seiner Diskretion sicher sein? Aber er drang so heftig in uns, dass auch Martha, die ja die eigentlich Kompromittierte war, schließlich nachgab. Vielleicht vermochte er einen Hinweis auf Hammerstocks rätselhaftes Verschwinden daraus zu entnehmen.
Wir fuhren also in die Stadt zurück und begaben uns in das Büro von Hammerstock und Co., wo Witters zuerst das Band des Anrufbeantworters ablaufen ließ. Aber es schien niemand angerufen zu haben. Enttäuscht nickte er. Dann legte er unser Band ein und lauschte eine Weile fasziniert, dann schüttelte er ein paar Mal den Kopf. Als es zu Ende war, sah er mich erstaunt an.
»Hört sich an wie ein Ausschnitt aus einem Gruselhörspiel«, meinte er. »Aber halten Sie das ernsthaft für einen Beweis, dass Ihre Frau vergewaltigt wurde, dass sie überhaupt Besuch empfing?«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Martha.
»Dass Sie, gnädige Frau, vielleicht unter hypnotischem Einfluss oder einem anderen Zwang standen, aber dass Sie allein da oben diese Komödie spielten, während wir auf der Straße waren und Ihr Fenster und das Haus beobachteten!
»Komödie?«, entfuhr es ihr.
Ich legte beruhigend den Arm um sie.
»Erklären Sie uns das genauer, Herr Witters«, sagte ich gepresst.
»Wie Sie wollen, Herr Mertens. Ein Tonbandgerät ist eine empfindliche, unbeirrbare Maschine. Wenn also der nächtliche Besucher schon nicht sprach, was ja verständlich wäre, so müsste seine Anwesenheit wenigstens aus Geräuschen wahrnehmbar sein. Ein Mikrofon ist nicht hypnotisierbar, Herr Mertens. Es zeichnet unbestechlich alles auf, was es hört. Und auf diesem Band befinden sich nur die Stimme und die Geräusche eines einzigen Menschen. Ihre, Frau Mertens.«
»Und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?«, fragte Martha kalt.
»Dass Sie entweder Ihren Mann auf geniale Art betrügen, gnädige Frau, oder dass Sie dringend einen Arzt aufsuchen sollten.«
Wir sahen ihn sprachlos an.
Er lächelte ein wenig unsicher. »Verzeihen Sie die sicherlich verletzende Offenheit!«
»Aber ich hörte die Stimme und auch seine Geräusche«, unterbrach ich ihn.
Er zuckte die Schultern. »Sie selbst erwähnten die Hypnose bereits.«
»Und was ist mit Ihnen?«, unterbrach ich ihn erneut triumphierend. »Sahen Sie nicht eine Gestalt aus dem Fenster springen? Folgte ihr Boss nicht einer fliehenden Gestalt bis nach Elbenburg?«
Er schüttelte den Kopf. »Was Letzteres betrifft, so stammt diese Information von Ihnen.«
»Aber ich …«, begann ich und hielt inne. Er hatte recht von seiner Warte aus gesehen.
»Und«, fuhr er fort, »was die Gestalt betrifft, so bin ich mir immer weniger sicher, was ich eigentlich gesehen habe. Es gibt nur ein paar Dinge, die ich sicher weiß: Dass Sie uns beauftragt haben, das Haus zu beobachten, dass seit gestern Abend mein Boss verschwunden ist, dass Sie mir sagten, er hätte aus Elbenburg angerufen, dass ich dort seinen Hut und seinen Wagen fand und Sie beide am Grab des verstorbenen Ehemannes antraf. Das ist mir kompliziert genug. Wenn Sie mir einzureden versuchen, jemand käme Sie im sechsten Stock Ihres Hauses allabendlich durch das Fenster besuchen und vergewaltige Sie, ohne dass sie es merkten, dann müssen Sie mir schon zugestehen, dass ich Sie zumindest für schizophren halte. Besucher, die zudem noch nicht den geringsten Lärm machen, selbst dann nicht, wenn sie einer Frau ihren Willen aufzwingen, meine liebe Frau Mertens, die gibt es in unserer logischen, physikalischen, diesseitigen Welt nicht. Und für die jenseitige bin ich nicht zuständig.«
»Wir auch nicht, Witters«, erwiderte ich ebenso spöttisch.
»So?«, meinte er. »Dann sagen Sie mir einen vernünftigen Grund, warum Sie heute Willie Martins Grab aufsuchten?«
6
Der Weg war heikel, aber es gab nichts, was mich davon abgehalten hätte. Auch Martha nicht. Sie versuchte es auch gar nicht. Bang und von Zweifeln erfüllt, standen wir noch am selben Nachmittag im Warteraum Dr. Steiners. Ich war fest davon überzeugt, dass Martha mich nicht betrog, zumindest nicht bewusst. Aber Witters hatte in seiner groben Art recht, wenn er meinte, es gäbe nur zwei Möglichkeiten: Sich einzugestehen, dass man krank ist und an Sinnestäuschung leidet, oder an Gespenster zu glauben.
Als wir schließlich an der Reihe waren drückte ich dem Psychiater nur wortlos das Band in die Hand. Nachdem er es abgehört hatte, klärte ich ihn über die Vorfälle der letzten vier Tage auf.
»Ist es möglich, Herr Doktor, dass wir beide gleichzeitig einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen sind? Dass wir beide … verrückt geworden sind?«
»Ich würde nicht so hastig urteilen«, lenkte Dr. Steiner ein und strich sich nachdenklich über das glattrasierte Kinn. Seine dunklen Augen blickten ernst, ernster als ich erwartet hatte. »Irrsinn ist eine gefährliche Sache, in die man in den meisten Fällen selber systematisch hineinkriecht. Aber eine Täuschung der Sinne oder eine starke Wunschvorstellung muss nicht gleich bedeuten, dass man verrückt ist. Es gäbe kaum einen normalen Menschen auf unserer Welt, wenn es so wäre. Jeder stößt in seinem Leben irgendwann einmal auf etwas, das er sich nicht erklären kann. Aber in einem haben Sie recht, Herr Mertens. Das Band beweist, dass Sie beide einer Sinnestäuschung erlegen sind. Ihre Frau in höherem Maße als Sie. In beiden Fällen scheint es mir aber recht einleuchtend erklärbar. Sie sagten, Ihre Frau hätte eine starke Bindung an Ihren ersten Mann gehabt und sich immer ein Kind gewünscht?«
»Sicher«, wandte ich ein und hielt Marthas Hand fest und beruhigend in der meinen. »Das ist es auch, was wir dachten, als wir endlich anfingen, die Dinge nüchtern zu überdenken. Aber Willie Martin ist seit fünf Jahren tot. Und Martha und ich führen seit drei Jahren eine ausgeglichene Ehe über der nur ein Schatten liegt, nämlich, dass es bisher mit einem Kind nicht geklappt hat. Aber das beunruhigt uns nicht.«
»Auch nicht, dass ihrer ersten Ehe ebenfalls kein Nachwuchs beschieden war?«, warf der Arzt ein.
Ich schüttelte entschieden den Kopf. »Sie war kaum ein Jahr mit ihm verheiratet.«
»Woran ist er gestorben?«
»Auf dem Totenschein stand Leukämie, aber die Ärzte waren sich nicht einig«, erklärte Martha. »Er war die letzten Wochen in Elbenburg, im Sanatorium für Blutkrankheiten. Er ist auch in Elbenburg begraben.«
Der Arzt sah uns nachdenklich an.
»Ich habe Angst«, sagte Martha leise. »Es grenzt an Besessenheit.«
Der Doktor schüttelte den Kopf. »Ich kann verstehen, dass es Sie beängstigt. Aber darin erst liegt die Gefahr. Alles weist doch daraufhin, dass Sie sich in etwas hineingesteigert haben. Sie lieben Ihre Frau sehr?«
»Ja«, sagte ich.
»Sie sind eifersüchtig«, erklärte er.
»Nein«, erwiderte ich mit Nachdruck. »Das bin ich nicht!«
»Das sagen viele, und doch sind sie krank davon und malen sich in ihrer Phantasie Dinge aus, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das Band ist der deutlichste Beweis dafür, dass Sie sich die Stimme nur eingebildet haben. Wollte ich voreilig diagnostizieren, so würde ich mich mit der Feststellung einer leichten Schizophrenie bei Ihrer Frau und einer keinesfalls besorgniserregenden Nervenüberreizung bei Ihnen selbst begnügen. Um Ihnen aber die Gewissheit zu geben, dass ich Ihre Sorge nicht leichtfertig in ein Schema presse und bagatellisiere, möchte ich, dass wir uns Klarheit verschaffen. Können Sie ein paar Tage Urlaub nehmen? Eine Woche würde genügen.«
Wir nickten zögernd. Für Martha war es kein Problem, und auch ich war sicherlich eine Weile im Büro entbehrlich.
»Gut«, fuhr er fort. »Sie werden die Stadt verlassen. Aber fahren Sie nicht in eine andere Stadt. Sie brauchen eine andere Atmosphäre. Fahren sie irgendwohin aufs Land.« Er lächelte. »Bemühen Sie sich um das Kind, das Sie sich wünschen. Und wenn Sie zurückkommen, werden Sie die Dinge in einem anderen Licht sehen. Wenn Sie dann immer noch Probleme haben, was ich nicht glaube, so mag es tiefere Ursachen haben. Nach denen müssen wir dann suchen. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub.«
7
Aber vorerst wurde nichts aus dem erholsamen Urlaub. Wir trafen zwar alle Vorbereitungen und hatten am frühen Abend bereits gepackt, doch dann rief Witters an und setzte vorerst einen Punkt hinter unsere Pläne.
Er hatte die Polizei benachrichtigt und Hammerstock als vermisst gemeldet. Er fand zwar selbst, dass es dafür noch ein wenig früh war, doch das Ausbleiben jeglicher telefonischen Benachrichtigung erfüllte ihn mit großer Besorgnis. Polizeibeamte würden also vorbeikommen, um meine Aussage zu Protokoll zu nehmen. Ich sollte gründlich überlegen und nichts verschweigen. Es sei sehr wichtig. Und das Wiederauftauchen Hammerstocks sei ja auch für mich von größter Wichtigkeit.
Martha und ich waren aufgebracht. Damit wurde unsere Privatangelegenheit ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Ich beruhigte mich aber wieder einigermaßen, als ich erfuhr, dass von dem Tonband bisher keine Erwähnung gemacht worden war. Und nach und nach gelang es mir, auch Martha zu beruhigen. In unserer Angst dachten wir zunächst daran, das Tonband zu vernichten. Aber dann erschien es uns doch zu kostbar. Schließlich war es der einzige Beweis dafür, dass etwas mit uns geschah, wenn wir auch immer noch nicht wussten, was. Aber wir beschlossen, es aus dem Haus zu schaffen.
Bald nach Witters Anruf kamen die Beamten. Sie waren höflich und misstrauisch, wie man es von einem guten Polizisten erwartet, und sie stellten eine Unmenge von Fragen. Ich berichtete von Hammerstocks Auftrag und von seinem Anruf aus Elbenburg. Ich berichtete auch von unserem Friedhofsbesuch in Elbenburg und dem Zusammentreffen mit Witters, dem Mitarbeiter Hammerstocks. Sonst war ich zurückhaltend. Sie zogen schließlich ab, doch wir sollten uns zu ihrer Verfügung halten.
Das bedeutete also, dass wir den geplanten Urlaub auf unbestimmte Zeit verschieben mussten.
Voller Nervosität erwarteten wir die Nacht. Ich wich nicht von Marthas Seite. Wenn unser nächtlicher Besucher wiederkam, so würde er meine Gesellschaft in Kauf nehmen müssen.
Ein nagender Gedanke ließ mich den ganzen Abend nicht los. Was war mit Hammerstock da draußen in Elbenburg geschehen? Ich war nun fast sicher, dass er das Telefon am Friedhof benutzt hatte, um mich anzurufen. Was aber mochte ihn dort so plötzlich bedroht haben?
Fast unbewusst griff ich nach dem Telefonbuch und suchte nach der Nummer. Wenn dort ein Telefon vorhanden war, musste es auch jemanden geben, der Anrufe entgegennahm. Eine Friedhofsverwaltung oder so etwas.
Ich wählte, aber es meldete sich niemand. Ich versuchte es erneut und ließ ein Dutzend Mal läuten. Schon wollte ich wieder einhängen, als jemand abhob. Ich hielt den Atem an.
»Totenhalle Elbenburg«, krächzte eine Männerstimme. »Scheint, dass man nachts selbst auf dem Friedhof keine Ruhe hat!«
»Verzeihen Sie«, sagte ich unsicher, »ich dachte …«
»Was dachten Sie?«, unterbrach mich die krächzende Stimme. »Dass wir hier Überstunden machen? Gute Nacht!«
Es klickte, bevor ich mich von meiner Verblüffung erholt hatte. Ich zuckte die Achseln und legte auf. Unwillkürlich musste ich lächeln.
Martha rumorte in der Küche. Ich warf einen Blick auf die Uhr: halb zehn. Die Zeit war längst vorüber. Blieb der Besucher heute aus? Hatte er Angst bekommen?
»Sieht so aus, als hätte jemand kalte Füße bekommen«, stellte ich fest, als ich in die Küche trat. Martha fuhr erschrocken herum, sah, dass ich es war, und atmete erleichtert auf. Sie nickte. »Glaubst du …«
»Dass er noch kommt?«, ergänzte ich. »Ich hoffe es fast. Ich möchte endlich Klarheit haben. Selbst wenn dieser Spuk jetzt für immer aus unserem Leben verschwindet, wird immer ein Schatten bleiben irgendwo in unserem Herzen, ein Zweifel, eine Furcht, dass es wieder geschehen könnte …« Ich riss mich von dem Gedanken los. »Aber jetzt sollten wir uns den Rat Dr. Steiners zu Herzen nehmen!«
Sie sah mich überrascht an. »Aber wir dürfen nicht wegfahren, Pet.«
Ich grinste. »Das war nicht der einzige Rat, den er uns gab.«
Sie lächelte nach einem Augenblick verstehend.
Später, bevor wir einschliefen, überzeugte ich mich davon, dass alle Fenster und Türen geschlossen waren. Obwohl mir die Vernunft sagte, dass niemand durch diese Fenster steigen konnte, nicht einmal von der Wohnung nebenan oder vom unteren Stockwerk aus, gab es mir ein irrationales Gefühl der Sicherheit, sie geschlossen zu wissen. Dann dachte ich an die Wohnung über uns, die eine ältere Dame, Frau Wengler, bewohnte. Von dort aus könnte jemand mit einem Seil ohne große Schwierigkeiten nach unten klettern. Aber wir hatten am Vorabend kein Seil bemerkt, und außerdem hatte Frau Wengler seit Jahren keinen Besuch empfangen.
Ich schlief schlecht. Immer wieder wachte ich auf und lauschte in die Dunkelheit, die nur erfüllt war von Marthas regelmäßigem Atmen oder vom Motorgeräusch eines Autos, das die Straße entlangfuhr. Gegen Morgen trommelte der Regen gegen die Fensterscheiben und ließ mich entsetzt aus einem Albtraum hochfahren, in dem ein Toter wieder erwachte und sich mit kalten Fingern an mich klammerte. In seinen Augen spiegelte eine dämonische Erkenntnis alles Jenseitige. Plötzlich war eine durchsichtige Wand zwischen uns, die das Bild verzerrte und verschwimmen ließ. Der eiskalte Griff löste sich, aber die Finger des Auferstandenen kratzten über die feste Substanz, als suchte er nach einem Riss, einem Spalt, um mich zu erreichen. In diesem Augenblick vernahm ich das trommelnde Geräusch des Regens am Fenster, und für einen Augenblick vermischte sich der Traum mit der Realität. Irgendetwas wimmerte in panischer Angst, und es dauerte einen langen Augenblick, bis ich erkannte, dass die Laute aus meinem eigenen Mund kamen. Meine Kopfhaut fühlte sich an, als stünde sie unter Strom, und mein Rückgrat schien aus Eis zu sein.
»Pet, was ist? Pet!«
Marthas Stimme. Das Traumbild schien vor ihr zurückzuschrecken.
»Pet! Wach auf! Du träumst!«
Endlich löste sich die Starre. Ich sprang zum Fenster und blickte benommen auf die nassen Finger des Regens, die über die Scheibe glitten.
»Pet«, wiederholte Martha eindringlich. »Es ist niemand hier. Du hast geträumt.«
Ich sah sie an, ganz wach nun, und fröstelnd. »Bist du sicher?«, sagte ich mühsam.
»Aber ja, Pet!«
Ich kroch ins Bett zurück, aber an Schlaf war nicht mehr zu denken. Die Dämmerung war voller Schatten, voller Bewegung, die nur darauf zu lauern schienen, dass ich die Augen schloss. Es erinnerte mich an meine Kinderzeit, an die Furcht vor allem Toten, vor dem kalten, starren Gesicht meiner früh verstorbenen Schwester, vor allem, was aufgehört hatte zu atmen, vor gebrochenen Augen, vor der Starre, die sich über den verlassenen Körper hermachte, damit nichts wieder diese Glieder bewegte.
Was war es, was mich jetzt so mit Grauen erfüllte? Dieselbe Kleinkinderfurcht? Oder glaubte ich im tiefsten Inneren tatsächlich, Willie Martin könnte sein Grab in Elbenburg verlassen? Welch absurder Gedanken ist doch der menschliche Geist fähig, und wie klein ist der Schritt in den Wahn!
Diese Überlegungen ernüchterten mich, aber sie brachten den Schlaf nicht wieder. Mehrmals versuchte ich mir das Traumbild zurückzurufen und das Gesicht zu erkennen, aber je stärker ich mich konzentrierte, desto mehr entschwand es aus meiner Erinnerung.
Nichts geschah während des folgenden Tages, und Martha und ich begannen aufzuatmen. Wir verbrachten den größten Teil des Tages und des Abends in der Stadt und fanden, dass auch ein Urlaub in der eigenen Stadt seine Reize besaß. Bevor wir die Wohnung verließen, rief ich Witters an und erfuhr, dass Hammerstock noch immer nicht aufgetaucht war. Witters’ Stimme klang resigniert. Er schien ziemlich sicher zu sein, dass ein Unglück geschehen war. Ich informierte ihn von unserem Ausflug und versprach, ihn am Abend anzurufen.
Wir bekamen Karten für ein Nachtkabarett, und es wurde sehr spät, bis wir nach Hause kamen. Daher verschob ich den Anruf bei Witters auf den Morgen. Wir waren beide leicht angeheitert und unglaublich guter Dinge. Das Risiko, dass Witters uns mit schlechten Nachrichten aus unserer rosigen Stimmung herausriss und für den Rest der Nacht Albträume verursachte, war mir zu groß. So stiegen wir, höchst belustigt darüber, dass wir unseren abendlichen Besucher diesmal versetzt hatten, ins Bett und schliefen den Schlaf der Rechtschaffenen, bis kurz vor neun das Telefon klingelte.
Es war Witters.
»Mann, Mertens, wo waren Sie die ganze Zeit? Warum haben Sie nicht angerufen?« Seine helle Stimme überschlug sich fast.
»Beruhigen Sie sich, ich bin ja hier«, sagte ich begütigend.
»Reden Sie nicht mit mir wie ein Onkel mit seinem geistig zurückgebliebenen Neffen!«, kreischte er. »Erst rückte mir die Polizei auf den Hals, die Ihnen noch einige Fragen stellen wollte …«
»Wüsste nicht, was ich denen noch hätte sagen können«, meinte ich.
»Dann kam der Boss …«
»Hammerstock!«, entfuhr es mir.
»Ja, er kam gegen zehn und erklärte mir, dass er einen wichtigen Auftrag in Elbenburg habe, dem er noch einige Zeit nachgehen müsse. Er wollte mit Ihnen sprechen. Er wartete bis gegen eins, dann musste er wieder fort.«
»Verdammt«, stieß ich hervor.
»Sagte ich auch gestern abends laufend«, erwiderte er. »Half aber nichts. Halten Sie sich heute Abend bereit. Er kommt nach Sonnenuntergang zu Ihnen.«
»Also gut. Haben Sie die Polizei schon verständigt?«
»Aber ja, Herr Mertens.«
Ich wollte schon auflegen, da fiel mir noch etwas ein. »Witters?«
»Ja, Herr Mertens?«
»Sagten Sie Sonnenuntergang?«
»Klingt seltsam, nicht wahr? Aber genau so sagte er es. Nach Sonnenuntergang.«
»Wissen Sie, wann das ist?«
»Kurz vor acht.«
»Sie verwenden also noch Uhren in Ihrem Büro?«
»Werden Sie nicht sarkastisch, Herr Mertens. Guten Tag.«
An meiner guten Laune vom Vortag hatte sich noch immer nichts geändert. Auch Martha wirkte heiter. Unserem Urlaub schien nun nichts mehr im Wege zu stehen. Wenn Hammerstock heute halbwegs pünktlich war und uns nicht allzu lange aufhielt, konnten wir noch den Nachtzug nehmen und unserem beklemmenden Besucher endgültig ein Schnippchen schlagen.
Nach Sonnenuntergang! Das ging mir eine Weile nicht aus dem Kopf. Das war auch der ungefähre Zeitpunkt für die Besuche Willies gewesen. Unser Willie, wie wir ihn gestern im Laufe unseres Abendbummels scherzhaft getauft hatten. Es klang alles viel weniger beängstigend, wenn man erst einmal darüber lachen konnte.
Natürlich blieb eine Spur von Unsicherheit, ein Funke, der jederzeit auflodern konnte. Man kann Ungewissheit und Furcht nicht einfach hinauslachen aus der Seele, besonders nicht, wenn sie aus der Tiefsee des Unterbewussten emporgetaucht sind.
7
Hammerstock kam kurz vor neun, als wir schon unruhig wurden. Unser Zug ging um zehn.
Er trat ein wenig steif ein und nickte nur zum Gruß. Er legte nicht ab und er setzte sich nicht. Es war äußerst ungemütlich, aber es deutete darauf hin, dass er nicht lange bleiben würde, und das war mir recht. Er wollte auch nichts trinken. Sein Gesicht war ungewöhnlich bleich, aber ich maß dem keine Bedeutung bei. Auch nicht der Tatsache, dass er beim Sprechen kaum den Mund öffnete.
»Was wollen Sie wissen, Herr Mertens?«, fragte er.
»Was Sie auf dem Friedhof von Elbenburg gefunden haben in jener Nacht, als Sie mich anriefen«, sagte ich rasch, denn das war die Frage, die mich seit Hammerstocks Verschwinden am meisten beschäftigt hatte.
»Die Toten«, erklärte Hammerstock. Ich sah, dass er seine Hände tief in den Taschen des Mantels vergraben hatte. Seine Augen musterten mich … kalt. Ich bemerkte es voller Unbehagen. Was war mit Hammerstock geschehen?
»Die Toten?«, wiederholte ich.
»Sie waren ungeduldig«, fuhr er fort.
»Die Toten?«, wiederholte ich erneut verständnislos. Irgendetwas an ihm erschien mir seltsam, aber so sehr ich mich auch bemühte, ich erkannte nicht, was es war.
»Ich folgte Willie Martin, nachdem er aus Ihrem Fenster gesprungen war.«
»Sie folgten …«, begann Martha erstickt und brach hilflos ab.
»Da wusste ich natürlich noch nicht, dass es Willie Martin war. Aber ich sah es, als ich schließlich an seinem Grab stand.«
Ich hatte das Gefühl, dass sich meine Nackenhaare sträubten. »Ist bei Ihnen auch wirklich alles richtig …?«, stieß ich hervor.
Er nickte mühsam, so als fiele ihm die Bewegung schwer. »Ich muss gehen«, sagte er. »Wir wollen alle leben.« Er wandte sich grußlos um und schritt steif zur Tür. Dort blickte er noch einmal zurück. »Willie Martin wird wiederkommen. Wir werden alle wiederkommen!«
Während wir ihn erstarrt anblickten, nahm er eine Hand aus der Tasche und griff nach der Türklinke. Die Hand war weiß und mager. Dann verließ er die Wohnung.
»Herr Hammerstock!« Ich eilte zur Tür und riss sie auf. Das Stiegenhaus war dunkel. Ich knipste das Licht an. »Herr Hammerstock?«
Kein Laut. Kein Geräusch von Schritten. Ich blickte zum Lift. Er stand im achten Stock. Den konnte er nicht benutzt haben. Ich wartete, bis das Licht verlöschte, dann trat ich zurück in die Wohnung und lehnte mich an die Tür. Er ist verrückt, dachte ich.
Martha sah mich wortlos an. »Er ist verrückt«, sagte ich leise. »Etwas muss da draußen mit ihm geschehen sein.«
Aber jetzt wollte ich nicht darüber nachdenken. Wir mussten zum Bahnhof. Im Taxi hielt ich Marthas Hände fest in den meinen, während meine Gedanken nicht von dem Detektiv loskamen. Mir ging nicht so sehr das, was er gesagt hatte, durch den Kopf, sondern etwas Unerklärliches an ihm.
Im Zug endlich wusste ich es: Hammerstock hatte nicht geatmet!
8
Ich behielt diese Entdeckung für mich, umso mehr, als sie mir bald allzu phantastisch erschien. Wir verbrachten ein paar erholsame Tage auf dem Bauernhof, in dessen geruhsamer Atmosphäre wir unsere bedrückenden Gedanken bald vergaßen. Der Psychiater schien recht zu behalten. Wir fühlten uns frei vom Albtraum der letzten Tage. Selbst das Erlebnis mit Hammerstock verblasste. Am ersten Tag versuchte ich ein paar Mal, Witters anzurufen, um ihm meine Eindrücke vom Besuch seines Chefs mitzuteilen. Aber es klappte nicht mit der Vermittlung, und schließlich gab ich es auf. Es erschien mir nicht mehr wichtig. Und dann noch dieser unvergleichliche Höhepunkt am Tag vor unserer Abreise, als Martha mir mit einem unnachahmlichen Lächeln auf den Lippen gestand, sie glaube, sie sei schwanger.
Auch die vertraute Umwelt zu Hause änderte nichts an unserer Hochstimmung. Der Albtraum schien endgültig besiegt. Beide waren wir ganz sicher, dass uns nur unsere Nerven einen Streich gespielt hatten, und so war der erste Tag zu Hause wie eine Fortsetzung des Urlaubs und des Glücks.
Am Tag darauf, einem Mittwoch, erschien ich wieder im Büro, ausgeglichener denn je. Ich unterrichtete auch den Psychiater. Er beglückwünschte mich zum guten Verlauf der Dinge und ich beglückwünschte ihn zu seiner guten Diagnose. Dennoch mahnte er zur Vorsicht und riet mir, nicht zu sehr davon überzeugt zu sein, dass nun alles im rechten Lot sei. Nervöse Störungen seien im Allgemeinen nicht von heute auf morgen heilbar. Ich sollte deshalb bei einem Rückfall nicht den Kopf verlieren, sondern sofort zu ihm kommen.
Ich versprach es.
An diesem Abend beschlossen wir, nicht zu Hause zu bleiben. Vielleicht aus einer unbewussten Angst vor dem Rückfall, vor dem der Doktor gewarnt hatte, vielleicht aber auch nur aus dem Wunsch heraus, unsere Abende ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten als bisher. Schließlich mochte auch die Monotonie diese inneren Spannungen herbeigeführt haben, die sich so merkwürdig äußerten.
Ich war bereits angekleidet. Martha rumorte noch im Schlafzimmer, während ich nervös auf die Uhr blickte. Kurz nach acht.
Plötzlich fiel mir auf, dass Stille eingetreten war. Ich lauschte angestrengt. Keine Schritte, keine Geräusche nichts.
Eine unheimliche Ahnung beschlich mich.
Als ich den Fensterriegel knirschen hörte, wollte ich schreien. Aber die Angst schnürte mir die Kehle zu.
Wie im Traum hörte ich die Männerstimme:
»Guten Abend, Martha.«
Und Marthas Stimme, schwach und verloren:
»Hallo, Willie.«
Ich versuchte verzweifelt, diesen Schleier des Irrsinns beiseite zu reißen, diese Stimme zu verleugnen. Ich versuchte mir einzureden, dass alles nur eine Sinnestäuschung war, eine Halluzination.
Aber da vernahm ich wieder die Männerstimme: »Weißt du es, Martha?«
Und Martha: »Ja, es ist soweit, Willie.«
Nach einem Augenblick des Schweigens die Männerstimme: »Dann ist es gut. Ich werde nicht wiederkommen.«
»Ja.«
Dieses demütige, kraftlose Ja löste meine Starre. Mit einem Aufschrei lief ich zur Schlafzimmertür und riss sie auf.
»Martha!«, rief ich »Martha!«
Mit einem halben Lächeln wandte sie sich um. »Ich bin gleich fertig, Pet.« Dann sah sie mein entsetztes Gesicht und wurde weiß wie die Wand. »Wieder …?«, fragte sie tonlos.
Ich nickte nur und deutete auf das offene Fenster.
9
Willie hielt Wort.
Wer immer Willie war, eine Ausgeburt unserer Phantasie, oder ein gespenstischer Besucher aus einer anderen Welt, er kam nicht wieder. Er blieb uns den endgültigen Beweis seiner Existenz schuldig.
Wir überwanden den Schrecken rasch, als in den nächsten Tagen nichts geschah, und in den nächsten Wochen, den nächsten Monaten. Zu sehr beschäftigte uns das kleine Wesen, das in Marthas Leib heranwuchs. Einmal noch tauchte Willie an die Oberfläche meines Bewusstseins. Indirekt. Ich traf Witters. Wir wechselten ein paar Worte, und er berichtete mir, dass nun er in der Hauptsache die Detektei leite, da Hammerstock nur sporadisch und nur nachts käme und ein immer eigenbrötlerischeres Leben führe. Meistens halte er sich in Elbenburg auf, um die rätselhaften Morde aufzuklären, die ein offenbar Wahnsinniger dort verübte.
Von den Morden hatte ich auch bereits gelesen. Das Seltsame daran war, dass in allen Fällen kurz vor der Beerdigung auch die Leichen verschwunden waren, was eine Welle allgemeiner Empörung auslöste. Leichenschändung wurde ein geflügeltes Wort, und der nekrophile Täter fand wesentlich mehr Beachtung und Entrüstung als der Mörder.
Aber abgesehen von dieser Begegnung mit Witters erinnerte uns nichts mehr an Willie.
Anfang März, als der letzte Schnee dahinschmolz, war es dann soweit. Martha kam in die Klinik, und wie alle werdenden Väter rannte ich nervös vor dem Kreißsaal auf und ab. Ich wäre aber noch viel nervöser geworden, wenn ich das Grauen geahnt hätte, das mit der Geburt unseres Kindes seinen Anfang nahm.
Ich hörte sein Schreien vom ersten Augenblick an, und etwas in mir bäumte sich auf gegen den kreischenden Ton, der nur menschlich klang, weil er aus einer menschlichen Kehle kam.
Und gleich darauf Marthas Entsetzensschrei!
Ich stürmte zur Tür, die im gleichen Augenblick aufgerissen wurde. Eine Schwester rief aufgeregt: »Dr. Felbermann! Dr. Felbermann!«
»Was ist geschehen?«, fragte ich hastig. »Lassen Sie mich zu ihr!«
Sie wollte gerade antworten, als sich die Tür nebenan öffnete, und ein Arzt heraustrat. »Schnell, Doktor, etwas hat sie sehr aufgeregt.«
»Was ist, Schwester?«, rief ich.
»Gedulden Sie sich einen Augenblick, Herr Mertens. Es ist alles normal verlaufen. Sie haben einen kräftigen Sohn. Es war sehr aufregend für Ihre Frau. Sie braucht jetzt ein paar Minuten, um sich zu beruhigen.«
Damit schlug sie mir die Tür vor der Nase zu. Ich presste das Ohr daran und vernahm undeutlich die aufgeregte Stimme der Schwester, die offenbar etwas erklärte, dann die beruhigende des Arztes, dazwischen Marthas Schluchzen. Der kalte Knoten in meinem Magen wollte nicht verschwinden. Irgendetwas war geschehen. Warum ließen sie mich nicht hinein?
Der Kleine begann wieder zu kreischen, und ich zuckte zusammen. Es klang wie der Schrei einer gequälten Kreatur. Und plötzlich wieder Marthas Schreie.
Ich ertrug es nicht mehr. Ich riss die Tür auf und stürzte in den Kreißsaal. Zwei Ärzte standen an Marthas Bett. Sie sahen nicht auf, sie waren zu sehr damit beschäftigt, Martha festzuhalten und auf sie einzureden. Der eine gab ihr gerade eine Spritze. Die Schwester hielt das Kind im Arm. Sie blickte mir erschrocken entgegen.
»Martha!«, rief ich und stürmte zu ihr.
Einer der Ärzte sah auf. »Es ist nichts Ernstes, Herr Mertens. Sie wird sich gleich beruhigt haben.«
Martha sah mich nicht an. Ihre weit aufgerissenen Augen waren auf die Schwester gerichtet, auf das kleine, weißhäutige Wesen in ihren Armen.
»Sehen Sie nur, Herr Mertens«, sagte die Schwester lächelnd und drehte sich um. »Sehen Sie nur, Ihr Sohn!«
Ich unterdrückte nur mühsam einen Aufschrei des Entsetzens. Das Gesicht des Babys besaß deutlich ausgeprägte Züge.
Nehmt es weg, dachte ich verzweifelt. Seht ihr nicht, wie es sie erschreckt? Seht ihr nicht, wie hässlich es ist, das kleine Monstrum? Seht ihr nicht, dass es aussieht wie ein Gnom, als wäre es bereits erwachsen, und nur der Körper hätte zu wachsen vergessen?
»Ich verstehe das nicht«, meinte einer der Ärzte und wandte sich zu mir um. »Was hat Ihrer Frau nur einen solchen Schock versetzt? Ist es ein ungewolltes Kind?«
»Ja«, erwiderte ich betäubt. »Seit diesem Augenblick weiß ich, dass es ein ungewolltes Kind ist. Wenn je eines ungewollt gewesen ist, dann dieses.«
Ein Schreien folgte meinen Worten, ein Wutgebrüll, das die Züge des Neugeborenen bis zur wohltuenden Unkenntlichkeit verzerrte.
Die Züge von Willie Martin.
10