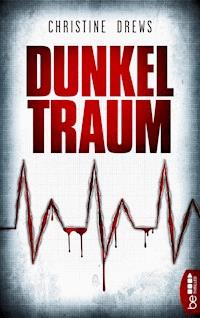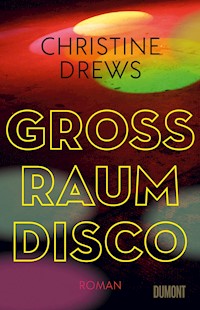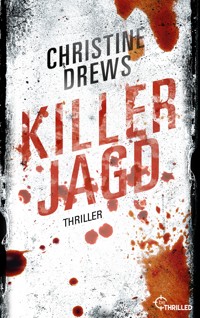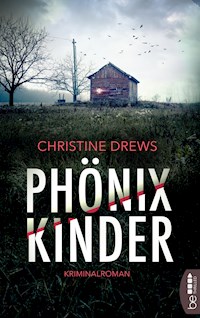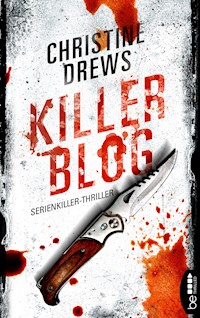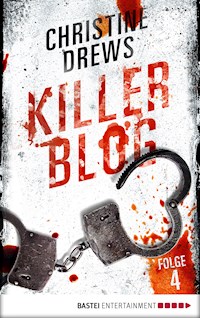9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Caro und ihr Vater Karl könnten nicht unterschiedlicher sein. Kriegskind Karl musste in seiner Kindheit alles entbehren, Kriegsenkelin Caro dagegen wächst im Überfluss auf. Karl war auf sich alleine gestellt, Caro fühlt sich eingeengt und überbehütet. Und sie schaffte es nie, sich von ihrem Übervater zu emanzipieren, mit dem sie eine ganz besonders innige Beziehung verband. Bis sie sich vor einem Jahr heillos zerstritten. Nun steht die Goldene Hochzeit ihrer Eltern vor der Tür. Aber wie soll sie sich mit ihrem Vater versöhnen? Als trockene, arbeitslose Alkoholikerin und alleinerziehende Mutter fühlt sie sich vom erfolgreichen Vater nicht ernst genommen. Erst als Caro die alte Frau Schneiders kennenlernt und eine Freundin in ihr findet, eröffnen sich ihr neue Perspektiven. Vielleicht gibt es doch einen Weg mit ihrem Vater ins Gespräch zu kommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Caro und ihr Vater Karl könnten nicht unterschiedlicher sein. Kriegskind Karl musste in seiner Kindheit alles entbehren, Kriegsenkelin Caro dagegen wächst im Überfluss auf. Karl war auf sich alleine gestellt, Caro fühlt sich eingeengt und überbehütet. Und sie schaffte es nie, sich von ihrem Übervater zu emanzipieren, mit dem sie eine ganz besonders innige Beziehung verband. Bis sie sich vor einem Jahr heillos zerstritten.
Nun steht die Goldene Hochzeit ihrer Eltern vor der Tür. Aber wie soll sie sich mit ihrem Vater versöhnen? Als trockene, arbeitslose Alkoholikerin und alleinerziehende Mutter fühlt sie sich vom erfolgreichen Vater nicht ernstgenommen.
Erst als Caro die alte Frau Schneiders kennenlernt und eine Freundin in ihr findet, eröffnen sich ihr neue Wege und eine Versöhnung scheint möglich. Aber wie viel Zeit hat Caro, die Geschichte ihres Vaters zu erfahren?
Die Autorin
Christine Drews arbeitete schon während ihres Germanistik- und Psychologiestudiums für diverse TV-Produktionen. Nach ihrem Magisterabschluss schrieb sie verschiedene Comedy-Serien und ist seit 2002 als freie Autorin tätig. Sie schreibt Drehbücher für Film, Familien- und Comedyserien und arbeitet als Autorin für zahlreiche Showformate. Aktuell schreibt sie Drehbücher für Soko Köln und Bettys Diagnose.
Christine Drews
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1628-4
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage September 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © ullstein bild/© Oscar Poss
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Es regnet nicht, es schüttet. Auf den ersten Blick bin ich mir nicht sicher, ob es Tropfen sind, die auf den Asphalt knallen, oder Hagelkörner. Aber es sind tatsächlich Regentropfen, so groß, dass sie einen Käfer erschlagen könnten.
»Das ist doch kein Sommer. Das ist der allerletzte Scheiß …«
Ich lalle, aber nur ein bisschen, nicht weiter schlimm.
Wo ist nur mein verdammtes Auto?
Ich musste Papa versprechen, nicht mehr zu fahren, ihm sogar mit großer Geste die Wagenschlüssel überreichen. Er weiß ja nicht, dass ich die Ersatzschlüssel immer in der Handtasche habe. Ist doch klar, ich bin ja nicht blöd, ich kann schließlich nicht dauernd zu Fuß nach Hause gehen, nur weil irgendjemand meint, ich könnte nicht mehr fahren. Was soll hier auf dem platten Land schon passieren? Und auf ein Taxi wartet man mindestens eine halbe Stunde.
Patschnass setze ich mich hinters Steuer, die Scheiben des Golf Cabrios beschlagen augenblicklich. Mit dem Ärmel meines hellblauen Kaschmir-Shirts versuche ich, mir etwas Sicht zu verschaffen. Dann drehe ich das Radio voll auf und singe aus Leibeskräften mit.
Prince, Purple Rain. Ich liebe es.
Die Scheibenwischer arbeiten auf Hochtouren, trotzdem kann ich kaum etwas sehen. Das Wasser steht auf der Straße, und ich fahre von einer Pfütze in die nächste, als wäre sie ein einziger großer See.
»I only wanted to see you bathing in the purple rain …«
Je lauter ich mitsinge, desto stärker beschlägt die Scheibe.
Ich fahre auf die nicht enden wollende Kurve zu, die an der niedrigen alten Friedhofsmauer vorbeiführt. Jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Hause.
Bin ich zu schnell?
»I only wanted to see you underneath the purple rain …«
Ich bin zu schnell.
Verdammt, die Reifen … sie berühren kaum noch den Boden. Ich kann nicht mehr lenken. Ich bremse. Nichts passiert.
Mit einem grellen Scheppern rast der Wagen durch die Friedhofsmauer.
Ich schreie.
Der Gurt scheint mich zu zerquetschen, und ein stechender Schmerz durchfährt meinen Brustkorb. Ich umklammere das Lenkrad, versuche weiterhin zu bremsen. Ich kann nicht aufhören zu schreien.
Ein erneuter Aufprall. Ich werde ein weiteres Mal nach vorne geschleudert und im nächsten Moment wieder zurück. Nun steht der Wagen.
Mein Schädel dröhnt, den Kopf kann ich kaum anheben, und mein Nacken scheint zur Bewegungsunfähigkeit verdammt. Die Schmerzen kriechen über meinen Hinterkopf nach vorne in die Stirn und breiten sich überall aus.
Stöhnend blicke ich durch die mehrfach gesprungene Windschutzscheibe. Der große Grabstein, der die Fahrt stoppte, liegt nun quer auf der Motorhaube. Qualm steigt auf, und die dicken Regentropfen prasseln auf das verbeulte Blech. Ich sehe doppelt und kneife die Augen zusammen, um meinen Blick zu fokussieren.
Nein. Das kann doch nicht sein.
Meine Hände fangen an zu zittern, und mir wird schlecht, als ich meinen Namen auf dem Grabstein lese:
Carolina Winter †Geliebt und unvergessen.
Maiglöckchen
[Convallaria majalis; Gattung der Liliengewächse]
1944
Eine merkwürdige Stille lag über der Stadt. Es war kurz nach fünf, die Sonne würde bald aufgehen. Die Bewohner der Stadt waren entweder tot oder schliefen noch. Dasselbe galt für die Soldaten. Das Inferno, das in den letzten Tagen in der Stadt gewütet hatte, war vorüber.
Vorsichtig kletterte Karl über die Trümmer. Der Hunger hatte den Siebenjährigen aus dem Versteck getrieben, in dem er mit seiner Mutter und seinen beiden älteren Schwestern bereits so lange ausharrte. Einmal waren sie den Russen begegnet, und seitdem trauten sich die Mädchen nicht mehr ans Tageslicht. Und Mutter schon gar nicht.
Suchend blickte der Junge sich um. Wo sollte er hier etwas zu essen finden?
»Vielleicht eine Taube oder eine Katze«, hatte Mutter zu ihm gesagt. Aber Karl wusste, selbst wenn er es schaffen würde, einen Vogel zu fangen, wäre er doch nicht in der Lage, dem Tier den Hals umzudrehen. Und einem Kätzchen erst recht nicht.
Er kletterte weiter über die Steinberge, stets darauf bedacht, nicht abzurutschen und unnötig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bloß keinen schlafenden Russen wecken, das hatte Mutter ihm immer und immer wieder eingeschärft.
Wo sollte er mit seiner Suche anfangen? Alles war in Schutt und Asche gelegt. Und zu weit von seinem Versteck wollte er sich auch nicht entfernen, aus Angst, in der Trümmerwüste die Orientierung zu verlieren und nicht mehr zu seiner Mutter zurückzufinden.
Plötzlich trat er auf etwas Weiches. Blitzartig zuckte er zurück. Ihm war sofort klar, worauf er getreten war, und er musste den Impuls, sich zu übergeben und einfach wegzurennen, zwanghaft unterdrücken.
Reiß dich zusammen! Es ist deine einzige Chance!
Karl wusste, dass er die Leiche durchsuchen musste. Vielleicht hatte der tote Soldat etwas Essbares bei sich, was ihm und seiner Familie das Leben retten konnte. Soldatenrationen waren wahrscheinlich das Einzige, was es in dieser zerbombten Stadt noch zu essen gab.
Er straffte seinen Körper, presste die Lippen zusammen und suchte mit zitternden Händen den kalten Körper ab. Er hatte Glück. Noch hatte niemand den Brotbeutel des Soldaten an sich genommen, der an einem Gürtel um seine Hüften hing, und tatsächlich befanden sich einige Reste Proviant darin. Eine kleine Bakelitdose mit etwas Margarine und ein faustgroßes steinhartes Stück Brot, vom Blut des Soldaten rot verfärbt, das durch die Uniform in den Brotbeutel gesickert war. Es war besser als nichts, jetzt würde er wenigstens nicht mit leeren Händen zur Mutter zurückkehren.
Obwohl Karl versuchte, dem Toten nicht ins Gesicht zu schauen, streifte sein Blick die entstellten Züge, als er aufstand. Schlagartig wurde ihm erneut schlecht. Schnell drehte er sich weg und kletterte über die Geröllwüste zurück in Richtung des Verstecks.
Denk nicht daran, sagte er sich. Denk einfach nicht mehr daran. Denk an was Schönes!
Aber er konnte sich an nichts Schönes mehr erinnern.
Doch dann blieb er stehen und hielt inne. Ungläubig staunend starrte er auf das, was er vor sich sah. Dort, zwischen Trümmern und Granatresten, mitten in den Überresten einer einst lebendigen Stadt, hatte sich ein Maiglöckchen den Weg zum Licht erkämpft.
Karl ging in die Knie und zog das Maiglöckchen vorsichtig aus dem Schutt.
Die erste Blume, die er seiner Mutter mitbringen würde.
2016
Caro Winter kniete auf der Rasenfläche, die definitiv schon bessere Zeiten erlebt hatte. Das Grün war von Moos und Unkraut durchzogen und eher als braun, mit viel gutem Willen vielleicht auch als schlammgrün zu bezeichnen. An einen Rasen erinnerte es jedenfalls nur noch entfernt. Vertikutieren wäre eine Möglichkeit, dachte Caro, vielleicht war es dafür aber auch schon zu spät, und sie musste neu aussäen. Dem kleinen Garten war es anzusehen, wie sehr er es ihr übelnahm, dass sie sich viel zu lange nicht um ihn gekümmert hatte. Es würde sie noch eine Menge Zeit kosten, ihn wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Caro seufzte. Und lächelte gleichzeitig. Sie freute sich auf die Gartenarbeit, auf das frische Grün in der Zukunft. Endlich hatte sie wieder Energie, um Pläne zu schmieden. Aber Pläne zu schmieden war eine Sache. Sie umzusetzen eine ganz andere.
Ihr Einsatz beim Roten Kreuz war ein erster Schritt, auch wenn sie nur einmal in der Woche in der Suppenküche aushalf. Sie spürte, dass sie mehr brauchte, eine Beschäftigung oder ein Hobby, das sie ausüben konnte, wenn sie früher getrunken hatte. Einen Job sowieso. Sie musste die Leere füllen, die früher der Alkohol eingenommen hatte.
Caro legte die kleine Metallschaufel zur Seite, mit der sie ein halbes Dutzend Löcher in das Beet vor sich gegraben hatte, und setzte das erste Maiglöckchen ein. Sorgfältig bedeckte sie die Knolle mit Erde und wässerte sie.
Heute war ein guter Tag. Sie hatte eine weitere Feuerprobe bestanden, eine äußerst schwierige, die sie die letzte Nacht kaum hatte schlafen lassen.
Seit fast einem Jahr wohnte sie jetzt in Köln-Rodenkirchen, dem hübsch am Rhein gelegenen Stadtteil der Dom-Metropole, dessen alte Bewohner vergeblich versucht hatten, ihr Veedel gegen die neureichen Villenbesitzer zu verteidigen, die in den letzten Jahren jedes alte Häuschen für Himmel und Geld aufkauften, abrissen und dafür ein riesiges Haus neben das andere setzten. Und in einem davon wohnte Annabel Harne, eine Freundin, nein, eine Bekannte, die zum Geburtstagsfrühstück eingeladen hatte. Eine Situation, der sich Caro vor einem halben Jahr noch nicht ausgesetzt hätte. Die Angst, einen Rückfall zu erleiden, war allgegenwärtig gewesen.
Aber heute hatte sie es geschafft.
»Du siehst toll aus!«, hatte Annabel zur Begrüßung geflötet und sie dabei strahlend gemustert. Caro hatte pflichtbewusst gelächelt. Sie wusste, dass die Floskel nett gemeint war, konnte sie aber trotzdem nicht mehr hören. Immer war sie die Hübsche gewesen, das Kind mit den großen, blauen Kulleraugen und den blonden Haaren, Papas Prinzessin, »meine Schöne«. Sehr viel mehr als Schönsein schien niemand von ihr zu erwarten, dachte sie und unterdrückte die Bitterkeit, die automatisch in ihr aufstieg. Sowohl ihre Eltern als auch ihre beiden älteren Brüder Stefan und Mark hatten kaum Ähnlichkeit mit ihr. Die Jungs waren beide dunkelhaarig und hatten das markante Kinn des Vaters geerbt, dem dank des auffälligen Grübchens immer eine gewisse Ähnlichkeit mit Kirk Douglas nachgesagt wurde. Und Mama war eine klassische Rothaarige, mit leichten Sommersprossen und fast durchsichtiger Haut.
»Du kommst nach Oma Carolina«, hatte Papa immer gesagt und ihr ein altes Foto gezeigt, das seine Mitte der 1980er Jahre verstorbene Mutter zeigte: eine große, schlanke Frau mit hohen Wangenknochen und leicht gebogener Nase, die weißblonden Haare zu einer sorgfältigen Dauerwelle frisiert. Das Blau ihrer Augen hatte selbst im hohen Alter nichts an seiner Intensität eingebüßt und wirkte immer noch so strahlend wie bei einem jungen Mädchen.
Caro pflanzte ein weiteres Maiglöckchen, die Lieblingsblume ihrer Oma, und dachte daran, wie unbehaglich ihr gewesen war, als Annabel den Champagner geöffnet hatte. Die anderen sechs Frauen, die auch zu Gast waren, griffen hingegen sofort nach den langstieligen Gläsern, die Annabel ihnen reichte, wobei jede beteuerte, höchstens ein Schlückchen trinken zu wollen, man müsse ja später noch die Kinder abholen. Kurz darauf waren die ersten bereits beim dritten Glas.
»Ich bleibe lieber bei Kaffee. Von Champagner krieg ich immer Kopfschmerzen«, hatte Caro mit heftig pochendem Herzen gelogen. Allein der Geruch machte sie nervös, und sie hoffte inständig, dass die Damen ihr die Ausrede abkauften. Oft genug wollte man sie zum Trinken überreden: »Wenigstens ein Glas zum Anstoßen« – diesen Satz hatte sie schon unzählige Male gehört.
Aber zum Glück wurde ihre Champagner-Verweigerung diesmal nicht weiter kommentiert. Und sie hatte durchgehalten, hatte den ganzen Vormittag nur Wasser und Kaffee getrunken, und das in einer Situation, in der sie sich noch vor nicht allzu langer Zeit dezent hätte volllaufen lassen. Und zwar so richtig.
Nachdenklich begann Caro, das Unkraut aus dem Beet zu zupfen. Obwohl sie keine von den anderen Frauen gut gekannt hatte, erinnerten diese pastellfarbenen blondierten Mitvierzigerinnen sie an ihre alte Clique. Manche Dinge änderten sich einfach nicht. Als Jugendliche waren Caro und ihre Freundinnen mit dem neusten Benetton-Sack über der Schulter auf die Roller der coolsten Jungs gestiegen, die Augen mit blauem Kajal umrandet, die langen Haare über eine Schulter geworfen, die, vom Solarium ganzjährig gebräunt, aus dem absichtlich verrutschten Sweatshirt blitzte. Caro gehörte zum festen Kern dieser Clique, ohne sie fand keine Party statt. Aber richtige Freundinnen waren es nicht gewesen, das war ihr erst viel später klargeworden. Alles hatte sich nur ums Feiern gedreht. Probleme wurden grundsätzlich nicht angesprochen, und im Nachhinein kam es Caro so vor, als wenn es schon damals allen am wichtigsten gewesen war, dem anderen zu zeigen, wie super es einem ging.
Mittlerweile war der Benetton-Sack dem Louis-Vuitton-Täschchen gewichen, und die ganzjährige Bräune war etwas dezenter geworden, ansonsten schien die Zeit stehengeblieben zu sein.
Ihr war bewusst, dass sie sich von den Partyfreunden zurückziehen musste, um so mit den alten Gewohnheiten zu brechen. Das war ihr auch in der Klinik geraten worden, und bisher hatte sie sich daran gehalten. Kam sie jetzt nicht vom Regen in die Traufe, wenn sie sich wieder mit solchen Freundinnen umgab?
Caro blickte auf die Maiglöckchen zu ihren Füßen und dachte an ihre Oma.
»In meinem Alter kann ich keine Zeit mehr vergeuden, mein Schatz«, hatte sie einmal zu ihr gesagt, als sie schlechtgelaunt von einem Kaffeeklatsch gekommen war. »Ich verschwende keine einzige Minute mehr mit Menschen, die zu nichts anderem als oberflächlichem Blabla in der Lage sind und die Probleme haben, die de facto keine sind. Das war das letzte Mal in meinem Leben, das verspreche ich dir.«
Ein halbes Jahr später war sie tot.
Vielleicht sollte sie keine vierzig Jahre mehr warten, bevor sie sich die Erkenntnis ihrer Großmutter zu eigen machte, überlegte Caro. Andererseits war es auch nicht so, dass sie nur negative Begegnungen mit Menschen hatte. Viele Eltern, die sie über Cornelius kennengelernt hatte, waren sehr sympathisch, und der Austausch über Angelegenheiten, die die Schule oder den Sportverein betrafen, taten ihr gut, auch wenn sie diesen Leuten niemals etwas von ihren Problemen erzählen würde. Aber dafür hatte sie ja Jakob, und eigentlich auch Papa. Eigentlich.
Sie war zu diesem Frühstück gegangen, um endlich mal wieder unter Leuten zu sein. Und dieses oberflächliche Geplapper hatte auch einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Sie musste grinsen, als sie daran dachte, wie eine der Frauen erschüttert erzählte, dass sie ihren Sohn beim Surfen auf Pornoseiten erwischt hatte.
»Ich glaube, alle Männer gucken sich Pornos an«, meinte Caro dazu nur.
Für einen winzigen Augenblick herrschte Stille.
»Er ist sechzehn!«, sagte die Frau dann empört.
Caro zuckte mit den Achseln. »Ich würde sagen, das ist das Porno-Alter schlechthin.«
»Ach ja? Guckt dein Sohn etwa auch diese Sachen?«
»Nein.«
»Na also!«
»Er ist neun.« Die Frauen machten ein Gesicht, als hätte Caro etwas Verwerfliches gesagt. »Ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen«, fügte sie hinzu. »Als die im besagten Alter waren, bekamen sie alle drei Tage die Betten neu bezogen.« Die Geburtstagsrunde sah sie ratlos an. »Sperma«, fügte Caro deshalb erklärend hinzu, und sofort erklang ein einstimmiges langgezogenes »Ääääh«, worauf Annabel schnell wieder die Champagnergläser befüllte und auch ihr ein volles Glas reichte.
Selbst jetzt bei der Gartenarbeit bekam Caro noch Herzrasen, wenn sie daran dachte, wie sie das Glas entgegennahm, es in der Hand hielt, kurz zögerte, um es dann doch abzusetzen, ohne daran genippt zu haben. Sie hatte weitere zwei Stunden durchgehalten, hatte sich aber auf den Augenblick gefreut, an dem sie endlich auf ihre teure Armbanduhr blicken und ihren Lieblingssatz sagen konnte: »Oh, verdammt, ich muss los!«
»Wir sehen uns ja nachher an der Schule«, sagte die eine Frau freundlich zu ihr. »Beim Abholen.«
»Cornelius geht allein nach Hause«, antwortete Caro und konnte die Gedanken der Frau förmlich lesen. Mit neun Jahren lässt die ihr Kind alleine auf der Straße rumlaufen!
Caro wusste, dass alle Frauen hier so dachten, und sie war sich sicher, dass die Porno-Mutter sogar ihren sechzehnjährigen Sohn noch ständig durch die Gegend kutschierte. Sie kannte die Ängste, die diese Mütter um ihren Nachwuchs hatten, sie hatte sie selbst oft genug gehabt und konnte sich auch heute nicht immer davon freimachen. Absurde Ängste vor Pädophilen und Entführern, die im Grüngürtel ihren Kindern auflauern könnten und realistischere Sorgen um tragische Verkehrsunfälle, die ihnen auf dem Schulweg passieren könnten – besonders durch die dicken SUVs, die jeden Morgen die kleine Straße zur Schule blockierten. Obwohl die Schulleitung die Eltern immer wieder nachdrücklich darauf hinwies, die Kinder bitte nicht mit dem Auto bis vor die Schultür zu bringen, hielt sich niemand daran. Sie wollten nun mal alles richtig machen, auch wenn es falsch war. Bis vor einem Jahr war es bei ihr nicht anders gewesen, und wenn sie ihren Führerschein nicht hätte abgeben müssen, wäre es ihr vielleicht auch nicht so leicht gefallen, Cornelius dieses kleine Mehr an Selbstständigkeit zuzugestehen.
Sie kannte es ja selbst nicht anders.
Ihr war allerdings klar, dass es einen großen Unterschied gab, zwischen dem Übermaß an Sorge und Schutz, mit dem ihr Vater sie überschüttet hatte, und ihrem Verhalten Cornelius gegenüber. Denn während seine Sorge wohl tatsächlich ihr gegolten hatte, hatte sich bei Caro doch in erster Linie alles nur um sie selbst gedreht. Funktioniere ich als trinkende Mutter? Merkt auch niemand, dass ich getrunken habe? Ja, sie hatte Cornelius früher wie eine klassische Helikopter-Mutter ständig durch die Gegend kutschiert, konnte ihn nur schwer alleine lassen und hatte ihn meistens begleitet, selbst wenn er nur wenige Hundert Meter zurücklegen musste. Sie wollte sich beweisen, dass sie eine gute Mutter war, dass sie sich kümmerte und dass der Alkohol kein Problem war. Im Gegensatz zu ihrem Vater war sie immer da gewesen. Jedenfalls physisch. Mit durchschnittlich zwei Promille im Blut war sie aber geistig ständig abwesend und so vermutlich die größte Gefahr für ihren Sohn gewesen.
Was hatte sie Cornelius zugemutet!
Dass ihm bei den Autofahrten unter Alkoholeinfluss nichts passiert war, dafür war Caro bis heute dankbar. Aber noch schlimmer wog die Gewissheit, so viel versäumt zu haben, leise Zwischentöne überhört und laut ausgesprochene Sorgen ignoriert zu haben. Was richtete es in der Seele eines kleinen Jungen an, wenn er seiner Mutter vom Ärger in der Schule oder mit Freunden erzählte, und sie nicht in der Lage war, ihm zuzuhören, geschweige denn, ihm mit Trost und Rat zur Seite zu stehen? Es nagte an ihr, dass sie es so weit hatte kommen lassen, zumal sie in ihrer eigenen Kindheit selbst darunter gelitten hatte, dass ihre Mutter nie ein offenes Ohr für sie hatte. Auch wenn Caro fand, dass ihr Sohn ein ganz normaler Junge war, der keinerlei Verhaltensauffälligkeiten zeigte, so war ihr doch bewusst, dass ihre Sucht Cornelius geprägt hatte. Sie merkte es an Kleinigkeiten, an Fähigkeiten, die er im Alltag an den Tag legte, die für Kinder in seinem Alter ungewöhnlich waren. Aber anstatt stolz darauf zu sein, dass Cornelius sich mit neun Jahren schon alleine Nudeln kochen konnte, dass er von seinem Taschengeld Brot kaufte und nach der Schule mit nach Hause brachte, erfüllten diese Dinge sie mit Traurigkeit. Denn er tat es, weil er schon früh gelernt hatte, dass er sich auf seine Mutter nicht verlassen konnte. Weil er wusste, dass eben nicht immer etwas zu essen im Haus war oder eine warme Mahlzeit auf dem Tisch stand, wenn er ausgehungert vom Sport nach Hause kam.
Sie hörte das Telefon klingeln, wischte sich die erdverschmierten Finger an der Hose ab und eilte ins Haus.
»Mama«, sagte sie, nachdem sie die Nummer auf dem Display gesehen und auf den grünen Knopf gedrückt hatte. »Wie geht es dir?«
»Ich wollte noch mal mit dir über die Feier sprechen«, sagte ihre Mutter ohne Umschweife. »Wir rechnen fest mit dir.«
»Mama …«
»Es ist unsere goldene Hochzeit, Caro!«
»Ich weiß. Aber Papa und ich …«
»… der Unfall war vor über einem Jahr! Jetzt könnt ihr euch doch endlich wieder versöhnen, Caro«, unterbrach ihre Mutter sie. Wieso konnte sie eigentlich nie einen Satz zu Ende sprechen? Warum musste Mama sie immer unterbrechen? »Wer weiß schon, wie viel Zeit dafür noch bleibt«, fügte ihre Mutter noch leise hinzu, und Caro brauchte eine Sekunde, um zu verstehen, worauf ihre Mutter hinauswollte.
Der Krebs, ging es ihr durch den Kopf. Papa hatte vor Jahren mal Prostatakrebs gehabt, angeblich ganz harmlos, aber das wusste man bei Krebs doch nie. Ob die Krankheit zurückgekehrt war? Andererseits war mit achtundsiebzig Jahren für jeden Menschen die Lebenszeit auf gewisse Art und Weise begrenzt, Krebs hin oder her.
Frag sie doch einfach, dachte Caro, die den Ausführungen ihrer Mutter über die anstehenden Feierlichkeiten nicht mehr zuhörte. Frag sie doch, ob bei Papa der Krebs zurückgekommen ist. Auch wenn sie seit einem Jahr kein Wort mehr mit ihm gesprochen hatte, wollte sie natürlich wissen, ob es ihm gutging.
Aber sie fragte nicht. Stattdessen hörte sie ihrer Mutter zu, die von den aufwendigen Vorbereitungen für die Feier erzählte, von dem Kleid, das sie sich kaufen wollte, und von dem Essen, das sie bestellt hatte, obwohl die Goldhochzeit erst in einigen Wochen stattfinden würde.
Warum fragst du nicht nach Papa und dem Krebs?
Vermutlich, weil die Krankheit ihres Vaters immer ein Tabuthema gewesen war. Sie und ihre Brüder waren bereits erwachsen gewesen, als man den Tumor festgestellt hatte. Anders als bei kleinen Kindern, hätte man mit ihnen offen über alles sprechen können. Das wurde aber nicht gemacht. Ihr Vater wurde operiert, bestrahlt und galt danach als geheilt. Und immer, wirklich immer, wenn sie ihn gefragt hatte, ob er noch irgendwelche Beschwerden habe, hatte er das Ganze abgetan, als wäre es nicht mehr als ein lästiger Schnupfen gewesen. Über Probleme wurde im Hause Winter nur ungern gesprochen, das war schon immer so, auch wenn sie nichts mit der Prostata zu tun hatten. Aber in diesem Fall, im Fall der Krankheit, war es Caro extremer vorgekommen als sonst. Wurden ihre Probleme in der Schule oder im Studium wenigstens noch mit ein paar knappen Sätzen bedacht, bevor sie mit einem »wird schon« unter den Teppich gekehrt wurden, so schwiegen ihre Eltern die Krankheit des Vaters fast tot. Stefan, ihr ältester Bruder, glaubte, dass es etwas mit dem betroffenen Organ zu tun hatte.
»Prostata hat doch irgendwie auch was mit Sexualität zu tun«, hatte ihr Bruder gemeint. »Und wie du sicher weißt, Schwesterchen, wurde über dieses schlimme Thema in unserer Familie nie gesprochen.«
Caro unterdrückte ein Seufzen, als sie an die Worte ihres Bruders dachte. Er hatte recht, über Sexualität wurde in ihrem Elternhaus nie gesprochen. Dabei war sie nicht in den 1950er Jahren großgeworden, wo alle verklemmt bis zum Gehtnichtmehr gewesen waren. Nein, sie war ein Kind der 70er, und sie fand immer noch, dass die Prüderie völlig unangemessen war. Als sie mit zwölf Jahren zum ersten Mal ihre Regel bekam, hatte sie nur ihren Freundinnen davon erzählt, hatte mit ihnen Binden und Tampons gekauft und heimlich ausprobiert, was besser funktionierte. Ihre Mutter hatte natürlich irgendwann gemerkt, dass ihre Tochter monatlich Besuch bekommen hatte, und ihr von da an mehr Taschengeld gegeben, damit sie sich mit dem Notwendigen eindecken konnte. Die Aufklärung übernahm die »Bravo« und obwohl sie immer davon ausgegangen war, dass das ihrer Mutter doch eigentlich nur recht sein konnte, hatte diese einen Heidenaufstand gemacht, als sie das pornografische Blatt eines Tages bei ihr gefunden hatte.
»Stefan und Mark werden in der Firma einen kleinen Empfang organisieren«, riss ihre Mutter sie aus den Gedanken. »Zur eigentlichen Feier werden aber keine Mitarbeiter eingeladen.«
Ihre beiden Brüder lebten immer noch in Raesfeld, dem kleinen Ort, in dem sie aufgewachsen waren. Ihr Vater hatte vor knapp zehn Jahren sein Bauunternehmen an seine beiden Söhne überschrieben. Stefan und Mark waren seitdem die Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens, das inzwischen über zweihundert Mitarbeiter beschäftigte. Karl Winter war aber noch immer sehr aktiv und tauchte trotz seines Alters fast täglich in der Firma auf.
»Ich nehme an, du willst dich direkt am Anfang der Feier entschuldigen«, fuhr ihre Mutter unbeirrt fort. »Willst du das unter vier Augen machen oder lieber ein paar warme Worte in der großen Runde sagen?«
Caro zögerte einen Moment. »Mama … ich … ich weiß gar nicht, ob ich komme …«, sagte sie dann. »Möchte Papa das überhaupt? Hast du ihn mal gefragt?«
»Natürlich will er dich dabeihaben. Du bist seine Prinzessin.« Sie lachte kurz auf, was sich irgendwie künstlich anhörte.
»Das ist doch lange vorbei …«
Caro hörte, wie ihre Mutter sich räusperte. Dann sagte sie mit fester Stimme: »Es ist an der Zeit, dass ihr euch versöhnt. Du entschuldigst dich, und gut ist. Es ist unsere goldene Hochzeit, da musst du deine Befindlichkeiten auch mal hintanstellen können.«
Caro schnappte nach Luft und versuchte, das aufkommende Zittern ihrer Hände unter Kontrolle zu halten. Ihr Herz schlug schneller, und sie musste schlucken.
»Befindlichkeiten?« Wie konnte ihre Mutter das Ganze so verharmlosen? »Er hat mit mir gebrochen!«, stieß sie hervor.
Niemals würde sie diese Demütigung vergessen. Sie war eine erwachsene Frau und kein kleines Mädchen gewesen, als ihr Vater sie vor einem Jahr geradezu aus seinem Leben verbannt hatte. Er konnte das, er war immer ihr Halt gewesen, die Person, auf die sie sich verlassen hatte, mit der sie mit einem scheinbar untrennbaren Band verbunden war. Aber er hatte dieses Band gekappt, hatte ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, den er zuvor immer für sie bereitet hatte. Nach der Trennung von Frank wohnte sie in einer seiner Wohnungen, fuhr einen Firmenwagen, und sogar ihre Urlaube hatte er bezahlt. Sie war abhängig von ihrem Vater gewesen. Und nach dem Unfall schmiss er sie von heute auf morgen aus der Wohnung, nahm ihr den Wagen weg und stellte jegliche finanzielle Unterstützung einfach ein. Cornelius musste zunächst zu seinem Vater ziehen – und sie stand buchstäblich auf der Straße. Obwohl sie krank war, obwohl sie Hilfe gebraucht hätte. Er hatte sie zwar in die Klinik gebracht, und vielleicht wäre sie niemals vom Alkohol losgekommen, wenn sie nicht so abgestürzt wäre, aber sie nahm es ihm übel, dass er ihren Sturz nicht etwas abgefedert hatte. Er hatte sie fallengelassen, das war bei aller Schuld, die sie für ihren Absturz trug, eine unbestreitbare Tatsache. Dass er an ihrem Zustand vielleicht eine Mitschuld trug, schien für ihn unvorstellbar zu sein, und auch das schmerzte sie. Das Band war zerschnitten, und sie wusste nicht, ob es jemals wieder repariert werden konnte.
Wenn sie nicht in das kleine Haus in Rodenkirchen hätte ziehen können, das Frank von seinen Großeltern geerbt hatte, und wenn er nicht jeden Monat Unterhalt zahlen würde, wüsste Caro nicht, wie sie das letzte Jahr überstanden hätte. Annabel und die anderen Pastellfrauen würden Augen machen, wenn sie wüssten, wie es hinter ihrer perfekten Fassade aus teuren Kleidern, edlem Schmuck und einem Häuschen in bester Lage aussah. Caro war inzwischen längst klar, was es bedeutete, diese Fassade zu pflegen. Wer die meiste Zeit seines Lebens dafür aufbrachte, sein Äußeres zu verschönern, vom Friseur zur Kosmetikerin, vom Inneneinrichter zum Designershop zu eilen, der hatte keine Zeit mehr, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Aber was nützte einem die schönste Fassade, wenn man dahinter noch nicht mal mit seinem Vater im Garten sitzen und Kuchen essen konnte?
»Er hat mich im Stich gelassen, als ich am Ende war«, sagte Caro bitter. »Mit Befindlichkeiten hat das wohl kaum etwas zu tun.«
»Caro, bitte! Nach diesem entsetzlichen Unfall war es das Einzige, was er machen konnte!«
»Entsetzlicher Unfall? Wie sich das anhört! Ich habe doch niemanden umgebracht!«
»Du hast Omas Grabstein zerstört!«, rief ihre Mutter empört.
Caro schwieg für einen Moment. Ja, das hatte sie. Die ganze Aktion war ein unverzeihlicher Fehler gewesen, den sie bitter bereute. Sie war im ganzen Ort zum Gespött geworden, alle hatten sich halb totgelacht, dass sie ausgerechnet in das viel zu große Monument ihrer Großmutter gerast war, das aus den ansonsten schlichten Grabsteinen hervorstach und den meisten Bewohnern ein Dorn im Auge war.
Ausgerechnet Omas Grab. Als würden die Schuldgefühle, die Caro seit dem Tod ihrer Großmutter mit sich herumtrug, noch nicht ausreichen.
Trotzdem.
»Ich weiß, dass es blöd war, aber es war nur ein Sachschaden. Ich habe niemanden verletzt …«
»Du hast deinen Vater verletzt. Und frag nicht, wie. Allein schon, was du ihm danach an den Kopf geworfen hast …«
Du warst doch nie da! Die Firma war dir immer wichtiger! Selbst als Oma starb, war dir die Scheißfirma wichtiger! Du warst nie ein guter Vater! Nie! Ich hasse dich!
Ihr wurde mulmig zumute, als sie an ihre Worte dachte. »Ich war betrunken … Das kann man doch nicht so ernst nehmen …«
Ihre Mutter atmete hörbar aus. »Wie auch immer du das siehst«, fuhr sie schließlich fort, »er ist nicht mehr der Jüngste. Wenn ihr nicht bald einen Schritt aufeinander zugeht, ist dein Vater irgendwann tot, und dann ist es zu spät. Die Goldhochzeit ist doch der perfekte Zeitpunkt für eine …«
»Ich muss jetzt Schluss machen«, sagte Caro.
»Unterbrich mich doch nicht immer!«
»Das sagt die Richtige.«
»Bitte?«
Caro schluckte die aufsteigende Wut herunter. »Entschuldige. Aber ich muss los. Ich habe noch einen Termin.«
»Was hast du denn für Termine?« Jetzt klang die Stimme ihrer Mutter spöttisch, und Caros Wut wurde immer größer. Sie musste dieses Telefonat beenden, sonst würde sie noch ausrasten.
»Ich hatte dir doch erzählt, dass ich mich in der Jugendhilfe …«
»Ach ja! Du kümmerst dich ja um diese Junkies!«, unterbrach ihre Mutter sie. »Sieh bloß zu, dass du dir da nichts einfängst.«
»Was soll ich mir denn …?« Caro sprach den Satz nicht zu Ende. Es hatte ja eh keinen Zweck. Ihre Mutter wollte nicht verstehen, was sie da ehrenamtlich machte, und vor allen Dingen, warum sie es tat.
Einmal in der Woche teilte sie in einer Anlaufstelle vom Roten Kreuz für obdachlose Jugendliche kostenloses Essen aus. Ihre Therapeutin hatte sie dorthin vermittelt. Obwohl Caro sich am Anfang dagegen gesträubt und das Zusammentreffen mit den zum Teil massiv verwahrlosten Jugendlichen als geradezu abstoßend empfunden hatte, ging sie inzwischen gerne zu dem Treffpunkt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hätte sie als Jugendliche nicht auch dort landen können? Es war nicht schwer, abzurutschen, im Gegenteil. Es war viel einfacher, als man es sich vorstellte. War man Meter vom Abgrund entfernt, war der Gedanke unvorstellbar, in die Tiefe zu stürzen. Aber es waren nur ein paar Schritte. Die Grenze zwischen oben und unten, zwischen einem gelungenen und einem verkorksten Leben war hauchdünn. Sie selbst war nicht nur einmal kurz davor gewesen, sie zu überschreiten.
»Desinfiziere dir danach bitte die Hände«, sagte ihre Mutter noch und legte dann mit einem geflöteten »Ich melde mich noch mal« auf.
Caro atmete tief durch und stellte genervt das Telefon zurück auf die Ladestation. Dann sah sie auf ihre erdigen Hände, ging ins Bad und wusch sie gründlich. Ihr Blick fiel auf Jakobs Zahnbürste, die seit gut zwei Wochen in einem eigenen Becher am Waschbeckenrand stand. Er wohnte zwar weiterhin in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Müngersdorf, war aber inzwischen häufiger bei ihr. Richtig zusammenziehen … nein, das kam ihr zu früh vor. Auch wenn sie sich sicher war, dass sie sich wirklich in Jakob verliebt hatte, wollte sie es nach dem katastrophalen Ende ihrer Ehe erst einmal langsam angehen lassen. Als selbständiger Tischler hatte er eine Menge zu tun, und da die Werkstatt in der Nähe seiner Wohnung lag, blieb er auch häufig dort, anstatt sich noch auf den Weg in den Kölner Süden zu machen. Im Moment gefiel ihr das ganz gut, auch wenn sie hoffte, irgendwann wieder mehr Nähe zulassen zu können.
Caro kämmte sich ihre schulterlangen blonden Haare und sah auf die Uhr. In einer Stunde musste sie bei der Jugendhilfe sein, wenn die Straßenbahn keine Verspätung hatte, schaffte sie das locker. Während sie sich fertigmachte, dachte sie an ihre Mutter, die fest davon auszugehen schien, dass sie zur Goldhochzeit kam und dass es dort zur großen Versöhnung kommen würde. Caro wusste, dass Stefan das genauso sah. Ihr ältester Bruder sah eigentlich immer alles so wie seine Mutter. Die enge Verbindung zwischen ihm und Mama hatte sie früher fast wahnsinnig gemacht. Er war nicht nur Mamas Liebling, sondern auch ihr Fürsprecher und Verteidiger. Allerdings hatte sie oft genug den Eindruck gehabt, dass er sich aus rein opportunistischen Gründen in diese Rolle begeben hatte. Denn natürlich hatte es in ihrer Kindheit und Jugend unbezahlbare Vorteile gehabt, Mamas Liebling zu sein. Allein schon, weil er dadurch Macht über seine Geschwister bekam. Stefan war Mamas rechte Hand in allen Erziehungsfragen geworden. Er hatte Caros Zimmerschlüssel einkassiert, wenn Mama nicht wollte, dass Caro sich einschloss, was sie manchmal tat, um in dem trubeligen Haus für einen Moment nur für sich zu sein. Er hatte sie verpetzt, sobald sich eine Gelegenheit dafür geboten hatte, und auch er ließ sie niemals aussprechen. Er unterbrach sie mindestens genauso oft, wie Mama es tat. Wenn nicht sogar öfter.
Mit Mark war es etwas anderes. Ihrem mittleren Bruder war die ganze Sache wahrscheinlich ziemlich egal, und in diesem Fall wusste sie seine Indifferenz durchaus zu schätzen. Mark war das klassische Sandwichkind, das sich grundsätzlich nicht in die Streitigkeiten der anderen einmischte. Am liebsten hatte er seine Ruhe.
Eine Versöhnung mit Papa, ging es Caro durch den Kopf, während sie im Badezimmerschrank nach ihrem Deo suchte. Es war ja nicht so, als wenn sie sich das nicht wünschen würde. Er fehlte ihr, sehr sogar. Ihr ganzes Leben hatte er ihr das Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Auch wenn sie die vielen Fehler sah, die er gemacht hatte, in seiner Anwesenheit hatte sie sich doch immer geborgen und sicher gefühlt. Vielleicht hatte seine Stärke sie unselbständig gemacht, vielleicht hatte sie neben einem solchen Vater nie richtig wachsen können, aber dennoch war er ihr Fels gewesen, und sie vermisste es, ihn hinter sich zu wissen. Und sie vermisste ganz alltägliche Dinge. Seine tiefe Stimme, sein lautes Lachen und seine blitzenden Augen.
Aber wäre sie überhaupt in der mentalen Verfassung, eine solche »Versöhnung« ruhig und besonnen durchzuziehen? Caro empfand sich selbst immer noch als sehr labil. Ihre Therapeutin war zwar der Meinung, dass sie sich auf einem guten Weg befinde, aber es war ein steiniger Weg, und das Ziel noch nicht in Sicht. Sie hatte nicht einen einzigen Rückfall gehabt, worauf sie sehr stolz war, im ersten Jahr lag die Rückfallquote immerhin bei siebzig Prozent.
Ja, er fehlte ihr. Sie war immer ein Papakind gewesen, hatte ihren Vater von klein auf vergöttert. Wie sollte sie ihm erklären, dass so vieles, was er richtig gemacht hatte, für sie falsch gewesen war? Er hatte es ja nicht besser gewusst, er hatte es schließlich gut gemeint.
Sie dachte an die Frauenrunde vom Vormittag, an die Mütter, die ihre Kinder zu jeder Verabredung fuhren, die sich um alles kümmerten und deren oberstes Ziel es war, alles Schlechte auf dieser Welt von ihren Söhnen und Töchtern fernzuhalten.
So wie Papa es immer versucht hatte.
1980
Vor Aufregung wurde Caro noch vor Sonnenaufgang wach. Seit Wochen hatte sie auf diesen Tag hin gefiebert. Seitdem sie mit Papa das weiße Kleid gekauft hatte, freute sie sich wahnsinnig auf ihre Erstkommunion. Mama würde ihr einen Blumenkranz in die Haare flechten, sie würde weiße Lackschuhe und ein kleines weißes Täschchen tragen. Und dieses wunderschöne Kleid. Sie würde eine Prinzessin sein.
Caro sprang aus dem Bett und hüpfte ins Bad. Heute war einzig und allein ihr Tag, heute würde nur sie im Mittelpunkt stehen, würde Geschenke bekommen und gefeiert werden, sie, die kleine Prinzessin in dem wunderschönen Kleid. Wie sie sich freute! Strahlend stand sie vor dem Spiegel und versuchte vorsichtig, die Lockenwickler aus dem Haar zu ziehen, die Mama ihr gestern Abend eingedreht hatte.
»Wer gut aussehen will, muss leiden«, hatte Mama gesagt und ihr die Wickler dabei so fest in die Haare gedreht, dass es nur so ziepte und sie fast geweint hätte. Aber sie hatte eisern durchgehalten, sie wollte eine Lockenmähne, unbedingt. Nichts anderes hätte zu diesem Traumkleid gepasst. Bodenlang, aus weißer Seide, mit kleinen Blümchen bestickt. Mama hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gerufen, dass so ein Kleid für ein kleines Mädchen doch viel zu pompös sei, aber das war ihr egal. Gegen Papa konnte sich ihre Mutter eh nicht durchsetzen.
Mama und ihr Sparfimmel. Sie war es leid, die Sachen ihrer Brüder aufzutragen! Caro hatte nie verstanden, warum sie das tun musste. Am Geld konnte es nicht liegen. Obwohl sie erst acht Jahre alt war, wusste sie genau, dass ihre Eltern viel mehr Geld besaßen als die meisten anderen in dem kleinen Ort. Ihr Elternhaus war riesengroß. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Klassenkameraden hatten sie und ihre Brüder jeder ein eigenes Zimmer, außerdem gab es zusätzlich noch ein Kinderbadezimmer und ein Spielzimmer, das von Playmobil und Barbiepuppen überflutet war. Niemand hatte so viel Spielzeug wie sie und ihre Brüder.
Eine große geschwungene Holztreppe führte von der ersten Etage in den Wohnbereich hinab, in dem weißer Marmorboden dominierte. Das Treppengeländer herunterzurutschen war eine der Lieblingsbeschäftigungen der drei Geschwister. Natürlich war das strengstens verboten und gerade deshalb so aufregend. Unten gab es ein weitläufiges Wohnzimmer mit weißen Ledermöbeln, das offen in ein großes Esszimmer überging. Papas Arbeitszimmer ging hier ab, der Eintritt in dieses Zimmer war für die Kinder verboten. Aber Caro hielt sich nie daran, und ihr Vater schien sich immer zu freuen, wenn sie sich zu ihm schlich. Dann hob er sie auf seinen Schoß, drückte ihr einen Kuss auf die Wange und sagte: »Na, meine kleine Prinzessin, langweilst du dich?« Und wenn sie nickte, zauberte er immer irgendetwas aus seiner Tasche, womit sie sich die Zeit vertreiben konnte, ein neues Spielzeug, neue Barbie-Kleidung. Er hatte immer etwas Schönes für sie. Allein deshalb ging sie so gerne in das verbotene Arbeitszimmer, um dann zu den Füßen ihres Vaters mit einer seiner kleinen Überraschungen spielen zu können.
Ihre Familie besaß den ersten Farbfernseher, den ersten Videorekorder, das erste Faxgerät. Warum bestand ihre Mutter bloß darauf, dass sie die Klamotten ihrer Brüder auftragen musste? Wenn Papa ihr nicht so häufig etwas Schönes zum Anziehen von seinen vielen Reisen mitbringen würde, dann würde sie vermutlich nur in Cordhose und T-Shirt herumlaufen.
»Du musst den Wert der Dinge schätzen lernen. Die Pullover deiner Brüder sind noch einwandfrei. Es wäre eine Schande, sie wegzuwerfen«, erklärte ihre Mutter, die sich mindestens einmal im Monat selbst ein neues Kleid kaufte.
Aber bei ihrer Erstkommunion gab es nichts aufzutragen. Sie konnte schließlich nicht die dunklen Anzüge von Stefan und Mark anziehen. Was für ein großartiger Tag!
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.