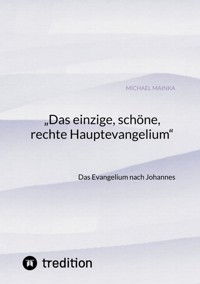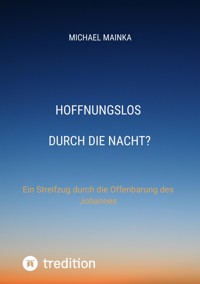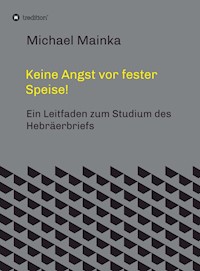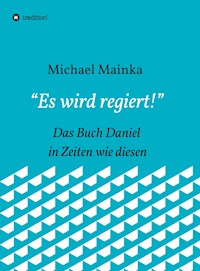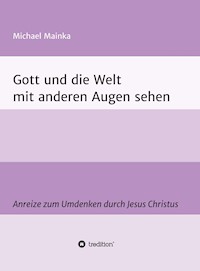9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Sabbat ist immer wieder neu entdeckt und entfaltet worden – bereits in biblischen Zeiten. Das vorliegende Handbuch zeichnet die Geschichte des Sabbats bis in unsere heutige Zeit nach und zeigt auf, welche Impulse er angesichts aktueller Hausforderungen geben kann. Es enthält und kommentiert alle einschlägigen Texte. Daher kann man es auch als eine Art Nachschlagewerk nutzen. Wer es aber von Anfang bis Ende durcharbeitet, wird so sein Gespür dafür schärfen, wie die Botschaft des Sabbats immer wieder neu wirksam geworden ist und welche Bedeutung sie in unserer heutigen Zeit hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 874
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael Mainka
Ein anderer Tag und ein anderes Leben
Ein Handbuch zum Sabbat in Geschichte und Gegenwart
© 2024 Michael Mainka
Umschlag, Illustration: Vorlage tredition
Verlag & Druck: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg
ISBN
Softcover 978-3-384-35731-1
Hardcover 978-3-384-35732-8
e-Book 978-3-384-35733-5
Die Bibelzitate sind – falls nicht anders vermerkt – der Elberfelder Bibel (Textstand 30) entnommen.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Das vorliegende Buch basiert auf der Vorlesung „Die Lehre vom Sabbat“, die ich seit mehr als 20 Jahren an der Theologischen Hochschule Friedensau halte. Der Botschaft des Sabbats in Geschichte und Gegenwart akribisch nachzugehen und das Ergebnis meiner Forschungen vor den Studenten zu entfalten und mit ihnen zu diskutieren, war und ist mir ein Vergnügen.
Obwohl die Vorlesung im Bereich der Systematischen Theologie angesiedelt ist, bin ich in meinen Vorlesungen historisch-chronologisch vorgegangen ist. Dahinter steht die Einsicht, dass die Botschaft des Sabbats immer wieder neu ins Spiel gebracht und entfaltet worden ist – und zwar bereits in biblischen Zeiten. Das Wissen um diese Geschichte ist ein nahezu unverzichtbares Handwerkszeug, um die Bedeutung des Sabbats in der Gegenwart zu erspüren.
Viele Literaturangaben stammen aus der Zeit, als ich mich erstmals auf die Vorlesung vorbereitet habe. Sofern ich später auf neuere Veröffentlichungen gestoßen bin, habe ich sie einbezogen. Das Literaturverzeichnis ist aber sicher unvollständig; vielleicht wird der eine oder andere bestimmte Monographien und Aufsätze vermissen. Ich vermute aber, dass die neueren Veröffentlichungen zwar im Detail zusätzliche Anregungen enthalten, aber die Grundlinien dieses Buches nicht in Frage stellen.
Das Kapitel zur Auslegungsgeschichte des Sabbats in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten habe ich erst vor kurzem überarbeitet und dabei die traditionellen Auffassungen nicht nur dargestellt, sondern auch kommentiert. Neueren Datums sind auch meine Ausführungen über die Bedeutung des Sabbats in der Spätmoderne. Hier versuche ich zunächst, die Epoche zu skizzieren – um dann der Frage nachzugehen, welche Bedeutung der Sabbat angesichts der Herausforderungen unserer Zeit hat. Erst durch dieses Kapitel ist das Buch vollständig und reif zur Veröffentlichung.
Entstanden ist ein „Handbuch“. Es enthält und kommentiert alle einschlägigen Texte, so dass es auch als Nachschlagewerk genutzt werden kann. Aber man kann es auch von Anfang bis Ende durcharbeiten, um so das Gespür dafür zu schärfen, wie die Botschaft des Sabbats immer wieder neu wirksam geworden ist und welche Bedeutung sie in unserer heutigen Zeit hat.
Erzhausen, Dezember 2024
Michael Mainka
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
1. Der Sabbat in alttestamentlicher Zeit
1.1 Die Begriffe
1.2 Vorbemerkung: Der Sabbat im Wandel der Zeit
1.3 Der Sabbat in den Propheten und Schriftenf
1.3.1 Im zweiten Buch der Könige
1.3.1.1 2. Könige 4,23
1.3.1.2 2. Könige 11,4-12
1.3.1.3 2. Könige 16,18
1.3.2 Im Buch Hosea: 2,13
1.3.3 Im Buch Amos: 8,4-7
1.3.4 Im ersten Teil des Buches Jesaja (Protojesaja): 1,10-17
1.3.5 Der Sabbat im Buch Jeremia und im Buch Klagelieder
1.3.5.1 Jeremia 17,19-27
1.3.5.2 Jeremia 32,6-7
1.3.5.3 Jeremia 34,8-22
1.3.5.4 Klagelieder 2,6
1.3.6 Der Sabbat im Buch Hesekiel
1.3.6.1 Hesekiel 20,1-26
1.3.6.2 Hesekiel 22,8
1.3.6.3 Hesekiel 22,26
1.3.6.4 Hesekiel 23,36-39
1.3.6.5 Hesekiel 44,24
1.3.6.6 Hesekiel 45,17
1.3.6.7 Hesekiel 46,1-4
1.3.7 Der Sabbat im dritten Teil des Buches Jesaja (Tritojesaja)
1.3.7.1 Jesaja 56,1-8
1.3.7.2 Jesaja 58,13-14
1.3.7.3 Jesaja 61,1-2
1.3.7.4 Jesaja 66,23
1.3.8 Der Sabbat im Buch Nehemia
1.3.8.1 Nehemia 5,1-13
1.3.8.2 Nehemia 9,1-17 (bes. 9,13-14)
1.3.8.3 Nehemia 10,32-34
1.3.8.4 Nehemia 13,15-22
1.3.9 Der Sabbat in den Chronikbüchern
1.3.9.1 1. Chronik 9,32
1.3.9.2 1. Chronik 23,30-31
1.3.9.3 2. Chronik 2,3
1.3.9.4 2. Chronik 8,12-13
1.3.9.5 2. Chronik 31,3
1.3.9.6 2. Chronik 36,20-21
1.3.10 Der Sabbat im Buch Daniel (Dan 9,24)
1.3.11 Zusammenfassende Übersicht (Tabelle)
1.4 Der Sabbat im Pentateuch
1.4.1 Der Sabbat im Privilegrecht: Exodus 34,21
1.4.2 Der Sabbat im Bundesbuch
1.4.2.1 Exodus 21,2-11
1.4.2.2 Exodus 23,10-12
1.4.3 Der Sabbat im Buch Deuteronomium
1.4.3.1 Deuteronomium 5,12-15
1.4.3.2 Deuteronomium 15,1-11
1.4.3.3 Deuteronomium 15,12-18
1.4.4 Der Sabbat im Heiligkeitsgesetz
1.4.4.1 Leviticus 19,3
1.4.4.2 Leviticus 19,30
1.4.4.3 Leviticus 23,2-4
1.4.4.4 Leviticus 24,8
1.4.4.5 Leviticus 25,1-7
1.4.4.6 Leviticus 25,8-34
1.4.4.7 Leviticus 25,39-55
1.4.4.8 Leviticus 26,2
1.4.4.9 Leviticus 26,32-35.43
1.4.5 Der Sabbat in der „Priesterschrift“
1.4.5.1 Genesis 2,1-4a
1.4.5.2 Exodus 16,1-36
1.4.5.3 Exodus 31,12-17
1.4.5.4 Exodus 35,2-3
1.4.5.5 Leviticus 27,16-25
1.4.5.6 Numeri 15,32-36
1.4.5.7 Numeri 28,9.10
1.4.5.8 Numeri 36,4
1.4.6 Der Sabbat im Dekalog des Buches Exodus (Ex 20,8-11)
1.4.7 Die Sabbatgesetze im Pentateuch und ihre Parallelen (Übersicht)
1.5 Der Sabbat im AT: Zusammenfassung
1.5.1 Die theologische Bedeutung des Sabbats
1.5.2 Die humanitäre und soziale Bedeutung des Sabbats
1.5.3 Die ökologische Bedeutung des Sabbats
1.5.4 Die kriteriologische Bedeutung des Sabbats
1.5.5 Die schicksalhafte Bedeutung des Sabbats
1.5.6 Die „geschichtsphilosophische“ Bedeutung des Sabbats
1.5.7 Die fundamentale Bedeutung des Sabbats
1.5.8 Die eschatologische Bedeutung des Sabbats
1.5.9 Die unterschiedlichen Akzente des Sabbats
2. Der Sabbat im Judentum
2.1 In der Zeit des Hellenismus
2.1.1 Der Sabbat im Jubiläenbuch
2.1.1.1 Jubiläenbuch 2,1.17-21.25-33
2.1.1.2 Jubiläenbuch 50,1-13
2.1.2 Der Sabbat im ersten Makkabäerbuch (2,29-41)
2.1.3 Der Sabbat im zweiten Makkabäerbuch
2.1.3.1 2 Makkabbäer 6,11
2.1.3.2 2 Makkabbäer 8,25b-29
2.1.3.3 2 Makkabbäer 15,1-5
2.1.4 Der Sabbat in den Qumran-Texten
2.1.4.1 Damaskusschrift VI,14-VII, 6
2.1.4.2 Damaskusschrift X,14-XI,18
2.1.4.3 Damaskusschrift XII, 3-6
2.1.4.4 11 Q 13 (Melchisedekfragment)
2.1.5 Der Sabbat im hellenistischen Judentum (Philo)
2.1.5.1 De decalogo [Über den Dekalog], 96-98
2.1.5.2 De vita Mosis [Über das Leben Moses], 2,12-13.20-22.43-44
2.2 Der Sabbat im rabbinischen Judentum
2.2.1 Die Bedeutung des Sabbats im rabbinischen Judentum
2.2.1.1 Midrasch Bereishit Rabbah XI, 8
2.2.1.2 Schab 118b (Gemara, Babylonischer Talmud)
2.2.1.3 Barakhoth 57b (Gemara, Babylonischer Talmud)
2.2.1.4 Sanhedrin 97a-b (Gemara, Babylonischer Talmud)
2.2.2 Die Sabbatgesetze des rabbinischen Judentums
2.2.2.1 Sabbath 7,2 (Mischna)
2.2.2.2 Sabbath 49b (Gemara, Babylonischer Talmud)
2.2.2.3 Sabbath 7,9 (Gemara, Jerusalemer Talmud)
2.2.2.4 Joma 3,6 (Mischna)
2.2.2.5 Joma 84b (Gemara, Babylonischer Talmud)
2.2.2.6 Joma 85a-b (Gemara Babylonischer Talmud)
2.2.2.7 Shebith X (Mischna)
2.2.3 Die Sabbatkultur des rabbinischen Judentums
2.3 Der Sabbat im modernen Judentum
2.3.1 Strömungen im modernen Judentum
2.3.2 Deutungen des Sabbats (Cohen, Baeck, Buber, Rosenzweig, Heschel)
2.4 Ergebnis
3. Jesus und der Sabbat nach den Evangelien
3.1 Der Sabbat im Markusevangelium
3.1.1 Markus 2,23-28
3.1.2 Markus 3,1-6
3.1.3 Die übrigen Texte
3.2 Der Sabbat im Matthäusevangelium
3.2.1 Matthäus 12,1-8
3.2.2 Matthäus 12,9-14
3.2.3 Matthäus 24,20
3.2.4 Die übrigen Texte
3.3 Der Sabbat im Lukasevangelium und der Apostelgeschichte
3.3.1 Lukas 4,16-21
3.3.2 Lukas 6,1-5
3.3.3 Lukas 6,6-11
3.3.4 Lukas 13,10-17
3.3.5 Lukas 14,1-6
3.3.6 Übrige Texte im Lukasevangelium und der Apostelgeschichte
3.3.7 Zusammenfassung
3.3.8 Exkurs: Das eschatologische Jobeljahr im Lukasevangelium
3.4 Der Sabbat im Johannesevangelium
3.4.1 Johannes 5,1-18
3.4.2 Johannes 9,1-41
3.4.3 Die übrigen Texte
3.5 Ergebnis
4. Der Sabbat im paulinischen Schrifttum und im Hebräerbrief
4.1 Kolosser 2,8-23 (bes. 2,16-17)
4.2 Galater 4,1-11 (bes. 4,10)
4.3 Römer 14,1-23 (bes. 14,5)
4.4 Hebräer 4,1-11 (bes. 4,9)
4.5 Ergebnis
5. Der Sonntag im Neuen Testament
5.1 1. Korinther 16,1-2
5.2 Apostelgeschichte 20,7
5.3 Offenbarung 1,9-10
6. Sabbat und Sonntag in der alten Kirche
6.1 Der historische Werdegang
6.1.1 Die Ablehnung der Sabbatfeier
6.1.1.1 Ignatius an die Magnesier 9,1.2
6.1.1.2 Barnabasbrief 15,3-9
6.1.1.3 Justin: Dialog mit dem Juden Tryphon 10,3; 12,3; 18,2
6.1.1.4 Tertullian, Gegen Marcion IV, 12, 7
6.1.1.5 Ergebnis
6.1.2 Das Aufkommen der Sonntagsfeier
6.1.2.1 Ignatius an die Magnesier 9,1.2
6.1.2.2 Didache 14,1
6.1.2.3 Barnabasbrief 15,3-9
6.1.2.4 Justin: Apologie 67,3-7
6.1.2.5 Der Sonntag im dritten Jahrhundert
6.1.3 Spuren der Sabbatfeier vom zweiten bis fünften Jahrhundert
6.1.3.1 Der Sabbat im Judenchristentum
6.1.3.2 Restelemente des Sabbats im (Heiden)Christentum
6.1.3.3 Sabbat-Gottesdienste im (Heiden)Christentum
6.1.4 Der Sonntag und die konstantinische Wende
6.1.4.1 Das konstantinische Sonntagsgesetz vom 3. März 321
6.1.4.2 Christliche Kommentare zum Sonntagsgesetz
6.1.4.3 Regeln zur Heiligung des Sonntags
6.1.4.4 Das Verschwinden des Sabbats
6.1.5 Zusammenfassung und Kritik
6.2 Die neue Deutung des Sabbats
6.2.1 Sabbat als Ruhe von den bösen Werken
6.2.1.1 Justin: Dialog mit dem Juden Tryphon 12,3
6.2.1.2 Ptolemäus, Brief an Flora 5,8.9.12
6.2.1.3 Tertullian, Gegen die Juden 4,2
6.2.1.4 Epiphanius, Arzneikasten der Häresien 30,6-7
6.2.1.5 Augustinus, Brief 55 an Januarius 22
6.2.1.6 Augustinus, Erklärung der Psalmen: Zu Psalm 91 (92), 2
6.2.2 Sabbat als die ewige Ruhe
6.2.2.1 Barnabasbrief 15,3-9
6.2.2.2 Hippolyt, Danielkommentar IV, 23,2-6
6.2.2.3 Tertullian, Gegen die Juden 4,2-3
6.2.2.4 Origenes, Numeri-Homilien, 23,4
6.2.2.5 Eusebius, Psalmen-Kommentar: Zu Psalm 91 (92)
6.2.2.6 Athanasius, Über Sabbat und Beschneidung, 1
6.2.3 Sabbat als jüdische Einrichtung
6.2.3.1 Tertullian, Gegen Marcion IV, 12, 7
6.2.3.2 Ignatius an die Magnesier, 8,1; 9,1.2 ; 10,3
6.2.3.3 Barnabasbrief (Barn) 4,6; 15,3-9
6.2.3.4 Justin: Dialog mit dem Juden Tryphon, 18,2
6.2.3.5 Didascalia 21
6.2.3.6 Viktorin von Pettau, Über die Weltschöpfung, 5
6.2.3.7 Die Bedeutung des Antijudaismus in der Sabbatfrage
6.2.4 Zusammenfassung und Kritik
6.3 Die Begründung der Sonntagsfeier
6.3.1 Der Tag der Auferstehung Jesu
6.3.1.1 Barnabasbrief 15,9
6.3.1.2 Justin: Apologie 67,7
6.3.2 Tag der Sonne bzw. des Lichts
6.3.2.1 Justin: Apologie 67,7
6.3.2.2 Eusebius, Leben Konstantins IV, 18
6.3.2.3 Hieronymus, Predigt zum Ostersonntag
6.3.2.4 Tertullian, An die Heiden 1
6.3.2.5 Sonnenkult als Hintergrund der Sonntagsfeier?
6.3.3 Der achte Tag
6.3.3.1 Beschneidung am achten Tag (Justin, Barnabasbrief)
6.3.3.2 Chiliasmus (Barnabasbrief, 15,3-5.8-9)
6.3.3.3 Gnostische Spekulationen (Irenäus, Clemens, Ambrosius)
6.3.4 Zusammenfassung
7. Der Sabbat im Mittelalter und bei Thomas von Aquin
8. Der Sabbat und die Reformation
8.1 Der junge Luther: Die geistliche Sabbatfeier
8.2 Andreas Karlstadt
8.2.1 Die geistliche und die leibliche Bedeutung des Sabbats
8.2.2 Sabbat feiern in der Beziehung zu Gott und den Nächsten
8.2.3 Recht auf Ruhe am Sabbat – Pflicht zur Arbeit in der Woche
8.2.4 Der leibliche Sabbat dient zur Erholung
8.2.5 Notwendige Arbeiten sind am Sabbat erlaubt
8.2.6 Das Wichtigste ist der geistliche Sabbat – der leibliche dient ihm
8.2.7 Was man am Sabbat (nicht) tun soll
8.2.8 Welcher Tag als Sabbat gefeiert wird, ist egal
8.2.9 Vergleich Luther - Karlstadt
8.3 Luthers Abgrenzung von Karlstadt bzw. vom Sabbat
8.3.1 Klare Trennung zwischen Evangelium und äußeren Dingen nötig
8.3.2 Das Gesetz zielt auf die Ungläubigen
8.3.3 Die Bedeutung des Sabbats: Arbeitsruhe und Gottesdienst
8.3.4 Kritik
8.4 Das Sabbatgebot im Kleinen und Großen Katechismus
8.5 Der Sabbat in der Polemik gegen die Reformation
8.6 Der Sabbat im Augsburger Bekenntnis
8.7 Die lutherische Sonntagsheiligung in der Reformationszeit
8.8 Der täuferische Sabbatismus
8.9 Der Siebenbürgische Sabbatismus
8.10 Der Sabbat bei Johannes Calvin
8.10.1 Die „dritte Anwendung des Gesetzes“ – auf das Leben des Christen
8.10.2 Die „Zeremonien“ – der Inhalt bleibt wichtig, ihr Vollzug ist „abgetan“
8.10.3 Der Sabbat als Bild geistlicher Ruhe – „äußerliche Übung … abgetan“
8.10.4 Der Tag des Gottesdienstes und der Ruhe ist kein „Abbild“ und gilt
8.10.5 Die Sabbatheiligung ist keine Gewissensfrage – und der Tag ist egal
8.10.6 Luther und Calvin
8.11 Der Sabbat bei Martin Bucer
8.11.1 Die Sabbatheiligung als Pflicht
8.11.2 Anweisungen zur Sabbatheiligung
8.12 Der puritanische Sonntag und Sabbat
8.12.1 Der (kirchen)politische Hintergrund
8.12.2 Der politische Kampf um die Sonntagsheiligung
8.12.3 Die theologische Begründung
8.12.4 Der Sonntag als der neue Sabbat
8.12.5 Die Siebenten-Tags-Baptisten
8.12.6 In Nordamerika: Die Geschichte geht weiter
8.13 Zusammenfassung
9. Der Sabbat bei den Siebenten-Tags-Adventisten
9.1 In der Frühgeschichte
9.1.1 Der Sabbat bei Joseph Bates
9.1.1.1 Die erste Broschüre: Eigene Akzente
9.1.1.2 Die zweite Broschüre: Entfaltung der eigenen Akzente
9.1.1.3 Die dritte Broschüre: Verteidigung und Abgrenzung
9.1.1.4 Die vierte Broschüre: Der Sabbat als Siegel Gottes
9.1.2 Der Sabbat bei Ellen White
9.1.2.1 Frühschriften: Der Sabbat ist jetzt entscheidend
9.1.2.2 Später: Der Sabbat ist noch nicht entscheidend
9.1.2.3 Die gesellschaftspolitische Bedeutung des Sabbats
9.1.3 Der Sabbat in der Erklärung von 1872
9.1.4 Die Geschichte des Sabbats – J.N. Andrews
9.1.5 Zusammenfassung und Kritik
9.1.5.1 Die Öffnung des Tempels im Himmel (Off 11,15-19)
9.1.5.2 Die Botschaft der drei Engel (Off 14,6-13)
9.1.5.3 Das „Malzeichen des Tieres“ (Off 13,11-18)
9.1.5.4 Das Siegel Gottes und die Versiegelung? (Off 7,1-8; 14,1-5)
9.1.5.5 Ergebnis
9.2 Kontinuität und Wandel
9.2.1 Der Sabbat in den „Fundamental Beliefs“
9.2.2 Der Sabbat in kirchlichen Publikationen
9.2.2.1 Questions on Doctrine
9.2.2.2 Seventh-day Adventist Encyclopedia
9.2.2.3 The Sabbath in Scripture and History
9.2.2.4 Was Adventisten glauben
9.2.2.5 Handbook of Seventh-day Adventist Theology
9.2.2.6 Hoffnung, die uns trägt
9.2.3 Der Sabbat im Dialog mit anderen christlichen Kirchen
9.2.3.1 Lutherans and Adventists in Conversation
9.2.3.2 Adventisten und der Reformierte Weltbund
9.2.4 (Vor)Boten des Wandels?
9.2.4.1 Richard Rice
9.2.4.2 Steve Daily
9.2.4.3 Johannes Mager
9.2.4.4 Steve K. Tonstad
9.2.5 Zusammenfassung und Kritik
10. Der Sabbat (und Sonntag) im 20. Jahrhundert
10.1 Karl Barth und der Sabbat
10.2 Der Sabbat im „Katechismus der Katholischen Kirche“
11. Der Sabbat in der Spätmoderne
11.1 Die Spätmoderne
11.1.1 Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten
11.1.2 Hartmut Rosa: Eine Frage der Geschwindigkeit
11.1.3 Nancy Fraser: Die kapitalistische Gesellschaft
11.2 Die „freie Marktwirtschaft“ des Neoliberalismus
11.2.1 Der Neoliberalismus – freier und verschärfter Wettbewerb
11.2.2 Das Problem: Gewinner und Verlierer
11.2.3 Der Sabbat: Begrenzung des freien Marktes
11.2.4 Sabbatliche Lösungsansätze
11.3 Wachstum
11.3.1 Warum eigentlich?
11.3.2 Wachstumskritik
11.3.3 Der Sabbat: Eine Ökonomie des Genug
11.3.4 Sabbatliche Alternativen: Postwachstum
11.4 Globalisierung
11.4.1 Imperiale Lebensweise und Externalisierung
11.4.2 Win-lose bzw. lose-lose
11.4.3 Der Sabbat: Schuldenerlass und Strukturen zur Begrenzung der Ungleichheit
11.4.4 Sabbatliche Alternativen: Schuldenerlass und neue Weltwirtschaftsordnung
11.5 Ökologie
11.5.1 Die Potenzierung ökologischer Probleme
11.5.2 Die Ursachen: Das „Anthropozän“ und das ökonomische Denken
11.5.3 Der Sabbat als „Krone der Schöpfung“ und das Recht der Schöpfung
11.5.4 Sabbatliche Alternativen
11.6 Das Tempo der Spätmoderne
11.6.1 Beschleunigung
11.6.2 Die Folgen der Beschleunigung
11.6.3 Der Sabbat: Aufhören
11.6.4 Konzepte zur Entschleunigung: Resonanz und andere Zeitordnungen
11.7 Arbeitszeit und freie Zeit in der Spätmoderne
11.7.1 Arbeitszeit und freie Zeit
11.7.2 „Konstruktionsfehler“ des Acht-Stunden-Tags
11.7.3 Der Sabbat: Der Vorrang der freien Zeit
11.7.4 Sabbatliche Konzepte zu Arbeitszeit und freier Zeit
11.8 Die Arbeitswelt der Spätmoderne
11.8.1 Arbeit ohne Grenzen – die Subjektivierung des Arbeitslebens
11.8.2 Die Überforderung des Subjekts
11.8.3 Der Sabbat: Das Leben ist mehr als Arbeit
11.8.4 Sabbatliche Alternativen zur spätmodernen „Arbeitsmoral“
11.9 Die Lebensstil in der Spätmoderne
11.9.1 Erfolgreiche Selbstverwirklichung
11.9.2 Enttäuschungen auf dem Weg zu erfolgreicher Selbstverwirklichung
11.9.3 Impulse des Sabbats
11.9.4 Sabbatlicher Lebensstil
11.10 Die Kirche in der spätmodernen Gesellschaft
11.10.1 „Kirche der Singularitäten“?
11.10.2 Warnungen vor einer „Kirche der Singularitäten“
11.10.3 Die Bedeutung des Sabbats für das Leben der Kirche
11.10.4 Sabbatliche Impulse der Kirche für die Gesellschaft
11.11 Spiritualität in der Spätmoderne
11.11.1 Spiritualität in der Gesellschaft der Singularitäten
11.11.2 Theologische Kritik der Spiritualität in der Gesellschaft der Singularitäten
11.11.3 Spirituelle Impulse des Sabbats: Loslassen, Ruhen, Hören …
11.11.4 Rituale – eine sabbatliche Form der Spiritualität
11.12 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Aufsätze und Monographien
Internet
Artikel
Quellentexte
Ein anderer Tag und ein anderes Leben
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Der Sabbat in alttestamentlicher Zeit
Literaturverzeichnis
Ein anderer Tag und ein anderes Leben
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
Abkürzungsverzeichnis
ABC
Seventh-Day Adventist Bible Commentary
ANET
Ancient Near Eastern Texts
ATD
Altes Testament Deutsch
BZNW
Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
EB
Elberfelder Bibel (Bibelübersetzung)
EKK
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament
EvTh
Evangelische Theologie (Zeitschrift)
FAT
Forschungen zum Alten Testament
FRALANT
Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments«
HAT
Handbuch Altes Testament
HNT
Handbuch Neues Testament
JSNT
Journal for the Study of the New Testament
KD
Kirchliche Dogmatik (Karl Barth)
KEK
Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament
LB
Luther-Bibel (Bibelübersetzung), hier: Revidierte Ausgabe 2017
LD
Luther Deutsch (Die Werke Luthers in Auswahl, hg. v. Kurt Aland)
LXX
Septuaginta
LXX-D
Septuaginta Deutsch
ÖR
Ökumenische Rundschau
ÖTK
Ökumenischer Taschenbuch-Kommentar zum Neuen Testament
Schl2000
Schlatter 2000 (Bibelübersetzung)
StrBill
Strack, Hermann/Billerbeck, Paul: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 5 Bde, München 1924ff.
ThHKNT
Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament
ThHWAT
Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament
ThWAT
Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament
ThWNT
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament
TRE
Theologische Realenzyklopädie
TUAT
Texte aus der Umwelt des Alten Testaments
VT
Vetus Testamentum
WA
Weimarer Ausgabe (Kritische Gesamtausgabe der Schriften Martin Luthers)
WMANT
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
WUNT
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
WuD
Wort und Dienst
ZNW
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
1 Der Sabbat in alttestamentlicher Zeit
1.1 Die Begriffe
Wenn vom „Sabbat“ die Rede ist, denken die meisten Menschen an einen bestimmten Wochentag des jüdischen Kalenders. Aber nur wenige wissen, was der Name dieses Wochentags bedeutet. Was also bedeutet der Begriff „Sabbat“?
• Das hebräische Wort „šabbāt“1 leitet sich vom Verb „šabāt“ ab.
o Es wird nicht nur im Zusammenhang mit dem Sabbattag benutzt. Im allgemeinen Sinn bedeutet es einfach so viel wie „aufhören“ oder „zu Ende kommen“.2
o Auch dort, wo es sich auf den Sabbattag bezieht, kann es auf diese Weise übersetzt werden.3
o An anderen Stellen zeigt sich eine spezielle Bedeutung. So erscheint es in Ex 23,12; 31,17; Lev 26,34f.; 2 Chr 36,21 im Sinne von „ausruhen“ oder „Atem schöpfen“.4
o Außerdem kann das Verb auch direkt das Feiern des Sabbats bezeichnen (Lev 23,32b; 25,2).
• Das Substantiv „šabbāt“ hat folgende Bedeutungen:
o Als Ableitung vom Verb „šabāt“ („aufhören“, „zu Ende kommen“) bedeutet es so viel wie „Ruhetag“.
o Da es auch im Zusammenhang mit anderen religiösen Festen gebraucht wird, kann es auch mit „Feiertag“ übersetzt werden.1
o Außerdem stoßen wir im AT auf die Superlativbildung „šabbāt šabbātôn“, die mit „unbedingter Feiertag“, „hoher Feiertag“ oder „Zeit zum Feiern“ wiedergegeben werden kann. Sie bezeichnet einerseits herausragende Feste (Lev 16,31; 23,32), andererseits aber auch den wöchentlichen Sabbat (Ex 31,15; 35,2; Lev 23,3).
In einigen Sabbattexten taucht der Begriff „šabbāt“ überraschenderweise gar nicht auf. Stattdessen ist dort lediglich vom „siebten Tag“ die Rede (Ex 23,12; 34,21).
Nicht wenige Bibelwissenschaftler sind der Meinung, beim Sabbat habe es sich zunächst nicht um einen wöchtentlichen Ruhetag, sondern um den monatlichen Vollmondtag gehandelt.2 Neben diesem monatlichen Sabbat sei damals auch der „siebte Tag“ von Bedeutung gewesen, der jedoch nicht als „Sabbat“ bezeichnet worden sei. Erst später seien dann der „Sabbat“ und der „siebte Tag“ verschmolzen.
Zur Begründung weisen sie u.a. darauf hin, dass der Sabbat in einer Reihe von Texten zusammen mit dem Neumondtag genannt wird (2 Kön 4,23; Jes 1,13; 66,23; Hes 45,17; 46,1; Hos 2,13; Am 8,5; 1 Chr 23,31; 2 Chr 2,3; 8,13; 31,3; Neh 10,34)3 und schließen daraus, dass der Sabbat anfangs der Vollmondtag war. Nachdem die Juden im babylonischen Exil dem babylonischen šab/pattu, dem babylonischen Vollmondtag, begegnet seien, hätten sie sich vom šab/pattu abgrenzen wollen und daher unter dem Einfluss Hesekiels den Sabbat nicht länger als monatlichen Vollmondtag begangen, sondern mit dem siebten Tag verschmolzen (Ex 20,10: „… aber der siebte Tag ist Sabbat …“; vgl. Ex 31,15; 35,2; Dtn 5,14). Für einen solchen Prozess gibt es allerdings keinerlei direkte Belege.
1.2 Vorbemerkung: Der Sabbat im Wandel der Zeit
In einem sehr persönlichen Lied hat der Liedermacher Wolf Biermann erklärt: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ Gemeint ist: Den eigenen Überzeugungen bleibt man nicht dadurch treu, dass man sich gegen Veränderungen sperrt, sondern nur, wenn man sich immer wieder fragt, welche Bedeutung sie angesichts neuer Herausforderungen haben – und dann etwas ändert. Wenn die Einen eher für Veränderungen und die Anderen eher für die Bewahrung des Status Quo sind, übersehen beide, dass manche Dinge nur durch Veränderungen bewahrt werden können – so paradox das klingt.
Auch der Sabbat wurde durch Veränderungen bewahrt. Wenn wir uns die biblischen Texte genau anschauen, werden wir erkennen, dass hier bereits in alttestamentlicher Zeit vieles in Bewegung war – mit dem Ziel, das Anliegen des Sabbats für die jeweilige Situation auf den Punkt zu bringen. Bevor wir uns den einschlägigen Texten des AT zuwenden, möchte ich dies an zwei Beispielen deutlich machen.
Das erste Beispiel ist der Wortlaut des vierten Gebotes, des Sabbatgebots. Die „Zehn Gebote“ (genauer: „zehn Worte“, Ex 34,28; Dtn 4,13; 10,4) werden in Ex 20,2-17 und in Dtn 5,6-21 aufgezählt. Überraschenderweise weichen beide Fassungen voneinander ab – auch beim Sabbatgebot:
Ex 20,8-11
Dtn 5,12-15
Denke an
Beachte
den Sabbattag, um ihn heilig zu halten,
den Sabbattag, um ihn heilig zu halten,
so wie der HERR, dein Gott, es dir geboten hat.
Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und
Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist ein Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und
dein Rind und dein Esel und all
dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt.
dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt,
damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du.
Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
Und denke daran, dass du Sklave warst im Lande Ägypten und dass der HERR, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat! Darum hat der HERR, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern.
Selbstverständlich gibt es Versuche, diese Unterschiede zu erklären (vgl. 1.4.3.1 und 1.4.6). Zu Beginn unseres Weges durch die Geschichte des Sabbats in alttestamentlicher Zeit ist nur wichtig, dass wir sie überhaupt wahrnehmen.
Das zweite Beispiel ist etwas komplizierter und betrifft den Bericht des Buches Exodus über die Offenbarung des Gesetzes am Berg Sinai (Ex 19-34).
Dabei geht es zunächst um die Ereignisse bis zur Offenbarung der Zehn Gebote:
• Der Bericht in Ex 19 beginnt damit, dass sich das Volk Israel „dem Berg gegenüber“ lagert (19,2) und Mose „hinauf zu Gott steigt“ (19,3). Oben auf dem Berg gibt Gott ihm den Auftrag, das Volk über sein „Vertragsangebot“ zu informieren: Wenn es auf ihn hört und den Bund einhält, wird Israel sein ganz besonderes „Eigentum“ sein (19,4-6).
• Vom Berg zurückgekehrt ruft Mose die „Ältesten des Volkes“ zusammen und überbringt ihnen diese gute Nachricht. Daraufhin erklärt „das ganze Volk gemeinsam …: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun“. Nach dieser Zusage steigt Mose wieder auf den Berg, um Gott die Antwort des Volkes zu überbringen (19,7-8).
• Dann kündigt Gott seinem Diener Mose an, „im Dunkel des Gewölks“ zu ihm zu kommen (weil eine „ungeschützte“ Begegnung mit Gott tödlich wäre). Wenn er ihm so begegnet, kann das Volk das Gespräch mithören, dass er mit ihm führen will (19,9). Und er erklärt ihm, wie das Volk sich auf die Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai „am dritten Tag“ vorbereiten und welche „Sicherheitsvorkehrungen“ es einhalten soll (19,10-13). Also steigt Mose wieder „vom Berg zum Volk hinab“ und bereitet das Volk auf die Gottesoffenbarung vor (19,14-15).
• Am „dritten Tag“ brechen „Donner und Blitze“ los und eine „schwere Wolke“ setzt sich auf den Berg. Zugleich ertönt „ein sehr starker Hörnerschall“. Das ganze Volk bebt vor (heiligem) Erschrecken. Mose führt das Volk „aus dem Lager hinaus, Gott entgegen“. Voller Erwartung steht es „am Fuße des Berges“ (19,16-17).
• Dann kommt Gott „im Feuer“ auf den Berg Sinai herab. Der ganze Berg wird in Rauch gehüllt und erbebt; der Schall der Hörner wird „immer stärker“. Mose redet mit Gott und der antwortet ihm „mit einer lauten Stimme“. Er ruft Mose „auf den Gipfel des Berges“ und Mose steigt erneut hinauf (19,18-20).
• Oben angekommen, beauftragt Gott ihn, das Volk zu warnen und zum Einhalten des „Sicherheitsabstands“ aufzurufen. Mose erklärt ihm, dass die verlangten Maßnahmen, wie befohlen, eingerichtet wurden und das Volk nicht auf den Berg gelangen kann (19,21-23).
• Daraufhin befiehlt Gott ihm: „Geh, steig hinab, und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir! Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum HERRN hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht.“ (19,24). Mose gehorcht dem Befehl und steigt „zum Volk hinab“, um ihm alles auszurichten (19,25).
• Und genau an dieser Stelle stoßen wir auf eine Ungereimtheit: Obwohl Mose sich nach Ex 19,25 beim Volk befindet und zu erwarten ist, dass er demnächst – wie in V. 24 befohlen – zusammen mit Aaron „wieder herauf“ kommen soll, folgt hier – nach einem kurzen Einleitungssatz (20,1) – der Text der Zehn Gebote (20,2-17). So entsteht der Eindruck, dass die Zehn Gebote an der falschen Stelle stehen!
Überraschend ist auch die Fortsetzung direkt im Anschluss an die Zehn Gebote.
• In Ex 20,18-21 wird berichtet, dass das Volk sich angesichts der „Phänomene“ auf dem Berg fürchtet, „von Ferne“ stehen bleibt und Mose bittet dafür zu sorgen, dass Gott nicht mit ihnen redet, damit sie „nicht sterben“. So geschieht es dann auch. Diese Aussagen sind unverständlich, wenn Gott unmittelbar vorher bereits geredet hat! Innerhalb der Rahmenerzählung des Buches Exodus wirken die Zehn Gebote von Ex 20,2-17 daher wie ein Fremdkörper!
• Dann folgen „Rechtsbestimmungen“ (Ex 21,1-23,33), die ebenfalls ein Sabbatgebot enthalten (23,12). Einleitend heißt es dazu: „Und dies sinddie Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst:“ Diese Bemerkung passt zu Ex 20,18-21! Denn dort war davon die Rede, dass das Volk von Ferne stehen bleibt und nur Mose sich Gott naht – damit Gott mit ihm redet und Mose die Rede Gottes dann dem Volk übermittelt. Bezieht sich Ex 20,18-21 also nicht auf die Zehn Gebote, sondern auf die „Rechtsbestimmungen“?
Ungereimtheiten gibt es auch im Zusammenhang mit den Gesetzestafeln:
• Nach den „Rechtsbestimmungen“ folgt der Hinweis, dass Mose sie dem Volk mitteilt, sie niederschreibt, das Volk auf die „Rechtsbestimmungen“, das „Buch des Bundes“, verpflichtet und den Bundesschluss vollzieht (24,1-8). Auch hier entsteht der Eindruck, dass der Bericht des Buches Exodus über die Sinai-Offenbarung ursprünglich auf die Offenbarung der „Rechtsbestimmungen“ von Ex 21,1-23,33 zulief.
• Obwohl Bundesschluss und Übergabe des Gesetzes nach Ex 24,1-11 eigentlich abgeschlossen sind, folgt nun ein Bericht über den Empfang der Gesetzestafeln (24,12-18; 31,18). Zwischen dem Bericht von der Aufforderung zur Entgegennahme der von Gott beschriebenen Tafeln und deren Übergabe an Mose stehen die Gesetze über die Stiftshütte (25,1-31,11) und ein weiteres Gesetz über den Sabbat (31,12-17). Während Mose sich auf dem Berg befindet, um die Gesetzestafeln aus Gottes Hand in Empfang zu nehmen, fällt das Volk vom Glauben ab. Die Israeliten bitten Aaron, ihnen einen Gott zu machen. Der tut, was verlangt wird – und das Volk feiert ein Fest (32,1-6). Als Mose das bei seiner Rückkehr bemerkt, zerschmettert er die Gesetzestafeln, die er kurz zuvor erhalten hat (32,19). Nachdem das Volk Buße getan hat, wird Mose beauftragt, zwei neue Tafeln vorzubereiten, damit Gott auf ihnen „die Worte schreiben“ kann, „die auf den ersten Tafeln standen“ (34,1). Es kommt zum (erneuten) Bundesschluss (34,10). In diesem Zusammenhang werden auch die Gebote aufgezählt, die auf den Tafeln stehen. Es handelt sich dabei aber weder um die „Zehn Gebote“ noch um die „Rechtsbestimmungen“, sondern um eine weitere Gesetzessammlung (34,11-26). Auch dort findet sich ein Sabbatgebot (34,12). Mose soll diese Worte festhalten und bleibt 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai, um die „Worte des Bundes, die zehn Worte“ auf die Tafeln zu schreiben (Ex 34,27-29).
• Welche Gebote standen also auf den Tafeln? Die in Ex 20,2-17 genannten Zehn Gebote? Die „Rechtsbestimmungen“ des Bundesbuches? Oder die Gebote aus Ex 34,11-26?
All diese Beobachtungen sind nicht nur überraschend, sondern auch verwirrend. Aber es lohnt sich, sie ernst zu nehmen und nicht als unwichtig beiseite zu schieben. Kleinigkeiten können entscheidende Gedankenanstöße geben – auch wenn sie uns zunächst ins Stolpern bringen.
Beim Schnelldurchgang durch die Kapitel 19-34 des Buches Exodus haben wir entdeckt, dass sich allein in diesem Abschnitt verschiedene Gesetzessammlungen finden, die nach Auffassung des Verfassers mit dem Bericht von der Offenbarung am Sinai verbunden sind, aber jeweils eine andere Version des Sabbatgebotes beinhalten. Die verschiedenen Sabbatgebote haben vieles gemeinsam und widersprechen einander nicht, setzen aber unterschiedliche Akzente. Das zeigt: Der Sabbat ist kein „statisches Produkt“, sondern wurde bereits in alttestamentlichen Zeiten immer wieder aktualisiert. Diese Erkenntnis ist keine Kleinigkeit, sondern äußerst hilfreich.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die Geschichte des Sabbats und seiner Aktualisierungen in alttestamentlicher Zeit nachzuzeichnen. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass religiöse Praktiken in der Regel älter sind als die Texte, in denen sie beschrieben werden. Daher liegen ihre historischen Ursprünge teilweise im Dunkeln.1 Außerdem geht es in dieser Arbeit in erster Linie nicht um eine genaue historische Rekonstruktion, sondern darum, die Bedeutungsbreite des Sabbats zu entdecken – damit wir uns angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen davon inspirieren lassen können.
Bevor wir uns dazu der Tora, den fünf Büchern Mose, zuwenden (1.4), lohnt sich ein Blick auf die anderen Sabbat-Texte des AT (1.3). Ein Grund für diese Vorgehensweise ist, dass diese Texte oftmals leichter zu datieren sind, als die Gesetzestexte der Tora. Außerdem ist die Kenntnis der übrigen Texte eine gute Grundlage für die Beschäftigung mit den Texten der Tora – vor allem dann, wenn offensichtliche Parallelen festzustellen sind.
1.3 Der Sabbat in den Propheten und Schriften1
1.3.1 Im zweiten Buch der Könige
1.3.1.1 2. Könige 4,23
Er sagte: Warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte: Friede mit dir!
Zu den Unterstützern des Propheten Elisa, der ab Mitte des neunten Jahrhunderts v. Chr. im Nordreich Israel wirkt, gehört auch eine wohlhabende, aber kinderlose Frau in Schunem (V 8-10).2 Elisa verheißt ihr einen Sohn – und tatsächlich geht die Verheißung in Erfüllung (V 14-17). Das Kind wächst heran; alles scheint gut.
Eines Tages aber klagt es über starke Kopfschmerzen. Nur wenige Stunden später verstirbt es in den Armen seiner Mutter. Sie legt ihren Sohn auf das Bett, in dem Elisa schläft, wenn er auf der Durchreise bei ihnen übernachtet, und bittet ihren Mann, ihr einen der Knechte und eine Eselin zu überlassen, damit sie sich so schnell wie möglich zu Elisa begeben kann. Ihr Mann aber entgegnet ihr: „Warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat“.
Diese Bemerkung zeigt, dass es nur am Neumondtag3 und am Sabbat üblich war, sich zum Heiligtum oder zu einem Gottesmann zu begeben – und an anderen Tagen nicht. Der Sabbat erscheint hier als „eine Zeit der besonderen Nähe der Gottheit“.4
1.3.1.2 2. Könige 11,4-12
4 Und im siebten Jahr sandte Jojada hin und ließ die Obersten über Hundert von den Karern und den Leibwächtern holen und zu sich ins Haus des HERRN kommen. Und er schloss einen Bund mit ihnen und ließ sie im Haus des HERRN schwören und zeigte ihnen den Sohn des Königs. 5 Und er befahl ihnen: Das ist es, was ihr tun sollt: Ein Drittel von euch, die ihr am Sabbat antretet, soll Wache halten im Haus des Königs, 6 und ein Drittel soll am Tor Sur Wache halten und ein Drittel am Tor hinter den Leibwächtern sein. Und ihr sollt abwechselnd Wache beim Haus halten. 7 Die zwei Abteilungen von euch aber, alle, die am Sabbat abtreten, die sollen im Haus des HERRN Wache halten beim König. 8 Und ihr sollt den König von allen Seiten umgeben, jeder mit seinen Waffen in seiner Hand; und wer in die Reihen eindringen will, soll getötet werden; und ihr sollt bei dem König sein, wenn er herauskommt und wenn er hineingeht. 9 Und die Obersten über Hundert taten nach allem, was der Priester Jojada befohlen hatte. Sie nahmen jeder seine Männer, die am Sabbat antraten, zusammen mit denen, die am Sabbat abtraten, und kamen zum Priester Jojada.
10 Und der Priester gab den Obersten über Hundert die Speere und die Schilde, die dem König David gehört hatten und die im Haus des HERRN waren. 11 Und die Leibwächter stellten sich auf, jeder mit seinen Waffen in seiner Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite des Hauses, zum Altar und zum Haus hin, rings um den König herum. 12 Und er führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone auf und gab ihm die Ordnung, und sie machten ihn zum König und salbten ihn. Und sie klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König!
In 2 Kön 11,1-20 wird der Sturz der ungläubigen Königin Atalja berichtet (um 835 v. Chr.). Er findet an einem Sabbat statt. Warum? Weil an diesem Tag routinemäßig der Wachwechsel erfolgt und daher eine größere Menge von Soldaten bereitsteht, deren Anführer auf den legitimen König vereidigt sind, der Atalja ersetzen soll.1
Im Hinblick auf den Sabbat können wir diesem Abschnitt nur entnehmen, „dass er zur Kennzeichnung der Woche als Zeiteinheit dient; als Gedächtnisfeiertag wird er nicht weiter beschrieben“.1
1.3.1.3 2. Könige 16,18
Und die überdachte Sabbathalle, die man am Haus gebaut hatte, und den äußeren Eingang des Königs veränderte er am Haus des HERRN wegen des Königs von Assur.
Der Bericht über König Ahas (2 Kön 16,1-20) schildert, wie der König sich nach dem syrisch-ephraimitischen Krieg auch in religiöser Hinsicht den übermächtigen Assyrern unterwarf (732 v. Chr.). In diesem Zusammenhang wird u.a. von der Veränderung der „überdachten Sabbathalle, die man am Haus gebaut hatte“ berichtet.
Da dabei auch vom „äußeren Eingang des Königs“ die Rede ist und Hesekiel für den König einen besonderen Platz für die Teilnahme am Kult vorsieht (Hes 46,2), könnte es sich „um eine überdachte Halle oder um ein Schutzdach gehandelt haben, unter dem der König am Sabbat im Tempel der liturgischen Feier beizuwohnen pflegte“2.
Vielleicht wurde sie abgebaut, weil sie aus kostbaren Metallen bestand, die Ahas dringend für seine Tributleistungen an Assur benötigte.3
Aus den Texten des zweiten Buchs der Könige sind nur wenige Einsichten bezüglich des Sabbats zu gewinnen. Jedoch wird deutlich, „dass der Sabbat als ein Feiertag in der frühen Königszeit bekannt war und dass man diesen Tag im Heiligtum unter Teilnahme des Königs in einer liturgischen Versammlung beging“.4
1.3.2 Im Buch Hosea: 2,13
Und ich mache ein Ende mit all ihrer Freude, ihren Festen, ihren Neumonden und ihren Sabbaten und allen ihren Festzeiten.
Das prophetische Wirken Hoseas beginnt in der Endphase der Regierungszeit von Jerobeam II. (787-747), die von machtpolitischen Erfolgen und wirtschaftlichem Aufschwung geprägt ist. Grundlage der Verkündigung Hoseas ist die Einsicht, dass Gott eine persönliche und exklusive Beziehung zu seinem Volk möchte (2,21). Daher wendet er sich gegen die Machtpolitik des Königtums und den religiösen Synkretismus (Baals-Kult). In diesem Zusammenhang kommt er auch auf die damalige Sabbatfeier zu sprechen.
Hos 2,13 ist Teil einer Strafankündigung. Das Volk hat nicht erkannt, dass Jahwe es war, der es mit Korn, Wein und Öl gesegnet hat. Stattdessen hat es seine Opfergaben Baal dargebracht (2,10). Deshalb wird Gott die Ernteerträge zurücknehmen (2,11). Dazu gehört auch der Flachs, der zur Herstellung der Kleidung benötigt wird, so dass das Volk nackt dasteht (2,11b.12).1
Der von Gott verhängte Ernteausfall hat aber auch Auswirkungen auf das kultische Leben, das eng mit Ernte bzw. Fruchtbarkeit verbunden war (vor allem im Baals-Kult). Es fehlt an Opfergaben, so dass die kultischen Feiern nicht mehr durchgeführt werden können. Dabei werden folgende Begriffe genannt:
• „Freude“: Es handelt sich um den Oberbegriff, der den Charakter der anschließend genannten Feiertage beschreibt und ausgelassene Sinnesfreude meint (Jes 24,8.11; 32,13; 62,5; Klg 5,15).
• „Feste“: Vermutlich sind hier die jährlichen Feste gemeint – die Wallfahrtsfeste aus Ex 23,14 oder die Erntefeste aus Ex 23,16 (vgl. Hos 9,5).
• „Neumonde“: Es handelt sich um das monatliche Neumondfest (vgl. Num 28,11-15).
• „Sabbate“: Handelt es sich hier um den siebten Tag der Woche? Dann würden die drei Begriffe „Feste“, „Neumonde“ und „Sabbate“ in absteigender Linie (jährlich – monatlich – wöchtllich) genannt. Oder stehen die „Sabbate“ parallel zu den Neumonden und meinen den Vollmondtag?
• „Festzeiten“: Es handelt sich um einen allgemeinen Begriff für eine Versammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder an einem bestimmten Ort).1
Was wird nun zu all diesen Festen gesagt? Jahwe macht ihnen „ein Ende“. Daraus ergibt sich ein Wortspiel, das so wiedergegeben werden kann: „Jahwe wird mit allen diesen Feiertagen Feierabend machen …“2
Warum will Gott mit ihrem Sabbat „ein Ende“ machen? Bevor Feste, Neumonde und Sabbate genannt werden, taucht als Oberbegriff der Ausdruck „Freude“ auf (s.o.). Gemeint ist hier die „ekstatische Freude, wie sie auch im kanaanäischen Kult belegt ist“3. „Wie aus den biblischen Beschreibungen zu den Höhenkultfesten hervorgeht, waren diese Kultfeiern in Wahrheit ausgelassene ‚Kirmesfeiern’, die auf die Befriedigung eigener Sinnesfreuden abzielten. Vom Tanz und frisch gegorenen Most berauscht, hatten die Kultteilnehmer Jahwe schnell vergessen. Um diese ‚Kultorgien’ zu beenden, wird Jahwe vorrübergehend jede Kultfreude untersagen.“4
Welchen Charakter hatte also der Sabbat zur Zeit des Propheten Hosea? Er ist ein religiöses Fest, das ausgelassen gefeiert wird und an dem vermutlich auch Opfer dargebracht werden. Das ist jedoch nicht im Sinne Gottes, der diese Feiern als „Festtage der Baalim“ betrachtet (Hos 2,15). „Hos 2,13 könnte ein Beleg dafür sein, dass der Sabbat zur Zeit Hoseas nicht im ursprünglichen Sinne begangen, sondern als ‚Baalstag’ gefeiert wurde.“5 Welchen positiven Sinn der Sabbat demgegenüber eigentlich hat, wird an dieser Stelle jedoch nicht gesagt.
1.3.3 Im Buch Amos: 8,4-7
4 Hört dies, die ihr den Armen tretet und darauf aus seid, die Elenden im Land zu vernichten, 5 und sagt: Wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn anbieten; um das Efa zu verkleinern und den Schekel zu vergrößern und die Waage zum Betrug zu fälschen, 6 um die Geringen für Geld und den Armen wegen eines Paares Schuhe zu kaufen, und damit wir den Abfall des Korns verkaufen? 7 Geschworen hat der HERR beim Stolz Jakobs: Wenn ich alle ihre Taten jemals vergessen werde!
Der Prophet Amos wirkt um 750 v.Chr. im Nordreich Israel, das damals unter Jerobeam II. eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte erlebt, die jedoch doch nicht allen zugutekommt, sondern mit der Ausbeutung der Armen verbunden ist.
In Am 8,4-14 kündigt der Prophet zum wiederholten Male Gottes Gericht über die Reichen an. Die ersten Verse (8,4-6) führen noch einmal ihre abgrundtiefe Bosheit vor Augen. Dazu gibt Amos ihre eigenen Worte wieder (vgl. 2,12; 4,1; 6,13; 8,14; 9,10), in denen sich ihre Gleichgültigkeit gegenüber religiösen Feiertagen offenbart.
Danach betrachten sie Neumond1 und Sabbat vor allem als Zeiten des Gewinnausfalls. Die religiösen Feiertage hindern sie daran, ihren „krummen Geschäften“ nachzugehen. Dazu gehört die Verwendung gefälschter Maßbecher für das Getreide, falscher Gewichte für das Abwiegen des Geldes (vgl. Jer 32,10) und manipulierter Waagen. Alle drei Praktiken waren im damaligen Wirtschaftsleben weit verbreitet (Hos 12,8; Mi 6,10.11). Darüber hinaus versuchen sie, ihren Käufern minderwertige Ware unterzuschieben. Schließlich behandeln sie diejenigen, die bei ihnen in Schuldsklaverei geraten waren, als Handelsware, die unter Umständen sogar zu Billigpreisen („wegen eines Paares Schuhe“) verkauft werden konnte (vgl. Ex 21,16; Dtn 24,7).
Der Prophet bringt den Sabbat positiv gegen die ausbeuterischen Händler ins Spiel. Er kritisiert die Einstellung, in der sie diesen Tag begehen. In ihren Augen ist er nicht mehr als eine lästige Pflicht, die sie von ihrem skrupellosen Gewinnstreben abhält. Damit wird indirekt deutlich, dass der Sabbat als Ruhetag ein Bollwerk gegen die grenzenlose Ausbeutung des Menschen ist und soziale Implikationen hat.
1.3.4 Im ersten Teil des Buches Jesaja (Protojesaja): 1,10-17
10 Hört das Wort des HERRN, ihr Anführer von Sodom! Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra! 11 Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen?, spricht der HERR. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt, und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. 12 Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen – wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? 13 Bringt nicht länger nichtige Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen: Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. 14 Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. 15 Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht – eure Hände sind voll Blut. 16 Wascht euch, reinigt euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun! 17 Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!
Jesaja wirkt zwischen 740 und 700 v. Chr. in Jerusalem. Der Abschnitt Jes 1,10-17 ist wohl die Zusammenfassung einer Predigt aus der Frühzeit seines Wirkens.1
Der Prophet gibt eine Unterweisung über falschen und wahren Gottesdienst. Im Auftrag Gottes erklärt er dem Volk, dass Gott am Opferdienst keinen Gefallen hat (1,11) und ihre Versammlungen im Tempel nur dazu führen, dass sein Vorhof zertreten wird (1,12).
Auch in 13a werden zunächst die Opfer angesprochen: „Bringt nicht länger nichtige Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel.“ Rauchopfer waren Teil des Tempelkultes (Ex 30,35; 39,1.27; Lev 16,12f.; Num 4,16; 16,7.17f.; 2 Chr 26,19; Hes 8,11). Das Verdikt „Gräuel“ stellt sie in einen Zusammenhang mit dem heidnischen Kult (Dtn 7,25f.; 18,9; 20,18).
In 13b folgt die Stellungnahme zu den Festen. Neben dem Neumondfest1 und den „Versammlungen“ wird auch der Sabbat erwähnt.2 Mit dem Begriff „Festversammlung“ werden Festtage bezeichnet, für die ein Arbeitsverbot galt (Lev 23,36; Num 29,35; Dtn 16,8).
All diese Einrichtungen sind nicht an sich problematisch. Sie werden es aber durch die Gesinnung und das Treiben der Menschen, die sich zum Fest versammeln. Dies wird im letzten Teil von Vers 13 deutlich: „Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht.“ „Sünde“ meint hier nicht etwa kultische Vergehen, sondern die Duldung von Unrecht und Unterdrückung. Schließlich ruft Gott dem Volk abschließend zu (1,17): „Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!“ Sünde und Festversammlung passen nicht zusammen.
In Vers 14 unterstreicht Gott seine ablehnende Haltung gegenüber den religiösen Feiern des Volkes. Sie erregen seinen Hass (Am 5,21) – so wie es die heidnischen Kultgebräuche tun (Dtn 12,31; 16,22). Er empfindet sie als unerträglich; sie machen ihn „müde“. Dieser Ausdruck kann forensische Bedeutung haben: „Die Erklärung eines Klägers, er sei der Machenschaften des Angeklagten ‚müde’, lässt den Strafantrag erwarten.“3
Vers 15 „steigert die Schärfe seiner ‚Belehrung’ noch einmal; auch die scheinbar unanfechtbarste Kulthandlung, das Beten, ist von der Verwerflichkeit der Kultübungen Jerusalems nicht ausgenommen.“4 Aber wie in Vers 13 nicht die dort genannten Feste als solches abgelehnt werden, sondern die Haltung und die Taten derjenigen, die sich zu diesen Festen versammeln, richtet sich das Wort auch hier nicht gegen das Beten an sich, sondern dagegen, dass sich blutverschmierte Hände zum Gebet gen Himmel strecken.
Angesichts ihrer blutverschmierten Hände sind die Adressaten abschließend (1,16.17) aufgerufen, sich zu waschen und zu reinigen. Dies ist jedoch kein kultischer Akt. Es geht darum, mit dem bösen Treiben aufzuhören und stattdessen das Gute zu lernen, nach dem Recht zu fragen und den Unterdrücker zurechtzuweisen. Konkret: Die sozial Schwachen nicht auszunutzen, sondern ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.1
Mit seinen kritischen Anmerkungen zur Sabbatfeier wendet sich Jes 1,13 nicht gegen den Sabbat an sich. Wenn jedoch das Recht der Schwachen mit Füßen getreten wird, macht die Feier des Sabbats, die hier erneut in kultischem Zusammenhang erscheint, keinen Sinn. Mehr noch: Sie wird für Gott unerträglich. Dies ist der Fall, wenn die Teilnehmer an Riten und Feiern der Auffassung sind, dass sie durch ihre Teilnahme am Kult – oder durch gesteigerte kultische Aktivität (vgl. Jes 1,11.15) – mit Gott ins Reine kommen können (ex opere operato – durch die vollzogene Handlung)2 und sie nicht auf das achten, was wirklich wichtig ist – Recht und Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen.
1.3.5 Der Sabbat im Buch Jeremia und im Buch Klagelieder
Der Prophet Jeremia wirkt in den letzten Jahrzehnten vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier (586 v. Chr.) und in den anschließenden Wirren. In Jer 52,31-34 wird abschließend von der Begnadigung Jojachins berichtet. Sie erfolgte um 560 v.Chr. Daher erfuhr das Jeremiabuch seine Endredaktion frühestens zu diesem Zeitpunkt.
1.3.5.1 Jeremia 17,19-27
19 So spricht der HERR zu mir: Geh und stell dich in das Tor der Söhne des Volkes, durch das die Könige von Juda einziehen und durch das sie ausziehen, und in alle Tore Jerusalems 20 und sage zu ihnen: Hört das Wort des HERRN, ihr Könige von Juda und ganz Juda und alle Bewohner von Jerusalem, die ihr durch diese Tore einzieht! 21 So spricht der HERR: Hütet euch bei eurem Leben, dass ihr am Tag des Sabbats keine Last tragt und durch die Tore Jerusalems hereinbringt! 22 Und ihr sollt am Tag des Sabbats keine Last aus euren Häusern herausbringen und sollt keinerlei Arbeit tun! Sondern heiligt den Tag des Sabbats, wie ich euren Vätern geboten habe! 23 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie haben ihren Nacken verhärtet, um nicht zu hören und keine Zucht anzunehmen. 24 Und es wird geschehen, wenn ihr wirklich auf mich hört, spricht der HERR, so dass ihr am Tag des Sabbats keine Last durch die Tore dieser Stadt hereinbringt und ihr den Tag des Sabbats heiligt, indem ihr keinerlei Arbeit an ihm tut, 25 dann werden durch die Tore dieser Stadt Könige und Oberste einziehen, die auf dem Thron Davids sitzen, mit Wagen und Pferden fahren, sie und ihre Obersten, die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem; und diese Stadt wird ewig bewohnt werden. 26 Dann werden Leute kommen aus den Städten Judas und aus der Umgebung von Jerusalem, aus dem Land Benjamin, aus der Niederung, vom Gebirge und aus dem Süden, die Brandopfer, Schlachtopfer, Speisopfer und Weihrauch bringen und die Lobopfer bringen in das Haus des HERRN. 27 Wenn ihr aber nicht auf mich hört, den Tag des Sabbats heilig zu halten und keine Last zu tragen und nicht durch die Tore Jerusalems einzugehen am Tag des Sabbats, dann werde ich Feuer in seinen Toren anzünden, und es wird die Paläste Jerusalems verzehren und nicht verlöschen.
Jeremia wird zum „Tor der Söhne des Volkes“ beordert, „durch das die Könige von Juda einziehen und … ausziehen“. Dort warnt er im Auftrag Gottes davor, am Sabbat Lasten zu tragen und durch die Tore nach Jerusalem hereinzubringen. Auch aus den Stadthäusern sollen keine Lasten herausgebracht werden. Offensichtlich geht es um einen Markt, anlässlich dessen Güter vom Land in die Stadt transportiert (vgl. Neh 13,15-22) und zusammen mit Handelsgütern aus den Stadthäusern zum Verkauf angeboten werden.
Dabei bezieht sich der Prophet auf das Gebot der Sabbatheiligung, das Gott den „Vätern“ gegeben hat (17,22; vgl. Dtn 5,12: „… so wie der HERR, dein Gott, es dir geboten hat.“). Möglicherweise war unklar, ob das Sabbatgebot auch das Tragen von Lasten bzw. den Marktbetrieb meint – und wird daher entsprechend „aktualisiert“.1
Die Warnung „hütet euch bei eurem Leben“ ist keine Androhung der Todesstrafe (anders in Ex 31,14; 35,2; Num 15,32-36), sondern will deutlich machen, dass das Wohl und Wehe des Volkes von der Beachtung des Gebotes abhängt (vgl. Jos 23,11). In diesem Sinne kündigt 17,24-26 den Segen an, während 17,27 den drohenden Fluch schildert. Diese „Fokussierung der Gerichtsbegründung auf die Befolgung eines einzigen Gebots lässt die Sabbatheiligung als Summe und Zentrum der Tora erscheinen“2 (vgl. Jes 56,2.4.6; 58,13; Neh 9,6-37).3
1.3.5.2 Jeremia 32,6-7
6 Und Jeremia sprach: Das Wort des HERRN geschah zu mir: 7 Siehe, Hanamel, der Sohn des Schallum, deines Onkels, wird zu dir kommen und sagen: Kauf dir meinen Acker, der in Anatot liegt! Denn du hast das Lösungsrecht, um ihn zu kaufen.
Das „Lösungsrecht“ steht im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Jobeljahres. Es soll nach sieben Sabbatjahren gefeiert werden (Lev 25,8-54). Die Regelungen bzgl. des Jobeljahres sehen vor, dass verkauftes Land an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wird. Außerdem hat der Verkäufer das Recht, es vorzeitig zurückzukaufen (Lev 25,25) – das „Lösungsrecht“.
Im Buch Jeremia wird nichts über den Sinn dieser Regelungen gesagt. Trotzdem ist ihre Intention klar: Sie sollen verhindern, dass sich der größte Teil des Landes über kurz oder lang in den Händen weniger Großgrundbesitzer befindet und soll denen, die ihr Land verkaufen mussten, einen Neustart ermöglichen (oder ihren Nachkommen).
1.3.5.3 Jeremia 34,8-22
8 Das Wort, das von dem HERRN zu Jeremia geschah, nachdem der König Zedekia einen Bund mit dem ganzen Volk, das in Jerusalem lebte, geschlossen hatte, ihnen eine Freilassung auszurufen, 9 dass jeder seinen Sklaven und ein jeder seine Sklavin, und zwar Hebräer und Hebräerin, als Freie entlassen sollte, so dass niemand mehr seinen judäischen Volksgenossen jemals als Sklaven hielt. 10 Und es hörten alle Obersten und das ganze Volk, das den Bund eingegangen war, dass jeder seinen Sklaven und jeder seine Sklavin als Freie entlassen sollte, ohne sie länger als Sklaven zu halten. Sie gehorchten und entließen sie. 11 Aber sie wandten sich um und holten die Sklaven und Sklavinnen zurück, die sie als Freie entlassen hatten, und unterjochten sie wieder zu Sklaven und Sklavinnen. 12 Da geschah das Wort des HERRN von dem HERRN zu Jeremia: 13 So spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe einen Bund mit euren Vätern geschlossen an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, herausführte, und habe gesprochen: 14 Am Ende von sieben Jahren sollt ihr jeder seinen hebräischen Bruder entlassen, der sich dir verkauft hat; er soll sechs Jahre dein Sklave sein, dann sollst du ihn als Freien von dir entlassen. Aber eure Väter hörten nicht auf mich und neigten ihr Ohr nicht zu mir. 15 Da seid ihr heute umgekehrt und habt getan, was in meinen Augen recht ist, dass jeder für seinen Nächsten Freilassung ausrief, und habt einen Bund vor mir geschlossen in dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist. 16 Dann aber habt ihr euch wieder umgewandt und meinen Namen entweiht und habt jeder seinen Sklaven und jeder seine Sklavin zurückgeholt, die ihr auf ihren Wunsch als Freie entlassen hattet. Und ihr habt sie wieder unterjocht, dass sie Sklaven und Sklavinnen für euch sein sollen. 17 Darum, so spricht der HERR: Ihr habt nicht auf mich gehört, eine Freilassung auszurufen, jeder für seinen Bruder und für seinen Nächsten. Siehe, so rufe ich für euch eine Freilassung aus, spricht der HERR, für das Schwert, für die Pest und für den Hunger und mache euch zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde. 18 Und ich will die Männer,die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzweigeschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind: 19 die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind; 20 die will ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und ihre Leichen sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß dienen. 21 Zedekia aber, den König von Juda, und seine Obersten werde ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten, und in die Hand des Heeres des Königs von Babel, das von euch abgezogen ist. 22 Siehe, ich gebe Befehl, spricht der HERR, und bringe sie zu dieser Stadt zurück, damit sie gegen sie kämpfen und sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. Und ich werde die Städte Judas zur Öde machen, ohne einen Bewohner.
Mit scharfen Worten kritisiert der Prophet, dass König Zedekia zunächst eine Freilassung aller Sklaven ausgerufen, sie jedoch bereits kurze Zeit später wieder rückgängig gemacht hat. Vermutlich hing die Freilassung mit der aktuellen Bedrohung durch das babylonische Heer zusammen (34,21). Sofern dies der historische Hintergrund ist, hat sich die Oberschicht des Volkes nach dem Abzug der Babylonier so verhalten, als hätte sie dieses Versprechen nie gegeben. Als Strafe ruft Gott dementsprechend ebenfalls eine „Freilassung“ aus – aber eine „Freilassung“ des Volkes in den Untergang (34,17-22).