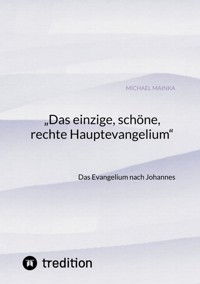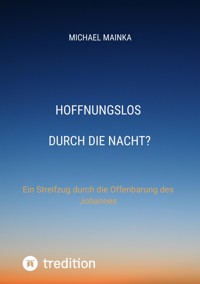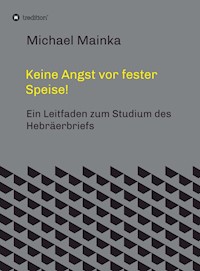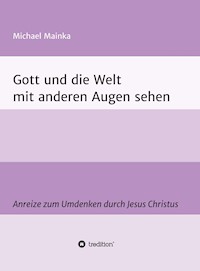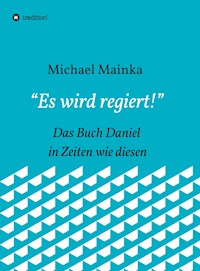
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Die Welt ist aus den Fugen" (Frank-Walter Steinmeier) und wir erleben eine Wiederkehr des Autoritären. Das Buch Daniel will zeigen, dass die Welt nicht dem Untergang geweiht ist und die Mächtigen in Wirklichkeit machtlos sind. Deshalb ist es eine wertvolle Inspiration für unsere Zeit. Michael Mainka lässt den Text des alten Buches sprechen und zeigt dabei Parallelen auf, die nicht zufällig, sondern unvermeidlich sind. Der Titel "Es wird regiert!" greift ein Wort des Theologen Karl Barth (1886-1968) auf, mit dem er sich unmittelbar vor seinem Tod zur Weltlage geäußert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Als Johann Christoph Blumhardt im Februar 1880 auf dem Sterbebette lag, sprach ihm sein Sohn Christoph Zuversicht und Hoffnung zu. Er tat es mit den Worten: „Es wird gesiegt“ – nach anderer Überlieferung lautete der Satz vielleicht auch so: „Es wird regiert.“…
Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass dieser selbe Satz auch der letzte ist, der aus dem Munde Karl Barths bekannt ist.
Am späten Abend vor der Nacht, in der er friedlich im Schlaf verstarb – es war die Nacht auf den 10. Dezember 1968 -, arbeitete er noch an seinem Schreibtisch. Da erhielt er einen Telefonanruf. Es meldete sich Eduard Thurneysen, mit dem ihn eine über sechzigjährige Freundschaft verband.
Sie unterhielten sich über die Weltlage mit ihren beängstigenden Gefahren und Nöten. Barth schloss endlich die Unterhaltung ab und munterte den Freund im Blick auf die besprochene Sorge auf: „Nur ja die Ohren nicht hängenlassen! Denn – ‚es wird regiert!‘“
(Eberhard Busch, Glaubensheiterkeit: Karl Barth, Erfahrungen und Begegnungen, Neukirchen-Vluyn 1987, 95f.)
Michael Mainka
„Es wird regiert!“
Das Buch Daniel in Zeiten wie diesen
© 2019 Michael Mainka
Umschlag, Illustration: Vorlage tredition
Lektorat, Korrektorat: Reinhild Mainka, Elke Schlude
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7497-8730-2
Hardcover
978-3-7497-8731-9
e-Book
978-3-7497-8732-6
Die Bibelzitate sind – falls nicht anders vermerkt – der Bibelübersetzung nach Martin Luther (revidierte Fassung 2017, Deutsche Bibelgesellschaft) entnommen.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Vom Mut, aus der Reihe zu tanzen (Daniel 1)
2 Ein Albtraum und die Vision einer neuen Welt (Daniel 2)
3 Ehre, wem Ehre gebührt (Daniel 3,1-30)
4 Bäume wachsen nicht in den Himmel (Dan 3,31-4,34)
5 Das Schicksal eines politischen Leichtgewichts (Daniel 5)
6 An der Wahrheit festhalten – Widerstand leisten (Daniel 6)
7 Weltmächte vor Gericht (Daniel 7)
8 Mit Füßen getreten und doch Recht bekommen (Daniel 8)
9 Die göttliche Vorsehung (Daniel 9)
10 Die Welt verstehen (Daniel 10-12)
Vorwort
In seiner „Vorrede über den Propheten Daniel“ betont Martin Luther die besondere Bedeutung dieses biblischen Buches und erklärt:
„Diesen Daniel befehlen wir nun zu lesen allen frommen Christen, welchen er zu dieser elenden letzten Zeit tröstlich und nützlich ist …Denn solche Weissagung Daniels und dergleichen sind nicht allein darum geschrieben, dass man die Geschichte und die künftigen Trübsale wissen … solle, sondern dass sich die Frommen damit trösten und fröhlich machen und ihren Glauben und Hoffnung in der Geduld stärken sollen …, dass ihr Jammer ein Ende haben und sie von Sünden, Tod, Teufel und allem Übel (…) ledig, in den Himmel zu Christo, in sein seliges ewiges Reich kommen sollen …
Darum sehen wir auch hier, dass Daniel alle Gesichte und Träume, wie gräulich sie sind, immerdar mit Freuden endet, nämlich mit Christi Reich und Zukunft, um welches Zukunft willen … solche Gesichte und Träume gebildet, gedeutet und geschrieben sind. Wer sie nun auch will nützlich lesen, der soll an der Historie oder Geschichte nicht hangen oder haften und da bleiben; sondern sein Herz weiden und trösten in der verheißenen und gewissen Zukunft unseres Heilandes Jesu Christi als in der seligen und fröhlichen Erlösung von diesem Jammertale und Elende.“1
Trotz dieser „Werbung“ aus berufenem Mund ist das Buch Daniel vielen Christen weitgehend unbekannt – abgesehen vielleicht von der Geschichte über „Daniel in der Löwengrube“, die sich wunderbar für Kindergottesdienste eignet.
Der Hauptgrund dafür ist vermutlich, dass die Bibelwissenschaft seit der Aufklärung überwiegend der Auffassung ist, das Buch Daniel sei im 2. Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben worden und richte sich an Juden in den Wirren der Makkabäerkriege. Dadurch ist der Eindruck entstanden, dass sich dieses Buch eigentlich erledigt habe. Und deshalb wird über die meisten Kapitel dieses Buches kaum mehr gepredigt.
Wo das doch geschieht, sind umgekehrt nicht selten Predigten zu hören, die an Verschwörungstheorien erinnern. Warum? Die Verkündiger gehen nicht nur davon aus, dass das Buch Daniel die wichtigsten Epochen der Weltgeschichte vom babylonischen Weltreich bis zur Wiederkunft Christi skizziert, sondern sind darüber hinaus der Meinung, dass in unseren Tagen die finalen Auseinandersetzungen stattfinden und sie durch die richtige Deutung des Buches Daniel erkennen können, welche Akteure dabei hinter den Kulissen die Strippen ziehen.
Der Theologe Rolf Pöhler, langjähriger Dozent für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule, deren Träger die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist, hat auf einem Symposium von Vertretern der Vereinigung Evangelischer Freikirchen und dem Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik darauf hingewiesen, dass hier „die Visionen ohne vorherige exegetische und theologische Analyse assoziativ auf geschichtliche Situationen und aktuelle Zeitereignisse angewandt und diese als angebliche Erfüllung der Weissagungen verstanden werden“1.
Auch wenn eine solche Auslegung höchst problematisch ist, hat sie doch eine entscheidende Gemeinsamkeit mit dem Vorgehen der modernen Bibelwissenschaft: In beiden Fällen steht die Frage im Mittelpunkt, welche Ereignisse und Mächte im Buch Daniel gemeint sind. Das aber greift zu kurz – wie bereits Martin Luther erkannt hat. Wer das Buch Daniel „nun auch will nützlich lesen, der soll an der Historie oder Geschichte nicht hangen oder haften und da bleiben; sondern sein Herz weiden und trösten in der verheißenen und gewissen Zukunft unseres Heilandes Jesu Christi als in der seligen und fröhlichen Erlösung von diesem Jammertale und Elende“.
So wichtig die Frage ist, auf welche geschichtlichen Ereignisse sich die Schilderungen des Buches Daniel beziehen, so entscheidend ist die Frage, was das Buch Daniel zu diesen Ereignissen zu sagen hat. Das Buch Daniel ist kein Geschichtsbuch – auch nicht in dem Sinne, dass es zukünftige Geschichte erzählt. Es geht um eine Kommentierung und Deutung geschichtlicher Ereignisse aus „himmlischer Perspektive“.
Deshalb hat Rolf Pöhler folgende Schritte der Auslegung vorgeschlagen:
„Daraus ergibt sich für die Auslegung apokalyptischer Texte ein methodisches Vorgehen in drei Schritten: Zunächst sind die Texte wie alle biblischen Bücher in ihrem historischen und literarischen Kontext zu analysieren (historische Exegese). Anschließend ist nach ihrem bleibenden Aussagegehalt der zeitübergreifenden Botschaft zu fragen (theologische Interpretation). Schließlich kann nach historischen Entsprechungen und situativen Anwendungen Ausschau gehalten werden, in denen sich die apokalyptischen Bilder widerspiegeln (konkrete Applikation).“1
Mein Buch basiert auf Predigten, die ich ab Frühjahr 2018 gehalten habe. In ihnen habe ich versucht, die theologische Absicht („theologische Interpretation“) des Buches Daniels zu entfalten und für unsere heutige Lebenswelt fruchtbar zu machen („konkrete Applikation“). Die Predigten haben jeweils mit der Verlesung des Bibeltextes begonnen (nach der Lutherbibel 2017). Auch bei der Lektüre dieses Buches lade ich dazu ein, zunächst den jeweiligen Textabschnitt zu lesen und ihn wirken zu lassen.
Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch allen Lesern, die mit ähnlichen Fragen unterwegs sind, Anregungen gibt, um die Aktualität des Buches Daniel neu zu entdecken.
Erzhausen, im November 2019Michael Mainka
1 WA 11.2, 129f.
1 Rolf Pöhler, Die Heilige Schrift in Gottesdienst, Bekenntnis und Auslegungspraxis der Siebenten-Tags-Adventisten, in: Walter Klaiber/WolfgangThönissen (Hg.), Die Bibel im Leben der Kirche, Paderborn 2007, 178f.
1 Pöhler, a.a.O., 178.
1 Vom Mut, aus der Reihe zu tanzen (Daniel 1)
(1) Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. (2) Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Schinar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes.
(3) Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, (4) junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen; und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. (5) Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank; so sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen.
(6) Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja. (7) Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Beltschazar und Hananja Schadrach und Mischaël Meschach und Asarja Abed-Nego.
(8) Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. (9) Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. (10) Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euern Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der andern jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben.
(11) Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gesetzt hatte: (12) Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. (13) Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen; und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. (14) Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. (15) Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. (16) Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. (17) Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Artvon Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art.
(18) Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. (19) Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. (20) Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. (21) Und Daniel blieb dort bis ins erste Jahr des Königs Kyrus.
Im Exil
Am 28. Februar 1933, einen Tag nach dem Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin, flieht der Schriftsteller Bert Brecht mit seiner Familie und einigen Freunden nach Prag. Dann geht es – auf einigen Umwegen – nach Dänemark und später in die USA.
Während seiner Zeit in Dänemark beschäftigt er sich damit, was das eigentlich ist – das Leben im Exil. 1937 schreibt er ein Gedicht mit dem Titel: „Über die Bezeichnung Emigranten“.
Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab: Emigranten.
Das heißt doch Auswanderer.
Aber wir wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss.
Wählend ein anderes Land.
Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer.
Sondern wir flohen.
Vertriebene sind wir, Verbannte.
Und kein Heim,
ein Exil soll das Land sein, das uns aufnahm.
Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen
Warten des Tags der Rückkehr,
jede kleinste Veränderung jenseits der Grenze beobachtend,
jeden Ankömmling eifrig befragend,
nichts vergessend und nicht aufgebend.
Und auch verzeihend nichts, was geschah, nichts verzeihend.
Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht!
Wir hören die Schreie aus ihren Lagern bis hierher.
Sind wir doch selber fast wie Gerüchte von Untaten,
die da entkamen über die Grenzen.
Jeder von uns,
der mit zerissenen Schuhn durch die Menge geht,
zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt.
Aber keiner von uns wird hier bleiben.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.1
Daniel und seine Freunde im Exil. Ein weltgeschichtlicher Umbruch hat sie nach Babylon gespült. Nicht nur sie, auch eine Reihe anderer junger Männer „aus gutem Hause“. Sogar ein Teil der Tempelgeräte.
Was nun? Obwohl mit ihren Gedanken oft ganz woanders, sind sie augenblicklich gefordert, sich auf ihr neues Leben in Babylon einzustellen. Sie sollen nicht in irgendeinem Lager ihr Dasein fristen, sondern sich nützlich machen. Sie sollen fit gemacht werden, um dem König zu dienen – zumindest diejenigen von ihnen, die das Potential dafür haben, die „schön, einsichtig, weise, klug und verständig“ sind.
Was sollen sie lernen? „Schrift und Sprache der Chaldäer“. Aber sie sollen nicht nur lernen, sich schriftlich und mündlich gut auszudrücken – obwohl es damals wie heute wünschenswert ist, dass Beamte über diese Kompetenzen verfügen. So heißt es dann auch später, dass Gott ihnen „Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit“ gibt (1,17). Auf dem Lehrplan stehen also die Schriften der Chaldäer.
Die Chaldäer, die in Babylon den Ton angeben, sind führend in den Wissenschaften, vor allem in der Astronomie. Dabei geht es ihnen aber nicht nur darum, die Bewegungen der Himmelskörper zu untersuchen. Es geht auch um die Zusammenhänge zwischen Konstellationen der Gestirne und irdischen Vorgängen. Es geht um eine astrologische Astronomie – nicht einfach für das „persönliche Horoskop“ am Morgen, sondern als Grundlage für Psychologie, Medizin, Geschichte …
Warum sollen sie das lernen? Damit sie den König beraten können. Der fragt vor allen wichtigen politischen Entscheidungen nach der geeigneten Himmelskonstellation bzw. danach, was bestimmte Himmelserscheinungen zu bedeuten haben. Deshalb müssen sich die Beamten mit dieser Materie auskennen und entsprechend unterrichtet werden.
Für Daniel und seine Freunde ist das etwas ganz neues und etwas ganz anderes. Und vor allem: es passt nicht zu dem Glauben, in dem sie erzogen worden sind. Schon die Idee, dass irdische Vorgänge etwas mit Gestirnkonstellation zu tun haben. Und erst recht die Vorstellung, dass es sich bei den Himmelskörpern gleichzeitig um Götter handelt. Der Bericht lässt jedoch nicht erkennen, dass Daniel und seine Freunde mit diesem Unterrichtsstoff ein Problem haben.
Sie lassen es auch über sich ergehen, dass der „oberste Kämmerer“ ihnen neue Namen gibt. „Daniel“ („Gott sei mein Richter“) wird zu „Beltschazar“ („Gott schütze das Leben des Königs“), „Hananja“ („Begnadet hat Jahwe“) zu „Schadrach“ („Nachkommenschaft“), „Mischaël“ („Wer ist wie Gott?“) zu „Meschach“ („Wer gehört Aku?“, dem Mondgott), „Asarja“ („Unterstützt hat Jahwe“) zu „Abed-Nego“ („Verehrer des Nabu“, dem Gott der Schreibkunst und Weisheit).
Namen sind nicht „Schall und Rauch“. Der „oberste Kämmerer“ weiß genau, was er da tut. Er gibt ihnen nicht einfach neue Namen; er verleiht ihnen eine andere Identität. Er will seine Schüler voll und ganz in die chaldäische Kultur eingliedern. Sie sollen möglichst nichts mehr mit dem Volk gemeinsam haben, aus dem sie stammen.
Grenzen der Assimilation
Aber bei Essen und Trinken ist für Daniel und seine Freunde die Grenze erreicht. „Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank … Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte.“
Warum kein Nein zur Astrologie? Warum kein Protest gegen die Umbenennung? Warum lehnen sie es ab, „von der königlichen Speise und von demWein“ zu essen und zu trinken? Weil Fleisch von unreinen Tieren dabei ist? Weil die Tiere nicht richtig geschlachtet werden? Weil Fleisch und Wein den Göttern geweiht werden?
Natürlich ist bei „der königlichen Speise“ auch das Fleisch von unreinen Tieren dabei. Natürlich werden die Tiere nicht nach den Vorschriften des mosaischen Gesetzes geschlachtet. Natürlich werden Fleisch und Wein den Göttern geweiht. Entscheidend aber ist: Es geht um die „Tafelkost des Königs“, wie die Elberfelder Bibel richtig übersetzt.
Was ist das Problem bei der „Tafelkost des Königs“? Warum essen und trinken die jetzigen und zukünftigen Beamten „von der königlichen Speise und von dem Wein“? Weil sie dadurch – auch wenn sie nicht mit ihm am Tisch sitzen – eine Art Mahlgemeinschaft mit dem König haben. Weil sie durch die königliche Speise und den königlichen Wein mit dem König verbunden sind.
Warum legt der König so viel Wert darauf? Es spielen vor allem zwei Gründe eine Rolle. Erstens: Es geht um Loyalität gegenüber dem König. Der Volksmund sagt: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.“ Das gilt erst recht, wenn es nicht nur Brot, sondern auch Fleisch und Wein gibt.
Zweitens: Die königliche Speise und der königliche Wein verleihen denen, die davon essen und trinken, außerordentliche Fähigkeiten. Weil der König nahezu übermenschliche Kräfte hat, steigern Essen und Trinken von der Tafel des Königs körperliches Wohlbefinden und geistige Potenz – meint man.
Das meint auch der „oberste Kämmerer“. Als Daniel ihm erklärt, dass er gern etwas anderes zu essen hätte, gerät der in Panik.
Die „Tafelkost des Königs“ zurückzuweisen bedeutet mehr, als eine andere Ernährungsweise zu bevorzugen. Wenn es nur um die Ernährung gehen würde, wäre vermutlich sogar Nebukadnezar tolerant – wenigstens so tolerant, dass er dem obersten Kämmerer nicht gleich im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf abreißen würde. Die „Tafelkost des Königs“ zurückzuweisen ist Majestätsbeleidigung. Da kann er nicht mitmachen. Wenn er auf den Wunsch Daniels eingeht, riskiert er seinen Kopf.
Außerdem ist er überzeugt, dass es sich negativ auf Daniel und seine Freunde auswirken wird, dass ihre „Gesichter schmächtiger“ sein werden als die Gesichter der „anderen jungen Leute“, die von der königlichen Speise essen und vom königlichen Wein trinken.
Es geht hier also nicht um irgendwelche Sonderwünsche. Es geht um den Anspruch des Königs und um den Anspruch Gottes. Genauer: Es geht darum, dass der Anspruch des Königs begrenzt ist, dass er nicht die oberste Autorität ist, dass es eine Autorität über ihm gibt.
Es geht um die Treue zum ersten Gebot: „Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“
Es geht um eine Haltung, wie sie die „Bekennende Kirche“ 1934 in der „Barmer Theologischen Erklärung“ gegenüber dem Anspruch des Nationalsozialismus formuliert hat:
„Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes [gemeint ist Jesus Christus] auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen …
Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften .
Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.“
Darum geht es immer wieder im Buch Daniel: dass der Anspruch des Königs begrenzt ist, dass er nicht die oberste Autorität ist, dass es eine Autorität über ihm gibt. Im Vergleich dazu ist ein Studium der Astrologie und die Sache mit den neuen Namen offenbar zweitrangig. Das kann man machen. Aber Gott muss Gott bleiben.
Mut zum Risiko
Beim obersten Kämmerer erreicht Daniel nichts – weil der augenblicklich die Dimension erfasst, die dieser Wunsch Daniels hat. Gott hat zwar bewirkt, dass er Daniel gegenüber „günstig und gnädig gesinnt“ ist. Deshalb hat er ihn angehört. Aber was zu viel ist, ist zu viel.
Aber Daniel gibt nicht auf. Weil es hier ans Eingemachte geht. Er wendet sich an den „Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gesetzt hatte“. Er geht also eine Instanz tiefer. Der Aufseher ist vermutlich nur für die vier jungen Leute aus Jerusalem zuständig. Was die miteinander ausmachen, bekommt so schnell niemand mit.
Daniel schlägt ihm ein Experiment vor. Er soll ihn und seine drei Freunde zehn Tage lang auf Diät setzen – soll ihnen nur Wasser zu trinken und Gemüse zu essen geben. Nach den zehn Tagen soll er prüfen, ob sie schlechter oder besser aussehen als die anderen jungen Leute, die die Tafelkost des Königs bekommen.
Warum will Daniel Gemüse und Wasser? Vielleicht, weil der Aufseher das relativ einfach organisieren kann. Das kostet auch nicht so viel. Aber wahrscheinlich hat Daniel noch einen anderen Grund: Gemüse und Wasser – das ist eine typische Fastenkost.
Der Aufseher geht auf den Vorschlag ein. Wohl auch deshalb, weil das Risiko begrenzt ist. Wenn sie nach zehn Tagen etwas schlechter aussehen, wird es vermutlich noch keine Nachfragen geben – und er wird anschließend schon dafür sorgen, dass diese Jungspunde essen, was auf den Tisch kommt. Das hat Daniel ihm ja auch versprochen.
Courage wird belohnt
Aber der Aufseher wird Zeuge eines Wunders. Obwohl sie auf Diät sind und nur Fastennahrung zu sich nehmen, sehen sie „schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise“ essen. „Kräftiger“ meint hier wohl vor allem: sie sind dicker. Dick sein, das ist damals ein Zeichen von Gesundheit. Obwohl sie nur Gemüse essen und Wasser trinken, bringen sie mehr Kilos auf die Waage als diejenigen, die es sich richtig schmecken lassen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist ein Wunder.
Und der Aufseher sagt sich: Mir soll’s recht sein. Dann geb‘ ich ihnen weiter Gemüse und Wasser. Das war so ausgemacht. Und wenn meine vier Jungs am Ende noch viel „schöner und kräftiger“ aussehen als die anderen, kann mir nichts passieren. Im Gegenteil – vielleicht kriege ich sogar noch einen Orden dafür, dass ich sie so gut versorgt habe.
Aber es kommt noch besser. Die Vier sind nicht nur „schöner und kräftiger“. Gott gibt ihnen auch „Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit“. Sie vertiefen sich in die chaldäischen Schriften. Keine oberflächliche Schnell-Lektüre, sondern ein sorgfältiges Studium. Sie verstehen, worum es geht. Sie entdecken die chaldäische Weisheitslehre – eine Weisheitslehre, bei der es um die Deutung von Träumen und die Deutung kosmischer Zeichen geht. Vor allem Daniel wird zum Experten für „Gesichte und Träume jeder Art“. Auch (oder gerade?) bei der Beschäftigung mit „heidnischer Wissenschaft“ erfahren sie Gottes Segen.