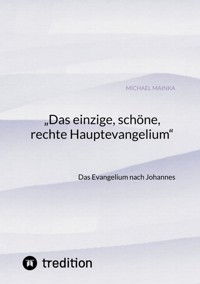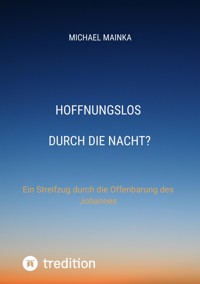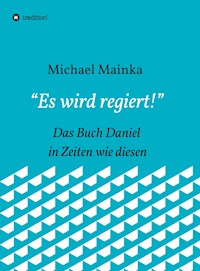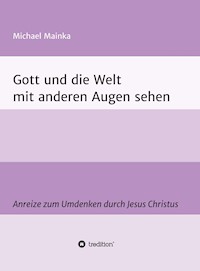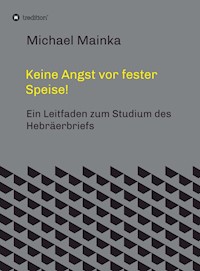
10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Hebräerbrief richtet sich an Christen, die viele Schwierigkeiten erlebt und gut gemeistert haben, dann aber müde geworden sind. Der Verfasser versucht, ihnen zu helfen. Typischerweise geschieht das durch mitfühlende Worte, Moralpredigten, Durchhalteparolen und Drohungen. Einiges davon findet sich auch im Hebräerbrief. Entscheidend ist aber etwas ganz Anderes: Der Hebräerbrief will seine Leser ermutigen, indem er ihnen eine tiefere Dimension des christlichen Glaubens vor Augen führt. Dabei handelt es sich um "feste Speise". Deshalb gilt: Langsam essen und gründlich kauen! Der vorliegende Leitfaden lädt dazu ein, diesem Brief Satz für Satz und Wort für Wort zuzuhören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Mainka
Keine Angst vor fester Speise!
Ein Leitfaden
zum Studium des Hebräerbriefs
© 2021 Michael Mainka
Umschlag, Illustration: Vorlage tredition
Lektorat, Korrektorat: Birthe Hertwig, Reinhild Mainka
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-43165-2
Paperback
978-3-347-43166-9
Hardcover
978-3-347-43167-6
e-Book
Die Bibelzitate sind – falls nicht anders vermerkt – der Elberfelder Bibel (Textstand 30) entnommen.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Literatur- und Abkürzungsverzeichnis
Einleitung in den Hebräerbrief
1 Gottes endgültige Rede in seinem Sohn (1,1-4,13)
1.1 Einfach überragend (1,1-14)
1.1.1 Die Überlegenheit des Sohnes (1,1-4)
1.1.2 Warum der Sohn den Engeln überlegen ist (1,5-14)
1.2 Wer viel bekommen hat, hat viel zu verlieren (2,1-4)
1.3 Göttliche Solidarität (2,5-18)
1.3.1 Ein Psalm über die Erniedrigung und die Krönung Jesu (2,5-9)
1.3.2 Die Brüderlichkeit und Solidarität Jesu (2,10-18)
1.4 Der Mehrwert Jesu Christi und die Verbindung zu ihm (3,1-6)
1.5 Predigt über ein abschreckendes Beispiel (3,7-4,13)
1.5.1 Der Predigttext (3,7-11)
1.5.2 Die Auslegung (3,12-19)
1.5.3 Die Aktualisierung (4,1-11)
1.5.4 Weil Gottes Wort richtet, muss die Chance genutzt werden (4,12-13)
2 Jesus – der wahre Hohepriester (4,14-10,18)
2.1 Jesus, unser Hohepriester – der Grund, um dran zu bleiben (4,14-16)
2.2 Zum Hohepriester (über)qualifiziert (5,1-10)
2.2.1 Der Hohepriester in alttestamentlicher Zeit (5,1-4)
2.2.2 Christus, unser Hohepriester (5,5-10)
2.3 An die Gemeinde am Rande des Abgrunds (5,11-6,20)
2.3.1 Die Situation der Gemeinde – und was daraus folgt (5,11-6,3)
2.3.2 Wer abfällt ist verloren, aber … (6,4-12)
2.3.3 Ausharren – weil Gott seine Verheißung beschworen hat (6,13-20)
2.4 Die „feste Speise“: Jesus unser Hohepriester (7,1-10,18)
2.4.1 Das Priestertum der Leviten und das bessere Priestertum Jesu (7,1-28)
2.4.1.1 Wer war Melchisedek? (7,1-3)
2.4.1.2 Die Größe und Überlegenheit Melchisedeks (7,4-10)
2.4.1.3 Warum die Änderung des Priestertums notwendig war (7,11-19)
2.4.1.4 Jesu Priestertum ist besser – es beruht auf einem Eid (7,20-22)
2.4.1.5 Jesu Priestertum ist besser – es bleibt in Ewigkeit (7,23-25)
2.4.1.6 Ein besserer Hoher Priester und ein besseres Opfer (7,26-28)
2.4.2 Hohepriester im Himmel und Mittler eines besseren Bundes (8,1-13)
2.4.2.1 Jesus „amtiert“ im Himmel (8,1-6)
2.4.2.2 Der neue Bund ersetzt den alten (8,7-13)
2.4.3 Jesus – das bessere Opfer und der bessere Opferdienst (9,1-28)
2.4.3.1 Der Dienst des ersten Bundes (9,1-10)
2.4.3.2 Der Dienst Jesu Christi im himmlischen Heiligtum (9,11-14)
2.4.3.3 Die Notwendigkeit des Opfertods Jesu Christi (9,15-22)
2.4.3.4 Das Ergebnis: Die Sünde ist außer Kraft gesetzt (9,23-28)
2.4.4 Das Unmögliche wird möglich: die Sünden sind vergeben (10,1-18)
2.4.4.1 Das Kultgesetz ist wirkungslos (10,1-4)
2.4.4.2 Gott wollte keine Schlachtopfer, sondern Jesu Opfer (10,5-10)
2.4.4.3 Jesus hat alles vollbracht (10,11-14)
2.4.4.4 Noch ein Zeugnis – und die logische Schlussfolgerung (10,15-18)
3 Aufruf zur Glaubenstreue (10,19-12,29)
3.1 Am Glauben festhalten – aus guten Gründen (10,19-39)
3.1.1 Festhalten, was wir haben (10,19-25)
3.1.2 Was droht, wenn wir uns lossagen (10,26-31)
3.1.3 Zurück zu den Anfängen (10,32-39)
3.2 Der Glaube in alttestamentlicher Zeit (11,1-40)
3.2.1 Der Glaube (11,1-2)
3.2.2 Der Glaube und die Schöpfung (11,3)
3.2.3 Der Glaube in der Urzeit (11,4-7)
3.2.4 Der Glaube Abrahams und der anderen Patriarchen (11,8-22)
3.2.5 Der Glaube in der Zeit des Mose (11,23-31)
3.2.6 Der Glaube in der weiteren Geschichte Israels (11,32-38)
3.2.7 Die Vollendung der Vorfahren des Glaubens: nur mit uns (11,39-40)
3.3 Mit Ausdauer laufen (12,1-29)
3.3.1 Auf Jesus sehen (12,1-3)
3.3.2 Verfolgung und Leiden positiv sehen (12,4-11)
3.3.3 Aufeinander achten und sich gegenseitig stärken (12,12-17)
3.3.4 Warum es nach dem Abfall kein Zurück gibt (12,18-29)
4 Brieflicher Schluss (13,1-25)
4.1 Das Miteinander und die persönliche Lebensführung (13,1-6)
4.2 Im rechten Glauben bleiben (13,7-21)
4.2.1 Die „Pioniere“ nachahmen und bei Jesus Christus bleiben (13,7-8)
4.2.2 Nicht vom Glauben an Jesus Christus abbringen lassen (13,9-12)
4.2.3 Leidensnachfolge (13,13-14)
4.2.4 Der Gottesdienst (13,15-16)
4.2.5 Den Leitern gehorchen und für sie beten (13,17-19)
4.2.6 Fürbitte für die Gemeinde – weil Gott alles schenkt (13,20-21)
4.3 Persönliches Schlusswort (13,22-25)
5 Die Botschaft des Hebräerbriefs auf den Punkt gebracht
Vorwort
„Einen Kopf pflegen alle Briefe zu haben, Hand und Fuß wenige.“ (Herbert Alfred Frenzel). Zu diesen Wenigen gehört sicher auch der Hebräerbrief (im Folgenden i. d.R. mit „Hebr“ abgekürzt). Das hängt natürlich mit dem Thema des Briefes zusammen: Es geht um Jesus Christus, „den Anfänger und Vollender des Glaubens“ (12,2). Aber auch damit, dass er sich nicht in Nebensächlichkeiten verliert, sondern zum Punkt kommt und bei der Sache bleibt.
Leicht liest er sich allerdings nicht. Wie bei den meisten Büchern der Bibel kommt es auch beim Hebräerbrief entscheidend darauf an, in die Lebenswelt des Autors einzutauchen und seine Gedanken Schritt für Schritt nachzuvollziehen.
Auch bei mir war es beim Hebr keine „Liebe auf den ersten Blick“. Aber ich meine, ihn nach und nach besser verstanden zu haben – und auch mein Einverständnis ist immer mehr gewachsen. Schließlich muss ich sogar sagen: Es war mir ein Vergnügen, an seinen Überlegungen teilhaben zu dürfen. Aus diesem Vergnügen ist schließlich dieses Buch entstanden.
Bei meiner Darstellung habe ich mich bemüht, besonders auf den „roten Faden“ zu achten und ihn hervorzuheben. Deshalb habe ich – über die detaillierte numerische Gliederung hinaus – viele weitere Zwischenüberschriften eingezogen. Außerdem findet sich am Ende eines jeden Abschnitts eine Zusammenfassung.
Trotzdem handelt es sich hier nicht um ein „Lesebuch“, sondern um ein „Studienbuch“. Dieser Leitfaden soll alle unterstützen, die den Hebr studieren. Natürlich kann man sich den Weg durch den Hebr auch ohne Hilfsmittel bahnen. Aber solange sie nicht zum Ersatz für eigenes Nachdenken werden, ist nichts gegen sie einzuwenden. In diesem Sinne will der vorliegende Leitfaden in gebündelter Form fundierte Informationen zur Auslegung des biblischen Textes zur Verfügung stellen und auf diese Weise das persönliche Studium unterstützen.
Und nun wünsche ich allen Lesern, dass der Hebr auch sie inspiriert.
Erzhausen, Oktober 2021
Michael Mainka
Literatur- und Abkürzungsverzeichnis
Die folgenden Werke wurden bei der Erarbeitung bevorzugt herangezogen und werden im Rahmen der Auslegung zitiert:
Braun, Herbert: An die Hebräer, Tübingen 1984 (= Handbuch zum Neuen Testament, Bd. 14).
Goppelt, Leonhard: Theologie des Neuen Testaments, Göttingen31981.
Gräßer, Erich: An die Hebräer, Zürich u.a. 1990ff. (= Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 17,1-3).
Hegermann, Harald: Der Brief an die Hebräer. Berlin 1988 (= Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. 16).
Johnsson, William G.: Der Brief an die Hebräer, Lüneburg 2003.
Josuttis, Manfred: Über alle Engel. Politische Predigten zum Hebräerbrief, München 1990.
Karrer, Martin: Der Brief an die Hebräer, Gütersloh, Würzburg 2002ff. (= Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Bd. 20,1-2).
Laubach, Fritz: Der Brief an die Hebräer, Wuppertal 1967 (= Wuppertaler Studienbibel).
März, Claus-Peter: Hebräerbrief, Würzburg 1989 (= Die Neue Echter Bibel: Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung, Bd. 16).
Michel, Otto: Der Brief an die Hebräer, Göttingen141984 (= Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Bd. 13).
Rose, Christian: Der Hebräerbrief, Göttingen 2019 (= Die Botschaft des Neuen Testaments).
Schlatter, Adolf: Die Briefe des Petrus, Judas, Jakobus, der Brief an die Hebräer. Ausgelegt für Bibelleser, Berlin 1954 (= Schlatters Erläuterungen zum Neuen Testament, Bd. 9).
Strathmann, Hermann: Der Brief an die Hebräer, in: Das Neue Testament Deutsch, Band 3, Der Brief an Timotheus und Titus, Der Brief an die Hebräer, Die Briefe des Jakobus, Petrus, Judas und Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Göttingen 1935.
Weiß, Hans-Friedrich: Der Brief an die Hebräer, Göttingen151991 (= Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Bd. 13).
Wilckens, Ulrich: Studienbibel Neues Testament, Basel 2015.
Abkürzungsverzeichnis (ohne biblische Bücher)
EB
Elberfelder Bibel
KD
Karl Barth, Kirchliche Dogmatik
LB
Lutherbibel (2017)
LD
Luther Deutsch (Kurt Aland, Hrsg.)
LXX
Septuaginta (griechische Übersetzung des AT)
LXX-D
Septuaginta Deutsch
StrBill
Hermann L. Strack, Paul Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch
ThBlNT
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament (Lothar Coenen, Hrsg.)
ThWNT
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Gerhard Kittel, Hrsg.)
WA
D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe
Schl2000
Die Bibel. Schlachter Version 2000
Einleitung in den Hebräerbrief
Der Hebräerbrief – Rede, Brief …?
Otto Michel hat ganz zu Recht festgestellt: „Es ist immer schon aufgefallen, dass der Hebr einen ganz anderen literarischen Charakter hat als etwa ein Paulusbrief. Bei Paulus finden wir eine Vielheit und Ungezwungenheit der Gedankenführung … Im Hebr dagegen haben wir ein einheitliches Thema, das von Anfang an bis zu Ende durchgeführt wird, eine Art theologischer Untersuchung, die sich kunstvoll aufbaut und die keineswegs an einen Brief erinnert.“1
Der Verfasser selbst spricht davon, dass er eine Rede hält:
• 2,5: „Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden.“
• 5,11: „Darüber haben wir viel zu sagen, und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid.“
• 6,9: „Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt.“
• 13,22: „Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung! Denn ich habe euch ja kurz geschrieben.“
Zudem hat der Hebr keinen Briefeingang (Angaben über Absender und Adressaten, Eingangsgruß etc.). Allerdings endet er wie ein Brief: mit anschließenden Ermahnungen, Segenswünschen und Grüßen (13,18-25).2 Außerdem kannte man in der Umwelt des Neuen Testaments auch Briefe ohne Briefeingang (im NT vgl. Jak, 2 Pt, 1 Joh).3 Handelt es sich also doch um einen Brief?
Da der Hebr einerseits eine Rede ist, anderseits aber typische Elemente eines Briefes aufweist, ist auch denkbar, dass es sich hier um eine Predigt handelt, die dann aber verschickt wurde. Sie „konnte nicht gehalten werden, weil der Verfasser nicht bei der Gemeinde sein konnte. Ihm liegt aber sehr daran, dass seine Verkündigung doch ihren Dienst ausrichtet, darum schickt er die Predigt mit einem Briefschluss an seine … Gemeinde. Die Predigt soll vorgelesen werden und die Anwesenheit des Verfassers ersetzen.“1
Wer ist der Verfasser?
Der Name des Verfassers wird nicht genannt. Trotzdem bewegte die Verfasserfrage von Anfang an die Gemüter, weil sie eng mit der Frage nach der Autorität und Kanonizität des Hebr verbunden war. „Wer den Hebr als kanonische Schrift haben wollte, der musste ihn als apostolisch ausgeben.“2
Daher wurde in der Ostkirche, in der man dieses Schreiben sehr schätzte, die paulinische Verfasserschaft behauptet (wobei man die Unterschiede zu den übrigen Paulusbriefen z.B. damit erklärte, dass Paulus mit Hilfe eines Übersetzers gearbeitet habe). In der Westkirche wurde er – „ganz eindeutig unter dem bestimmenden Einfluss der Kirche des Ostens“3 – aber erst ab Mitte des vierten Jahrhunderts als kanonisch (und paulinisch) anerkannt.
Martin Luther hat den Hebr zunächst als paulinisches Schreiben betrachtet, diese Auffassung aber später revidiert. Für Johannes Calvin gehört der Hebr zu den apostolischen Schriften – auch wenn er aus seiner Sicht nicht von Paulus stammt. In der protestantischen Orthodoxie des 17. und 18. Jahrhunderts wird die paulinische Verfasserschaft jedoch klar befürwortet. Anschließend aber setzt sich die kritische Position endgültig durch. Im Katholizismus ist dies allerdings erst nach dem zweiten Vaticanum der Fall.
Auch andere Vorschläge bzgl. des Verfassers wurden – und werden – diskutiert (Clemens, Silas, Apollos, Petrus, Philippus, Silvanus, Aristion, Prisca, Judas, Maria). Jedoch konnte sich bisher keiner dieser Vorschläge durchsetzen.
Welche Informationen über den Verfasser können wir dem Hebr selbst entnehmen? Klar ist, dass der Verfasser – wie auch die Empfänger des Schreibens – zur nachapostolischen Generation gehört. So heißt es in 2,3: „… wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben …“ Hier ist von drei Phasen bzw. Generationen die Rede:
• Der Verkündigung der Rettungsbotschaft „durch den Herrn“.
• Der Bestätigung dieser Botschaft durch die Augen- und Ohrenzeugen.
• Der Empfang dieser Bestätigung in der Gegenwart.
Für die Verfasserfrage ist außerdem die Schlussnotiz interessant (13,18-25): „(18) Betet für uns! Denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. (19) Ich bitte euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. (20) Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, (21) vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (22) Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung! Denn ich habe euch ja kurz geschrieben. (23) Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. (24) Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen! Es grüßen euch die von Italien. – (25) Die Gnade sei mit euch allen!“
Diese Verse zeigen, dass der Verfasser von den Adressaten getrennt ist, aber davon ausgeht, sie demnächst wieder zu sehen. Auch Timotheus wird erwähnt, der Schüler des Apostels Paulus. Er ist offenbar „freigelassen“ worden und wird ebenfalls „bald“ die Adressaten treffen. Außerdem hat der Verfasser zu Gemeindegliedern „von Italien“ Kontakt. Das zeigt zumindest, in welchem Umfeld sich der Verfasser bewegt hat.
Diskutiert wird auch die Frage, von welchen religiösen Traditionen der Verfasser – neben denen der übrigen neutestamentlichen Schriften – beeinflusst ist. Dabei wird auf (vermeintliche) Ähnlichkeiten zur Gnosis, zur frühjüdischen Apokalyptik und zum jüdisch-alexandrinischen Platonismus hingewiesen.
Zeit und Ort der Abfassung
Wenn der Verfasser zur nachapostolischen Generation gehört, spricht dies gegen eine Frühdatierung. Allerdings gibt es auch „nach hinten“ eine Grenze: den ersten Clemensbrief.
Wie der folgende Vergleich zeigt, ist der erste Clemensbrief offenbar vom Hebr abhängig:
1 Clem
Hebr
36,2-5: (2) Durch ihn streben wir standhaft nach den Höhen des Himmels, durch ihn schauen wir sein heiliges und erhabenes Antlitz, durch ihn wurden die Augen unseres Herzens geöffnet, durch ihn ringt sich unser unweiser und dunkler Verstand durch zum Licht, durch ihn wollte der Herr uns kosten lassen von dem unsterblichen Wissen, der, „da er der Abglanz ist seiner Majestät, um soviel größer ist als die Engel, um wieviel sein Name sich unterscheidet, den er erhalten hat“. (3) Es steht nämlich also geschrieben: „Der Geister zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern“. (4). Zu seinem Sohne aber sprach der Herr also: „Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt; verlange von mir, und ich will dir Völker geben zum Erbe und zu deinem Besitze die Enden der Erde“. (5) Und wiederum sagt er zu ihm: „Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege“
1,3-5.7.13: (3) er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; (4) und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. (5) Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: »Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt«? und wiederum: »Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein«? (7) Und von den Engeln zwar spricht er: »Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme«,(13) Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: »Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße«?
36,1: Das ist der Weg, Geliebte, auf dem wir unser Heil finden, Jesus Christus, den Hohenpriester unserer Opfergaben, den Anwalt und Helfer in unserer Schwäche.
2,18: denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.3,1: Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus,
17,5: (5) Moses wurde treu in seinem (Gottes) ganzen Hause genannt, und durch seinen Dienst strafte Gott Ägypten durch die Geißeln und Plagen, (die er) gegen sie (sandte); aber auch er führte, obwohl hochgeehrt, keine hochfahrenden Reden, sondern sprach, als ihm die Offenbarung im Dombusch gegeben wurde: „Wer bin ich, dass Du mich sendest? Ich habe eine schwache Stimme und eine schwere Zunge"43,1: (1) Und ist es zu verwundern, wenn die von Christus mit einem solchen Werke Betrauten die oben Genannten eingesetzt haben? Da ja auch der selige Moses, „der getreue Diener im ganzen Hause“, die an ihn ergangenen Befehle sämtlich in den heiligen Büchern verzeichnet hat, dem auch die übrigen Propheten gefolgt sind, indem auch sie Zeugnis geben für das, was von ihm gesetzlich angeordnet wurde.
3,2.5: (2) der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause! … (5) Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu – zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte –,
56,2-3.16: (2) Wir wollen, Geliebte, die Zurechtweisung annehmen, über die sich niemand ärgern darf. Die Ermahnungen, die wir einander gegenseitig geben, sind gut und überaus nützlich; denn sie verbinden uns mit dem Willen Gottes. (3) Denn also sagt das heilige Wort: "Gar sehr hat mich der Herr in Zucht genommen, aber dem Tode hat er mich nicht preisgegeben".(16) Ihr sehet, Geliebte, wie stark der Schutz ist für die, welche der Herr in seine Zucht nimmt. Da er nämlich ein guter Vater ist, züchtigt er, damit wir durch seine heilige Zucht Erbarmen finden.
12,4-11: (4) Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden (5) und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: »Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst! (6) Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt.« (7) Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? (8) Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. (9) Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? (10) Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. (11) Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.
1,3: Denn ohne Ansehen der Person tatet ihr alles und nach den Gesetzen des Herrn war euer Wandel, da ihr untertänig waret euren Vorgesetzten und die geziemende Ehrfurcht euren Priestern erzeigtet; die Jungen wieset ihr an, eine gemäßigte und heilige Gesinnung zu hegen, den Frauen befahlet ihr, alles in einem tadellosen, heiligen und reinen Gewissen zu tun und ihre Männer in der richtigen Weise zu lieben; auch lehrtet ihr sie, in den Schranken der Unterwürfigkeit sich zu halten und das Hauswesen würdevoll zu besorgen und sich in jeglicher Hinsicht verständig zu benehmen.21,6: Unseren Herrn Jesus Christus, dessen Blut für uns hingegeben wurde, wollen wir verehren, unsere Vorgesetzten wollen wir achten, die Älteren ehren, die Jugend wollen wir erziehen in der Zucht der Gottesfurcht, unsere Frauen wollen wir zum Guten anleiten:
13,7.17.24: (7) Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben! Schaut den Ausgang ihres Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach!(17) Gehorcht und fügt euch euren Führern! Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn dies wäre nicht nützlich für euch.(24) Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen! Es grüßen euch die von Italien.
Der erste Vers des 1. Clemensbriefes zeigt, dass er kurz nach einer Zeit der Verfolgung – gemeint ist vermutlich die Christenverfolgung durch Kaiser Domitian (81-96 n.Chr.) – verfasst wurde: „Wegen der plötzlichen und einander nachfolgenden Drangsale und Leiden bei uns, Brüder, glauben wir, etwas lässig sein zu dürfen, bis wir unsere Aufmerksamkeit den bei euch lebhaft verhandelten Dingen zuwendeten; wir meinen, Geliebte, den für die Auserwählten Gottes unpassenden und fremdartigen, den ruchlosen und unseligen Streit, den einige wenige hitzige und verwegene Leute, die da sind, bis zu einem solchen Grade von Unverstand angefacht haben, dass euer ehrwürdiger, hochgerühmter und bei allen Menschen beliebter Name in hohem Grade beschimpft wurde.“ Weil der Verfasser des ersten Clemensbriefes den Hebr kannte, bedeutet das, dass dieser vermutlich einige Jahre vorher entstanden ist.
Eine genauere Bestimmung der Abfassungszeit ist kaum möglich. Zwar hat man gemeint, dass die Aussagen des Hebr über den Kult das Bestehen des Tempels in Jerusalem voraussetzen. Aber das ist eine unsichere Annahme und reicht keinesfalls aus, das Schreiben in die Zeit vor dessen Zerstörung, also vor 70 n. Chr., zu datieren. Fest steht nur, dass auf Verfolgungen zurückgeblickt wird und auch von zukünftigen Verfolgungen der Adressaten die Rede ist:
• 10,32-34: „(32) Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, (33) als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging! (34) Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt.“
• 12,4: „Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden.“ „Darum ist es realistisch, die Abfassung des Hebr in den achtziger oder neunziger Jahren anzunehmen.“1
Als Abfassungsort kommt Italien bzw. Rom in Frage – wegen der Nähe zum ersten Clemensbrief, der ebenfalls dort verfasst wurde, und aufgrund der Grüße durch „die von Italien“ (13,24).
Die Adressaten
„Drei Fragen vor allem sind in diesem Zusammenhang umstritten:
1. Welche Bedeutung für die Adressatenfrage hat die zwar nicht ursprüngliche, aber doch schon früh bezeugte Inscription Πρὸς Ἑβραίους [An die Hebräer]?
2. Sind die ursprünglichen Adressaten des Hebr Judenchristen oder Heidenchristen gewesen?
3. Wird im Hebr eine für das nachapostolische Zeitalter insgesamt typische oder eine ganz konkrete, möglicherweise sogar singuläre Situation vorausgesetzt?“1
Zur ersten Frage: Mit „an die Hebräer“ können nur aus dem Heiligen Land stammende Juden bzw. Judenchristen gemeint sein. Die Frage ist aber, welchen Stellenwert diese Überschrift für die Klärung der Frage nach den Adressaten hat. Schließlich ist sie nicht Teil des Schreibens und der Begriff „Hebräer“ wird dort nicht verwendet. So erscheint es schwierig, allein aufgrund der Überschrift eine Entscheidung zu treffen.
Zur zweiten Frage: Hier sind die Bibelwissenschaftler geteilter Meinung.
• Ausleger, die den Hebr als an Judenchristen gerichtet verstehen, weisen „durchgängig auf den zentralen Inhalt des Hebr“ hin, „insbesondere auf die schriftgelehrte Argumentation des Autors, die als solche auf seiten der Adressaten eine intensive Kenntnis der Schrift, und zwar auch in ihren kultgesetzlichen Partien, voraussetzte und somit von vorherein auf einstige Juden (oder sogar jüdische Priester) schließen lasse“2.
• Zu den Gegenargumenten zählt die Beobachtung, dass die Adressaten nicht vor einem Rückfall ins Judentum, sondern vor einem Abfall vom Glauben überhaupt gewarnt werden (3,12: „Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens ist im Abfall vom lebendigen Gott“).
Außerdem ist die Elementarbelehrung von 6,1-2 („(1) Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, (2) der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.“) „nur in einem an Heidenchristen gerichteten Schreiben sinnvoll“.3
Zur dritten Frage: Allgemeiner Hintergrund ist das nachapostolische Zeitalter (s.o.). Konkret ist von Glaubensmüdigkeit, Leidensscheu, Abstumpfung, nachlassender Hoffnung, Zurückweichen, Gefahr der Glaubensaufgabe, Zweifel an den Verheißungen die Rede – was gut zu den Herausforderungen des Christseins in der dritten Generation und den Herausforderungen im letzten Drittel des ersten nachchristlichen Jahrhunderts passt. Dabei sind vor allem folgende Aussagen von Bedeutung:
• 5,11: „Darüber haben wir viel zu sagen, und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid.“
• 6,12: „damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben.“
• 10,23: „Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten - denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat -,“
• 10,26: „Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig,“
• 10,35-39: „(35) Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. (36) Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. (37) Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. (38) ‚Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben ‘ und: ‚Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben.‘ (39) Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens.“
Hintergrund ist vermutlich die „Erfahrung … des Widerspruchs zwischen eschatologischer Hoffnung und dem tatsächlichen Verlauf der Geschichte mit ihren Pressionen für den Glaubenden“1. Oder anders formuliert: „Die Gemeinde ist darüber befremdet, dass die ihr verheißene Herrlichkeitsoffenbarung nicht sichtbar in Erscheinung tritt und ihr stattdessen nur immer neue Drangsal widerfährt (…).“2
Finden sich darüber hinaus Hinweise auf eine spezielle Situation der Adressaten? Hier kann man auf die Aussagen hinweisen, die von einer akuten Gefährdung der Adressaten durch Verfolgungen sprechen:
• 10,32-34: „(32) Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, (33) als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging! (34) Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt.“
• 12,4: „Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden.“
Einige Verse können auch so verstanden werden, dass sich der Verfasser an eine bestimmte Gruppe innerhalb einer Gemeinde wendet, die sich in einer speziellen Krise befindet:
• Wenn er also z.B. dazu aufruft, sich um den „Frieden mit allen“ zu bemühen (12,14), kann sich das möglicherweis auf das Verhältnis zu anderen Teilen der Gemeinde beziehen – zumal anschließend davor gewarnt wird, dass „irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosst“ (12,15).
• In den abschließenden Grüßen heißt es: „Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen!“ (13,24). Bedeutet das, dass diese Gruppe ihre eigenen „Führer“ hatte? Stand sie möglicherweise in Gefahr, sich vom Rest der Gemeinde zu trennen (10,24-25: „(24) und lasst uns aufeinander achthaben …, (25) indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist …“).
Diese Andeutungen sollten aber nicht überinterpretiert werden.
Gliederung
Typisch für den Hebr ist, dass er ein zentrales Thema behandelt und dabei regelmäßig zwischen Lehre (L) und Paränese/Ermahnung (P) wechselt. Daraus ergibt sich folgender Vorschlag für eine Gliederung:
1
Gottes endgültige Rede in seinem Sohn (1,1-4,13)
1.1
L: Die Größe und Überlegenheit Jesu (1,1-14)
1.2
P: Die größere Verantwortung aufgrund der größeren Offenbarung (2,1-4)
1.3
L: Die Erniedrigung des Sohnes unter die Engel als Vorbedingung seiner hohenpriesterlichen Stellung über den Engeln (2,5-18)
1.4
L: Christus – höher als Mose (3,1-6)
1.5
P: Das warnende Beispiel des Unglaubens Israels (3,7-4,13)
2
Jesus, der wahre Hohepriester (4,14-10,18)
2.1
P: Der mitleidende Hohepriester als Grund für das Festhalten am Bekenntnis (4,14-16)
2.2
L: Jesus erfüllt die Voraussetzungen für das Hohepriestertum (5,1-10)
2.3
P: Aufruf zu vertiefter Glaubenserkenntnis und zum Festhalten des Glaubens (5,11-6,20)
2.4
L: Jesus, der himmlische Hohepriester (7,1-10,18)
2.5
P: Aufruf zu freimütigem Glauben (10,18-39)
3
Aufruf zur Glaubenstreue (10,19-12,29)
3.1
P: Am Glauben festhalten (10,19-39)
3.1
L: Der Glaube in alttestamentlicher Zeit (11,1-40)
3.2
P: Mit Ausdauer laufen (12,1-29)
4
Brieflicher Schluss (13,1-25)
4.1
P: Das Miteinander und die persönliche Lebensführung (13,1-6)
4.2
P: Im rechten Glauben bleiben (13,7-21)
4.3
Persönliches Schlusswort (13,22-25)
Der erste Hauptteil hat „die Funktion einer Grundlegung und Hinführung der Leser zum eigentlichen Thema“1, im zweiten Hauptteil wird das eigentliche Thema behandelt und der dritte Hauptteil stellt die Mahnung zum Glauben in den Mittelpunkt.
1 Michel, 21.
2 In der Bibelwissenschaft wird allerdings auch die Auffassung vertreten, dass es sich beim Abschnitt 13,18-25 um einen späteren Nachtrag „von fremder Hand“ handelt, das diesem „Schreiben paulinische Dignität sichern soll“ (Gräßer I, 18) – und der Hebr daher als Rede zu verstehen ist. Diese Auffassung ist aber umstritten, z.B. weil „kaum verständlich wäre, warum der spätere Redaktor dem Hebr nicht noch deutlicher den paulinischen Stempel (etwa auch durch Hinzufügung eines Präskripts) aufgeprägt hat.“ (Weiß, 38).
3 Hegermann, 2.
1 Michel, 35.
2 Gräßer I, 19.
3 Weiß, 123.
1 Gräßer I, 25.
1 Weiß, 67.
2 Weiß, 71.
3 Weiß, 71.
1 Weiß, 72f.
2 Goppelt, 574.
1 Weiß, 49.
1 Gottes endgültige Rede in seinem Sohn (1,1 -4,13)
„Der Verfasser beginnt seine großangelegte Mahnpredigt mit einem relativ grundsätzlich gehaltenen ersten Teil. Er ruft hier den bei den Hörern in Geltung stehenden Glauben an Jesus den Sohn Gottes in Erinnerung und stellt dabei die Größe des den Hörern verkündeten Heils vor Augen.“1
1.1 Einfach überragend (1,1-14)
Lohnt es sich, Christ zu sein? Auf diese Frage will der Autor des Hebr eine Antwort geben.
Er tut das auf eine besondere Weise. Anstatt auf die Vorteile hinzuweisen, die der christliche Glaube für den Einzelnen hat, zeigt er, dass Jesus Christus selbst unvergleichlich ist.
Warum macht er das? Nicht nur, weil ihm bewusst ist, dass den Vorteilen immer Nachteile gegenüberstehen und Christen nicht selten sogar mit zusätzlichen Herausforderungen zu tun haben (in seiner Zeit vor allem die Verfolgung um des Glaubens willen). Er macht das, weil er weiß: Christen, die sich fragen, ob sich die Sache mit Gott für sie überhaupt noch lohnt, werde ich nur überzeugen, wenn ich ihnen neu vor Augen führe, was es mit diesem Jesus Christus auf sich hat, an den sie doch glauben.
Dabei geht es ihm allerdings nicht etwa um eine geeignete Überzeugungstaktik, sondern um die Einsicht, dass sich alles an Jesus Christus selbst entscheidet. Das ist so, wenn jemand Christ wird – und das wird auch so sein, wenn sich ein Christ die Frage stellt, ob sich das Christsein noch lohnt und ob er dabei bleiben soll. „Es kann uns nichts in der christlichen Gemeinde festhalten, wenn Jesus für uns Wert und Bedeutung verloren hat, aber auch nichts uns von ihr trennen, wenn wir ihn erkannt haben in der Größe seiner Person und seines Werks.“2
1.1.1 Die Überlegenheit des Sohnes (1,1-4)
(1) Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, (2) hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat; (3) er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; (4) und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat.
Ein Vergleich, der zu denken gibt (1,1-2a)
Die ersten vier Verse bestehen aus einem einzigen Satz. In ihm stellt der Schreiber einen Vergleich an.
Bei einem Vergleich stehen die Unterschiede im Mittelpunkt. Aber es gibt immer auch Gemeinsamkeiten. Hier besteht die Gemeinsamkeit darin, dass Gott nicht stumm ist, sondern redet. Aber wie er redet und wann er das tut – das ist ganz unterschiedlich. Dabei gibt es auch Qualitätsunterschiede.
„Ehemals“ bzw. „in vergangenen Zeiten“ (Schl2000) hat er „zu den Vätern geredet“. Bereits dieser Begriff enthält vermutlich ein Werturteil. Jedenfalls wird im Hebräerbrief immer wieder die Überlegenheit des Neuen gegenüber dem Alten betont – besonders drastisch in 8,13: „Indem er von einem ‚neuen‘ Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe.“
Gleiches gilt für die Aussage, dass Gott sich in alter Zeit „vielfältig und auf vielerlei Weise“ offenbart hat. Immer wieder stellt der Autor den Vorteil der Einzahl bzw. der Einmaligkeit vor der Mehrzahl bzw. Mehrmaligkeit heraus.1 Mit „vielfältig“ kann die Vielzahl der Offenbarungsträger gemeint sein, mit „vielerlei Weise“ die Mannigfaltigkeit der Offenbarungsweisen (Träume, Visionen, Auditionen, Mitteilungen von Engeln etc.). Dabei hat Gott sich der Propheten bedient.1 Durch sie hat er in alter Zeit „vielfältig und auf vielerlei Weise … zu den Vätern geredet“.
„Die Vielzahl der Wortvermittler und die Vielfalt der Redeweisen sind nicht nur Zeichen für den Reichtum der Wortkundgaben, die den Vätern zuteil wurde, sie sind auch Zeichen für das unabgeschlossene und vorläufige Reden Gottes durch die Propheten.“2
Nun zum Vergleich. Vers 1 steht nicht für sich allein, sondern soll zur Hauptaussage hinzuführen und dient als Hintergrund, auf dem „sich das alles überragende Reden Gottes im Sohn scharf abzeichnen soll“3.
Ging es eben um das, was Gott „ehemals [bzw. in alter Zeit] zu den Vätern geredet hat“, so jetzt um das, was er „am Ende dieser Tage zu uns geredet“ hat. Mit dem „Ende dieser Tage“ ist die Endzeit gemeint, in der die jetzige Weltzeit zu Ende geht und die mit Jesu Wirken angebrochen ist (vgl. 9,26). Es geht um die „abschließende und ein für alle Mal gültige Offenbarung im Sohn“.4 Dabei klingt eine besondere Dringlichkeit mit. Wenn Gott „am Ende dieser Tage“ zu uns redet, gewährt er damit „eine letztmalige Chance, die es entsprechend wahrzunehmen gilt“5.
Hatte Gott in alter Zeit „vielfältig und auf vielerlei Weise“ durch die „Propheten“ zu den Menschen gesprochen, hat er nun „im Sohn“ geredet. Das ist natürlich eine „andere Qualitätsstufe“: „Das Reden Gottes im Sohn ist nicht mehr eine austauschbare Form seiner Selbstkundgabe, sondern die absolut gültige …“6.
Die „andere Qualitätsstufe“ des Sohnes (1,2b-4)
Was hat es mit diesem Sohn auf sich? Dazu weist der Hebr auf sieben Punkte hin:
Zunächst heißt es, dass Gott ihn „zum Erben aller Dinge eingesetzt hat“. Dieser Hinweis steht wahrscheinlich deshalb an erster Stelle, weil Sohnschaft und Erbschaft eng miteinander verbunden sind (vgl. Ps 2,7-8; Röm 8,17; Gal 4,7).
Die Pointe ist: Gott hat seinem Sohn Jesus Christus „einen verlässlichen Rechtsort“ bzw. Rechtstitel gegeben, „auf den sich seine Umgebung einzustellen hat“.1 Er steht als Erbe „aller Dinge“ fest. Dabei darf folgende Botschaft mitgehört werden: „Als derjenige, den Gott bereits zum ‚Erben aller Dinge‘ eingesetzt hat, ist der ‚Sohn‘ zugleich der Garant für das Erlangen der Verheißung des ‚Erbes‘ seitens der Christen.“2.
Wann ist der Sohn „zum Erben aller Dinge eingesetzt“ worden? Nicht bereits von Anfang an. Sondern: „Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat“, hat er sich „zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt“ und einen „vorzüglicheren Namen … geerbt“ (1,3-4).
Zweitens erinnert er daran, dass Gott durch ihn „auch die Welten gemacht hat“. An dieser Stelle steht nicht das Wort „Kosmos“, sondern der Begriff „Äon“ (αἰών). Er wird oft mit „Weltzeit“ übersetzt. Im Hebräerbrief findet sich dieser Begriff auch in 11,3: „Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist.“ Hier geht es daher „weniger um Weltzeiten und Weltperioden als – mehr räumlich – um die sichtbare und unsichtbare Welt“3. Gemeint ist die Schöpfungsmittlerschaft des Sohnes, von der auch Paulus (1 Kor 8,6; Kol 1,15-16) und Johannes sprechen (Joh 1,3).
Der Sohn, den Gott „zum Erben aller Dinge eingesetzt hat“, ist also auch derjenige, durch den er „die Welt gemacht hat“. „Die Welt ist nicht bloß für ihn bestimmt, sondern auch durch ihn entstanden.“4 „Vom Anfang und vom Ende her umgreift somit der Sohn das All als Weltherrscher.“5 Und das bedeutet gleichzeitig: „Anfang und Ende des Weges der Christen in der Welt“ stehen „in einem christologischen Horizont“. Der „Welt und allem Weltlichen“ kommt „keine Eigengesetzlichkeit“ mehr zu.6 Christus ist das A und das O, „der Anfang und das Ende“ (Offb 21,6; 22,13), und hat alles in seiner Hand.
Ging es in den ersten beiden Aussagen um die Stellung des Sohnes in der Welt, ist anschließend davon die Rede, wer der Sohn in Beziehung zu Gott ist. Er ist „Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens“.
Dabei handelt es sich um einen Parallelismus:
Ausstrahlung (gr. ἀπαύγασμα)(andere Übers.: Abglanz)
Abdruck (gr. χαρακτήρ)(andere Übers.: Abbild)
seiner Herrlichkeit (gr. δόξα)andere Übers.: Ehre, Glanz)
seines Wesens (gr. (ὑπόστασις)(andere Übers.: Wirklichkeit)
Die „Herrlichkeit“ (δόξα) ist der göttliche Lichtglanz oder die göttliche Ehre (vgl. 2,9.10; 3,3; 13,21). Sie leuchtet in Jesus, dem Sohn Gottes, unübersehbar auf.
Aber inwiefern ist Jesus „Abdruck seines [Gottes] Wesens“? Das griechische Wort, das hier mit „Wesen“ übersetzt wird, findet sich auch in 11,1: „Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.“ Dort geht es um die „unzweifelhafte (…) Realität seiner jenseitigen Wirklichkeit“1.
Dementsprechend wird in 1,3a gesagt: Der Sohn ist „Abdruck“ der „ewigen, jenseitigen göttlichen Wirklichkeit“2 bzw. „die schlechthin gültige Offenbarung der jenseitigen Wirklichkeit Gottes“3. Gottes Wesen „prägt sich aus in einem Merkzeichen“. Dieses Merkzeichen ist Jesus Christus. Er „allein ist die Gestalt, die sichtbar macht, was Gott ist“.4
Die beiden parallel formulierten Formeln betonen also, dass wir in Jesus Christus Gott selbst sehen.
Viertens „trägt“ der Sohn „alle Dinge [bzw. das All] durch das Wort seiner Macht“. Gemeint ist wohl, dass er das All vor dem Zerfall bewahrt.5 „Alles würde zerfallen, nichts käme auf gutem Weg zum rechten Ziel, wäre es nicht gehalten von der Hand des Christus. Wie trägt er für alle Dinge Sorge, und wie gibt er jeder Kreatur Bestand? … Durch sein Wort gibt er allem seinen Platz und zeigt allem seine Bahn … Spricht er zu uns: Lebe! das gibt uns Leben; schilt er uns, das bindet uns in Ohnmacht und Tod. Wollten wir ihn lassen oder sein Wort verachten, so würden wir uns von der Wurzel trennen, aus der für uns und die ganze Welt das Leben und Gedeihen kommt.“1
Fünftens hat der Sohn „eine Reinigung von den Sünden vollbracht“. Wenn das nicht so wäre, „hätten wir von ihm keinen Gewinn. Gottes Herrlichkeit leuchtet in ihm; kann ihr Glanz auch uns verklären, während wir doch Sünder sind? Gott wird durch ihn offenbar; sollen auch wir Gott schauen, die wir gesündigt haben? Er nimmt sich in der Macht Gottes aller Dinge an und trägt sie alle, dass sie alle Bestand und Kraft erhalten aus ihm; gibt es auch für uns bleibenden Bestand und lebendiges Gedeihen, für uns Sünder? Es muss noch etwas Weiteres geschehen, damit das Wesen und Werk des Sohnes uns zugute kommt. Noch eine Tat gehört zur Ausrichtung seines heiligen Amts, und er hat sie vollbracht, die große Tat des irdischen Lebens Jesu, die Frucht seiner Erscheinung im Fleisch, der Gewinn seines Leidens, Sterbens und Auferstehens: er stellte eine Reinigung von den Sünden her.“2
Das Verb steht hier nicht Präsens (wie in 3ab), sondern im Aorist und bezeichnet daher ein punktuelles, einmaliges Geschehen. Gemeint ist der Tod Jesu am Kreuz bzw. die reinigende Wirkung seines Blutes, das er dort vergossen hat (9,14: „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient!“; 9,22-23: „(22) und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. (23) Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese.“). Die Sühnung der „Sünden“ ist zentrales Thema des Hebräerbriefes (vgl. 2,17; 5,1).
Sechstens: Der Sohn hat sich „zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt“. Damit ist er Mitregent Gottes und hat Anteil an seiner Größe.
Das ist der Höhepunkt aller Aussagen über die Stellung und Bedeutung des Sohnes.3 Außerdem sind die „Reinigung von den Sünden“ bzw. sein Tod am Kreuz und das Setzen „zur Rechten der Majestät in der Höhe“, auch an anderer Stelle eng miteinander verbunden (10,12: „Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes.“; 12,2: „indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.“).
Wann hat der Sohn sich „zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt“? Nachdem er am Kreuz „eine Reinigung von den Sünden vollbracht“ hat (zur Reihenfolge vgl. auch 10,12; 12,2). Auf das Kreuz folgt seine Erhöhung.
Und schließlich: Als derjenige, der sich „zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt“ hat, ist er mit einem besonderen „Namen“ ausgezeichnet worden (vgl. Phil 2,9-10: „(9) Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, (10) damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge …“).
Welcher Name ist gemeint? Das wird nicht ganz deutlich. Im unmittelbaren Zusammenhang finden sich die Bezeichnungen „Sohn“ (1,5), „Gott“ (1,8) und „Herr“ (1,10). Entscheidend ist, dass es sich um einen außergewöhnlichen Namen handelt, der die Hoheit Jesu unterstreicht – und um einen „vorzüglicheren Namen“ im Vergleich zu den Namen, die den Engeln verliehen werden.
In der Besonderheit seines Namens spiegelt sich die Überlegenheit des Sohnes, der sich „zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt“ hat, über die Engel.1 Er „ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat“.
„Woran der Autor des Hebr vor allem interessiert ist, ist die möglichst umfassende Herausstellung der alles überragenden und einschließenden Größe und Einzigartigkeit des ‚Sohnes‘. Seit der Erhöhung trägt der ‚Sohn‘ bleibend solchen ‚Namen‘, der ihn von allen weltlichen und nicht-weltlichen Mächten und Wesenheiten unterschieden sein lässt.“2
Der Sohn, durch den Gott end- und letztgültig geredet hat, ist der Anfang und das Ende und Gott gleich. Er hat alles in seiner Hand, hat sich nach seinem Tod am Kreuz, der zur „Reinigung von den Sünden“ geschah, zur Rechten Gottes gesetzt und ist mit einem göttlichen Namen ausgezeichnet worden. Der Sohn überragt alle und alles und ist einfach unvergleichlich. Deshalb lohnt es sich, Christ zu sein.
1.1.2 Warum der Sohn den Engeln überlegen ist (1,5-14)
(5) Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: "Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt"?, und wiederum: "Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein"? (6) Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er: "Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!"
(7) Und von den Engeln zwar spricht er: "Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme", (8) von dem Sohn aber: "Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches;
(9) du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat dich, Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten.“ (10) Und: "Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände; (11) sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten wie ein Gewand,
(12) und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören."
(13) Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: "Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße"? (14) Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen?
„Denken heißt Vergleichen“ (Walter Rathenau). Wenn wir denken, sind wir – unter anderem – damit beschäftigt, zu vergleichen. Wir entdecken ganz unterschiedliche Dinge und fragen uns, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Was ist größer, schneller, wichtiger?
Auch der Hebr vergleicht. Das hat er auch schon im ersten Satz getan (1,1-4). Aber in den Versen 5-14 geht es ausschließlich um Vergleiche. Drei Mal stellt der Schreiber Jesus Christus, den Sohn Gottes, und die Engel gegenüber.
Dabei argumentiert er jeweils mit Aussagen der Heiligen Schrift. Allerdings haben wir hier – zumindest teilweise – „eine überraschende Auslegung der alttestamentlichen Schrift vor uns. Der Mann, der hier spricht, hat die Bibel anders gelesen als wir. Wir müssen zunächst allen Fleiß daran wenden, das Wort der Propheten und Apostel so zu fassen, wie sie es gegeben haben, und ihren Gedanken genau in uns zu wiederholen. Wir lesen die Schrift als die Lernenden, die sich klarmachen möchten, was diese Worte nach der Absicht der heiligen Männer bedeuteten und was sie uns damit ans Herz legen wollten, und wir haben gelernt, wie nützlich uns hierbei die geschichtliche Kunst und Übung ist, die uns auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen Zeiten und Männern achtsam macht. Die Auslegung unseres Briefes ist anderer Art. Denn er liest die Schrift nicht als ein Schüler, sondern als ein Meister, und ein Meister ist er deshalb, weil er Jesus kennt. Sein Auge ruht auf zwei Dingen und verbindet sie; hier auf dem Schriftwort, dort auf Jesus, dessen Erhabenheit und Herrlichkeit ihm aufgedeckt ist. Eins macht das andere hell, wichtig und groß. Jesus wird ihm groß um deswillen, was die Schrift über ihn sagt, weil er die Tat und Wahrheit hat zu jeden großen Worten der Schrift. Die Schriftworte werden ihm groß, neu und reicher als das, was sie anfänglich bedeuteten, um deswillen, was er an Jesus sieht; erst dadurch kommt ganz ans Licht, was Gottes Regierung und Wille in demselben war.“1
Wenn der Hebr mit Hilfe der Schriftworte zwischen Jesus Christus, dem Sohn, und den Engeln vergleicht, hat er dabei eigentlich nur ein Anliegen: die Größe Jesu Christi herauszustellen. Es geht ihm also nicht um die Engel „als solche“ – sie dienen lediglich als Vergleichsgröße. In Kapitel 3 vergleicht er Jesus Christus auch mit einer anderen Größe: Mose. Mit wem er Jesus Christus vergleicht, scheint also nicht so wichtig zu sein. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt und immer wieder deutlich wird, dass wir es in Jesus Christus mit einer ganz anderen „Kategorie“ zu tun haben.
Der Sohn ist erhöht (1,5-6)
Drei Worte Gottes bzw. Schriftzitate – zwei über Engel und eins über den Sohn. Bei den beiden Schriftworten über die Engel will der Autor allerdings „nur“ darauf aufmerksam machen, was Gott nicht über sie gesagt hat.
Das erste Zitat über die Engel: „Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt“. Dieser Satz stammt aus Ps 2,7. Dort bezieht er sich auf die Einsetzung des Königs. Er wird auch in Apg 13,32f. zitiert – als Schriftbeleg für die Auferstehung Jesu. Was aber ist im Hebräerbrief gemeint? Er findet sich auch in Hbr 5,5: „So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hoher Priester zu werden, sondern der, weicher zu ihm gesagt hat: ‚Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.‘" Dort geht es um die Einsetzung Jesu Christi zum Hohepriester. Dementsprechend dient dieses Zitat auch in 1,5 dazu, die Erhöhung bzw. Einsetzung Jesu Christi in der himmlischen Welt zu belegen.
Das zweite Zitat über die Engel: „Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein …“. Es stammt aus 2 Sam 7,14. Dort geht es um Salomo. Der Prophet Nathan richtet König David eine Verheißung Gottes für seinen Sohn aus: Gott wird ein Vater für ihn sein und Salomo als König ein Sohn Gottes. Im Hebräerbrief wird diese Aussage natürlich auf den erhöhten Jesus Christus bezogen.
Für beide Zitate gilt: So hat Gott niemals zu einem der Engel gesprochen. Und das bedeutet: Der Sohn ist einzigartig und den Engeln überlegen.
Ganz anders aber spricht Gott über den „Erstgeborenen“ – gemeint ist natürlich Jesus Christus, „der Erstgeborene aus den Toten“ (Kol 1,18) –, wenn er ihn „wieder in den Erdkreis einführt“: Denn dann „spricht er: ‚Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!‘“. In diesem Zitat wird „offenbar, dass die Schrift die Engel in ein anderes Verhältnis zu Gott setzt als den Sohn. Zwischen dem Wort, das sich an Christus wendet: Du bist mein Sohn! und dem, das sich an die Engel richtet: Betet Christus an! ist ein großer Unterschied, und dieser Unterschied gibt ein Maß für die Erhabenheit Jesu über alles, was im Himmel ist.“1
Das Zitat „und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!“ stammt aus Dtn 32,43, wird im Hebräerbrief aber stark verändert wiedergegeben.2
Was aber bedeutet es, dass Gott den Erstgeborenen „wieder in den Erdkreis einführt“?
• Ist damit die Menschwerdung Jesu gemeint? Dagegen spricht, dass Jesus nach Aussage des Hebräerbriefs bei seiner Menschwerdung und Passion „ein wenig unter die Engel erniedrigt war“ (2,9) – und der Hebr hier ja nachweisen möchte, dass Jesus den Engeln überlegen ist. Außerdem ist fraglich, ob der „Erdkreis“ hier „den Planeten Erde“ meint. Der wird im Hebr nämlich als „Schöpfung“ (κτίσις;; 9,11) oder „Welt“ (κόσμος; 10,5) bezeichnet.
Hebräische Bibel (EB)
Septuaginta (nach LXX-D)
im Hebräerbrief
Lasst jauchzen, ihr Nationen, sein Volk! Denn er rächt das Blut seiner Knechte, und Rache wendet er auf seine Gegner zurück, und sein Land, sein Volk entsühnt er.
Freut euch, ihr Himmel, zusammen mit ihm, und alle Söhne (und Töchter) Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen! Freut euch, ihr Volksstämme, zusammen mit seinem Volk, und alle Engel Gottes sollen für ihn stark werden, denn (für) das Blut seiner Söhne (und Töchter) wird Strafe verhängt, und er wird Strafe verhängen und den Feinden mit rechtmäßiger Strafe vergelten, und denen, die (ihn) hassen, wird er (es) vergelten, und der Herr wird das Land seines Volkes reinigen.
Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!
• Handelt es sich bei der Wiedereinführung des „Erstgeborenen“ in den „Erdkreis“ um die Wiederkunft Jesu? Dagegen spricht, dass die Engel in diesem Zusammenhang traditionell nicht als Anbeter, sondern als Gefolge Jesu auftreten (Mt 25,31: „Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm …“).
• Daher ist vermutlich die Rückkehr Jesu Christi in die himmlische Welt zu seiner Erhöhung bzw. Inthronisation gemeint (vgl. 1,2.4 und 1 Pt 3,22: „Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen.“). Dafür spricht auch, dass es in den beiden ersten Zitaten ebenfalls um die Erhöhung Jesu ging.
Bei der Erhöhung Jesu Christi, des „Erstgeborenen“, befiehlt Gott: „Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten“. Das zeigt die Überlegenheit Jesu Christus, des Sohnes, über die Engel.
Der Sohn bleibt (1,7-12)
Es folgt ein weiteres Schriftwort über die Engel, dem sich dann zwei Schriftworte über den Sohn anschließen.
Von den Engeln heißt es: „Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme." Es handelt sich um ein Zitat aus Ps 104,4 (LXX: 103,4)1.
Ps 104 ist ein eindrucksvolles Lob des Schöpfergottes. Der Gott, der alles geschaffen hat, macht „Winde zu seinen Boten“ und „Feuer und Lohe zu seinen Dienern“. In der Septuaginta (LXX), der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die bei den ersten Christen in Gebrauch war, ist die Argumentation umgekehrt: Dort heißt es nicht, dass Gott Winde bzw. Feuer und Lohe macht, sondern, dass er „seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu loderndem Feuer“.
Der springende Punkt dabei ist: „Engel sind also wandelbar … und werden von der Gottheit entsprechend eingesetzt …“2 Und die Wandelbarkeit der Engel ist hier nicht etwa ein Vorteil, sondern – wie auch die folgenden Verse zeigen – ein Zeichen für Unterlegenheit der Engel gegenüber dem Sohn. Christus „verfügt über die Engel als seine Geschöpfe, nimmt sie in Dienst, kann sie vernichten und zur Feuerflamme machen. Sie besitzen … keine ewige Qualität, sind wandelbar und von Christus abhängig. Der Sohn dagegen ist ein unwandelbares Wesen.“1
Hebräische Bibel
Septuaginta (nach LXX-D)
im Hebräerbrief
der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern …
der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu loderndem Feuer …
Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme …
Demgegenüber sagt Gott „von dem Sohn“ etwas ganz anderes. In den Versen 8 und 9 wird zunächst Ps 45,7-8 (LXX: Ps 44,7-8) zitiert: