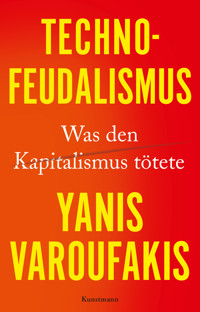18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist ein liberaler Sozialismus machbar? Gibt es Wohlstand und Wachstum ohne den Ruin der Erde? Sind wir in der Lage, eine gute Gesellschaft trotz unserer Fehler zu schaffen? Stellen Sie sich vor, es ist 2025. Als Folge der Finanzkrise von 2008 ist eine globale politische Bewegung entstanden, durch die die Gesellschaft, wie wir sie kennen, verändert wurde: Geld, Land, digitale Netzwerke und Politik sind wahrhaft und von Grund auf demokratisiert worden. In einem originellen Gedankenexperiment bietet der weltbekannte Ökonom Yanis Varoufakis Einblicke in diese alternative Realität. Durch die Augen von drei Protagonisten – einer libertären Ex-Bankerin, einer marxistischen Feministin und einem technisch hochbegabten Eigenbrötler – sehen wir die Genese einer Welt ohne kommerzielle Banken oder Börsen, in der die Unternehmen denen gehören, die dort arbeiten, in der es ein garantiertes Grundeinkommen gibt, globales Ungleichgewicht und Klimaveränderung sich gegenseitig ausgleichen und Wohnen ein Grundrecht ist. Radikal in Form und Vision verbindet Ein Anderes Jetzt platonischen Dialog mit Fiktion und zeigt, dass es eine Alternative zum Kapitalismus geben könnte. Die Frage ist: Wie weit würden wir gehen, um das zu erreichen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Wie sähe eine gerechte und gleichberechtigte Gesellschaft aus? In Ein Anderes Jetzt gibt der weltbekannte Ökonom Yanis Varoufakis darauf eine radikale und subversive Antwort.
Ist ein liberaler Sozialismus machbar? Gibt es Wohlstand und Wachstum ohne den Ruin der Erde? Sind wir in der Lage, eine gute Gesellschaft trotz unserer Fehler zu schaffen?
Stellen Sie sich vor, es ist 2025.
Als Folge der Finanzkrise von 2008 ist eine globale politische Bewegung entstanden, durch die die Gesellschaft, wie wir sie kennen, verändert wurde: Geld, Land, digitale Netzwerke und Politik sind wahrhaft und von Grund auf demokratisiert worden.
In einem originellen Gedankenexperiment bietet der weltbekannte Ökonom Yanis Varoufakis Einblicke in diese alternative Realität. Durch die Augen von drei Protagonisten – einer libertären Ex-Bankerin, einer marxistischen Feministin und einem technisch hochbegabten Eigenbrötler – sehen wir die Genese einer Welt ohne kommerzielle Banken oder Börsen, in der die Unternehmen denen gehören, die dort arbeiten, in der es ein garantiertes Grundeinkommen gibt, globales Ungleichgewicht und Klimaveränderung sich gegenseitig ausgleichen und Wohnen ein Grundrecht ist.
Radikal in Form und Vision verbindet Ein Anderes Jetzt platonischen Dialog mit Fiktion und zeigt, dass es eine Alternative zum Kapitalismus geben könnte. Die Frage ist: Wie weit würden wir gehen, um das zu erreichen?
Über den Autor
Yanis Varoufakis, geb. 1961, wurde 2015 Europas bekanntester Finanzminister, als er sich weigerte, für das bankrotte Griechenland neue Schulden aufzunehmen. Seit seinem Rücktritt wurde er zur Galionsfigur der Bewegung Democracy in Europe Movement 25 (DiEM25) für eine Reform der Eurozone. Der international renommierte Wirtschaftswissenschaftler lehrte an Universitäten in England, Australien und den USA und an der Universität in Athen. Zuletzt erschien Die ganze Geschichte – Meine Auseinandersetzung mit Europas Establishment (2017).
Yanis Varoufakis
EIN ANDERES JETZT
Nachrichten aus einer alternativen Gegenwart
Aus dem Englischen vonUrsel Schäfer
Verlag Antje Kunstmann
Für Danaëohne die ein Anderes Jetzt unvorstellbar wäreund Unser Jetzt unerträglich
Inhalt
Vorwort
1 Die Moderne ist besiegt
2 Ein Anderes Jetzt
3 Korposyndikalismus
4 Wie der Kapitalismus starb
5 Die Abrechnung beginnt
6 Märkte ohne Kapitalismus
7 Ärger im Paradies
8 Die Abrechnung geht weiter
9 Exodus
Nachwort
Vorwort
Heute vor einem Jahr haben wir Iris in einem rotschwarzen Sarg zu Grabe getragen. Das Rot symbolisierte das revolutionäre Feuer, das nie aufgehört hatte, in ihr zu lodern. Und das Schwarz erinnerte uns, wie sie es immer getan hatte, an die dunkle Seite, die wir alle in uns tragen.
Iris’ Begräbnis war so, wie sie es sich gewünscht hätte, nur dass Eva fehlte. Die Reden würdigten meine außergewöhnliche Freundin in angemessener Weise, aber die Worte rauschten an mir vorbei. Rund zwanzig Jahre waren vergangen, seit ich Iris und Eva zum letzten Mal zusammen gesehen hatte. Damals saßen sie auf Iris’ Terrasse, Eva mit dem üblichen Glas Pinot Grigio in der Hand, während Iris ihr eine Standpauke hielt, die sie nur unterbrach, um hin und wieder an ihrem eisgekühlten Wodka zu nippen. Ich weiß noch, dass ich mich fragte: Warum nur hat Iris Eva unter ihre Fittiche genommen?
Diese Freundschaft passte schlichtweg nicht zu einer Frau, die sich nicht vorstellen konnte, dass es einen guten Markt, einen gerechten Krieg oder einen unberechtigten Streik geben könnte. Eva hatte sich von einer ehemaligen Investmentbankerin in eine orthodoxe, nüchterne Ökonomin verwandelt, die an einer Universität lehrte. Sie hatte keine sehr gewinnende Art und verkörperte in gewisser Weise Oscar Wildes Definition des Zynikers: Sie wusste alles über Preise, aber nichts über Werte. »Und ich bin nicht einmal sicher, dass sie überhaupt eine Ahnung von Preisen hat!«, sagte Iris einmal scherzhaft in ihrer Gegenwart. Trotzdem, als Iris’ Sarg in die Erde gesenkt wurde, wog Evas Abwesenheit schwer.
Nachdem Iris und Eva nun nicht mehr da waren, blieb als Einziger von unserer alten Bande Costa übrig. An dem Tag, als Iris starb, hatte ich ihm zweimal eine Nachricht geschickt, an eine alte Nummer, die ich immer noch besaß. Es kam keine Reaktion. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich die Beerdigung ohne ihn würde durchstehen müssen, als ich ihn plötzlich doch entdeckte. Er war nicht leicht zu erkennen: eine einsame Gestalt, die an einer Platane lehnte und aus der Entfernung zusah, wie Iris in ihre letzte Ruhestätte hinabgelassen wurde.
Als die Trauergäste sich langsam zerstreuten, trat ich auf ihn zu, und sein Gesicht erhellte sich dankbar. Von seiner jugendlichen Fröhlichkeit war nichts mehr da, doch aus seinen Augen blitzte immer noch die vertraute Mischung aus Scharfsinn und Empfindsamkeit. Aber während wir uns unterhielten, wirkte er gehetzt, als fühlte er sich verfolgt. Er sprach immerzu von »dem Tagebuch« und wie wichtig es sei, dass es nicht »in die falschen Hände« gerate. Da wurde mir klar, dass Iris ihn eingeweiht hatte, bevor sie mich ins Hospiz gerufen hatte, zwei Wochen bevor ihr Körper vor dem Krebs kapitulierte.
Iris’ Ruf erreichte mich Ende Juni 2035 und riss mich aus meiner zwei Jahrzehnte währenden Isolation. Das letzte Mal hatte ich Costa und sie im August 2015 gesehen, bei meinem letzten Aufenthalt in Brighton, als sich mein Leben wegen einer anderen Sache in Auflösung befand. Sobald ich das Zimmer in dem Hospiz betreten hatte, versuchte Iris mühsam, sich aufzurichten, fest entschlossen, all ihre schwindende Energie zusammenzunehmen, um mich zu empfangen. Ohne Vorrede zeigte sie auf ein Tagebuch, das auf ihrem Nachttisch lag, und bedeutete mir, ich solle es nehmen. »Dazu gibt es eine Anweisung und eine Verfügung«, flüsterte sie.
Die Anweisung war eindeutig. Ich sollte mich auf die »Botschaften« in dem Tagebuch konzentrieren und sie verwenden, »um den Menschen die Augen für Möglichkeiten zu öffnen, die sie sich allein nicht vorstellen können«. Und die Verfügung bestand darin, dass ich ihr versprechen musste, nichts von den »technischen Details« preiszugeben. »Zu gegebener Zeit wirst du erfahren, was ich meine«, flüsterte sie. Bemüht, die Atmosphäre aufzulockern, sagte sie mir in ihrer typisch direkten und herrischen Art: »Fang an, sobald ich tot und begraben bin.« Weil ich sie nicht weiter anstrengen wollte, ergriff ich ihre Hand und gab ihr das verlangte Versprechen.
Damals wusste ich nicht, dass »zu gegebener Zeit« hieß, dass Costa bei ihrem Begräbnis auftauchen und mir Anweisungen überbringen würde, die er mir atemlos in einer stillen Ecke des Parkplatzes vor dem Friedhof erteilte. Beim Lesen von Iris’ Tagebuch solle ich mich vor den Konzernleuten hüten: »Iris wollte, dass du ihr Tagebuch bekommst. Sie wollte, dass unsere Geschichte erzählt wird, damit die Welt versteht, dass es wirklich eine Alternative gibt. Aber ich weiß, dass sie dir die eine, strikte Bedingung eingeschärft hat: Von den detaillierten Informationen über meine Technologie, die das Tagebuch enthält, darf nichts in ihre Hände fallen. Sag mir, dass du das verstanden hast!«
Ich versicherte ihm, ich hätte es verstanden. Er blickte mir direkt in die Augen, um sich zu überzeugen, dass ich aufrichtig war. »Wir haben uns all die Jahre geirrt, Yango«, sagte er schließlich. »Wir wussten, dass alles um uns herum zu einer Ware gemacht worden war. Dass alles, was wir taten und sagten, festgehalten und weiterverkauft wurde. Aber wir wussten nicht, dass der Vorgang, alle Informationen zu digitalisieren, uns alle zu Proletariern machte, auch die Bosse. Denk darüber nach, Yango, denk darüber nach.«
Es war schon eine Weile her, dass ich einen solchen Ausbruch abbekommen hatte, aber es schien irgendwie passend. Schließlich hatten wir gerade die größte Wortführerin revolutionärer Politik zu Grabe getragen, die ich jemals gekannt hatte.
»Was heißt es eigentlich, ein Proletarier zu sein?«, fuhr Costa fort und gab gleich selbst die Antwort. »Ich will es dir sagen. Aus bitterer Erfahrung. Es bedeutet, dass du ein Rädchen im Produktionsprozess bist, der auf dem aufbaut, was du tust und denkst, während er dich nicht mehr sein lässt als sein Produkt. Es bedeutet das Ende der Souveränität, die Umwandlung von allem Erfahrungswert in Tauschwert, die endgültige Niederlage der Autonomie.«
Ich hatte keine Ahnung, warum er mir das alles erzählte, stimmte aber zu.
»Darum bin ich immer noch hier, Yango. Darum bin ich hiergeblieben. Ich will dafür sorgen, dass wir diesen Mistkerlen nicht endgültig unterliegen. Ich kann nicht verhindern, dass sie es selbst erfinden, aber ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass sie sich meine Erfindung unter den Nagel reißen, um mit ihrer Hilfe den letzten Tropfen Menschlichkeit aus uns allen herauszupressen.«
Nachdem Costa mir gesagt hatte, was er hatte sagen wollen, holte er ein Gerät aus seinem Rucksack und drückte es mir in die Hand. »Das ist ein Energiefelddämpfer. Idiotensicher.« In seiner Stimme schwang ein Hauch von Verachtung mit. Er zeigte mir, wie ich das Gerät anschaltete, um zu verhindern, dass die »Mistkerle« Zugang zu Iris’ Tagebuch erhielten.
In der Hoffnung, uns darüber austauschen zu können, was in den vielen Jahren seit unserer letzten Begegnung geschehen war, schlug ich vor, wir könnten doch zusammen essen oder wenigstens etwas trinken gehen. Costa blickte mir gerade in die Augen, umarmte mich fest und schritt dann davon, ohne sich noch einmal umzusehen.
Ich schaute ihm nach, wie er davonschritt, den Blick zu Boden geheftet. Dabei kam mir ein melancholisches griechisches Lied in den Sinn, das ich als Teenager gelernt hatte:
Letzte Nacht sah ich einen Freund
der wie ein Kobold auf einem Motorrad herumfuhr
streunende Hunde rannten hinter ihm her
durch verlassene Straßen.
Dabei musste ich an einen mittelalten Besucher in einem abgetragenen Regenmantel denken, der einmal an einem Winterabend vor der Tür unserer Wohnung in Athen gestanden und meinem Vater feierlich ein paar zerfledderte kommunistische Schriften überreicht hatte. »Wir haben 1946 gemeinsam in einer Zelle bei der Polizei gesessen«, flüsterte mein Vater traurig, als sein Genosse in der kalten, nassen Dunkelheit verschwand.
Aber Costas Worte erinnerten mich an jemand anderen: an Sam, die Hauptfigur aus einem alten Science-Fiction-Film. Sam schuftet in einem Bergwerk auf der dunklen Seite des Mondes und wird verrückt, als er herausfindet, dass er einer von vielen Klonen ist, die seine Firma als billige Wegwerfarbeiter erschaffen hat, und dass ihm Erinnerungen eingepflanzt wurden, die ihm vorgaukeln sollen, seine seit Langem verstorbene Familie lebe noch auf der Erde und warte auf seine Rückkehr. Science-Fiction ist Zukunftsarchäologie, hat ein linker Philosoph einmal gesagt. Mittlerweile ist sie beinahe die beste Dokumentation unserer Gegenwart.
Nach Beerdigungen von Freunden bin ich meistens wie betäubt und funktioniere nur. Doch als ich nach Iris’ Beerdigung den Friedhof verließ, fiel es mir schwer, in meine Gegenwart zurückzukehren. Das in Leder gebundene Tagebuch, das sie mir ausgehändigt hatte, lag wie eine ständige Aufforderung auf meinem Schreibtisch. Ich ignorierte es für den Rest des Tages, aber früh am nächsten Morgen kapitulierte ich. Ich setzte mich an den Schreibtisch und öffnete den schweren Einband.
Zwei rote Pfeile füllten mein Sichtfeld aus, als meine Hybrid-Reality-Kontaktlinsen audiovisuellen Inhalt in dem Tagebuch registrierten und sich einschalteten. Instinktiv machte ich eine Bewegung, um meine haptische Schnittstelle zu unterbrechen, und klappte das Buch wieder zu. Costa hatte mich ausdrücklich angewiesen, den Energiefelddämpfer einzuschalten, bevor ich das Tagebuch öffnete. Geknickt, dass ich es vergessen hatte, ging ich hinaus, um das Gerät zu holen. Sobald es auf meinem Schreibtisch stand und beruhigend vor sich hin summte, konnte ich mich unter den denkbar kostbarsten Umständen – ganz für mich allein – in Iris’ Tagebuch versenken.
Es dauerte neun Tage und Nächte, das Tagebuch zu studieren. Ich las Iris’ handschriftliche Erinnerungen und nahm den audio-visuellen Inhalt auf, der in die Seiten eingebettet war. Nach der Hälfte stieß ich auf die außerordentlichen Ereignisse des Jahres 2025, in die sie und Costa und Eva verwickelt gewesen waren, und mir dämmerte, warum Iris unbedingt gewollt hatte, dass ihre gemeinsame Geschichte erzählt würde. Nachdem ich mit dem Tagebuch ganz durch war, kämpfte ich zwei lange Monate gegen den Drang, zu tun, was ich immer tue, wenn ich aufgewühlt bin oder das Gleichgewicht verloren habe: schreiben. Stattdessen verwendete ich diese sechzig Tage darauf, das Material gründlich zu verdauen, es wieder und wieder zu lesen, anzuschauen, anzuhören.
Die Geschichte, die Iris in ihrem Tagebuch erzählte, erschütterte mich zutiefst. Iris hatte gewusst, dass es so sein würde, genau wie sie gewusst hatte, dass ich nicht würde widerstehen können, sie wohl oder übel aufzuschreiben. Es dauerte noch einmal neuneinhalb Monate, das Buch zu schreiben, das Sie, liebe Leserin und lieber Leser, nun vor sich haben. Und so bin ich, genau ein Jahr nachdem wir Iris in dem rot-schwarzen Sarg begraben haben, bereit, mit einem einzigen Klick das Manuskript an ihren Verlag zu schicken. Wenn es nur einen Weg gäbe, wie sie mir sagen könnte, was ich übersehen habe.
Der Großteil des Tagebuchs und das meiste, was folgt, besteht aus einer Reihe von Dialogen. Diese intellektuellen und politischen Debatten lagen Iris am Herzen, sehr viel mehr als die Ereignisse, die den Anstoß dazu gegeben hatten. Weil ich den Gedanken und Standpunkten meiner Freunde unbedingt Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte, hielt ich es für nötig, diese Debatten so wiederzugeben, als wäre ich selbst dabei gewesen. So gebe ich vor, eine Vergangenheit miterlebt zu haben, in der ich größtenteils nicht anwesend war, und ich schmücke Gespräche aus, an denen ich nicht teilgenommen habe. Im Verlauf dieses Prozesses schreibe ich Iris, Eva und Costa notwendigerweise Gedanken und Gefühle zu, die das Produkt meiner Fantasie sind – aber nur, weil ich glaube, dass solche Ergänzungen nötig sind, um den Kern dessen zu vermitteln, was sie erlebt haben, um deutlich werden zu lassen, wer diese lieben Menschen wirklich waren. Für meine Freiheiten und meine Fehler entschuldige ich mich ausführlich und bereitwillig.
Yango Varo, 10.05 UhrMontag, 28. Juli 2036
1 Die Moderne ist besiegt
Iris
Iris und ich lernten uns in der Dystopie des englischen Universitätsbetriebs kennen. Wir waren beide unglücklich, sie in Sussex, ich in Essex. »Sex mit einem Präfix«, sagten wir immer scherzhaft. Anfang 1982 kreuzten sich unsere Wege zum ersten Mal – an der London School of Economics, bei einer der zahllosen Versammlungen, die damals von linken Aktivisten einberufen wurden, um den Kampf gegen den Thatcherismus zu organisieren. Nachdem sich langweilige Sprecher zwei Stunden auf dem Podium abgemüht hatten, hielt Iris ihre Rede. Sie war großartig.
»Während ich den Vorrednern zugehört habe«, begann sie in entschlossenem, aber launigem Ton, »dachte ich mir: Maggie Thatcher wäre mir lieber!« Die Protestrufe aus dem Publikum freuten sie offensichtlich, und sie fuhr fort: »Im Gegensatz zu euch, meine Freunde, weiß Maggie, wie es geht. Wir leben in einem revolutionären Augenblick. Der Waffenstillstand zwischen den Klassen, den es in der Nachkriegszeit gab, ist vorbei. Wenn wir die Schwachen verteidigen wollen, dürfen wir nicht defensiv sein. Wir müssen das Gleiche fordern wie Maggie: Weg mit dem alten System, her mit einem ganz neuen. Nicht ihr dystopisches System, aber dennoch ein ganz neues. Ihr flickt Leichen zusammen, während Thatcher Gräber aushebt. Wenn ich wählen müsste zwischen euch und ihr, würde ich mich jederzeit für sie entscheiden. So monströs sie auch sein mag, sie kann man wenigstens stürzen!«
Damals erlebte ich zum ersten Mal Iris’ hitziges Temperament. Aber während ihre Worte auf viele von uns großen Eindruck machten, sorgten sie auch dafür, dass sie zur Außenseiterin wurde. Radikale haben es nicht gern, wenn man sie nicht ernst nimmt. Als ich ihr einmal vorhielt, sie glaube nicht an Solidarität, sondern gebe sich lieber als einsame Wölfin, erwiderte sie stolz und ohne eine Spur von Ironie: »Genau das bin ich!«
Im Lauf der Jahre steigerte sich Iris’ natürliche Neigung, Menschen, die ihre Ansichten weitgehend teilten, vor den Kopf zu stoßen, im selben Maß, wie die Gesellschaft die entgegengesetzte Position einnahm. Iris’ Meinung nach bestand Thatchers größter Triumph darin, die Menschen zu der Überzeugung gebracht zu haben, dass niemand etwas tat, ohne sich einen Vorteil davon zu erhoffen. Iris ging das vollkommen gegen den Strich, sie war entsetzt und elektrisiert zugleich bei dem Gedanken, dass jeder hinter etwas her war und nach uneingeschränkter Macht gierte – auch in öffentlichen Versammlungen, bei denen es darum ging, Margaret Thatcher, die Londoner City und die raffinierteren Formen von Gier zu kritisieren. Iris war eine leidenschaftliche Feministin, konnte aber die meisten Feministinnen nicht ausstehen, weil sie in ihren Augen privilegiert waren, sich aber dennoch vor sexueller Freiheit fürchteten und außerdem die Angewohnheit hatten, für – und über – diejenigen zu sprechen, die eigentlich die Bewegung gegen das Patriarchat anführen sollten. Sie war lesbisch, hatte aber auch Sex mit Männern, aus »einem Hang zur Solidarität mit dem unvollkommenen Geschlecht und dem Drang, Lesben zu schockieren«, wie sie sagte. Sie war Marxistin und verachtete zugleich die meisten Marxisten, weil sie Marx’ emanzipatorische Theorie missbrauchten, um andere Genossen fertigzumachen, ihre eigene Machtbasis zu errichten, einflussreiche Positionen zu ergattern, leicht zu beeindruckende Studentinnen ins Bett zu kriegen und schließlich die Kontrolle über das Politbüro zu übernehmen und Kritiker in den Gulag zu schicken. Vor allem aber warf Iris ihr radikales Denken selbst immer wieder radikal über den Haufen. Sie war energiegeladen und brillant und im nächsten Augenblick nervtötend und unerträglich.
An jenem Abend an der London School of Economics kamen wir ins Gespräch, vielleicht weil ich als Einziger aus dem Publikum nach ihren Ausführungen geklatscht hatte. Ein paar Monate später, an einem trüben Abend im Dezember 1982, rief sie an und erzählte, sie arbeite mit bei der Planung einer großen Protestkundgebung von Frauen vor einem Stützpunkt der Royal Air Force gegen die Stationierung amerikanischer Marschflugkörper, die auf Osteuropa zielen würden. Ob ich kommen und ihr helfen könne? Spät am nächsten Tag traf ich in Greenham Common ein. Im strömenden Regen versuchten dreißigtausend Frauen, angesichts eines entschlossenen Polizeiaufgebots eine Menschenkette rund um den Flugplatz zu bilden. Als ich gerade dachte, es sei unmöglich, Iris in dem Durcheinander zu finden, erspähte ich sie auf dem kalten, schlammigen Boden. Zwei Frauen knieten neben ihr und drückten ein Taschentuch auf einen blutenden Schnitt auf ihrer Stirn. »Von einem übereifrigen Verteidiger der Anlage«, erklärte sie mir mit einem stolzen Grinsen.
Iris wirkte jünger, als es ihrem Alter von achtundzwanzig Jahren entsprach. Sie lehrte damals seit drei Jahren Sozialanthropologie, davor hatte sie Feldstudien in Afrika betrieben und dabei Wörterbücher und eine Grammatik der Sprachen erstellt, die von zwei Stämmen in Kamerun gesprochen wurden. Ich war mehrere Jahre jünger als sie und kämpfte mit meiner Doktorarbeit über mathematische Modelle, die Iris mit einer gewissen Berechtigung als »Fingerübungen in logisch-positivistischer Masturbation« abtat. In den folgenden fünf Jahren nahmen wir neben unseren universitären Pflichten an vielen aussichtslosen Kämpfen teil – an den Bergarbeiterstreiks 1984/85 und, besonders deprimierend, an dem gescheiterten Streik der Drucker gegen das Medienimperium von Rupert Murdoch 1986/87. Die insgesamt hundertfünf Wochen, in denen wir Leute zusammentrommelten, Streikposten aufstellten, Geld sammelten und auf der falschen Seite der Geschichte standen, mussten uns entweder auseinandertreiben oder zu unzertrennlichen Freunden werden lassen.
Ich erinnere mich, dass ich sie 1987 einmal im Krankenhaus besuchte, nachdem berittene Polizisten vor dem strahlenden neuen Druckhaus von Murdoch in Wapping buchstäblich über sie hinweggetrampelt waren. Ich fragte sie, ob sie aus Angst vor Verletzungen jemals ans Aufgeben gedacht habe. Iris erwiderte, wenn man sich einem berechtigten Kampf anschließe, lerne man, so zu leben, als werde man demnächst aufgeben, ohne es je zu tun. Nein, sie bedauerte lediglich, dass wir zwar großartig für Gruppen kämpften, die jede Unterstützung verdienten, aber für Anliegen, die offensichtlich »anachronistisch« waren. »Warum können wir dieses Land nicht dazu bringen, saubere Energie und eine freie Presse zu fordern, statt dreckige Kohlekraftwerke und die männlichen Gewerkschaftsbosse bei einer rechten Zeitung zu verteidigen?«
Eine Niederlage konnte Iris niemals das Vergnügen verderben, gegen Widerstände in den Kampf zu ziehen. Keine Schlappe konnte ihren Enthusiasmus dämpfen – »Der Kampf für eine gute Sache ist niemals vergebens«, sagte sie immer –, nur die Angst, dass wir Löwen waren, die von Eseln aufs Schlachtfeld geschickt wurden. Sie unterschied zwei Typen selbst ernannter progressiver Anführer: einmal diejenigen, die Privilegien verteidigten, die sie der sterbenden Nachkriegsordnung verdankten, und dann die anderen, die radikaleren, die darauf aus waren, die bestehende Ordnung durch ein anderes, aber genauso unterdrückerisches Patriarchat zu ersetzen. Erst als ich sie am selben Abend vom Krankenhaus zurück nach Brighton fuhr, begriff ich, was für eine Obsession dieser Gedanke für sie war.
»Okay, sagen wir, wir sind die Avantgarde. Aber die Avantgarde wofür, verdammt noch mal?« Nachdem sie zuvor lange geschwiegen hatte, zuckte ich bei Iris’ Ausbruch zusammen. »Denk an meine Worte. Sobald unsere Genossen Macht wittern, werden sie alle Grundsätze opfern, die sie jemals gehabt haben. Und all jene von uns, die weiterhin anderer Meinung sind, werden sie dämonisieren oder zumindest lächerlich machen.«
Als ich vor ihrem Haus anhielt, wirkte sie missmutig und niedergeschlagen. So hatte ich sie noch nie gesehen. »Ich mache da nicht mit. Ich kann es nicht«, erklärte sie. Und dann stieg sie aus dem Auto.
Ein paar Monate später, im Frühsommer 1987, siegte Margaret Thatcher zum dritten Mal in Folge bei den Parlamentswahlen. Am nächsten Tag gab Iris ihre Dozentenstelle auf. Sie kam auch nicht mehr zu politischen Versammlungen. Weder die Universität noch die Streikposten interessierten sie noch genug, um weiterzumachen. Als junges Mädchen hatte sie ein bescheidenes Erbe von einem freundlichen alten Mann erhalten, einem Angehörigen des Oberhauses mit einem erblichen Titel, der die vornehme Gesellschaft gern schockierte, indem er sich als die Queen der queeren Menschen bezeichnete. Dank dieses Geldes konnte sie sich den Luxus erlauben, ihre Stelle zu kündigen. »Aus irgendeinem Grund betrachtete er mich als eine Muse, für die er sorgen musste, Gott segne ihn.« Merkwürdigerweise leuchtete mir ihre Erklärung vollkommen ein, und ich forschte nicht weiter nach.
Als Antwort auf meine Frage nach den Gründen für ihren doppelten Ausstieg holte sie zwei Papiere hervor. Eines war ein Rundschreiben der Universität Sussex, in dem die Studierenden als Kunden und Kundinnen bezeichnet wurden. »Wenn sie das sind, sind sie diejenigen, die immer im Unrecht sind«, kommentierte sie. Das zweite war ein internes Memorandum der Labour Party, in dem es um die berüchtigte Clause IV ihrer Satzung ging, die langjährige Verpflichtung der Partei, »dafür zu sorgen, dass Hand- und Kopfarbeiter in den vollständigen Genuss der Früchte ihres Fleißes kommen … auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzes der Produktions-, Vertriebs- und Tauschmittel und durch das beste verfügbare System der Verwaltung und Kontrolle jedes Zweigs von Industrie und Dienstleistungen durch das Volk«. Seit 1959 hatte es in der Partei immer eine Gruppe gegeben, die diese Verstaatlichungsklausel streichen wollte, aber die Gewerkschaften hatten Widerstand geleistet. Iris verstand sich darauf, die Zeichen an der Wand zu lesen, und wusste, was das Memorandum bedeutete. Nach ihren jüngsten Niederlagen bereiteten sich die Gewerkschaftsbosse darauf vor, den Traum vom gemeinschaftlichen Eigentum an Versorgungsunternehmen, Betrieben, den Eisenbahnen, den verschiedenen Einkaufsstraßen und Marktplätzen, wo der Handel stattfindet, aufzugeben, selbst als nie realisierte Vision. Sie ahnte, dass das Spiel aus war.
»1987 können die Gewerkschaften genauso gut aussterben und unseren Universitäten in die Versenkung folgen wie in jedem anderen Jahr. Und ich kann zu meinen Wandteppichen zurückkehren.« Was sie dann auch tat.
Iris hatte in Kamerun die Kunst erlernt, aufwendige Wandteppiche zu knüpfen. Ihre Lehrer waren die Menschen in den Dörfern gewesen, bei denen sie gewohnt hatte, als sie ihre Sprachen dokumentierte. Dort war es üblich, dass die Frauen den ganzen Tag auf den Feldern arbeiteten, während die Männer zu Hause blieben und kochten, putzten, sich um die Kinder kümmerten und knüpften. Sie hatte von Männern gelernt, deren sozialer Status von der Schönheit ihrer Handarbeiten abhing und deren Techniken, ohne Vorlage zu knüpfen, ihrer Fantasie freien Raum ließen. Das Ergebnis waren faszinierende Darstellungen komplizierter, oft schlüpfriger Szenen, die aus afrikanischen, europäischen, indischen und japanischen Bildwelten stammten.
Iris fasste den Triumph von Margaret Thatcher als Signal auf, sich in ihren Wintergarten im Obergeschoss zurückzuziehen und ihre Zeit einer Kunstform zu widmen, die für die vertrauten Kategorien der feinen Gesellschaft eine Herausforderung darstellte. Wie nicht anders zu erwarten, verkauften sich ihre Werke nach einigen Jahren in Galerien in Genf und London und sogar bei Auktionen zu stattlichen Preisen. Über meinem Schreibtisch, an dem ich diese Zeilen schreibe, hängt einer der ersten Wandteppiche, die sie in jenem Sommer knüpfte, er zeigt einen Sumo-Ringer, der im Buckingham-Palast einen erotischen Tanz aufführt. Die wollige Oberfläche ist ein bisschen abgenutzt und etwas ausgeblichen, aber die Darstellung strahlt auch nach achtundvierzig Jahren noch unvermindert ihre respektlose Kraft aus.
An den Abenden ging es in Iris’ Reihenhaus in Brighton zu wie eh und je. Ihr Haus war wie immer der Zufluchtsort für unseren Kreis aus Freunden und zufälligen Besuchern, die fast jeden Abend bei ihr zusammenkamen, um zu trinken und zu diskutieren und sich von Iris gleichermaßen begeistern, kritisieren und aufheitern zu lassen. Über Jahre war sie ein Gestalt gewordener Widerspruch: die gesellige Einsiedlerin von Brighton, die mit offenen Armen jeden aufnahm, der ihre Hilfe brauchte, während sie selbst sorgfältig jede Bindung an eine Person oder eine Sache vermied. Das heißt, bis fünfundzwanzig Jahre später Eva auf der Bildfläche erschien.
Eva
An einem Nachmittag im Sommer 2012 zog Eva neben Iris ein. Die achtundzwanzigjährige Kalifornierin kam mit einem Taxi direkt vom Flughafen Gatwick, zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn Thomas und drei großen Koffern. Minuten später klopfte Iris gebieterisch an ihre Haustür und lud sie zu einem Begrüßungsglas Wein am Abend ein. Bei der Gelegenheit könne sie gleich die Besucher kennenlernen, die zufällig da sein würden.
Eva brachte Thomas ins Bett und aktivierte die Kinderüberwachungs-App auf ihrem Handy. Dann ging sie hinüber zu Iris. Sie stellte sich den Anwesenden vor, erzählte, dass sie aus den Vereinigten Staaten nach Brighton gekommen sei, um ihre erste Stelle als Dozentin anzutreten – an der Universität Sussex. Ungefähr ein Jahr zuvor hatte sie in Princeton in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Der Titel ihrer Arbeit, »Drei Abhandlungen über spieltheoretische Modelle der Evolutionspsychologie«, lieferte Iris im Lauf der Jahre zahllose Gelegenheiten, sich über sie lustig zu machen. Hinter ihrem Spott verbarg sich jedoch eine wachsende Anteilnahme, nachdem sie erkannt hatte, dass Eva auf der Flucht war: dass sowohl ihre akademische Karriere als Wirtschaftswissenschaftlerin wie ihre Übersiedlung nach England Teil eines größeren Ausbruchs waren. Damals hätte sich Iris noch nicht ausmalen können, wie weit Evas Ausbruch dreizehn Jahre später, in den letzten Tagen des Jahres 2025, tatsächlich gehen würde.
Glück und eine Begabung für Mathematik spielten in Evas Geschichte die Hauptrollen. 2006, als zweiundzwanzigjährige Stanford-Absolventin mit einem Abschluss in theoretischer Physik in der Tasche, war sie ihren privilegierten Kommilitonen zu den Geldtöpfen der Wall Street gefolgt, zuerst als Praktikantin bei Goldman Sachs und dann als lächerlich bezahlte Finanzingenieurin bei Lehman Brothers, der Titanic der Finanzwelt. Als Lehman im Herbst 2008 seinen Eisberg rammte, verließ Eva nicht nur das sinkende Schiff, sondern die ganze Branche. Nach ein paar Monaten Denkpause schrieb sie sich Anfang 2009 in Princeton für ein Doktorandenprogramm in Wirtschaftswissenschaften ein, entschlossen, ganz in abstrakter, rein mathematischer Theorie aufzugehen. Sie suchte Zuflucht bei den ökonomischen Lehren, auf denen einst ihre Arbeit in der Finanzwelt basiert hatte.
Kurz nach ihrer Ankunft in Princeton stellte sie fest, dass sie schwanger war. Iris machte sich eine geistige Notiz, wie penibel es Eva vermied, den Vater zu erwähnen, und schnell zu der Erzählung überging, wie sie neun Monate in einer besonderen Art von Isolation verbracht hatte, bei der ihr Geist und ihr Körper sich in zwei ganz unterschiedlichen Welten befanden: Während der eine die extremsten Abstraktionen wälzte, machte das heranwachsende Baby ihr so intensiv die eigene Körperlichkeit bewusst, wie sie sie noch nie zuvor gespürt hatte.
In Thomas’ ersten beiden Lebensjahren sah Eva außer ihrem Baby und gelegentlich ihrem Doktorvater kaum einen Menschen. Iris hatte ein bestimmtes Bild von ihr vor Augen: eine Kreuzung zwischen einer Ostküsten-Pietà und einem traumatisierten Leutnant, der sich nach dem Blutvergießen auf dem Schlachtfeld in das Kloster zurückzieht, das den heiligen Massakern seiner Generäle den göttlichen Segen erteilt hat. Ich erinnere mich noch, wie Iris mir zuflüsterte: »Sie ist von der Wall Street geflohen, um sich in Princeton zu verstecken und dort die Theorien zu verbessern, die ihren Finanzverbrechen bei Lehman zugrunde lagen.«
Und 2012 zog sich Eva erneut zurück, kaum dass sie den Doktortitel in der Tasche hatte. Diesmal verließ sie ihr Land und sein lukratives Universitätssystem und ging nach Großbritannien an die Universität von Sussex. Sie war noch keine dreißig, da glich ihr Leben schon einer ewigen Wanderschaft.
Iris und Eva kamen aus unterschiedlichen intellektuellen und moralischen Welten, aber sie merkten irgendwann, dass ihre beiderseitigen Erfahrungen mit Paradoxien und Traumata ihre Verbindung auf eine ganz eigene Basis stellten. Iris, die große Praktikerin und Theoretikerin des kollektiven Handelns, agierte wie eine Ein-Frau-Armee. Eva, die unerschütterliche Individualistin, spürte brennend ihre Einsamkeit und das Fehlen menschlicher Bindungen in ihrem Leben. Beide wollten es nicht zugeben, aber ihre jeweiligen Paradoxien spiegelten sich ineinander, und ebenso ihre Traumata.
Eva war 1984 zur Welt gekommen, im Jahr des Bergarbeiterstreiks in England. Das Scheitern des Streiks war Iris’ Waterloo, es drückte ihrem Leben den Stempel permanenter Niederlage auf. Was der Bergarbeiterstreik für Iris gewesen war, war der Zusammenbruch von Lehman Brothers für Eva. Und genau wie wir 1984 schmerzhaft erkannten, dass wir für den Rest unserer Tage die Verlierer der Geschichte sein würden, sah Eva 2008, wie die Geschichte vor ihrer Tür mit der gleichen seelenzerstörenden, jeden Optimismus verschlingenden Gewalt explodierte. Beiden war die schockierende Offenbarung zuteilgeworden, dass ihre Welt nicht mehr existierte. Das erwies sich als die Kraft, die ihnen trotz hartnäckigen Widerstands den Weg zu einer seltsamen, aber intensiven Freundschaft bereitete.
An jenem Sommerabend 2012, als Eva zum ersten Mal über Iris’ Schwelle trat, schlug die Stimmung ziemlich abrupt von lustig zu gereizt um. Iris hatte Eva aus nachbarschaftlicher Anteilnahme eingeladen, aus feministischer Solidarität mit einer alleinerziehenden Mutter, die sich allein in einem neuen Land durchkämpfte, und aus Neugier. Aber sobald Eva ihre Vergangenheit als Bankerin erwähnte, konnte Iris nicht mehr an sich halten.
»Banker können nur eins, nämlich der Gesellschaft den Sauerstoff rauben«, erklärte Iris. »Sie leiten ungeheuerliche Summen zu Ganoven, während sie entweder viel zu viel oder viel zu wenig Geld verleihen, aber nie bekommen die Menschen von ihnen Geld, die es brauchen oder sinnvolle Dinge damit vorhaben. Darum«, ihr Tonfall wurde belehrend, »ist es unter dem Strich gut, dass du es aufgegeben hast, das Leben von Menschen auf dem ganzen Planeten zu zerstören, um stattdessen die Köpfe von Englands Jugend mit Vorlesungen über die Effizienz von Finanzmärkten zu vergiften.«
Eva fehlte Iris’ Talent zur amüsanten Unverschämtheit, aber eine leichte Gegnerin war sie dennoch nicht.
»Die Menschen handeln aus demselben Grund auf Märkten, aus dem sie sich mit den Gesetzen der Schwerkraft abgeben«, schoss sie zurück. »Meinst du, wir sollten auch die Gesetze der Schwerkraft abschaffen? Die jungen Leute mit den Fähigkeiten auszurüsten, die sie brauchen, um in der Welt zurechtzukommen, in der sie leben, ist doch wohl besser, als ihre Köpfe mit sinnlosen Utopien vollzustopfen?«
»Meine liebe Eva«, setzte Iris an, »an Universitäten geht es nicht darum, Fähigkeiten zu vermitteln. Dort sollen flexible Lakaien produziert werden, die es gar nicht erwarten können, zu tun, was man ihnen befiehlt. Du sollst dort junge Leute fabrizieren, die sich verzweifelt wünschen, den Vorstellungen ihrer künftigen Chefs zu entsprechen. Und dazu sollen sie in einem ersten Schritt ohne jede Nachfragen deine Überzeugung schlucken, Märkte seien genauso natürlich wie die Schwerkraft und das einzige lohnende Ziel sei Profit.«
So ging es hin und her, Eva parierte jede einzelne Beleidigung von Iris mit einer passiv-aggressiven Entgegnung.
»Ich bestreite nicht, dass die Finanzmärkte und das Profitstreben Schaden angerichtet haben«, erwiderte Eva an einer Stelle, »aber schmutzige Geldmacherei kann der Menschheit niemals so großen Schaden zufügen, wie es deine kollektivistischen Träume getan haben. Du meinst es gut, aber du pflasterst den Weg zum nächsten Archipel Gulag. Du lehnst es ab, alles als Ware zu betrachten. Mein Job ist es, die Studierenden davon zu überzeugen, dass das die größte Hoffnung der Menschheit ist!«
Obwohl es gar nicht ihre Art war, ließ Iris Eva mit diesem lahmen Konter davonkommen. Die junge Amerikanerin hatte bei ihr eindeutig einen Nerv getroffen, ohne Zweifel denselben, der Iris vor so vielen Jahren dazu gebracht hatte, der akademischen Welt und dem politischen Aktivismus den Rücken zu kehren. Zutiefst frustriert über die autoritäre Haltung der Linken, wünschte sich Iris zum ersten Mal überhaupt eine Spur von Evas abgespecktem Liberalismus. So lächelte sie einfach nur, statt einen von mindestens einem Dutzend Pfeilen abzuschießen, die sie noch im Köcher hatte, erhob ihr Glas und hieß Eva mit einem Zitat von Shakespeare, den sie in boshaften Momenten oft bemühte, überschwänglich in England willkommen, auf »diesem Kleinod, in die Silbersee gefasst«. Damit endete ihre erste Auseinandersetzung.
Kurz darauf verabschiedete sich Eva mit der Bemerkung, Thomas sei schon viel zu lange allein.