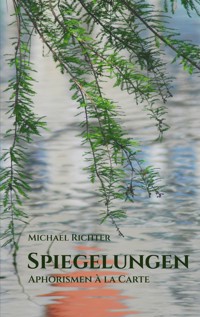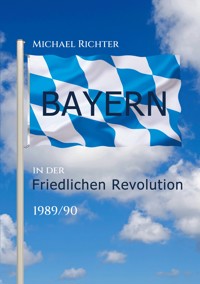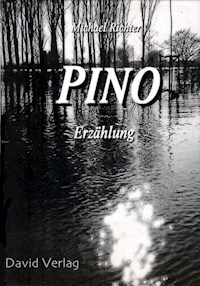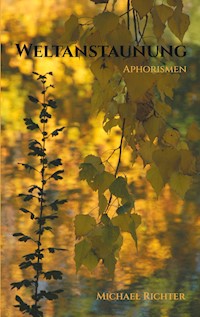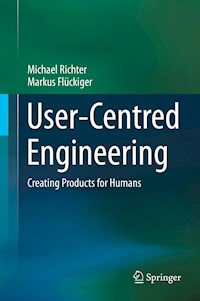Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünfundvierzig Jahre nach dem Staatsexamen und nahezu dreissig Jahre in eigener Praxis hängte ich das Stethoskop an den berühmten Nagel. Vieles hatte ich in meiner beruflichen Tätigkeit erlebt. Da gab es manch Erfreuliches aber auch Herausforderndes, Lustiges aber auch Trauriges. Auf vieles schaue ich zurück und möchte einige Erlebnisse, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, mitteilen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Von der Pike auf…
2. Ein ehemaliger Doktorand erzählt
3. Als Ärzte noch rauchten
4. Alternativmedizin
5. Mal ein trauriger Tag, mal eine fröhliche Begegnung
6. Das Gesetz – drei Punkte – Tod den Bullen – im Milieu
7. Insulin und der Armenier
8. Die Geschichte von Herrn HDS
9. Danke – früher und heute
10. Reanimationen
11. Nach fast 30 Jahren Praxis ist Schluß
Vorwort
Fünfundvierzig Jahre nach dem Staatsexamen und nahezu dreißig Jahre in eigener Praxis hängte ich das Stethoskop an den berühmten Nagel. Vieles hatte ich in meiner beruflichen Tätigkeit erlebt. Da gab es manch Erfreuliches aber auch Herausforderndes, Lustiges aber auch Trauriges.
Gerne habe ich meinen Beruf ausgeübt, trotz vieler Widerwärtigkeiten würde ich den Beruf wieder wählen. Im Studium gab es schon Hürden zu überwinden. Eine Doktorarbeit wollte oder mußte ich schreiben und dafür ein Stipendium beantragen. An verschiedenen Kliniken habe ich die Facharztausbildung absolviert und mich dann als Kardiologe niedergelassen.
Auf vieles schaue ich zurück und möchte einige Erlebnisse, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, mitteilen. Die Geschichten habe ich über einen längeren Zeitraum aufgeschrieben. Somit ist es weder eine chronologische Abfolge noch klar inhaltlich getrennt, nein es ergaben sich somit mehrfach Wiederholungen. Ja jede Geschichte soll für sich alleine stehen können.
All den vielen Patientinnen und Patienten, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, ob nun in irgendeiner Weise erwähnt oder auch nicht, gilt mein Dank. Vielen konnte ich helfen, andere bei ihren Krankheiten und Leiden begleiten.
Anfangs 2025
Michael Richter
1.Von der Pike auf….
Die erste Zeit meines Studiums war unter anderem geprägt von einer enorm knappen finanziellen Lage. Für die ersten drei Monate hatte ich gerade mal tausend Mark bekommen. Davon musste ich die Miete für das Zimmer bezahlen, die Monatsfahrkarte vom Wohnort nach Zürich, das Essen, Studiengebühren, Bücher etc. Es war äusserst knapp.
So erinnere ich mich an Freitage vor dem Wochenende mit gerade mal fünf Franken in der Tasche, dies musste ausreichen. Zum Glück gab mir meine Mutter bei jedem Besuch zu Hause zwei oder drei Päckchen Haferflocken sowie zwei oder drei Päckchen mit Teigwaren mit. Also ein bisschen etwas hatte ich in der virtuellen Vorratskammer. Im Laden musste ich dann schon genau überlegen wie ich meinen Menüplan ergänzen würde. Muss aber festhalten, damals kostete ein Becher Joghurt noch zehn Rappen. Auch das Brot war für vierzig Rappen zu haben, Fleisch lag nicht drin, höchstens mal ein Paar Würstchen. Günstig war das Essen unter der Woche in der Mensa, so war die Ernährung auch nicht zu einseitig, denn dort gab es auch Gemüse und Salat.
Schnell wurde ich aufmerksam, im damaligen Kantonsspital waren Studenten als Nachtwachen sehr gefragt. Ich meldete mich. Der Anfangslohn war, meiner Erinnerung nach, ungefähr fünf Franken pro Stunde. Würde man einen Einführungskurs besuchen, würde sich der Stundenlohn schon nach zehn Nachtwachen statt erst nach zwanzig, um rund einen Franken erhöhen. Klar diesen Einführungskurs musste ich so schnell wie möglich besuchen.
Im Einführungskurs wurden wir instruiert wie man Blutdruck misst. Wir wurden auf die Schweigepflicht usw. aufmerksam gemacht. Was man uns sonst noch so beibrachte weiss ich nicht mehr im Detail.
Nun so kamen die ersten Nachtwachen. Da musste ich zum Beispiel im Zimmer mit einer älteren Dame sein. Über ihre Krankheit wusste ich nichts. Ich musste nur Dasein. Wenn sie etwas brauchte, musste ich ins Stationszimmer gehen und die diensttuende Schwester (damals waren es noch Schwestern und keine Pflegefachfrauen) orientieren. Licht machen durfte ich auch keines, somit war Lesen nicht möglich. Da musste ich wohl schon mit dem Schlaf kämpfen.
Teilweise suchte ich und andere Studenten das Personalbüro auf und erkundigten uns nach möglichen Einsätzen. Es kam aber auch immer wieder vor, dass wir extra aufgeboten wurden. Manchmal, wie schon erwähnt, waren es sogenannte Sitzwachen oder auch Aushilfen auf den Stationen.
Auf den verschiedensten Stationen bekam man ganz unterschiedliche Eindrücke. Ganz besonders ist mir ein Einsatz auf einer Bettenstation geblieben. Die dortige Oberschwester ging mit mir in einem Zimmer betten. Wie man sogenannte Spitalecken (Strechleintücher gab es damals noch nicht) macht, wusste ich natürlich schon lange. Sie wollte, dass ich auf der Fensterseite die Betten machen würde. Dies deshalb, da ich sie möglicherweise nicht so schön hinbekommen würde wie sie. Ja wenn dann der Chefarzt zur Visite käme und die schlecht gemachten Betten sehen würde….
Häufig war ich auf chirurgischen Stationen im Einsatz, recht häufig auf der Notfallaufnahmestation der Traumatologie. Da gab es dann schon mal betrunkene Patienten nach Stürzen und dergleichen. Ich erinnere mich, wie ich damals die ersten Eindrücke von Patienten mit Delirium tremens oder akuter Alkoholintoxikation mitbekam.
Ein besonderer Einsatz war auf der Privatabteilung von Professor Krayenbühl, Neurochirurg. Bei einem sehr prominenten Filmregisseur musste ich eine Sitzwache machen. Obwohl der Patient wohl eine Diskushernie hatte operieren lassen müssen, fragte mich der Professor (damals von uns Studenten liebevoll Kollege Hugo genannt) ob ich nicht bei einer Hirnoperation zusehen wolle. Nun, da sagte ich nicht nein. So fand ich mich am vereinbarten Tag im Operationssaal. Mehrfach fragte der Professor wo denn der Famulus sei und erklärte mir, über seine Schultern schauend, genau was er da operieren würde. Er schilderte wie er mit einem bestimmten Wachs Gefässe abdichtete, wie er dies von einem anderen bekannten Neurochirurgen gelernt habe. Ein eindrückliches Erlebnis.
Auf der Überwachungsstation der Neurochirurgie war ich dann in der Folge mehrfach im Einsatz. Da war Schwester Rita, sie machte nur Nachtwachen. Ihr grosser Traum war Opernsängerin zu werden. Ob sie es jemals wurde weiss ich nicht. Sie hatte eine sehr spezielle Technik des Waschens. Morgens mussten alle Patienten gewaschen werden. Nach Hirnoperationen waren die meisten Patienten noch etwas in einem Dämmerzustand. So war es Schwester Rita, die die Patienten mit einem Waschlappen etc. wusch, und ich – wie auch andere Studenten – mussten hinterher die Patienten wieder abtrocknen. Sie fand dies sei besonders effizient und zeitschonend. Was die Patienten mitbekamen oder empfunden haben mögen?
Einmal sollte ein Patient mitten in der Nacht katheterisiert werden. Der diensttuende Assistenzarzt meinte, dass müsse doch der Student können. In anderen Worten er wollte eigentlich weiterschlafen. Nun da ich diesen Eingriff noch nie gemacht hatte, wollte er es mir zeigen. Dies lief dann so ab, dass er mir die Anatomie erklärte und ich eigentlich gar nicht genau wusste wie ich dies dann selbst machen müsste. Bei nächster Gelegenheit, bat ich einen Pfleger mir es doch nochmals zu zeigen. Bei ihm war es dann so, dass er mir exakt erklärte mit einem Tupfer erst so putzen, dann so usw. Da wusste ich technisch wie es anzustellen sei und mit den anatomischen Erklärungen des Arztes war ich dann gewappnet.
Im Studium wurde während der ersten Semester verlangt ein sogenanntes «Häfelipraktikum» zu absolvieren. Dies war gedacht, damit angehende Ärzte einen Einblick in die pflegerischen Vorrichtungen und Tätigkeiten bekommen sollten. Auch sollte man einen Eindruck von kranken Menschen bekommen, vielleicht auch schon die Beobachtungsgabe schulen. Hier nutzte ich meine Einsätze aus, und habe diese Pflicht mit meinen Nachtwachen und weiteren Tätigkeiten auf Stationen abgegolten. Studium, Nachtwachen etc., es war nicht immer einfach dies alles unter einen Hut zu bringen. So habe ich auch mal vorgezogen zu Schlafen statt in die Vorlesung zu gehen.
Es ging nicht lange, wurde ich für einen Einsatz auf der Intensivstation für Traumatologie aufgeboten. Das waren damals – anfangs der 70-er Jahre – neue Einrichtungen. Nach kurzer Einarbeitung musste ich selbstständig Schwerstkranke übernehmen. Die zuständige Oberschwester erkannte, dass sie mit motivierten und aufgeschlossenen Medizinstudenten ihre personellen Engpässe stopfen konnte (auch damals gab es schon so was wie einen Fachkräftemangel). So wurde ich mit anderen Kollegen zu Studenten mit vermehrter Verantwortung ausgewählt. Nun bekamen wir ein Stundenbüchlein und einen deutlich höheren Lohn. Auf der anderen Seite waren wir aber auch verpflichtet eine gewisse Anzahl Nächte, zum Teil auch Tage, zu arbeiten.
Die Arbeit auf der Intensivstation war oftmals sehr streng. Vor allem musste man sehr aufpassen die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit dem richtigen Patienten zu verabreichen. Im Nachhinein denke ich, wir wurden mit wenig Wissen zu grossen Aufgaben herangezogen. So kann ich mich erinnern, wie mir drei Patienten anvertraut waren. Die beiden äusseren Patienten waren beatmet und dazwischen lag ein unruhiger Patient mit einem Schädel-Hirn-Trauma. Da war man die ganze Nacht ein- und angespannt. Infusionen mussten gewechselt werden, die Ausscheidung kontrolliert und festgehalten werden und mindestens stündlich die Beatmungsmaschine genau kontrolliert werden. Dies sollte mir später als Assistenzarzt zu Gute kommen, ich kannte die Geräte schon.
Als unregelmässig Arbeitender war ich immer wieder mit verschiedenen Schichten, will heissen Teams, zusammen. In einem dieser Teams war eine Schwester Gisela – hieß sie wirklich so, ich weiß es nicht mehr. Immer nachts um drei wechselte sie alle Abfallsäcke aus und bestand darauf diese bis zur Übergabe am Morgen nicht mehr zu füllen. Wohin aber mit dem Abfall? Nun so gut diese Idee gemeint sein möge, zum Arbeiten war es nicht gerade einfacher, nur noch ein zentral gelegener Abfallsack durfte gebraucht werden. Wenn die Arbeit es zu liess, tranken wir kurz vor Übergabe an die nächste Schicht, eine Ovomaltine oder Schokolade. Bei der Vollbelegung der Station waren Pausen oftmals kaum möglich.
Es gab auch immer wieder schwierige Situationen. Einmal hatten wir einen Patienten mit einem Tetanus (Wundstarrkrampf). Die Behandlung war sehr anspruchsvoll. Er war beamtet, die Muskeln relaxiert. Damals hatten die Patienten oft schon eine arterielle Schleuse (Kanüle), um nicht ständig neu stechen zu müssen für die häufigen Blutkontrollen zur Überwachung der Sauerstoffkonzentration im Blut, die Elektrolyte (Salze) usw.. Ein Drucksystem war jedoch damals nicht immer angeschlossen. So konnte es passieren, und ist auch einmal geschehen, daß der Dreiweghahnen abfiel und das Blut aus der Schleuse frei ins Bett lief. Ein Horror. Wenn nicht rechtzeitig entdeckt, hätte der Patient verbluten können. Andererseits war das Bett voller Blut und der Patient mußte neu gebetet, aber vorher noch gewaschen werden. Es lohnte sich also engmaschig die Situationen im Auge zu behalten, sonst führte dies zu Gefährdung der Patienten und anschließender deutlicher Mehrarbeit.