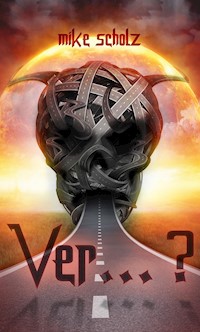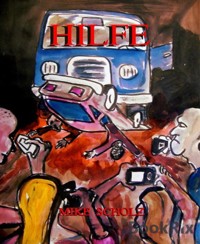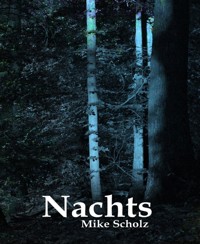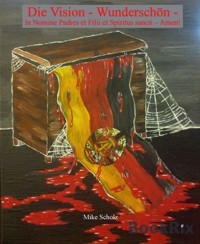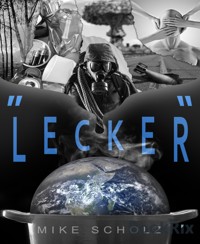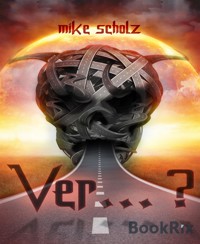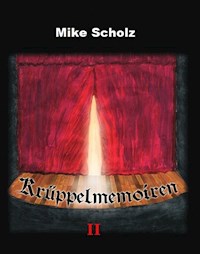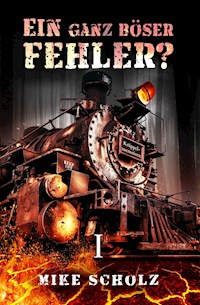
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sommer 1990, während der Wendezeit. Das Schicksal schreitet voran ... Ein junger Mann wird auf der Autobahn verunfallt. Schwer verunfallt. Und – alles ändert sich nun für ihn: Er ist nicht mehr der Strahlemann, der versucht, immer im Mittelpunkt zu stehen, er ist jetzt ins Abseits gestoßen. Alle seine "Freunde" haben ihn verlassen, seine Freundin hat ihn verlassen, seine Eltern haben ihn verlassen – er ist isoliert. Von den Ärzten erhält er eine vernichtende Prognose. War es das? Nun merkt er zum ersten Mal, dass man als "Krüppel" andauernd belogen wird, nicht mehr für voll genommen wird. Trotzdem: Er will sich durchbeißen, es allen zeigen, wieder hochkommen. Aber wie? Mit unbändigem Hass, Hass auf alles und jedem? Mit niemanden mehr störender Ironie? Mit gespieltem Zynismus? Jede Unterstützung, um die er heischt, wird ihm verwehrt. Während seiner Krankenhauszeit, die lange, sehr lange dauert, und auch, als er wieder im Alltag steckt. Oder er muss hart ringen um sie. Oder – muss er es doch nicht? Stehen ihm alle Wege offen, er erkennt es nur nicht? Wird er wieder ins Licht treten? Und was wird aus seinem Hass? Wird er ihn überwinden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titel
Impressum
"... The life is a show, and the show must go on."
Ich danke Angie, Mona und Micha für ihre Hilfe
Vorwort
Das Jahr 1990 ist angesagt, 3. August. Ein Jahr des totalen Umbruchs in Deutschland. Das sozialistische System der DDR musste sich geschlagen geben, zeigte, dass es der Marktwirtschaft unterlegen ist. Den Menschen hatten sich plötzlich die Grenzen geöffnet, jetzt konnten sie Leute wiedersehen, von denen sie geglaubt hatten, vor Jahrzehnten wäre es das letzte Mal gewesen. Auch die Währungsreform war vollzogen, die Ostdeutschen nannten seit einem Monat Geld ihr Eigen, welches Wert in der ganzen Welt besaß. Nur die politische Einheit fehlte noch, doch die war auch schon in Sicht, sollte noch im gleichen Jahr über die Bühne laufen. Alles schwelgte in Verzückung, freute sich über die neue Freiheit, die es auszukosten galt.
Wiedergeburt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Leben oder Tod?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
„Und geht mir mit Eurer Mitleidsheuchelei nicht immer aufn Sack!“
Ein ganz böser Fehler?
Ein ganz böser Fehler?
Krüppelmemoiren I
von
Mike Scholz
Autobiographie
Impressum
© 2018 Mike Scholz
E-Mail: [email protected]
Mobil: 0162 295 30 68
Coverdesign: Irene Repp
https://daylinart.webnode.com/
Bildrechte: © Gary Gray - 123rf.com; © Zacarias Pereira Da Mata - 123rf.com;
© nanypw - 123rf.com; © Jakub Gojda - 123rf.com
Satz: Jana Walther
Verlag & Druck: epubli
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
"... The life is a show, and the show must go on."
(Queen)
Ich danke Angie, Mona und Micha für ihre Hilfe
und grüße sie alle.
Vorwort
Ich hoffe, dass diese Geschichte denen nützt, die in einer ähnlichen Lage sind, wie ich es war. Meine Erfahrung besagt, dass Ärzte – ganz gleich welchen Fachgebietes – meistens zum Patienten sagen: "Riskiere nichts, es wird schon werden." Doch wie, das sagen sie einem nur ganz selten. Wenn man dann alles daran setzt, seine Regeneration zu verwirklichen, auch Niederlagen (Stürze mit deren Folgen) wegstecken kann, ohne dass man wegen Angst vor weiteren in sich zusammenfällt, dann schafft man es auch.
Ich war 21, als der Unfall passierte. Normalerweise – ich nehme es zumindest an – bekommt man dann von jeglicher Seite Unterstützung. Bei mir war aber das genaue Gegenteil der Fall: Höflichkeitsphrasen, die mir dann, als ich es merkte, auf den Geist gingen, waren von den meisten die einzige Hilfestellung, die sie mir zuteilwerden ließen.
Aus diesem Grund soll sie auch Freundeskreisen, die davon betroffen sind, zeigen, dass Behinderte noch eine Gefühlswelt haben und der Mensch immer noch ein Rudeltier ist; und Eltern könnten daran erkennen, wie man es nicht machen sollte.
Dies sind meine Memoiren, keine Fiction–Geschichte. Und Memoiren sind dazu da, es so zu beschreiben, wie es wirklich gewesen ist. Auch, wenn es manchmal sarkastisch bis makaber ist, sollte man doch immer bedenken, Umwelt beeinflusst den Menschen. Und in manchen Situationen wird man gezwungen, so zu reagieren! Eine Chance hätte es für mich nie gegeben, wäre ich ein ruhiger Typ. – Das ist vor kurzem von jemand Unbeteiligtem gesagt worden. – Ich möchte auch auf keinen Fall mit erhobenem Zeigefinger dastehen. Deswegen ist dies kein reiner Krankenreport. Obwohl dies eine gewichtige Rolle spielt – logisch, denn darum geht es ja. Aber es geht auch um das Umfeld, was für einen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und wenn einige daraus etwas für sich entnehmen können, bin ich schon zufrieden. Und wenn man noch darüber lachen kann – super. Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
So, und nun viel Spaß beim Lesen.
Das Jahr 1990 ist angesagt, 3. August. Ein Jahr des totalen Umbruchs in Deutschland. Das sozialistische System der DDR musste sich geschlagen geben, zeigte, dass es der Marktwirtschaft unterlegen ist. Den Menschen hatten sich plötzlich die Grenzen geöffnet, jetzt konnten sie Leute wiedersehen, von denen sie geglaubt hatten, vor Jahrzehnten wäre es das letzte Mal gewesen. Auch die Währungsreform war vollzogen, die Ostdeutschen nannten seit einem Monat Geld ihr Eigen, welches Wert in der ganzen Welt besaß. Nur die politische Einheit fehlte noch, doch die war auch schon in Sicht, sollte noch im gleichen Jahr über die Bühne laufen. Alles schwelgte in Verzückung, freute sich über die neue Freiheit, die es auszukosten galt.
Auch die Insassen eines Trabants, welcher gerade auf die Autobahn Löbau–Dresden am Burkauer Berg auffährt. Auch sie wollen die Möglichkeiten der neuen Freiheit genießen, wollen nach Augsburg fahren, um Karten für ein Thrash-Metal-Konzert zu holen.
"Gib Stoff!", fordert Mike, der Beifahrer, den am Lenkrad sitzenden Frank auf.
"Hier wird gebaut. Deswegen nur sechzig erlaubt."
"Scheiße!", knurrt Mike. Und legt die Füße auf das Handschuhfach, greift nach einer Zigarette, zuckt jedoch im gleichen Augenblick davor zurück, da er mit Rauchen aufhören will; wirft dafür einen Blick nach hinten auf den Rücksitz, wo Pia, seine Freundin, halb sitzt, halb liegt. Und er betrachtet sie genüsslich, kann sich sehr gut an den Freudentaumel der letzten Nacht erinnern, als er mit ihr das erste Mal schlief. Denn obwohl sie erst sechzehn ist, kann sie doch schon jedem Mann den Kopf verdrehen – mit ihren üppigen prallen Rundungen, an denen er sich laben konnte. Aber trotzdem! Mike – der gerade bei der Armee ist und kurz vor seiner Entlassung steht, welche am 24. August stattfinden soll (endlich, wie er findet) – wird danach für ein Jahr als Betreuer in die USA gehen und hat nicht die Absicht, sie dorthin mitzunehmen. Und er weiß auch, warum er Pia nichts davon erzählt, sie hier zurücklassen will: Er ist nicht in sie verliebt! Optisch sieht sie in seinen Augen zwar unheimlich gut aus, doch was sie außen mehr hat, fehlt ihr dafür im Kopf – findet nicht nur er. Und deswegen ist für ihn eine Bindung an sie auf ewig unmöglich.
"Ab Dresden wird die Autobahn besser", lässt sich Frank wieder vernehmen. "Ab da können wir dann schneller fahren."
"Ich werde jetzt schlafen", meldet sich Pia. Und auch Mike schließt die Augen, will ein Nickerchen machen. Denn der Sensenmann erhebt sich bereits mühsam ächzend, um die Toten für ihrem all–mitternächtlichen Rundgang aufzuwecken.
Plötzlich fängt Frank an, unflätig zu fluchen. Worauf Mike wieder die Augen öffnet, denn das ist nicht Franks Art.
"Was ist los?", fragt er verwundert.
"Na gucke mal durch die Scheibe!", kräht Frank wütend dagegen.
Mike setzt sich dazu auf. Wünscht sich jedoch im gleichen Augenblick, lieber unten geblieben zu sein. Denn draußen versucht sich ein Polski Fiat als Lückenspringer, überholt einen anderen Trabant, der sich mit ihrem Wagen auf gleicher Höhe befindet.
Frank flieht vor der drohenden Kollision auf die Parkspur. Verliert aber nicht die Kontrolle über seinen Wagen und schickt sich nach weiteren Flüchen an, seine Fahrt fortzusetzen.
Es rumst kurz. Glas klirrt. Dann ein aufbrüllender Motor, der plötzlich abstirbt. Und ein anderer, der eiligst verschwindet. Pia schreit auf: "Haltet an! Haltet an! Da ist was passiert!"
Frank stoppt den Wagen ab. Mike lugt durch die Heckscheibe, sieht jedoch nur rote Augen, die sich langsam schließen. Und ein paar helle Blitze, die ein Laser über den Horizont jagt. Doch sonst alles dunkel, wie in einer tiefen Grube auf einem verlassenen Fabrikgelände.
*
Mike ist ausgestiegen und läuft zurück, um sehen zu können, was da passiert ist.
Frank, der seinen Motor abgestellt hat, folgt ihm.
Wie von Geisterhand geschaffen tritt unvermutet ein Anblick aus der Dunkelheit hervor, der ihren Drang weiterzulaufen, stoppt, sie aber auch nicht zurückgehen lässt, an Ort und Stelle in Erstarrung treibt: Der andere Trabant steht quer zur Fahrbahn, belebt ihre Vorstellungen eines Trümmerhaufens: Scherben liegen weit verstreut auf der Straße, aus dem Nichts kommendes Licht spiegelt sich in den Zacken der Autoscheiben, die Heckklappe hat sich halb abgeschert und gewährt Einblick in die gähnende Dunkelheit des Kofferraums, Eingeweide des Wagens lugen um die Ecke; niemand bewegt sich darin, obwohl deutlich zu sehen ist, dass es zwei Insassen gibt.
Mike erwacht zuerst aus seiner Erstarrung. "Renn schnell zurück und hole Verbandszeug", weist er Frank an. "Und sage Pia, dass sie drin sitzen bleiben soll", fügt er noch hinzu. "Habe keine Lust, dass sie mir den Buckel voll kotzt."
Frank rennt los. Derweil ruckt Mike die Beifahrertür auf.
Eine korpulente ältere Frau schaut zu ihm – nein, nicht zu ihm, sondern zu irgendeinem entfernten Punkt hinter ihm. Und Blutbläschen blubbern stoßweise in unregelmäßigem Rhythmus aus ihrer Nase heraus. Der Fahrer aber schaut niemanden mehr an; er klebt mit dem Kopf am Lenkrad, dazu dringt qualvolles Stöhnen aus seinem weit geöffneten Mund.
"Und, was ist?", will Frank wissen, als er zurückkehrt.
Mike weist nach innen: "Gucke es dir an."
Frank riskiert einen kleinen Blick. Doch gleich darauf hält er sich würgend und heftig nach Luft japsend die Hand vor den Mund, saugt danach mit gierigem Röcheln die kühle Brise der Nacht in seine jetzt nach Erlösung schreienden Lungen. "Ich kann kein Blut sehen", gesteht er weinerlich, "davon wird mir immer soo schlecht."
"Mist, dann muss ich die Alte auch noch alleine raushieven", zeigt Mike sich wenig begeistert.
Doch dann fasst er zu. Schleppt unter Ächzen die Frau zum Straßenrand, wo er sie in eine stabile Seitenlage legt und nachschaut, ob er bei ihr irgendwo Verband anlegen muss. Da er aber nichts findet, rennt er zurück zum Fahrer des Wagens.
Frank spurtet zu diesem Zeitpunkt den Berg hinauf, hat das Den-Kommenden-Wagen-Zeichen-Geben über-nommen.
Kurze Zeit später kommt ihm der erste entgegen. Frank winkt – irgendwie, aber wie, das weiß er selbst nicht – und stellt erleichtert fest, dass der Opel Kadett das Winken bemerkt und richtig gedeutet hat. Frank schaut ihm nach, sieht, wie der Opel hinter Mike langsam vorbeituckert und dann nach der Unfallstelle anhält, die Warnblinkanlage blitzt auf.
Mike hat sich über den Fahrer gebeugt. Dabei bemerkt er, wie hinter ihm ein Wagen entlangfährt und dann irgendwo hält. Doch Mike kümmert sich nicht darum, ist vielmehr konzentriert auf den vor ihm liegenden Mann, fragt sich, ob er es wagen soll, ihn auch herauszutragen; ist sich jedoch nicht so schlüssig darüber. Darum richtet er sich wieder auf und lässt hilfesuchend seinen Blick umherschweifen.
Frank hat sich wieder der Bergkuppe zugedreht und will weiter auf sie zurennen. Doch da kommt der nächste Wagen. Und der fährt mit hoher Geschwindigkeit. Ein Mercedes ist es, erkennt Frank und fängt an zu winken.
Wiederum steigt in ihm Befriedigung auf, als er bemerkt, dass der Mercedes abbremst – er hört die Reifen quietschen. Aber plötzlich – der Mercedes gerät ins Schleudern.
Frank weiß noch nicht, was er davon halten soll.
Dann hört er, wie der Motor von einer starken Gaspeitsche getroffen aufjault, seinen geraden Weg fortsetzt. Und nun ist kein Bremsenquietschen mehr zu vernehmen. Er rast jetzt mit voller Geschwindigkeit auf Frank zu!
Dessen Augen weiten sich vor Erstaunen, gepaart mit Entsetzen. Nun hämmert es ihm durch den Kopf: Spring! Spring! Der Wagen hält nicht an! Spring!
Frank hebt ab. Dabei scheint es ihm, als wenn er in Zeitlupe segeln würde, Kopfschmerzen bekommt er; nur eine Hoffnung macht sich in ihm noch breit: Mike bemerke es und fliehe rechtzeitig. Dann landet er im Straßengraben.
Dort liegt er still mit schmerzenden Knochen und sieht nicht, was nun abläuft auf der Straße, hört es aber – ein Orgeln und Stampfen und Kreischen und Schreien, wie er es noch nie gehört hat, und nie mehr hören möchte. – Er hält sich die Ohren zu.
Mikes Blick bleibt an dem nun haltenden Opel hängen. Er sieht, wie die Warnblinkanlage angeschaltet wird, hofft, dass ihm der Fahrer helfen kann. Doch im gleichen Moment ertönt hinter ihm ein wildes Gehupe, Scherben knirschen, verraten, dass sie mit riesiger Geschwindigkeit überrollt werden. Dazwischen das immer wiederkehrende hysterisch–entsetzte Schreien von Pia: "Mike! Mike!"
Nun dreht er den Kopf in Richtung der Geräuschkulisse. Sieht einen schleudernden Mercedes auf sich zurasen. Will wegspringen.
Kurz nach dem Absprung spürt er, wie sein Körper von etwas Hartem erfasst wird. Dann wird es dunkel. Nur ein Gedanke schießt noch in seinen Kopf und bleibt in ihm stehen:
Das war's!
Wiedergeburt
„So close no matter how far …” (Metallica)
1
Dunkelheit
schwarzer Raum – kein Empfinden – existieren?
Dunkelheit
Plötzlich – ein Lichtblick
Wie von einem Blitz getroffen entsteht ein Gleißen in meinem Kopf, zeigt mir überdeutlich und unabänderbar ein Bild, in dem ich nur der objektive Zuschauer bin, meinen Körper sehe, in ihm aber nicht darinstecke: Er sitzt in einem Wagen, welchen es hin und her schüttelt.
Doch ehe ich nach diesem Bild greifen kann, es mir möglich ist, die Bewandtnis dieses Bildes zu ergründen, entfleucht es wieder. Und um mich herum senkt sich wieder der Schleier der Dunkelheit.
*
Plötzlich flammt das Licht wieder auf. Und diesmal weiß ich, wo ich bin: Im 'CK', einer Disko, wo ich mich öfters blicken lasse. Und stecke dort mitten in einer Schlägerei. Doch obwohl ich viele Schläge einstecken muss und ich hin und her wanke, wird mir klar, ich bin wieder nur Beobachter. Der Körper dort unten wehrt sich, versucht zurückzuschlagen; doch ich bin völlig unbeeindruckt davon, spüre keine Schmerzen, kein Wutlodern in mir, auch keine Reaktion, es juckt mich einfach nicht! Jetzt wird er auf eine Bank gedrängt und dort festgeklemmt, gleichzeitig droht das Bild wieder zu entfleuchen. Ich will es diesmal festhalten, suche eine Möglichkeit dazu. Doch – auf einmal etwas anderes. Ich schaue mich um. Gibt es hier irgendwo eine Kamera, welche sich umgeschwenkt hat? Ich richte meinen Blick wieder auf das sich vor mir abspielende: Sehe erneut ihn, diesmal auf einem Bett, an den Händen angeschnallt, zerrend und heftig reißend an seinen Fesseln. Und ich bin jetzt wieder drin im Körper, spüre das Festhalten an den Händen, spüre, dass ich versuche, mich zu befreien.
Es ist doch mein Körper!
Nach einer Weile halte ich erst einmal inne, um wieder Kraft sammeln zu können. Schaue mich derweil um und erkenne, dass mir der Raum bekannt ist. Nur woher? – Plötzlich, als wenn die Erkenntnis darauf gewartet hätte, bis ich mich mit diesem Thema befasse, um dann zu erscheinen, flüstert sie mir zu, dass ich mich im Bett der Wohnung befinde, in der ich neunzehn Jahre lang lebte. Doch warum? Vor einem Vierteljahr zog ich um. Und wer und warum hat man mich angeschnallt? Ich hasse es, in der Freiheit beschnitten zu werden!
Ich versuche wieder, die Gurte zu zerreißen. Versuche es mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht. Versuche es erneut und noch einmal.
Trotz der Vereinigung des Körpers mit mir – nichts. Ich resigniere. Das Leuchten vor meinen Augen wird auch wieder schwächer. Doch diesmal kann ich es nicht festhalten, bin ja der Beweglichkeit meiner Hände beraubt.
Die Dunkelheit nimmt mich wieder in Besitz, bettet mich ein in die Wogen ihrer Unendlichkeit.
*
Wieder das Leuchten. Erst ein Glimmen, dann die Leuchtkraft von vorhin, dann – es strahlt richtig. Sagt mir, dass ich in der Wirklichkeit sein muss. Ich fühle mich auch als Bestandteil dieses Körpers, der auf diesem Bett liegt.
Sind meine Hände immer noch angeschnallt? Ich hebe die linke Hand: okay; die rechte: Nanu? Was ist das? Sie lässt sich nicht bewegen! Ist sie noch angeschnallt? Nein. Und doch ... Was ist hier los? Und was ist das für ein Zimmer? Kann mich nicht erinnern, es irgendwann mal gesehen zu haben. Und was ist das für ein Bett, in dem ich hier liege? Kann mich auch nicht erinnern, jemals reingestiegen zu sein! Wo bin ich? Was wird hier gespielt??
Zwei junge Frauen treten in den Raum. Beide sehen sehr gut aus, doch – ich kenne sie nicht! Will sie auch deswegen fragen, was hier eigentlich los ist.
"Wo bin ich hier?"
"Können Sie uns hören?", werde ich statt einer Antwort gefragt. Und mir wird auf einmal klar: Ich habe nicht ein einziges Wort ausgesprochen. Nicht eines.
Ich schaue die beiden Frauen an, verdutzt und ungläubig. Kann es nicht fassen, dass ich nicht sprechen kann. Und das gerade ich, wo ich doch so eine absolute Quasselstrippe bin.
Die eine Schwester beugt sich besorgt über mich.
Das kann sie ruhig öfters machen. Denn was da in ihrem Ausschnitt leuchtet, sieht nicht schlecht aus. Außerdem duftet sie verführerisch.
"Ich kann das nicht verstehen", teilt sie der anderen mit. "Sein Puls ist in Ordnung, atmen tut er auch, rollt mit den Augen. Wahrscheinlich ist sein Gehör auch verletzt."
"Nein, das ist okay!", will ich schreien, aber auch jetzt entringt sich meinen Lippen kein einziger Laut.
Nur in meinem Kopf entstehen die Worte.
Wütend will ich mit dem rechten Arm auf das Bett schlagen. Werde jedoch sehr schnell und schmerzlos daran erinnert, dass der Befehlsverweigerung betreibt.
"Hörst du uns?", werde ich noch einmal von der über mir gebeugten Frau gefragt.
"Ja!" – Scheiße, geht nicht! – Ich nicke.
"Wie geht es dir?"
Wie soll es mir gehen? Beschissen! Vor allem, weil ich nicht weiß, was hier abläuft! – Ich zucke mit den Schultern.
"Schlaf ruhig weiter, du bist jetzt über den Berg." Sie lassen mich wieder allein.
Berg? Was für ein Berg? Bin ich Bergsteigen gewesen? Mache ich doch normalerweise gar nicht. Aber was ist hier normal? Ich kann nicht sprechen, den rechten Arm nicht bewegen – das muss ein Traum sein, ein schrecklicher Alptraum. Und die beiden jungen Damen sind Glücksfeen. Was haben sie gesagt? Schlafen? Aber ich schlafe doch schon. Aber vielleicht meinen sie richtig schlafen. Mmh, okay. Jetzt richtig schlafen und dann richtig erwachen. Und diesen Alptraum vergessen.
Ich lasse mich in die Dunkelheit zurückfallen.
*
Eine Stimme schlägt in mein Bewusstsein: "Heute ist Freitag, der neunzehnte August."
Mit einem Schlag bin ich hellwach. Überlege, was ich gestern gemacht habe. Überlege und überlege, zermartere meinen Erinnerungsspeicher. Doch der hüllt sich in Schweigen. Deswegen beschließe ich weiterzuschlafen. Ich träume noch!
*
Wieder Stimmen. Eine davon kommt mir bekannt vor.
"Ist es besser geworden mit ihm?"
"Er ist heute Vormittag erwacht." Das ist die Stimme der vorhin über mich Gebeugten.
"Und jetzt? Ist er jetzt auch wach?"
Woher kenne ich diese Stimme bloß? Es will mir nicht einfallen!
Die mir Bekannte kommt herein. "Mike, bist du wach?", fragt sie mich.
Ich nicke. Richte dann wieder erwartungsvoll meinen Blick in Richtung Eingang. Will endlich wissen, wem diese Stimme gehört.
Sie holt eine Frau herein. Und auch so, wie die Frau aussieht, ist sie mir bekannt. Also: "Wer ist das?".
Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Na klar, meine Mutter! Die sich jetzt mit mitleidsvollem Blick und fast schüchtern zu mir wendet.
"Hallo Mike. Erkennst du mich?", fragt sie mich leise, als wenn die Stasi mithören würde, und jeden Buchstaben betonend.
Ich nicke. Und fühle mich plötzlich geborgen und mit Wärme umhüllt, obwohl sie mich nicht anfasst. Nur – ich finde es schön, ein mir bekanntes Gesicht zu sehen.
"Ich darf dir noch nichts mitbringen, aber das wird sich bald ändern. Morgen komme ich wieder. Tschüss."
Ich greife mit der linken Hand nach ihrer – fürchterlich langsam bewegt sich diese –, bekomme sie zu greifen; dann fange ich an, sie zu streicheln. Ein Schleier legt sich vor meine Augen.
Nach einer Weile geht sie mit dem Versprechen wiederzukommen. Ich aber fühle mich durch diese Begegnung zu ihr so hingezogen, von ihrer Wärme so überwältigt, dass alle Fragen nach dem wie, warum und was überschattet werden und diese Gedanken an meine Mutter die Herrschaft in mir übernehmen. Ich schlafe wieder ein.
*
Die Augen geöffnet schaue ich mich sofort um. Und erblicke etwas Neues.
Es waralso doch nur ein Traum!
Ich juble innerlich.
Dann – Rückfall ins andere Extrem. Ein schmerzvolles Stöhnen will sich mir entringen, doch findet es keinen Ausgang, lässt dafür alles in mir verkrampfen: Wie oft träume ich diesen Scheiß noch? Hört das denn niemals auf? Werde ich denn niemals wach? – Ich liege in einem anderen Zimmer, einem Mehrbettzimmer, wo weitere sechs Menschen liegen. Und an meinem linken Arm hängt ein Schlauch.
Was soll denn das Ganze? ist das eine Klapper und ich soll stillgelegt werden?
Ich betrachte mir den Schlauch genauer. Stelle fest, dass er nirgendwo angeschlossen ist, einfach nur am Arm baumelt.
Hä? Hää? Was soll denn der dort?
Ich will ihn abreißen, denn er stört mich. Doch mit der linken Hand bekomme ich ihn nicht zu fassen. Die rechte – ich habe den linken Arm hinübergelegt – kann nicht zugreifen. Was nun?
Mir fallen die Zähne ein. Darum führe ich den Arm zum Mund und zerre den Schlauch heraus. Was zwar ein bisschen schmerzt, trotz dessen fühle ich mich jetzt viel freier.
Von irgendeinem Mitbewohner des Zimmers wird geklingelt, worauf eine – Ich wette hundert zu eins, dass ich mich in einem Krankenhaus befinde. Bloß – warum bin ich hier? – Krankenschwester erscheint: "Den Schlauch brauchst du aber noch."
Ich versuche zu antworten, will andeuten, dass dies Blödsinn ist – ich schüttle den Kopf.
Nichtsdestotrotz versucht sie aber, mir den Schlauch wieder anzulegen, hat allerdings nicht mit meiner Gegenwehr gerechnet. Sie kommt nicht an meine linke Hand heran, da ich sie immer wieder wegziehe.
"Ich muss wohl deine Hand erst festzurren!", droht sie wütend.
Ich tippe an meine Wange.
Verwundert schaut sie mich an.
"Na gut, auf deine Verantwortung", schränkt sie dann ein. "Aber wenn es nicht geht, kriegst du ihn sofort wieder dran." Ich grinse.
Warum soll es nicht gehen? Es hat, und dann werden wir weitersehen.
*
Essen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mit der linken Hand zu löffeln. Denn auch davon bleibt die rechte unbeeindruckt.
Ich weiß immer noch nicht, was ich hier eigentlich soll. Man scheint hier gar nicht daran zu denken, mich mal zu informieren. Könnte ich reden, würde ich einen Aufstand machen, dass der Sturm auf die Bastille als friedliche Demonstration erscheint. Aber das kann ich nicht! Träume ich vielleicht doch noch? Nee, dazu ist alles hier zu echt. Kann es der Wirklichkeit aber trotzdem nicht zuordnen! Alles konfus hier, unerklärbar, surreal! Ich hänge zwischen den Stühlen! Eine Scheißstellung ist das. Muss sogar daran zweifeln, ob ich es wirklich selber bin.
Das Essen schmeckt aber sehr gut; ich muss danach feststellen, dass der eine Teller für mich nicht reicht. Also wird noch einer verlangt.
Die Schwester schaut mich zweifelnd an, dann holt sie mir Nachschlag. Allerdings ist der so gering, dass der ebenfalls nicht ausreicht, nicht ausreichen kann. Ich verlange noch einen.
"Was, du willst noch einen?? Wo isst du denn das hin?"
Ich zeige feixend auf meinen Bauch. Ich bin ein schlanker Typ – schnuppere schon am Zustand des Dürrseins –, weshalb es ihr wohl auch etwas unklar ist, wie ich das verzehren konnte und immer noch nicht genug habe.
Sie betrachtet mich ungläubig, holt mir aber noch einen weiteren, der diesmal dick belegt ist.
Nachdem ich den auch verspeist habe, lächle ich befriedigt. Sie jedoch kann es nicht fassen. Schaut vom Teller auf mich und wieder zurück; dann zieht sie kopfschüttelnd ab. Aber wenn es so gut schmeckt, dann ist es doch wohl normal, dass man ein bisschen mehr isst. Und genau dies habe ich heute getan.
*
Am Abend erzählt man mir, dass meine Mutter gestern dagewesen wäre. Aber ich hätte geschlafen.
Die wollen mich wohl auf den Arm nehmen, ich war doch gestern wach!
Kurz darauf höre ich im Radio die Datumsangabe: "Es ist Sonntag, der 2. September."
Sonntag heute? Gestern war doch Freitag, also was soll das? Oder ist dem nicht so? Das gibt es doch aber gar nicht! Eigentlich müsste heute Sonnabend der 1.9. sein. Was ist hier los? Wollen die mich etwa verscheißern? Es macht denen hier wohl Spaß zu sehen, wie ich meiner Freiheiten beraubt bin! Ja, jetzt habe ich es: Man hat hier bestimmt das Radio manipuliert, es irgendwo angekoppelt, um mich im Ungewissen zu lassen. Ich soll nicht hinter die Bühnenvorhänge gucken können. Eindeutig. Ich könnte dabei ja etwas für die nicht so Angenehmes entdecken. Ja, die wollen mich verscheißern, ist sonnenklar!
2
Am nächsten Tag glaube ich, der Zeitpunkt ist gekommen, von hier zu verschwinden. – Ja, danke, es war wunderschön hier. Doch es ist nichts nach meinem Geschmack; darum winke–winke. – Ich fühle mich munter und frisch genug, misslingen also ausgeschlossen.
Aufrichten. Muss dabei bemerken, mein Kopf zittert wie im Sturm befindliches Espenlaub. Doch im Moment kann ich dagegen nichts tun, also ab in den Hinterkopf damit.
Der Fußboden vor mir scheint eben, begehbar zu sein.
Auf einmal registriere ich, wie irgendein Blick auf mir ruht. Ich hebe den Kopf, lasse meinen eigenen umherkreisen – dann: Ein älterer Patient beobachtet mich argwöhnisch. – Spinnt der? Was hat denn der zu gucken? Der ist wohl neidisch? Na, was soll's; mich juckt es ja eh nicht. Weiter geht es.
Die Beine stoßen die Bettdecke weg und stellen sich auf. Rechts ist das noch etwas komisch, aber egal jetzt. Eeh, wenn ich hier erst einmal raus bin, nicht mehr unter dem hiesigen Einfluss stehe, dann wird sich das schon geben.
In dem Moment – es klingelt. Verdutzt schaue ich mich um – der Alte hat geklingelt. Mistbock. Schleunigst wieder ins Bett.
Eine Schwester kommt hereingerannt. "Wer hat geklingelt?", will sie wissen.
Der ältere Patient meldet sich: "Ich war's. Der Junge da drüben war aufgestanden."
"Ist irgendwas nicht in Ordnung?", wendet sie sich an mich.
Ich gucke ganz unschuldig und zucke mit den Schultern.
"Okay, aber mache das nie wieder!"
Kaum ist sie weg, schnellt mein Körper wieder in die Höhe.
Es klingelt.
Ich lasse mich wieder zurückfallen und werde so wütend, dass ich ihm den Hals umdrehen könnte, wäre er in meiner Reichweite: Scheinbar will der sich als Amme aufführen. Hat der nicht mehr alle? Doch was bleibt mir anderes übrig? Ich muss nach wie vor gute Miene zum bösen Spiel machen, die Schwester ganz unschuldig anlächeln. Wird nur mit jedem Mal schwerer.
Die gleiche Schwester wie vorhin. Der Hilfsaufpasser reckt nur seinen Finger in meine Richtung, worauf sie sofort zu mir weiterläuft.
"Also wenn ich wegen dir noch einmal gerufen werde, passiert was!", schreit sie mich an. "Dann schnalle ich dich wieder fest!"
Darauf zu nicken, fällt mir schwer, doch ich tue es. Muss es tun, denn sonst passiert das sofort; man kann erkennen, dass sie dazu bereit ist.
Nach ihrem Weggang beobachte ich erst einmal meinen Aufpasser, um erfassen zu können, wann sich mir eine reelle Chance zum Aufstehen und Abhauen bietet.
Nach einer langen Weile – einer unendlich langen Weile; kostbare Zeit geht mir dadurch verloren – hat er vom mich Anstarren genug und wendet sich ab.
Jetzt!
Wie auf einem schlappen Trampolin liegend katapultiere ich mich aus dem Bett. Ein Schritt, der zweite – plötzlich knicke ich mit dem rechten Bein um und lande unter dem Bett.
Es klingelt. Ich mache mir nicht erst die Mühe des Aufstehens.
Die Schwester kommt wieder hereingerannt und stürmt sofort auf mein Bett zu. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr Gesicht jetzt zorngerötet ist, die Blutadern pulsierend hervortreten wie bei einem, der soeben gehenkt wird.
Nach einem längeren Augenblick erscheint ihr Gesicht in meiner Höhe. "Was soll das? Du willst dich wohl völlig umbringen?" Ihr Gesicht ist tatsächlich hochrot.
Ich fange an zu grinsen. – Soll ja helfend sein, habe ich gehört. – Was sie dazu animiert, es mir gleichzutun. – Sieht so richtig niedlich aus. Das andere stand ihr nicht.
"Und, wie kommst du jetzt wieder hoch?"
Eh, mache dir darum mal keine Sorgen.
Ich bedeute ihr mit einer einladenden Geste, sich neben mich zu legen; worauf sie mir aber ein Stirnrunzeln herüberschickt.
Kann sie das Zeichen nicht richtig interpretieren oder ist es ihr unterm Bett zu unromantisch?
Da sie die Frage nicht hört, kann sie auch nicht antworten. Bedauernd zucke ich deswegen mit den Schultern; schnappe mir danach mit links eine Bettstütze und ziehe mich hoch, wobei sie mir hilft.
Oben lasse ich mich erleichtert ins Bett fallen. Muss dabei erstaunt feststellen, dass das unnormal anstrengt, Höchstleistungen von mir abfordert. Was aber nicht heißt, dass ich es nie wieder machen werde. Obwohl sie mir eine "letzte Warnung" gegeben hat und ich angeschnallt sein als beschämend empfinde.
Es klingelt.
Diesmal schimmert kein Lächeln auf den rosigen Wangen der Schwester, ihr Gesicht ist eine starre Maske, durchpulst von übermächtigem Ergrimmen. Mir wird klar, jetzt ist der Zeitpunkt der Hinrichtung gekommen, jetzt brauche ich nicht erst die unschuldsvolle Miene aufzusetzen, jetzt hätte sie keinen Sinn mehr.
"Jetzt reicht es! Jetzt wirst du angeschnallt!", bestätigt sie meine Befürchtung.
Ich will dagegen was sagen; muss aber wieder mal feststellen, dass ich vergessen habe, dies ist unmöglich – zurzeit, denn ich bin fest davon überzeugt, dass es mir wieder gelingen wird. – Ich greife zu meiner einzigen Kommunikationsmöglichkeit – schüttle heftig den Kopf wie bei Rock'n Roll.
Sie ignoriert es.
Ich balle die linke zur Faust und wehre mich. Sie ruft eine zweite Schwester herbei; nun liegt das Kaninchen auf der Schlachtbank.
*
Wieder allein. Angeschnallt an der linken Hand. Ich bin ein Schwerverbrecher, der im Zuchthaus an den Ketten hängt und auf seine Hinrichtung wartet. Meine Wut, sie wird unvorstellbar groß, wächst immer weiter, so dass es mich schon fast selber vor ihr graust: Wenn ich reden könnte, würde ich den dafür schuldigen Alten so belegen, dass er sich unterm Bett verkriechen müsste und die Maden in seinem Gesicht verschwänden. Doch es gibt kein Abflussventil für meine Wut! Nicht durch den Mund, nicht durch die Hände! Oder doch? Meine rechte Hand ist nicht festgeschnallt; man nimmt ja an, ich könne sie nicht rühren. Doch niemand hat bedacht, dass die Finger ein bisschen beweglich sind. Damit müsste es doch gehen, nicht? Okay, ich versuche es. Und wenn ich es geschafft habe, was mache ich dann: dem Alten erst eine reinziehen oder gleich verduften?
Ich bekomme tatsächlich die beiden Hände zusammen, zumindest soweit, dass ich mit der rechten den Gurt berühre, muss ihn nur noch aufbekommen.
Immer wieder habe ich es versucht, und es gelang mir auch, den Gurt zu lockern. Doch gelöst hat er sich nicht. Weil mir das Gefühl in der Hand fehlt. Was mache ich nur? Was? Sollte das schon alles gewesen sein?
Die Schwester kommt herein und schaut nach, ob mein Gurt noch sitzt.
Ja, Frau Wärterin, meine Fessel ist noch dran.
Sobald sie wieder verschwunden ist, versuche ich es noch einmal wie vorhin.
Wieder nichts. Doch so schnell werde ich mich nicht unterkriegen lassen.
Plötzlich fällt mir eine vielversprechende Möglichkeit ein.
Ich führe meinen Kopf an den Gurt, fasse diesen mit den Zähnen. Und – ääh, schmeckt furchtbar beschissen – er löst sich tatsächlich. Immer weiter.
Die Schwester kommt schon wieder herein. Sieht den nun fast gelösten Gurt.
"Das kann doch wohl nicht wahr sein", stöhnt sie auf. "Das kann es doch nicht geben! Vor dir ist wohl gar nichts sicher?" Und will mich wieder festbinden.
Ich gebe es auf. Lege meine linke zur rechten Hand, was als Zeichen dafür gilt, dass ich ein Nickerchen machen will. Denn nur, wenn ich die Notlichtlampe hinter meinen Lidern beschaue, kann ich schlafen.
Sie gewährt mir die Erholung.
*
14.00 Uhr. Ein älterer Mann in weißem Kittel wird mir vorgestellt. Er soll mich bei meiner Krankengymnastik anleiten. Ich weiß zwar nicht, was Krankengymnastik beinhaltet und warum die bei mir angewandt wird, doch der Mann ist sympathischer Natur, schnell fasse ich Vertrauen zu ihm.
"Guten Tag! Wie geht es?", fragt er mich als erstes.
Ich weiß nicht, ob ich den Daumen heben oder senken soll, also lächle ich.
"Jetzt machen wir erst einmal paar Tests und dann schreiten wir zur Tat."
Er schaut nach, wie die Beweglichkeit meiner Arme und Beine aussieht: Das linke Bein kann ich ein paar Zentimeter anheben, rechts ist die ganze Seite katastrophal – kein Drehen, kein Heben, keine Bewegung, nichts. Warum?
*
Am Ende dieser Krankengymnastik bin ich schon in der Lage, das rechte Bein einen Mikrometer anzuheben.
Wow, super! Wenn ich bedenke, dass ich vor nicht allzu langer Zeit im Stehen das Knie bis zur Brust brachte ... wow, Superleistung! – Er bescheinigt mir das auch. – Eeh ich weiß zwar nicht, warum ich hier liege, doch ich bin schon in der Lage, das rechte Bein und auch den Arm soweit anzuheben, dass sie nicht einstauben. Und mit dem linken Bein kann ich schon tieffliegende Mücken jagen. Und wenn ich die zur linken Hand treibe, kann ich sie sogar erschlagen. Wow, was bin ich glücklich! Der glücklichste Augenblick in meinem Leben!!! – Scheiße hoch ... ich weiß nicht, wie viele Nullen.
Als er dann fertig ist, einigen wir uns noch darauf, dass er – wenn es geht – zweimal am Tage kommt.
*
Wieder allein. Ich liege im Bett und stelle zum ersten Mal fest, wie langweilig es hier ist. Habe auch nichts zum Lesen. Normalerweise vertreibe ich mir die Zeit immer damit, aber hier – Fehlanzeige. Was dann?? Üben, was er mir gerade gezeigt hat? – Affig, okay, denn wenn es mir gelingt, hier abzuhauen, ist das mit den unbeweglichen Beinen und Armen eh gegessen; doch irgendwas muss man ja tun gegen dieses scheiß-nagende Scheusal, das sich Langeweile nennt.
*
Meine Mutter lässt sich wieder mal blicken, bringt ein junges Mädchen mit, dass ich sofort als meine Schwester erkenne.
"Hallo Mike, wie geht es dir?"
Ich lächle. Bin froh darüber, Besuch zu bekommen. Denn es ist mein einziger Kontakt zur – Außenwelt? Wenn ich hier wirklich in einem Krankenhaus liege, kann es ja nur die Außenwelt sein.
Meine Mutter hat Saft und Früchte mitgebracht, übermittelt mir Grüße von Leuten, an die ich mich sofort erinnern kann: ehemalige Lehrer, frühere Klassenkameraden. Doch was jetzt für mich primär ist: Ich will endlich was über den letzten Monat erfahren!
Darum starte ich einen Versuch, mich mit Gesten verständlich zu machen. Die aber nicht verstanden werden, auch nicht von meiner Schwester, obwohl sie krampfhaft versucht, sich in meine Sprache hineinzuversetzen. Allerdings glaube ich, dass selbst ich meine Gesten nicht verstanden hätte, wenn ich nicht wüsste, was sie bedeuten.
Plötzlich habe ich einen neuen Einfall: Na klar, ich werde einfach das, was mich bewegt, aufschreiben.
Nachdem ich mir Stift und Zettel habe bringen lassen, erscheinen die ersten Striche auf dem Papier. Und da ich Rechtshänder bin, schon immer mit rechts schrieb, versuche ich es auch automatisch mit rechts. Doch – weit komme ich damit nicht. Ich kann den Stift einfach nicht festhalten! Wenn ich ihn ansetze, muss ich immer ohnmächtig und von Grausen erfüllt sehen, wie er mir wegrutscht, wie er gegen meine Finger drückt und dann zwischen ihnen hervortritt wie beim Seewolf die zerquetschte Kartoffel, weil sie keinen Gegendruck erzeugen können.
Oh no! Sollte ich etwa überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, meine Fragen in die Öffentlichkeit zu bringen? Ich kann nicht sprechen! Ich kann keine Zeichensprache! Ich kann nicht schreiben! Ich kann nichts! Nichts!! Nichts!!! Bin ich auf Ewigkeit dazu verdammt, in meiner eigenen Traumwelt zu leben, in ihr ständig isoliert zu sein, weil ich sie niemandem vermitteln kann??
"Mike, versuche es doch mal mit links!", reicht mir plötzlich meine Schwester einen Vorschlag herüber. Einen brauchbaren, glaube ich.
Ich versuche es. Muss dabei feststellen, das Schreiben klappt, nur – selbst ich kann es nicht lesen.
Meine Mutter und meine Schwester natürlich auch nicht. Darum versuche ich es noch einmal, krakle diesmal ganz, ganz langsam, Strich für Strich sorgfältig ausführend, Punkt für Punkt besonnen nachdrückend. Sieht auch etwas besser aus; doch – auch jetzt können sie sich nicht hineinversetzen.
Sie rufen eine Schwester; die schaut es sich konzentriert an, kommt dann dahinter: "Wie komme ich hierher?"
Ich juble innerlich, könnte der Schwester um den Hals fallen: Du bist ein Schatz! Die ersten Worte von mir, seit ich hier drin bin, die das Tageslicht erblicken.
"Das erfährst du nächste Woche", sagt meine Mutter. "Jetzt wäre es noch zu zeitig dazu."
Ich glaube, mich verhört zu haben: Warum will sie mir das verheimlichen?
Plötzlich durchzuckt mich ein Schatten, der mir zuflüstert, ich hätte schon vor meinem Hiersein nicht das beste Verhältnis zu ihr gehabt. Aber das warum, wieso, weshalb usw.. bleibt im Dunkeln. Nur katapultiert es mich zögerlich doch stetig zu der Überzeugung, dass sie die Ursache für diesen Schlamassel ist: Vielleicht will sie mich wieder an sich binden, damit ich ihr den Dreck wegräume.
Ich stutze: Woher kommt dieser Gedanke schon wieder? Und spüre, dass sich irgendetwas hinter diesem Blitz verbirgt, irgendeine Wahrheit, vielleicht irgendetwas mich aufklärendes, zu dessen Schloss ich aber den Schlüssel nicht finden kann, vielleicht nie mehr finden soll und deshalb nie mehr finden werde.
Wütend schaue ich vor mich hin. Die Wärme, die ich so wohltuend empfand, hat sich in Luft aufgelöst; wenn ich meine Mutter ansehe, fühle ich, wie Erinnerungen an die Oberfläche wollen, nur noch keine Öffnung finden. Und ich muss ehrlich sagen: Ich habe Angst vor den Erinnerungen; und doch gelüstet es mich, den Schleier von ihnen herunterzureißen, mich den sicher existierenden Komplikationen zu stellen.
Meine Mutter und meine Schwester – sie nimmt mein Geschriebenes mit, um sich mit ihm vertraut machen zu können – gehen wieder; mit dem Versprechen, auch morgen wiederzukommen.
3
Sonntag, 9. September. Früh.
Wie jeden Morgen ist Visite angesagt. Die Ärzte sind bei mir angekommen, schauen sich die Papiere an. Dann fragen sie mich, ob es mir gut gehe. Dabei erwarten sie bestimmt wieder, dass ich ein Zeichen gebe. Aber ich will unbedingt endlich antworten, habe es noch nicht aufgegeben.
"Ja."
Sie schauen ganz verdutzt.
Ich bin es auch.
"Was?"
"Gu." Dazu lächle ich sehr zufrieden. Endlich wieder einen Ton gesagt.
"Er kann wieder sprechen! Er bessert sich weiter!" Die Überraschung und auch die Freude darüber ist den Ärzten anzusehen.
Mein Lächeln wird verschmitzt, tue so, als könnte ich es schon lange, habe es ihnen nur die ganze Zeit nicht verraten.
"Und jetzt weiter üben, damit es nicht wieder verschwindet!", ermahnen sie mich im Weggehen noch.
Mein Wortschatz ist leider noch nicht groß genug, um fragen zu können, was hier eigentlich los ist. Im Kopf sind die Wörter klar, doch mit der Artikulation klappt es noch nicht so. Also halte ich ein paar Monologe ab, damit er sich erweitert. Aufzustehen stellt jetzt kein Priorität für mich dar, das Sprechen ist wichtiger.
*
Am Nachmittag kommt meine Mutter mit einem hübschen Mädchen, die ich irgendwoher kenne; allerdings nicht weiß woher.
"Hall."
Meine Mutter stutzt. "Mike, du kannst ja wieder sprechen! Das ist also die Überraschung, von der die Schwestern sprachen."
Nicken. Und ich genieße ihre Verwunderung. Denn ich war es ja auch mal, wenn ich es auch mittlerweile als die selbstverständlichste Sache der Welt ansehe. – Ist ja eigentlich auch völlig normal, dass ein Mensch spricht. Noa??
Während sie auspackt, was sie mir mitgebracht hat, schaue ich mir das Mädchen genauer an: Sie lächelt freundlich, ich spüre wieder diese wonnige Wärme, die aber diesmal nicht von meiner Mutter ausgeht und auch eine andere ist.
Woher kenne ich die bloß?
Meine Mutter bemerkt diesen Blick. "Kennst du sie?", fragt sie mich deswegen.
"Jaaa", bin ich noch am Überlegen.
"Und wie heißt sie?"
Eigentlich habe ich ja ein gutes Namensgedächtnis, aber hier? Richtig peinlich so was. Also muss ich raten, was soll's: "Dianaa."
"Nein, Pia. Und sie ist deine Freundin. Weißt du das noch?"
Aha, sie ist meine Freundin. Daher kenne ich sie also. Und Pia heißt sie? Soso. Na ja, Hauptsache, meine Freundin.
"Ja, kese." Damit verschwindet das Fragen in meinem Blick. Ich schnurre.
In dem Gesicht meiner Mutter blitzt kurz ein Ausdruck der Enttäuschung auf. Doch der ist sofort wieder verschwunden.
Warum ist sie enttäuscht? Verbirgt sie irgendetwas vor mir? Sie will mir nicht sagen, warum ich hier bin, ist enttäuscht, dass ich meine Freundin wieder erkenne ...
DAS LETZTE STÜCK DRECK!
Was war das? Was hat das schon wieder zu bedeuten? Keine Ahnung, doch später werde ich mich darum kümmern.
*
Meine Mutter macht sich zum Aufbruch bereit. Wohingegen Pia jetzt richtig auf den Plan tritt: "Wie geht es dir, Mike?"
"Gan gu", schaue ich ihr jetzt tief in die Augen.
"Soll ich wiederkommen?"
Ich möchte antworten "natürlich", bekomme aber nur ein Nicken heraus. Kann dafür aber weiter lächeln.
"Ich mache jetzt los, Mike." Ruhig und beschwörend redet sie auf mich ein, wie ein Dompteur auf seinen tierischen Schützling. – Bin ich ein angeschlagenes Raubtier? – Sie gibt mir noch einen Kuss auf die Wange; ich nehme ihre Hand, streichle diese. Dann geht auch sie.
Pia heißt sie also. Kann mich zwar nicht erinnern, jemals eine Pia gehabt zu haben, aber der Name ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass ich jemanden liebte und liebe – Oder lieben werde? Habe ich mit ihr eigentlich schon gepennt? Oh peinlich, das will mir auch nicht einfallen. Kenne ich doch überhaupt nicht von mir. Erst weiß ich den Namen nicht, dann weiß ich nicht, ob ich mich schon mal von ihr habe verführen lassen ... eeh bin ich überhaupt Mike Scholz? Es nützt nichts, ich muss mal irgendwann demnächst in den Spiegel gucken. Doch was ist, wenn ich nicht Mike Scholz bin??
4
Montag, 10 September. Nachmittag.
Pia ist da. Allein. Vorhin waren meine Mutter und meine Schwester hier, wobei meine Mutter den Vorschlag ablehnte, mich aus dem Bett zu nehmen und in einen Stuhl zu setzen. Überhaupt kam es mir so vor, als wenn sie heute nur zur Pflichterfüllung hier gewesen wäre; lediglich meine Schwester zeigte Anteilnahme, versuchte, mein Gekritzeltes zu entziffern. Doch dem jetzigen Augenblick messe ich viel mehr Bedeutung bei: Ich habe Pia gefragt, warum ich hier bin.
"Hat dir das noch niemand gesagt?", fragt sie ungläubig.
Ich schüttle den Kopf. Zwar hatte ich mal bei den Schwestern nachgefragt, doch so richtig Auskunft geben konnten sie mir auch nicht. – Oder wollten nicht?
"Gut, dann werde ich versuchen, es dir zu erklären. Allerdings weiß ich auch nicht allzu viel davon: Also, du hast versucht, anderen, die einen Unfall hatten, zu helfen. Dabei bist du angefahren worden. Das ist alles."
Wovon spricht sie – ich wäre angefahren worden? Davon weiß ich doch gar nichts. Vor allem, ich bin doch ein vorsichtiger Typ. Wie kann mir das also passieren? Fragen über Fragen. Sie hat mir zwar eine beantwortet, dadurch sind aber wieder eine Menge neuer aufgeworfen worden.
"Wasa si äh äh abspiel?"
"Ich kann dir auch nicht mehr sagen, ich saß mit dem Rücken dazu."
Sie war also dabei, doch sie weiß auch fast nichts. Oder soll ich bloß eingelullt werden? Nee, glaube ich nicht, dass sie mit meiner Mutter unter einer Decke steckt. Weiß nicht warum, doch ich glaube es nicht. Also dürfte sie die Wahrheit gesagt haben. Doch – wie soll man das kombinieren? Schlussfolgerungen – no chance. Ich begreife es nicht. Kann es nicht begreifen. Will es nicht begreifen? ist es wirklich so irrationell? Wieder mal weiß ich es nicht, so wie ich zurzeit eigentlich nichts weiß. Nichts wissen soll? Doch, eines weiß ich: Ich werde dahinterkommen, werde die Geheimnisse lüften! Egal, ob es mir oder jemanden anderen weh tun wird. Ich werde es wissen!
*
Beim Abschiednehmen werden wir uns darüber einig, dass sie mich aller zwei Tage besuchen kommt. "Unorallm ohne mei Mutte. Ich möch mi diralleisein uni ständi ihr lände Gsich deiham." Denn plötzlich kann ich mich wieder daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit wie das letzte Stück Dreck behandelt wurde: Ich durfte jeden Mist machen, um dann doch nur Prügel dafür zu bekommen. Gelobt – kann mich nicht erinnern, jemals gelobt worden zu sein. Meine guten Leistungen in der Schule – uninteressant. Von Bedeutung war nur meine Ordnungszensur, ständig 'genügend'. Aber ich wurde doch dazu animiert! Sie selbst war und ist eine große Schlampe! Saubere Wohnung – Fremdwort für sie. Dafür spielte sie allein immer so ein beklopptes System von Mensch-ärgere-dich-nicht. Oder machte Kreuzworträtsel.
Ich spüre, dass da noch mehr in meiner dafür reservierten Kammer auf einen Ausbruch wartet. Was wird es noch sein, was mich dann völlig von ihr abstößt?
5
11. September. Vormittag.
Diesmal habe ich es geschafft aufstehen; wenn auch nur mit Mühe und Not. Und stehe jetzt neben dem Bett. – Da meine Aufpasseramme entlassen worden ist, kann ich mir das ohne Probleme leisten. Die anderen gucken nur misstrauisch und als ich ihnen sage, dass sie nicht klingeln sollen, drehen sie sich wieder ab. – Jetzt Lauscher ausfahren, denn ich möchte bei meinem Ausreißversuch nicht gestört werden.
Doch niemand ist zu hören. Schnell noch ein letztes Mal umschauen – von den anderen Patienten achtet keiner auf mich, also kann ich starten.
Der erste Schritt. Der zweite. – Dabei halte ich mich aber lieber fest, denn ich bin ja schon lange nicht mehr gelaufen.
Überraschend kommt plötzlich eine Schwester herein. – Innerliches Aufstöhnen – habe sie gar nicht gehört –, dann lasse ich mich grinsend ins Bett zurückfallen.
"Na, wo willst du denn hin?", fragt sie mich.
"Lieg is äääh lanweil."
"Jetzt bleibst du erst einmal liegen, gleich gibt es Mittag."
Nachdem sie mich gefragt hat, wie viel ich will (was jeden Tag passiert), dreht sie wieder ab.
Na gut, das Mittagessen wird noch abgewartet, dann geht es auf Tour.
*
Nach der Mittagsruhe richte ich mich wieder auf und strecke mein Ohr wieder in Richtung Außenterrain: Stille.
Ich stehe auf.
Jetzt ein Schritt nach dem anderen – langsam, festhaltend.
Dann vorn am Bett. Doch da sich mein Bettausgang an der Wandseite befindet, muss ich um das Bett herum, also an der Fußseite entlang.
Der erste Schritt, noch einer – plötzlich knickt mir das rechte Bein weg. – Wieder das rechte! Was ist nur los mit ihm?
Schnell versuche ich, mich am Bett festzuklammern, was aber auch schief geht. Ich falle, purzele allerdings geruhsam unter das Bett.
Zum Fluchen komme ich nicht einmal, da die anderen Patienten sich mir interessiert zuwenden.
"Ni kling, ich schaffsallee!", zische ich schnell, damit es draußen niemand mitbekommt. Und ächze mich schnellst möglichst unter mühsamer Aufbringung aller Kräfte ins Bett zurück.
*
Nach einer dringend benötigten Verschnaufpause stehe ich wieder auf. Rechts vom Bett steht ein Stuhl, den ich erst mal ansteuern will, um mich dort kurz erholen zu können. Er steht aber nicht genau am Bett, sondern ich muss erst vom Bett wegtreten. Aber zuerst um das Bett herum.
Noch langsamer als vorhin, noch vorsichtiger, denn ich kenne ja nun die Unteransicht des Bettes, brauche sie nicht noch ein drittes Mal zu besichtigen, meine Augen kleben fast am Fußboden.
"Phhh, gschafft."
Jetzt noch zum Stuhl und dann wäre der erste Zielort erreicht. Doch wie mache ich das am besten?
Ich bleibe stehen, denke nach. Und nach einer kurzen Weile fällt es mir ein: Immer an der Wand lang, na klar!
An der Wand stehend schätze ich den Raum bis zum Stuhl ab: Circa einen Meter. Doch alles frei um ihn herum, keine Möglichkeit zum Festhalten. – Den Meter schaffe ich auch noch, wäre ja gelacht, wenn nicht.
Wankend, schnell das linke Bein wieder zum Stand bringend – wobei mir mächtig die Kraft ausgeht –, erreiche ich den Stuhl und lasse mich erschöpft auf ihn fallen; wobei mir klar wird, dass ich erst mal eine Weile sitzen bleiben muss, um wieder Kraft zu tanken. Trotzdem – den ersten Teil habe ich geschafft!
Eine Schwester kommt herein. Verdutzt schaut sie mich an.
"Wie bist du denn in den Stuhl gekommen?", schaut sie sich misstrauisch um.
"Gloufe", bekommt sie lakonisch von mir zu hören. Und genieße dabei wohlig die von ihr ausgestrahlte Überraschung.
"Willst du bis zum Abendbrot im Stuhl sitzen bleiben?"
Ich nicke, hätte augenblicklich auch nicht die Kraft aufzustehen und zu flüchten. Außerdem wäre es jetzt völlig sinnlos abzuhauen, da es ja gleich was zu mampfen gibt. Denn zu dem Zeitpunkt laufen zu viele herum.
6
Mittwoch, 12 September. Morgens.
Nach dem Frühstück bin ich wieder mal dabei, mich in den Stuhl zu bugsieren, nur hilft mir diesmal eine soeben eingetretene Schwester.
Eigentlich könnten wir ja gleich weiterlaufen; wobei ich ihr natürlich nicht erzählen darf, dass ich abhauen will.
"Könntst Laufübung mitir mach, Schwesterchn, äh hm?" – So nenne ich alle hier befindlichen Krankenschwestern.
"Was für Zeug?"
"Laufübu--ngen. Od meinst, ich wi ew so rum-äh-hoppen?"
Sie schaut mich ungläubig an, dann grübelt sie nach.
"Heute Mittag, eher habe ich keine Zeit", ist sie sich dann schlüssig geworden. "Außerdem brauche ich noch jemanden dazu."
Das letzte Phonem spricht sie gar nicht mehr richtig aus, dreht schnell ab und verschwindet – wahrscheinlich, damit mir nicht noch mehr einfällt.
*
Ich warte und sitze, sitze und warte – furchtbar langweilig. Auch habe ich keine Ahnung, wie spät es ist. Ohne Uhr ist das schlecht möglich (meine Mutter ist der Meinung, ich brauche keine) und eine innere Zeituhr besitze ich nicht. Ergo gehe ich den Schwestern, immer wenn sie kommen, gehörig auf den Geist, fordere stets Laufübungen, gebe keine Ruhe mehr – irgendwann muss es ihnen doch mal zu bunt werden und irgendwann müssten sie mir doch mal den Wunsch gewähren.
*
Schließlich werde ich erhört: "Auf geht's, jetzt ist die Laufübung dran."
Sofort werde ich nervös, fühle eine nervliche Anspannung in mir. Doch wahrscheinlich ist es immer so, wenn man etwas heiß ersehnt und nach endlosem Warten endlich erhält. Deshalb achte ich auch nicht weiter darauf; und einen Rückzieher zu machen kommt sowieso nicht in Frage.
Sie heben mich an den Armen auf die Füße: Ein herrliches Gefühl, ohne festhalten wieder auf den eigenen Beinen zu stehen. (Die Schwestern halten mich an den Oberarmen, so dass ich die Hände nicht irgendwo dagegenstemmen muss.)
Der erste Gang in Richtung Tisch. Manchmal knicken mir die Beine weg, aber es muss weitergehen, denn schließlich will ich ein Ziel erreichen. Dabei merke ich aber, dass es ohne Hilfe noch (!) nicht gehen würde. – Also muss ich weitertrainieren! Das ist die einzige Möglichkeit!
Vom Tisch aus laufen wir zurück zum Bett. Doch dabei zeige ich rapide Verschleißerscheinungen, die letzten Schritte schleiche ich nur noch. Und wären nicht die Schwestern, dann würde ich schon lange wütend auf dem Boden liegen.
"Na, es reicht wohl erst einmal", sagt eine der Schwestern. "Du kannst jetzt sowieso eine Pause machen, es gibt nämlich gleich Mittag."
"Bist du zufrieden, Mike?", will die andere wissen.
"Für erst äh ja. Da aber ni heess, dass grad die letzt äh Tour war. Wann kommtirn heut wiede?"
"Das musst du unserer Ablösung sagen. Wir machen nach dem Mittagessen Schluss."
"Daserd ich. Ihr könnt euch äh drauf verlass."
Sie lachen wissend und lassen mich zurück ins Bett plumpsen.
*
Unfern vom Abendbrot wird mit mir endlich die nächste Laufübung gemacht. Und bei der erreichen wir gerade den Tisch, als meine Mutter erscheint.
"Bringen Sie ihn bitte zurück ins Bett", weist sie die Schwestern an.
Fassungslos, mich endlos aufregend, erschreckt starre ich sie an: Die spinnt wohl! Ich bin froh, dass ich aus dem Bett raus bin!
Strohdo...
Strohdoof? Strohdoppelgeil? Oder was war das? War es vielleicht wieder die besondere Kammer, die brauchbare Informationen über meine Mutter enthält?
"Waruniin Stuhl?", grollt es konfrontationsbereit in meiner Stimme.
"Im Bett geht es leichter, auch für dich."
Ich bin entsetzt, entsetzt über so viel Dummheit. Doch jetzt stehen mir die Schwestern bei: "Er kann in den Stuhl, er ist schon fast den ganzen Tag dort. Und gestern war er auch."
Meine Mutter wird rot. – Nichts mit bestimmen über mich! – "Na gut, ich wusste das nicht", lenkt sie zerknirscht ein.
Ich aber muss erkennen, dass in Bezug auf sie wieder eine Erinnerung gekommen ist: Erst fiel mir ein, dass sie meine Mutter ist, dann, dass ich von ihr als Kind wie das letzte Stück Dreck behandelt wurde, und heute, dass sie einen Dachschaden hat. Langsam öffnet die Kammer "Persönlichkeit meiner Mutter" ihre Pforten.
Nach ein paar Grußübermittlungen und dem Hinweis, dass sie morgen nicht kommt, verschwindet sie wieder. – Habe ich vielleicht an ihrer Ehre gekratzt?