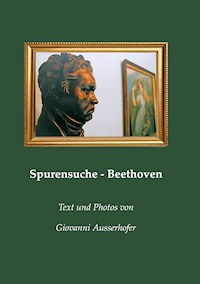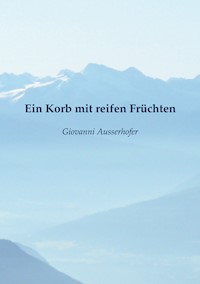
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser »Korb mit reifen Früchten« bringt Begegnungen und Gespräche mit namhaften Persönlichkeiten aus Kultur und Politik, deren geistreiche Äußerungen, frei nach Goethe, hier »eine befruchtende Wirkung entfalten« sollen: Yehudi Menuhin erzählt von seiner Hingabe zur Musik Mozarts, Elisabeth Schwarzkopf über ihre Pflicht und Erfüllung als Sängerin, Götz Friedrich über seine Erfahrung bei einer Operninszenierung mit Marionetten, Rudolph Noelte über seine Leitidee von textgetreuer und historisch verorteter Regiearbeit, Jossi Wieler über den anderen Weg, den der Aktualisierung antiker Dramen. Günter Grass spricht ausführlich über sein politisches Engagement im Rahmen von Politik und Literatur, Otto von Habsburg über seinen Weg zu einem vereinten Europa, und das Konzept von Johannes Wasmuth wird vorgestellt, der sein Museum zu einer Begegnungs-stätte einrichtete. Giovanni Ausserhofer legt neben diesen Aufzeichnungen von bedeutenden Zeitgenossen auch eigene historische Betrachtungen vor: Die authentischen Erfahrungen bekannter Persönlichkeiten bei Kriegsbeginn 1914; das Aufspüren gefährlicher Tendenzen in den Zwischenkriegsjahren durch einen scharf beobachtenden Joseph Roth sowie den chronologischen Verlauf der Autonomie-Bestrebungen in Südtirol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
gewidmet all jenen, mit denen ich ein offenes, ehrliches Gespräch führen konnte, die mir zuhörten und unvoreingenommen versuchten, das Gesagte zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I: Ausstellungen
Melodie für Volk und Herrscher
Joseph Haydns »Kaiserhymne
«
Das Zeitalter Rembrandts
»Die Sehnsucht ist dem Menschen oft lieber als die Erfüllung
«
»
Friedrich der Große – verehrt, verklärt, verdammt...
«
Eine Rezeptionsgeschichte des preußischen Königs
Fundsache Luther
Archäologen auf den Spuren des Reformators
Casanova. La Passion de la Liberté
»… selige Augenblicke – sinnliche Genüsse zu kultivieren
«
Albrecht Dürer: Kunst – Künstler – Kontext
»Ein guter Maler ist inwendig voller Figur…
«
Georg Büchner – Revolutionär mit Feder und Skalpell
»Wir wissen wenig voneinander… wir sind sehr einsam
«
Artus – der Traum vom Guten Herrscher
»Audite fratres, rex quidam fuit, qui Artus vocabatur
«
Gian Lorenzo Bernini – der Erfinder des barocken Rom
»Ich vertraue der Gnade des Herrn, der nicht mit Pfennigen rechnet
«
Sophie Taeuber-Arp – die bekannte Unbekannte
… mehr als nur eine »fleißige Träumerin
«
»
documenta 13« in Kassel
Reflexionen beim Betrachten einiger Kunstobjekte
II. Besprechungen
Grazile Puppen, die lebend sich entwickeln
»Hoffmanns Erzählungen
«
von Jacques Offenbach im Salzburger Marionettentheater
Moskau mit der Seele suchend
Anton Tschechows »Drei Schwestern
«
in der Regie von Rudolf Noelte
Michelangelo – Der Dichter
Das poetische Talent des Universalgenies
Die Begegnung zwischen Goethe und Napoleon
Eine erkenntnisreiche Studie über das historische Treffen
Ludwig van Beethoven und Joseph Woelfl
Ein Klavierwettstreit zwischen »amici rivali
«
Sostiene – erklärt Pereira
Eine historisch erzählte Zeugenaussage
Friedrich Schiller - Gayot de Pitaval
Infame Verbrechen als literaturgeschichtliche Dokumente
»
Die Marquise von O.
«
»… wenn er ihr nicht wie ein Engel vorgekommen wäre
«
»Ida« – Vergangenes bestimmt ihr Leben
Ein polnischer Film mit sozial-historischen Bezügen
»
Winterschlaf
«
von Nuri Bilge Ceylan mit der »Goldenen Palme
«
in Cannes ausgezeichnet
Ein
»
Faust
«
-Film
–
ohne des Pudels Kern
des russischen Regisseurs Alexander Sokurow
III
.
Gespräche und Interviews
mit Persönlichkeiten aus Kultur und Politik
»
Alle Konflikte werden ins Innere verlagert
«
Yehudi Menuhin
dirigiert W. A. Mozarts »La clemenza di Tito
«
Singen als Pflicht und Erfüllung
Die Kammersängerin
Elisabeth Schwarzkopf
blickt zurück
»
Das Dreieck in uns selbst
«
Jossi Wieler
(Regisseur) über Heinrich von Kleists »Amphitryon
«
»
Rückkehr zu den Quellen
«
Götz Friedrich
(
Regisseur) zu W. A. Mozarts »Cosi fan tutte
«
Vereinigtes Europa – Ende oder neuer Anfang?
Ein Gespräch mit
Otto von Habsburg
(Präsident der Paneuropa Union und Mitglied des Europäischen Parlaments
Die Wiedervereinigung Deutschlands Herbert Wehner
(
Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen)
Literatur und Politik Günter Grass
und sein politisches Engagement
IV. Joseph Roths politische Einstellung
»
Gift in veilchenblauen Kelchen
«
Roths literarischer Kampf gegen den Nationalsozialismus
»
Der Tinten-Terror der Bürokratie
«
Seine Berichte über die Sowjetunion, zwei Jahre nach Lenins Tod
»
Die messianische Friedensidee ist die Zerstreuung
« Joseph Roth - im Widerspruch zum Zionismus
V. Johannes Wasmuth – eine visionärer Impresario
Als der Schnurrbart am Nagel hing
J. Wasmuth
–
sein Wirken und seine Verdienste
Eine Gedenktafel für Johannes Wasmuth
VI. 31. Juli 1914: Kriegsproklamation des Deutschen Reiches
»… als in ganz Europa die Lichter verlöschen«
VII. Betr.: Südtirol
Silvius Magnago
,
Landeshauptmann von Südtirol, Thema: »Probleme der Südtiroler Hochschüler
«
Chronologie des Südtirol-Konflikts
vom Ende des Zweiten Weltkriegs (1945) bis zum Autonomiestatut (1970)
Anhang
Abbildungen
Anmerkungen
Vorwort
Ein Besuch des Obstmarkts in meiner Heimatstadt Bozen war in meiner Kindheit stets ein sinnfreudiges Ereignis. Zu jeder Jahreszeit wurden die im Umland gereiften Früchte verlockend dargeboten. Im Frühjahr schmackhafte Erdbeeren, dann dunkelrote, saftige Kirschen und mehltauig-blaue Pflaumen, honiggelb-samtene Marillen und köstlich schmeckende Äpfel sowie Birnen verschiedener Sorten; zu Beginn des Herbstes kamen erlesene Trauben aus dem Überetsch mit frisch gepflückten, weichen Feigen und orangefarbigen Kaki-Früchten dazu und, kurz vor Wintereinbruch, schließlich die begehrten glänzenden Edelkastanien.
Nicht nur die Reife dieser Früchte war begehrenswert anzusehen, auch die Art, wie sie behutsam präsentiert wurden, steigerte das sinnliche Verlangen. Sie wurden sorgsam sortiert bereitgestellt, wie bereits Goethe auf seiner Italienreise 1786 auf dem Bozner Obstmarkt feststellte: »in runden flachen Körben, über vier Fuß im Durchmesser, lagen Pfirsiche wie Birnen nebeneinander, da sie sich nicht drücken sollten«.
Der Bozner Obstmarkt regte aber nicht nur die Sinnes- und Gaumenfreuden an, er bot auch die Gelegenheit zu Begegnungen mit den Bürgern zu einem unbefangenen Austausch des alltäglich Erlebten.
Diese früh in meiner Kindheit erfahrenen Eindrücke wurden wieder lebendig, als ich die Aufzeichnungen von Begegnungen und Gesprächen noch einmal zur Hand nahm, die ich mit außergewöhnlichen Menschen führen durfte, aus denen soviel Menschenkenntnis, Weitsicht und Lebensreife spricht.
Diese Begegnungen und Gespräche, die großen Einfluss auf mich gehabt haben, will ich nun hier unter dem schlichten, aber zutreffenden Titel »Ein Korb mit reifen Früchten« präsentieren.
Bereits bei der ersten Begegnung mit Yehudi Menuhin spürte ich den vom Geist der Humanität erfüllten Weltbürger, der in einer aufrichtigen und zugewandten Weise über Musik und ihre transformierende Kraft für unser Leben sprach. Seine innige Hingabe zu Mozart rührte daher, dass man in dessen Kompositionen die gesamte Spannweite menschlicher Gefühle glaubwürdig und mit tiefem Empfinden nachvollziehen kann.
Elisabeth Schwarzkopfs makellose, natürliche Stimme hörte ich zum ersten Mal als Student in einem Liederabend und war fasziniert, wie sich Wort und Gesang vollendet vereinten und einen betörenden Glanz erlangten. Ein großer Zauber ging von ihren Opernrollen aus, besonders als Donna Elvira und Fiordiligi von Mozart und als Marschallin im »Rosenkavalier« von Richard Strauss. Hier erreichte die Schönheit der Stimme, ihre klare Artikulation und künstlerische Perfektion eine hohe Vollendung. Nach ihrem Abschied von der Bühne wollte ich sie, die zu den führenden Sopranstimmen der Welt gehörte, einiges aus ihrem Leben als Opern- und Liedersängerin erfragen. Sie sagte zu und nahm sich auch genügend Zeit über »Pflicht und Erfüllung« als Sopransängerin zu berichten. Dabei war, als sie rückblickend über ihre Karriere berichtete, eine spürbare Strenge zu sich selbst und ein starker Wille nach künstlerischer Vollendung zu erkennen.
Anregend und reizvoll war mitzuerleben, wie der gefragte Opernregisseur Götz Friedrich auf der kleinen Marionettenbühne in Salzburg Mozarts »Cosi fan tutte« inszenierte. In diesem »dramma giocoso« geraten Liebende, durch ein Intrigenspiel verwirrt, in ambivalente Gefühle, werden in ihrer Existenz erschüttert und stehen sich am Ende betroffen, aber versöhnend gegenüber.
Es ist ein Werk voll menschlicher Gefühle, dessen Dramatik durch die anmutige Leichtigkeit der Marionetten in gewisser Weise gemildert wird und beim Regisseur wie bei den Mitspielern eine heitere und spielfreudige Stimmung auslöst. Man spürte bei den Puppenspielern, durch die charmanten Bewegungen der Marionetten motiviert, etwas von jenem Gefühl, das einst Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz »Über das Marionettentheater« als eine verloren gegangene kindliche Unschuld bezeichnete.
Mit einem bis in die feinsten Details und Nuancen erarbeitetes Konzept begann der geniale Regisseur Rudolf Noelte seine berüchtigten Theaterproben. Denn er las die Dramen so wortgetreu und deutungstief wie die Noten einer Partitur und konnte die Figuren so formen und darstellen, wie sie wohl vom Verfasser kreiert wurden.
Mit eleganter Vehemenz und unerbittlicher Genauigkeit inszenierte er mit den Schauspielern Wort für Wort, jede Hebung und Senkung der Silben, jedes Atemholen, jede Geste und jede Bewegung bis hin zum Augenaufschlag. Auf Noeltes Bühne verbreitete sich Sinnlichkeit und ein leiser Abschiedsschmerz, atmosphärisch noch unterstützt durch ein schräg einfallendes Dämmerlicht und einen in die Tiefe gehendenden Raum. Sein Regietheater war zeitlos, da er fern jeder Mode Menschen in ihrer Verlorenheit, Einsamkeit und in ihren Sehnsüchten zeigte.
Gegensätzlich im Arbeitsstil wie in der Herangehensweise inszenierte der Regisseur Jossi Wieler. In einem intensiven Dialog mit den Schauspielern spürte er zunächst dem tieferen Sinn und der Symbolik des Werkes nach, um dann im wechselseitigen Austausch die Figuren zu gestalten, und dies stets unter einem gesellschaftskritischen Aspekt. Seine Intention war, das Bühnenwerk zeitbezogen zu gestalten, damit wir erkennen, was es uns heute noch zu sagen hat. Dabei achtete Jossi Wieler darauf, dass die Werke, wie er betonte, »von innen heraus beleuchtet und glaubwürdig« umgesetzt werden und dass sie gleichzeitig den Zuschauern auch »Echoräume« zum Reflektieren und für eigene Gefühle bieten.
Allein den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Nachkriegszeit, Günter Grass, in einem Podiumsgespräch im Kreise von Studierenden über »Literatur und Politik« sprechen zu hören, ließ von Anbeginn eine erwartungsvolle Stimmung aufkommen, die sich im Verlauf der Diskussion noch steigerte. Das lag sicher daran, dass Günter Grass seine Sichtweise auf aktuelle Geschehnisse pointiert vortrug, erkennbar in seiner Vortragsweise und in seinem sonoren, einnehmenden Erzählton, der die gekonnt formulierten Sätze in einem Wechsel von Spannung und Entspannung vortrug.
Für das Publikum war das Gespräch mit Günter Grass eine positive Erfahrung wegen der deutlichen wie pointierten Stellungnahme zu politischen und literarischen Aspekten, mehr noch wegen des druckreif formulierten Vortrags, der zeigte, wie wirkungsstark die Sprache sein kann, wenn sie klar strukturiert und auf einem bestimmten Niveau sich bewegt.
Die Begegnung mit Dr. Otto von Habsburg erfüllte mich mit dankbarer Ehrfurcht angesichts seiner Stellung, die er im Verlauf der historischen Geschehnisse eingenommen hat, war er doch einst der Thronfolger des untergegangenen österreichischen Vielvölkerstaats. Eindrucksvoll wurde dies öffentlich erkennbar beim Staatsbegräbnis des Kaisers Franz Joseph, als er, erst vierjährig, leuchtend weiß gekleidet mit den Eltern dem Sarg seines Urgroßonkels folgte und für die Trauernden gleichsam ein tröstliches Sinnbild für eine fried- und hoffnungsvollere Zeit darstellte.
Auch wenn Otto von Habsburg weder Reich noch Krone erben sollte, so wurde ihm der verpflichtende Auftrag vermittelt, als Repräsentant einer einstigen Dynastie sich für die allgemein gültige Idee einzusetzen, wonach sich bereits die kaiserlichen Vorfahren in ihrem übernationalen Vielvölkerstaat orientierten: eine Grundlage des Rechts und der Selbstbestimmung zu schaffen, damit die Völker sich entfalten und in gegenseitiger Achtung miteinander leben können.
Aus dieser verantwortungsvollen Verpflichtung setzte sich Otto von Habsburg, unbeirrt der intensiven Angriffe von rechts und links, für eine Integration der europäischen Völker ein und war über viele Jahre im Europäischen Parlament der Fürsprecher dieser Idee.
Trotz seiner Position und seiner Vergangenheit trat Otto von Habsburg im Gespräch bescheiden auf und zeigte sich ganz zugewandt den gestellten Fragen, so als wäre nun ein bedeutsamer Moment gekommen, sein Herzensanliegen darlegen zu können. Intuitiv spürte ich eine große Persönlichkeit, die, historisch verwurzelt, sich überzeugend wie zuversichtlich für ein besseres gemeinschaftliches Leben der europäischen Völker einsetzt.
Rückblickend kann ich sagen, dass solche Begegnungen für mich mehr als nur wertvolle Geschenke waren, ich empfand sie als ein hohes Gut, da sie das Leben lebenswerter erscheinen ließen. Und kam es dabei zu einem lebendigen Gespräch und geistigen Austausch, dann wirkten sie, wie Anton Tschechow schreibt, gleich einem in der Seele lange nachklingender Gesang.
Franz Grillparzers Erzählung »Der arme Spielmann«, die ich als 12jähriger las, eröffnete mir damals das Tor zur Literatur. Ich traf auf eine Sprache, die ich von zuhause nicht kannte. Mit diesem Reclambändchen betrat ich als Knabe für mich neue, nie geschaute Landschaften, in denen sich Wirkliches mit Unwirklichem verband und der überschaubare Bereich meiner Kindheit sich mit einmal erweiterte. Ein nicht mehr zu stillendes Bedürfnis wurde geweckt, von nun an in die von Literaten geschaffene Welten einzutreten, sie zu erkunden und mitfühlend zu erleben.
Später, als Jugendlicher, galt dann meine Vorliebe der dramatischen Literatur, den Bühnenwerken Friedrich Schillers und William Shakespeares. Ich wollte genauer wissen, wie Regisseure das Geschehen in Szene setzen und den Schauspielern ihre Vorstellungen vermitteln. Deshalb suchte ich auch das Gespräch mit den Regisseuren.
Neben diesen literarischen Aspekten war für mich außerdem noch das Historische bestimmend. Das hatte seinen Grund: Seit meiner frühen Kindheit hatten die Besuche bei der Großmutter stets einen besonderen Reiz wegen der dort vorhandenen antiken Gegenständen, die sie selbst einst geerbt oder als Aussteuer zur Hochzeit erhalten haben mochte. Mit diesen Zeugnissen vergangener Epochen waren Erinnerungen verbunden, von denen die Großmutter anschaulich zu berichten liebte, so dass ich diese »alten Sachen«, wie sie genannt wurden, mit einigem Respekt zu betrachten und zu schätzen begann. Daraus entwickelte sich nach und nach mein lebhaftes Interesse für das Vergangene.
Ein historisches Ereignis, das mich entscheidend prägte, war die im November 1957 durchgeführte Großkundgebung auf Schloss Sigmundskron, an der 35.000 Südtiroler teilnahmen und bei der der Landeshauptmann Silvius Magnago in einer beeindruckenden Rede die gefährdete Existenz Südtirols und den befürchteten Verlust der traditionsreichen Heimat beschwor.
Obwohl ich damals noch ein junger Schüler war, begann ich zu ahnen, wie bedeutsam Tradition, Herkommen, Geschichte - kurzum die Vergangenheit für eine Volksgemeinschaft sein kann, denn man kann sich von den Wurzeln der eigenen Geschichte kaum lösen. Und warum sollte man es überhaupt tun? Nur wenn man die eigene Vergangenheit vergißt, sich von ihr ganz trennt, erst dann hört eine Gemeinschaft auf zu bestehen. Eine bloß auf die Gegenwart ausgerichtete Existenz gefährdet ihr Bestehen.
Damals erkannte ich bereits, dass geschichtliches Wissen und Denken uns unser eigenes Dasein besser verstehen lässt und dass wir erst aus diesem Wissen das Neue und das Notwendige zu tun vermögen. Ein Rückblick und Besinnen auf das, was die Generationen vor uns erlebt haben, lehrt uns gleichzeitig, Mögliches in Angriff zu nehmen und Unmögliches zu unterlassen.
Diese Erkenntnis war für mich auch der Grund, Geschichte zu studieren.
Juni 2022
I . Ausstellungen
Eine Melodie für Volk und Herrscher Joseph Haydns Kaiserhymne
Als Auftakt zum Haydn-Gedenkjahr 2009 präsentierte die Österreichische Nationalbibliothek vom 28. 11. 2008 bis 1. 2. 2009 im prachtvollen Ba-rocksaal der Wiener Hofburg in der Ausstellung »Joseph Haydn - Gott Erhalte, Schicksal einer Hymne« 1) das Autograph der bekannten Kaiser-hymne sowie Dokumente zu dessen historischem Werdegang. Neben der wechselvollen Geschichte dieser Hymne Joseph Haydns wurde den Be-suchern durch Briefe, Tagebücher, Handschriften und Objekte aus der Musiksammlung auch die Persönlichkeit und die Umgebung des Kom-ponisten zur Zeit des Entstehens dieser Komposition näher gebracht.
Abb. 1
Joseph Haydn komponierte die Hymne zwischen Oktober 1796 und Januar 1797 in einer unruhigen, angespannten Zeit, als europäische Mo-narchien Koalitionskriege gegen das republikanische Frankreich führten. Denn die von dort ausgehenden revolutionären Ideen richteten sich gegen das monarchische Prinzip und bedrohten die Existenz der absolutistisch regierten Staaten. Diese politische wie gesellschaftliche Gefahr veranlasstedas kaiserliche Herrscherhaus in Wien, die Verbundenheit mit dem Volk durch Symbole zu bekräftigen.
Welche Wirkung der Musik zukommt, wenn sie volksnah und gefühlvoll gestimmt ist, das zeigte die Marseillaise, deren Erklingen die Franzosen einander näherbrachte und positive Emotionen bei ihnen auslöste.
Deshalb sollte bewusst ein musikalischer Gegenpol gesetzt werden, und zwar von dem damals berühmtesten Komponisten im Habsburgerreich, von Joseph Haydn. Wolfgang Amadé Mozart war bereits gestorben und Beethoven erst am Beginn seines Schaffens.
Joseph Haydn, gerade von seiner zweiten Londoner Konzertreise nach Wien zurückgekehrt, war von der englischen Hymne »God save the King« und deren suggestiver Wirkung beeindruckt. Er beabsichtigte ebenfalls eine feierliche Volkshymne zu komponieren. Deshalb war es für den Regierungspräsidenten Franz Graf von Saurau ein Leichtes, als er an Haydn mit der Bitte herantrat, er möge den bereits vorliegen Text des Kaiserlieds »Gott! erhalte Franz, den Kaiser, /...« von Lorenz L. Haschka vertonen.
Der äußere Anlass war die Geburtstagsfeier von Kaiser Franz II., dem obersten Repräsentanten des Römischen Reiches Deutscher Nation, am 12. Februar des Jahres 1797 im Alten Burgtheater. Die Übergabe dieses musikalischen Geschenks war sorgfältig inszeniert. Vor Beginn der Feier wurde den geladenen Gästen auf Handzetteln der Notentext verteilt, und der Ablauf der festlichen Veranstaltung wurde so gestaltet, dass es auch bei einem verzögerten Erscheinen Seiner Majestät kein Verschieben des kaiserlichen Geburtstagsständchens gab.
Nach der Pause erklang zum ersten Mal Haydns Komposition. Gleichzeitig wurde auch in allen Theatern Wiens und in vielen Orten des Kaiserreichs Haydns Hymne gespielt, um so eine rasche und breite Wirkung im Volk zu erzielen. Und dank der wohlgesetzten und eingängigen Melodie wurde die Kaiserhymne beim Volk populär wie ein Volkslied.
Von dieser Musik war ein reicher Engländer, der gerade in Wien weilte, so angetan, dass er spontan 24 arme Brautpaare ausstatten ließ und für sie ein Hochzeitsmahl beim Hoflieferanten Jahn arrangierte. Während des Festessens wünschten sich die Neuvermählten aus tiefer Dankbarkeit, man möge das »Gott erhalte« von Haydn dreimal spielen.
Auch der Kaiser war mit der Komposition zufrieden und ließ Joseph Haydn eine goldene Dose mit seinem Bildnis überreichen.
Haydn hat mit Absicht volksliedhafte Elemente aufgegriffen, so den auf den Grundton beginnenden Tetrachord, eine Tonfolge vieler Volkslieder und sakraler Gesänge. Vermutlich hat er sich auch des kroatischen Volkslieds »Vjutrerano« aus seiner Kindheit im Burgenland erinnert. Durch Haydns meisterliches Können ist diese Komposition eine in sich harmonisch vollkommene Einheit geworden. Sie wird als kleines musikalisches Juwel bezeichnet.
Um die schwebende Transparenz dieser Melodie nicht zu stören, verzichtete Haydn auf jeden pathetisch-effektartigen Ansatz. Dass ihm dies ein Anliegen war, zeigt der zweite Satz seines wenig später komponierten »Kaiserquartetts« (op. 76,3), in dem er die Melodie der Kaiserhymne aufgreift und diese, entgegen den bisher figurativen Verzierungen bei Variationen, gleichbleibend, fast ehrfurchtsvoll, nur kontrapunktisch verdichtend, durch die einzelnen Instrumente wandern lässt, um sie dann mit wehmütiger Inbrunst ausklingen zu lassen.
Abb. 2
Dass die Komposition der Hymne Joseph Haydn selbst etwas Besonderes bedeutete, zeigte er in seinen letzten Lebensjahren, als er selbst feststellte: »all mein Kraft ist hin«. Zu der Zeit begann er sein tägliches Klavierspiel mit dem Intonieren seiner Kaiserhymne und empfand dabei Ehrfurcht und Zuversicht.
In dem monarchischen Vielvölkerstaat gestattete man den dort lebenden Völkern, auch um die Solidarität mit dem Kaiser zu stärken, den Hymnentext in die jeweilige Sprache zu übersetzen, was zur Popularität der Haydn-Melodie beitrug, die nun neben dem Bild des Kaisers das Symbol dieser Monarchie wurde.
So entstanden, unberührt von Haydns Melodie, verschiedene Textversionen, von denen dann 1826 aufgrund »Allerhöchster Entschließung« der Text eines unbekannten Dichters als »die offizielle« Version deklariert wurde.
Mit der Thronbesteigung von Kaiser Ferdinand I. (März 1835) drehte sich das Hymnenkarussell erneut. Diesmal wurden 14 Textvorschläge eingereicht, darunter auch einer aus Preußen, was, da dieser von außerhalb der österreichischen Monarchie kam, als illoyal angesehen wurde.
Ein ähnliches Gerangel um den Hymnentext entstand in den ersten Herrscherjahren von Kaiser Franz Joseph, der kurz vor der Vermählung mit Elisabeth, am 24. April 1854, den Vorschlag von J. G. Seidl als die nunmehr authentische Texthymne erklärte.
Sie blieb während seiner langen Herrscherzeit unverändert bestehen. Mit seinem Tode 1916 begann der Untergang der Donaumonarchie, der, zwei Jahre später, nach verlorenem Weltkrieg, durch die Siegermächte besiegelt wurde. Ein republikanisches Österreich entstand und es wurde vergeblich versucht, eine neue Nationalhymne zu kreieren. In dieser turbulenten Zeit des Umbruchs wurde für den Dauphin Karl I. offiziell kein neuer Text geschrieben. Wie an einem Anker, hielt man an der überlieferten Hymne fest.
Auch in der Ersten Republik Österreich (ab 1918), die sich der Tradition verpflichtet fühlte, war die Haydn-Melodie weiterhin ein Allgemeingut. Erst ab 1929 wurde dann dieses bewährte Musikstück durch eine neue Bundeshymne mit dem Text: »Sei gesegnet ohne Ende…« ersetzt.
Nach dem nationalsozialistischen Einmarsch in Österreich (März 1938) überstülpte man dem nun als "Ostmark" des Deutschen Reiches benannte Land die Doppelhymne des Dritten Reiches, das »Deutschlandlied« und das »Horst-Wessel-Lied«.
Nach Kriegsende beschloss man 1947 in der neu entstandenen Republik Österreich, die braun besudelte, ideologische verzerrte Haydn-Melodie nicht mehr einzuführen. Man entschied sich für die Musik eines Mozart zugeschriebenen Freimaurerliedes, nun auf den Text: »Land der Berge, Land am Strome… «
Eine kuriose Variante erhielt die Hymne nach dem frühen Tod Kaiser Karls I. Monarchietreue widmeten dem Thronprätendenten Otto von Habsburg die Hymne: »In Verbannung, fern den Landen / Weilst du, Hoffnung Österreichs…«; sie bestand inoffiziell bis zu dessen verbrieften Thronverzicht 1961.
Parallel zu der im Habsburger Reich gesungenen Hymne wurde während der nationalen Freiheitsbestrebungen auch in deutschen Gebieten die Haydn-Musik aufgegriffen.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als nationale Bewegungen sich zunehmend ausbreiteten und es noch über 40 deutsche Staaten gab, schrieb Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland »Das Lied der Deutschen« und versah es, der Wirkung wegen, mit der Melodie von Haydns Kaiserhymne. Nicht mehr einem Herrscher war das Lied nun zugedacht, sondern einem ersehnten Land, das noch zu gründen war.
Während der revolutionären Wirren von 1848 wurde es von den studentischen Burschenschaften stimmungsvoll patriotisch gesungen, und es erklang – nunmehr bekannt als das »Deutschlandlied« – nach der Proklamation des deutschen Kaiserreichs (1871). Beliebter waren allerdings »Die Wacht am Rhein« und »Heil Dir im Siegerkranz«.
Erstmals offiziell bei einer regierungsamtlichen Handlung wurde 1890 auf Helgoland »Das Deutschlandlied« angestimmt, als die Insel dem Deutschen Reich zugesprochen wurde.
Während des ersten Weltkriegs wurde dieses Lied für viele deutsche Soldaten zur Nationalhymne, wohl auch um ihrem Einsatz irgendeinen Sinn zu geben. Erst Reichspräsident Friedrich Ebert erklärte im August 1922 für die Weimarer Republik das »Deutschlandlied« zur offiziellen Nationalhymne, wobei er die dritte Strophe besonders hervorhob.
Wegen seiner großen Popularität gelang es den Nationalsozialisten nicht, das »Deutschlandlied« zu verdrängen. Sie ließen allerdings nur die erste Textstrophe bestehen und deuteten diese, die Vaterlandsliebe Fallerslebens missbrauchend, zu einem imperialistischen Anspruch Deutschlands um. Gleichzeitig führten sie mit dem »Horst-Wessel-Lied« eine zweite Nationalhymne ein. Die Doppelhymne war nun das musikalische Kennzeichen des nationalsozialistischen Deutschlands.
Im Mai 1952 stimmte Bundespräsident Theodor Heuss nach heftigen Diskussionen dem Ansinnen von Bundeskanzler Konrad Adenauer zu, das »Deutschlandlied« wieder als Nationalhymne zu etablieren, allerdings in einer musikalisch vergröberten Form.
Umstritten blieb der Text der drei Strophen, bis sich im März 1990 das Bundesverfassungsgericht für die dritte Strophe entschied, als den Text, der nun vor Verunglimpfungen geschützt ist.
Nach Meinung von Musikkennern hat die Melodie der heutigen deutschen Nationalhymne durch Abänderungen vieles von der ursprünglichen Ausdruckskraft verloren. Für manche ist nicht einmal mehr das Wesen der Musik Haydns vorhanden und sie plädieren für eine textliche wie musikalische Revision.
Dezember 2008 2)
Zitate von Joseph Haydn
»Meine Sprache versteht die ganze Welt«
»Erfindet eine schöne Melodie, und eure Musik, welcher Art sie auch sei, wird schön sein und gefallen.«
»Durch den wahren Vortrag muß der Meister sein Recht behaupten.«
»Ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen – und so musste ich original werden.«
»Wenn ich an Gott denke, ist mein Herz so voll Freude, daß mir die Noten von der Spule laufen. «
»Da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben hat, wird er mir schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich diene.«
Das Zeitalter Rembrandts
»Die Sehnsucht ist dem Menschen oft lieber als die Erfüllung«
Rembrandt van Rijn
Nach der imposanten Rembrandt-Retrospektive, mit der sich die Albertina in Wien nach ihrer Wiedereröffnung vor fünf Jahren in einem neuen Gewand präsentiert, zeigt sie, indem sie an jene Schau anknüpft, nun »Das Zeitalter Rembrandts«3) in einer 40 Gemälde und 150 Zeichnungen, Radierungen und Druckgrafiken umfassenden Ausstellung. Diese als einmalig apostrophierte Dokumentation mit Werken von rund 70 Künstlern ermöglicht einen Überblick über das künstlerische Schaffen einer ganzen Periode, die wie kaum eine andere eine Vielzahl an Begabungen und eine überbordende Fülle an Themen und Techniken hervorbrachte. Somit wird das 17. Jahrhundert als das »Goldene« der Niederlande bezeichnet.
Abb. 3
Rembrandt mit Barett selbstbewusst, mit offenem Blick und geistvoller Hinwendung zum Betrachter
Ein goldener Glanz bedeckte aber lediglich die vom wohlhabenden Bürgertum getragene Kultur dieser Zeit, denn politisch befand sich das Land in einem von Kriegen durchzogenen Umbruch. Adel und Klerus verloren ihre Macht, ein gestärktes Bürgertum und durch Fernhandel reich gewordene Patrizier übernahmen öffentliche Aufgaben. Sie wandten sich auch der Kunst zu, um ihre neugeschaffenen Intereurs mit patriotischen Gemälden und Stichen auszustatten.
Das führte zu einem überaus produktiven Kunstschaffen, das den Kunstmarkt in den Niederlanden so zum Florieren brachte, wie bisher noch in keinem anderen europäischen Lande geschehen ist. Eine Vielfalt an künstlerischen Ideen und Formen blühte auf, die über die Niederlande hinaus bis ins Zeitalter der Romantik anregend wirkten.
Das Konzept der Ausstellung
Um die zahlreichen niederländischen Kunstobjekte des 17. Jahrhunderts überschaubar, verständlich und geordnet zu präsentieren, sahen sich die Aussteller der Albertina konzeptionell gefordert. Sie entschieden sich für einen Kompromiss. Von den vielen Künstlern erhielten Rembrandt und Jan van Goyen, der Hauptvertreter monochromer Malerei, eigene Repräsentationsräume. Darüber hinaus wird das breite Spektrum der verschiedenen künstlerischen Kategorien dargestellt, deren wichtigste Aspekte die Landschafts- und Marinebilder, Stadtansichten, Stillleben, Porträts und das Bauerngenre waren.
Landschafts- und Marinebilder
Das auffallendste Kriterium des damaligen Kunstmarkts waren realistische Abbildungen der heimischen Landschaft mit einem stimmungsvoll von Licht und Wolken überspannten Himmel. Aus dem reichen Angebot der unterschiedlich gestalteten Landschaftsbilder heben sich die Gemälde von Albert Cuyp durch die Intensität ihrer lichtüberfluteten Darstellungen besonders ab und, gleichsam als Gegenstück, die nächtlichen, romantisch-schaurigen Gefilde von Aert van der Neer.
Gefragt waren auch Marinebilder, vor allem die von Simon de Vlieger und Allart van Everdingen, die oft sturmgepeitschte Schiffe im dramatischen Spiel von Wind und Wellen mit düsteren Lichteffekten atmosphärisch eindrucksvoll auf die Leinwand bannten. Aber auch friedlich vor Anker liegende Handelsschiffe waren beliebt, waren sie doch für das Besitzbürgertum der sichtbare Ausdruck von Wohlstand und Statussymbol eines gewachsenen patriotischen Bewusstseins.
Zudem wurden im Laufe des 17. Jahrhunderts die Arrangements von gemalten Naturalien und üppig mit Obst und Blumen gedeckten Tische zunehmend beliebter, zumal die Maler, wie z.B. Jan van Huysum, sich auf bestimmte Motive und Details spezialisierten und es dabei zu einer erstaunlichen naturalistischen Perfektion brachten.
Die geniale Vielfalt Rembrandts
Den Kristallisationspunkt der breit gefächerten Ausstellung bildet Rembrandt mit ausgewählten Gemälden und 25 Zeichnungen sowie Radierungen aus hauseigenen Beständen, die ihn als denjenigen genialen Künstler ausweisen, der die vielfältigen Anregungen seiner »goldenen Zeit« zu einer gesteigerten Symbiose vereint und seinen Werken geheimnisvolle Tiefe verleiht.
Hervorgehoben seien das »Hundertguldenblatt«, Rembrandts beeindruckendste Radierung, auf der verschiedene Ereignisse um Jesus auf einem Blatt kombiniert sind, und die beiden »Ecce homo«-Graphiken, Rembrandts erster Versuch, ein großformatiges Motiv in reiner Kaltnadeltechnik auszuführen.
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls auf die »Drei Kreuze« hinzuweisen, eine Radierung, die als Höhepunkt seines graphischen Schaffens angesehen wird. Hierauf wird der dramatische Moment des Todes Christi durch Licht- und Dunkeleffekte und in angsterfüllten Bewegungen der Anwesenden festgehalten.
Von den über 90 Selbstporträts Rembrandts werden lediglich drei aus unterschiedlichen Lebensphasen vorgestellt. Zunächst ist die an die Renaissance-Tradition anknüpfende Radierung zu begutachten, auf der der Künstler im Samtmantel eines Grandseigneurs mit keck aufgesetztem Barett selbstbewusst den Betrachter kritisch prüft. Auf dem zweiten Bild zeigt sich Rembrandt im reifen Mannesalter, in sich gefestigt und mit mildem Blick. Und das dritte Selbstporträt, auf bräunlich getöntem Papier, ist eine skizzenhafte Studie. Die Hauptlinien sind mit der Rohrfeder nur angedeutet, wodurch der Gesichtsausdruck umso präsenter erscheint: der Mund leicht zugekniffen, der Blick eindringlich und durch die gewölbte Braue noch verstärkt. Dieses intensive Dokument eines Selbstporträts ist selten zu sehen.
Es lohnt sich, diese Ausstellung in der Wiener Albertina zu besuchen, da die breite Kunstpalette der Niederlande des 17. Jahrhunderts mit geschickt ausgewählten Exponaten überschaubar vorgeführt und somit die Spannweite des »Zeitalters Rembrandts« nachvollziehbar wird, jenes Jahrhundert, das die folgenden entscheidend inspiriert hat.
April 2009 4)
»Friedrich der Große – verehrt, verklärt, verdammt...«
Die Rezeptionsgeschichte des preußischen Monarchen
Wenn der Besucher die Ausstellung »Friedrich der Große - verehrt, verklärt, verdammt... « betritt - sie wird zur Zeit im »Deutschen Historischen Museum in Berlin«6) gezeigt -, dann wird er durch den einer Gruft ähnlichen Raum im dämmrigen Schein flackernder Kerzen, durch die fahlweiße Totenmaske und das vom Aderlass blutbefleckte Sterbehemd sogleich in eine beklemmende Atmosphäre versetzt.
Unmittelbar danach erscheint als plastische Wachsfigur Friedrich II. selbst in seiner bekannten Montur mit Dreispitz, abgewetzter, blauer Hauptmannsuniform und Knaufstock und mit starrem Froschblick, der den Menschen damals Respekt einflößte, die Besucher von heute aber eher irritiert.
Dieser Gegensatz macht auch die Intention dieser Ausstellung erkennbar, die vermitteln will, wie dieser schon zu Lebzeiten wegen seiner ambivalenten Charakterzüge umstrittene preußische König von den nachfolgenden Generationen gesehen, gewertet und instrumentalisiert wurde.
In nicht weniger als 13 Schauräumen, die über zwei Etagen verteilt sind, werden etwa 450 Exponate präsentiert, eine überbordende Fülle an Bildern, Skulpturen, Repliken, Alltagsgegenständen, propagandistischen und konsumfördernden Materialien in Porzellan, Gips und Bronze, die alle irgendwie auf „Tugenden“ wie Disziplin, Pflicht und Gehorsam hinweisen. Dabei handelt es sich um Zeugnisse ikonenhafter Verehrung bis hin zu skurrilen Nippesfiguren. Hier wäre wohl weniger mehr gewesen.
Dem Besucher werden auch keine anschaulich erklärende Informationen der historischen Vorgänge angeboten. Damit hätte dieser die Vielzahl an Exponaten zeitlich besser zu- und einordnen bzw. nachvollziehbarer reflektieren können. Erst das genaue Studium des Katalogs hilft hier zu einer schlüssigeren Orientierung.
Sowohl in der preußischen als auch in der deutschen Geschichte bietet die Gestalt Friedrichs II. ein schwankendes Bild. Je nach historischer Situation und abhängig von der vorgegebenen politischen Tendenz wurde der Preußenkönig passend eingesetzt.
Bereits wenige Jahre nach dem Tod dieser schillernden Persönlichkeit setzte ein legendenbildendes Gedenken an den König ein, gefördert durch die Publikation von Anekdoten, in denen Friedrich II. als bescheidener, geistreicher, den Landsleuten zugetaner Herrscher beschrieben wird, frei von autoritären, königlichen Attitüden. Die gleichzeitig entstandenen Genrebilder, etwa von Daniel Chodowiecki, in denen der König volksnah und väterlich fürsorgend erscheint, ergänzen und verfestigen dieses Bild vom »Alten Fritz«, wie er auch wohlwollend genannt wird. Die dadurch entstandenen Mythen wirken noch bis heute weiter, wenn auch in abgemilderter Form.
Abb. 4
Friedrich II. von Preußen
Während der napoleonischen Kriegswirren und der Befreiungskriege flaut das Erinnern an Friedrich II. ab, setzt aber im vorrevolutionären Preußen um 1840 mit den kleindeutschen Bestrebungen verstärkt wieder ein.
Und wiederum ist das auf eine Publikation zurückzuführen, nämlich auf die populär verfasste »Geschichte Friedrich des Großen« von Franz Kugler, vor allem aber auf die beinahe 400 Holzschnitte, die der noch junge Adolph Menzel zur Illustration dieses Werks entworfen hatte, auf denen der einstige Herrscher in einer realistisch dargestellten Umwelt als ein verständnisvoller, auf das Wohl des Volkes bedachter König zu sehen ist.
Die Intention des ebenso liberalen wie königstreuen Menzel war, wie er sich äußerte, »ihn« als den zu zeigen, »den die Fürsten hassten, die Völker aber verehrten«.
Bei aller realistischen Detailtreue in diesen Abbildungen verweist die Darstellung des Königs aber auch auf die schon erwähnte Mythenbildung, die letztlich schon im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung vorhanden war und dem Zeitgeist entsprach.
Eine verstärkt politische Ausrichtung erhielt der Kult um Friedrich den Großen mit dem Machtzuwachs Preußens nach 1848, als der damalige Herrscher Friedrich Wilhelm III. 1859 ein monumentales Reiterdenkmal seines Vorfahren Friedrich II. vom Bildhauer Christian Daniel Rauch in Berlin errichten ließ. Damit wollte er seinen Untertanen die einstige Größe Preußens vor Augen führen und den Anspruch rechtfertigen, bei der Einigung der deutschen Länder führend zu sein.
Während die herrschenden Hohenzollern bei ihren politischen Vorhaben den berühmten Vorfahren wirkungsvoll einzusetzen versuchten, fängt Adolph Menzel unterschiedliche Szenen aus dem Leben des Preußenkönigs anschaulich auf elf Gemälden ein; diese sind vollzählig in der »Alten Nationalgalerie« ausgestellt.
Dabei zeigt er ihn als aufgeklärten Monarchen, der sich mal als volksnaher, väterlicher Fürst gibt, so in »Die Bittschrift«, mal als entschlossener, willensstarker Feldherr in der »Ansprache Friedrichs des Großen an seine Generäle vor der Schlacht bei Leuthen«, oder einfühlsam den schönen Künsten zugewandt, wie im stimmungsvollen Gemälde »Das Flötenkonzert von Sanssouci«.
Dass Menzel in vielen seiner Bilder auch aktuelle Probleme mit einfließen und das Volk nahe an den Preußenkönig herantreten ließ, führte jedoch zu Unstimmigkeiten mit dem regierenden Königshaus, das „ihren“ Friedrich so nicht präsentiert sehen wollte.
Deshalb wurde »Die Bittschrift« als ehrverletzend abgelehnt, denn der reitende Preußenkönig befände sich auf einem matschigen Wege und dies sei eines Monarchen unwürdig. Außerdem missbilligte Wilhelm I. die »Ansprache bei Leuthen«, da Friedrich der Große auf diesem Bild inmitten von ihm zu vertraut zugewandten Generälen zu klein dargestellt sei, weswegen er hier die monarchische Prärogative nicht gewahrt sah.
Nach dem Ende der Hohenzollern-Monarchie als Folge des Ersten Weltkriegs lebte in konservativen und rechtsmilitaristischen Kreisen das verklärende Gedenken Friedrichs des Großen weiter. Das, was man in den unsicheren und schwer belasteten Jahren der Weimarer Republik als verloren erkannte, nämlich die militärischen Auftritte zur Repräsentation der Stärke des Staates, eine an der Macht des Herrschers orientierte Ansicht nationaler Größe und eine auf Tradition beruhende Staatsführung, wurde auf ihn projiziert.
Dazu wurde gezielt das Konterfei des Monarchen auf parteipolitischen Plakaten eingesetzt.
Eine verhängnisvolle Belastung erhält der Kult um Friedrich den Großen durch die Nationalsozialisten, die gleich zu Beginn ihrer Machtergreifung, im März 1933, im Staatsakt von Potsdam mit ihm ihren eigenen Anspruch historisch zu legitimieren versuchten und ihn in populär propagandistischen Fridericus-Rex-Filmen als einen heroisch-patriotischen Wegbereiter des Führers darstellten.
Und Hitler sah in ihm einen Machtherrscher, der durch sein präventiv militärisches Agieren, durch sein zähes, willensstarkes Festhalten an seinen Vorhaben, der letztlich gegen alle Widerstände Preußen zu Größe und Ruhm geführt hatte. So präsent war Friedrich für Hitler, dass er dessen Bild ständig in sichtbarer Nähe haben wollte, ob in der Reichskanzlei, auf dem Berghof, in der Wolfsschanze, ja selbst noch im Bunker in Berlin.
Nach dem Krieg belastete Friedrich II., immer noch „braun verschmiert“, die beiden deutschen Staaten: den Osten bei seiner Selbstfindung wesentlich mehr als den Westen.
Bei der Wiedervereinigung spielte er aber in keinerlei Weise eine Rolle.
Zu seinem 300. Geburtsjahr besteht nun ein neues Interesse für den Briefwechsel zwischen dem Preußenkönig und dem Homme de lettres Voltaire, der vier Jahrzehnte andauerte und hunderte von literarisch wohlgesetzten Schreiben umfasst. Es ist eine vielschichtige Korrespondenz zwischen zwei aufklärerischen Denkern höchst unterschiedlicher Provenienz, die sich wechselweise schmeicheln und ausforschen, kritisieren und ermahnen und sich in ihren Lebenskrisen trotz ihres belauernden Misstrauens doch gegenseitig stärken und stützen.
Ferner gilt das Interesse der musisch-kompositorischen Neigung des Preußenkönigs, der sich neben seinem rational bestimmten Regieren und Agieren fast täglich mehrere Stunden dem Spiel auf der Querflöte widmete, wohl auch um einen gewissen inneren Ausgleich in seinem ambivalenten Charakter herzustellen.
Dennoch bleibt, selbst bei abgewogener psychologischer wie historischwissenschaftlicher Analyse der Denk- und Handlungsweise von Friedrich II. lediglich die Erkenntnis, dass seine Persönlichkeit nachweisbar vielverzweigte Risse zeigt, die man zwar aufdecken kann, die sich aber letztlich kaum nachvollziehbar erklären lassen.
Es stellt sich die Einsicht ein, die auch Adolph Menzel einst hatte, der nach so zahlreichen Porträt-Darstellungen bekannte, er sei trotz seiner Bemühungen letztlich der Person des Preußenkönigs nicht näher gekommen.
Juni 2012
Fundsache Luther
Archäologen auf den Spuren des Reformators
In einer umfangreichen Ausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle 5) werden bis Ende April 2009 die Ergebnisse von Archäologen und anderen wissenschaftlichen Spezialisten gezeigt, welche die drei Wohnstätten von Martin Luther akribisch durchleuchtet haben.
So wurde der Fußboden des Geburtshauses in Eisleben freigelegt, das Wohngebäude seiner Kindheit in Mansfeld durchkämmt und sein Anwesen in Wittenberg mit den neuesten kriminalistischen Methoden durchsucht.
Die Funde ermöglichen nun einen höchst aufschlussreichen Einblick in das Privatleben Martin Luthers und seiner Familie. Die vorliegenden Fundaussagen machen deutlich, dass die bisherige Auffassung darüber einer gründlichen Revision bedarf.
Seine Tischreden enthalten mehrere unrichtige Aussagen. So stellt er sich als Sohn eines Bauern vor und über seinen Vater berichtet er, dieser sei mit der jungen Familie »gegen Mansfeld gezogen« und dort sei er »ein Berghäuer geworden«. Und dann erinnert er sich, dass sein Vater, »ein armer Herr gewesen« sei, »als ich heranwuchs«. Vermutlich um seine Herkunft aus einfachen ärmlichen Verhältnissen zusätzlich zu unterstreichen, fügt er noch hinzu: »die Mutter hat all ihr Holz auf dem Rücken herangetragen«.
Auf Grund der Funde und Analysen ist jetzt aber deutlich geworden, dass diese Äußerungen über seine Herkunft nicht den Tatsachen entsprechen. Dementsprechend lautet das Forschungsergebnis: Der Reformer nahm es mit der Wahrheit, vor allem was seine Person betraf, nicht so genau.
Nach den intensiven Untersuchungen der letzten Jahre kommen die Wissenschaftler zu folgenden eindeutigen Aussagen:
Die väterlichen Vorfahren waren keinesfalls Bauern, sondern sie gehörten zur damaligen Oberschicht und sie waren begütert. Der Vater besaß bereits als junger Mann eine Kupfermühle; und die Mutter brachte einiges in die Ehe mit und musste wohl kaum jemals Brennholz schleppen.
Auch war der Vater keineswegs als »Berghäuer
«
in Mansfeld tätig, sondern als erfolgreicher Hüttenbetreiber. Er beaufsichtigte drei Kupferschmelzen, besaß ein 80 Hektar großes Stück Land und verlieh Geld gegen Zins. Er galt als Unternehmer mit beträchtlichem Kapital.
Entsprechend prächtig sah das Elternhaus Luthers aus. Es bestand aus zwei Häusern, die durch einen Zwischenbau verbunden waren und somit eine Straßenfront von 25 Metern aufwiesen. Das Anwesen verfügte über wuchtige Kellergewölbe sowie einen Hinterhof, der von großen Wirtschaftsgebäuden umrahmt war, und repräsentierte insgesamt Reichtum.
Seine Frau Katharina war geschäftstüchtig. Sie versah Studenten mit Kost und Logis, aber nicht umsonst. Man besaß das meiste Vieh der Stadt und braute 5000 Liter Bier im Jahr.
Dementsprechend lebte die Familie Luther in einem ansehnlichen Wohlstand, wofür auch der gefundene Abfallmüll als Indiz spricht. So verzehrten die Luthers beträchtlich viel von dem zarten und wohlschmeckenden Fleisch junger Schweine, das teuerste Fleisch in der damaligen Zeit.
Auch kamen oft Gänse und junges Geflügel wie Tauben und Rebhühner, ja selbst gefangene Singvögel auf den Tisch, und zur Fastenzeit gab es Karpfen, Zander, Heringe, Scholle und sogar Aale, - Speisen, die sich die übrige Bevölkerung kaum leisten konnte. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren; dass Luther Wasser predigte und Wein trank.
Seine Gicht und sein Übergewicht kamen nicht von ungefähr. Bei einer eher kleinen Statur wog er zuerst 100, dann 120 und gegen Ende seines Lebens geschätzte 150 Kilogramm, wie die am Totenbett angefertigte Federzeichnung ahnen lässt. So wird verständlich, dass Luther sich, wie man erwähnt, in einem Handkarren in den Hörsaal ziehen ließ.
Der beleibte Luther hat nicht nur fürstlich gespeist und getrunken, sondern er lebte auch wie ein Fürst. Beweise für dieses aufwendige Leben waren in der Abfallgrube zu finden, die mit Sperrmüll der Familie Luthers gefüllt war.
So fand man Scherben von zarten Stangengläsern und von kostbaren Fayence-Schalen, auch prächtige Kannen aus der Türkei. Neben feinsten Ofenkacheln mit alttestamentlichen Motiven, Messern mit edlen Griffen und 1600 Scherben von Hohlgläsern, aus denen wohl tüchtig gebechert wurde. Auch eine Handvoll Silbermünzen und ein goldener Ring wurden zu Tage gebracht, vermutlich jener Ring, den Luther 1537 seiner Frau schenkte und den sie bald darauf verlor.
In der Forschung bleibt höchst umstritten, ob der berühmte Thesenanschlag am Tag vor Allerheiligen 1517 überhaupt stattgefunden hat. Luther hat das jedenfalls nie behauptet. Selbst wenn es ein entsprechendes Zeugnis von ihm gäbe, müsste man dies skeptisch betrachten. Denn schließlich belegt das nun aufgespürte stichhaltige Beweismaterial, dass Luther sich in einem anderen Licht dargestellt hat, nicht so wie er wirklich lebte.
Seine Bibelübersetzung, die für die Weiterentwicklung der deutschen Sprache stilbildend wirkte, ist unbestreitbar hoch anzuerkennen. Allerdings hat Luther dies nach Aussagen von Historikern nicht allein vollbracht. Einige haben ihm theologisch zugearbeitet und man darf dabei auch nicht vergessen, dass es bereits 18 deutschsprachige Ausgaben gab, auf die er zurückgreifen konnte. Dennoch bleibt die Bibelübersetzung seine große Leistung.
Ärgerlich ist, dass man Luther den bekannten Ausspruch zuschreibt: »Wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen«. Denn schließlich ist schon seit langem bekannt, dass diese Aussage von einem hessischen Pfarrer stammt, der damit angesichts einer sich ausbreitenden Untergangsstimmung im Kriegsjahr 1944 bei seinen Kirchenbesuchern Hoffnung und Gottvertrauen wecken wollte.
Luthers hochmütiges Auftreten und seine derb-deftigen bis menschenverachtenden Worte stoßen heute noch bei vielen auf Ablehnung. So nennt er sich selbst »Doctor über alle Doctor(es) im ganzen Bapsttum«. Die Türken nennt er »Teufel«, die Juden »Lügner«, schwule Priester »Gartenbrüder« und die Theologen in Rom »Sautheologen«.
Während des Bauernkrieges fordert er die Fürsten auf, die »räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern wie tolle Hunde zu erschlagen«. Nach dem Fund neuer Archivdokumente konnte jetzt die oft gestellte Frage, warum Martin Luther Mönch geworden ist, aus psychologischer Sicht beantwortet werden.
Danach sei Luther ins Kloster eingetreten, um einer Verheiratung durch den Vater zu entgehen. Nachdem dieser bereits drei seiner Töchter und einen Sohn mit Kindern von anderen Hüttenbetreibern hatte verheiraten können, war nun Martin an der Reihe. Dem wollte er sich entziehen.
Als das Kloster in Wittenberg sich 1522 auflöste, erwarb Luther das Gebäude, finanziell wurde er dabei von zu Hause unterstützt, und so konnte er die aus dem Kloster ausgetretene Nonne Katharina von Bora, er nennt sie »Herr Käthe«, heiraten und mit ihr ein wohlbetuchtes, einflussreiches Leben führen.
Gestorben ist der Reformator Luther als einer der reichsten Männer von Wittenberg. Erwähnenswert bleibt noch Luthers Hinweis in zwei seiner Tischreden, Nr. 1681 und 3232, dass er die grundlegende Idee zu seinem Reformwerk auf der »cloaca« sitzend erhalten habe, – demnach weht der »spiritus sanctus«, wie die Redewendung besagt, letztlich wo er will.
November 2008
Casanova. La Passion de la Liberté
»Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin«
Giacomo Casanova
Die Ausstellung in der »Bibliothèque Nationale de France« in Paris 7), die sich über mehrere Räume erstreckt, zeigt Original-Manuskripte von den wohl berühmtesten Lebenserinnerungen, der »Histoire de ma vie« des Giacomo Casanova. Dieser nannte sich Chevalier de Seingalt, weil er den Eindruck erwecken wollte, er gehöre einem höheren sozialen Stand an, als dies in Wirklichkeit der Fall war.
Nach einem ungewöhnlichen Lebenswandel voll sexuell-libertärer Ausschweifungen und abenteuerlicher Unternehmungen zog er sich mit sechzig als Bibliothekar des Grafen Waldstein auf dessen Schloss Dux in Böhmen zurück, wo er aus Langeweile und um die Schwermut zu verdrängen, seine Lebenserinnerungen niederzuschreiben begann. Er sah sie als Tribut an »selige Augenblicke, die ich nicht mehr erhoffen darf, deren teure Erinnerung mir aber nur der Tod allein rauben kann«, denn »die sinnlichen Genüsse zu kultivieren, bildete die Hauptbeschäftigung meines Lebens; niemals hat es für mich etwas Wichtigeres gegeben«.
Der Venezianer Casanova verfasste seine Memoiren in der damaligen französischen Umgangssprache der adelig-höfischen Oberschicht, die er nuancenreich und bis in die feinsten Verzierungen eloquent beherrschte. So entstanden 3700 Manuskriptseiten, ein Konvolut, das die Pariser Nationalbibliothek für sieben Millionen Euro vom Brockhaus-Verlag erwarb.
Der erste Eindruck beim Betrachten seiner Manuskripte ist, dass die Handschrift in einer deutlich lesbaren Graphik erscheint und kaum Streichungen und stilistische Änderungen aufweist. Zwar ist auf jedem Blatt ein Rand für eventuelle Anmerkungen belassen, es sind aber kaum welche zu finden. Obgleich gerade Korrekturen, Verbesserungen und Streichungen die neugierigen Leser von heute besonders interessieren. Manche Sätze hat Casanova unterstrichen, wie »tu oublieras aussi Henriette«, ob als Aufforderung oder als späte Klage gedacht, bleibt verborgen.
Abb. 5 »selige Augenblicke – sinnliche Genüsse zu kultivieren«
Giacomo Casanova
»Während meiner langen Laufbahn als Libertin hat mich mein unüberwindlicher Hang zum schönen Geschlecht alle Mittel der Verführung anwenden lassen, und ich habe einigen hundert Frauen, deren Reiz mein Interesse geweckt hatte, den Kopf verdreht; aber den besten Erfolg hatte ich stets, wenn ich Novizinnen, deren moralische Prinzipien und Vorurteile der Eroberung im Weg standen, vorsorglich nur in Gesellschaft einer zweiten Frau angriff.
Ich wusste schon früh, dass ein junges Mädchen sich einfach aus Mangel an Mut schwer verführen lässt, während es sich in Gegenwart einer Freundin verhältnismäßig leichter ergibt; die Schwächen der einen führen zum Fall der anderen. Freilich bedarf es einer doppelten Anstrengung, aber man wird für seine Mühe reichlich entschädig.«9)
Das unmittelbare Erleben der Original-Memoiren vermittelt ein Gefühl, als würde man Casanova bei seinen Aufzeichnungen gewissermaßen über die Schulter sehen und ihm dabei ein Stück näher kommen.7)
Aber auch das Umfeld seines Lebenswandels wird angedeutet. So werden die damals viel begehrten Spielkarten gezeigt, oder alchemistische Gefäße, mit denen Casanova geschickt umzugehen wusste, oder das Reisegepäck und die Toilette-Utensilien, deren er sich vor seinen Rendezvous bediente. Außerdem führen Bühnenbilder einige Szenen aus seinem Leben vor Augen, allen voran die Flucht aus den Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig. Auch ein kurzer Ausschnitt aus Mozarts »Don Giovanni« wird eingespielt, nicht um Casanova dem spanischen Don Juan näher zu rücken, sondern vielmehr um darauf hinzuweisen, dass er vermutlich bei einer Libretto-Szene mitgeschrieben haben könnte.
Casanova, der einst dem Universalgelehrten Jean-Baptiste de Boyer versprach, nie die Dummheit zu begehen, seine eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, erlag dennoch dieser Versuchung. Die Nachwelt verzeiht ihm das gerne, denn in seinen Erinnerungen begegnen wir einer der schillerndsten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts, konnte er doch mit seinen vielfältigen Talenten geschickt jonglieren. So verstand er es, mit zwei Päpsten amüsant zu plaudern, mehrere Herrscher auf ihren Spaziergängen beratend zu begleiten, mit Voltaire ein geistreiches Wortgefecht zu führen, töricht-dreiste Personen mit Spielertricks um ihr Geld zu bringen oder spiritistisch zugeneigte Abergläubige mit alchemistischen Beschwörungsformeln zu umgaukeln. Vor allem aber hinterließ Casanova auf all seinen Wegen durch die vielen Länder eine sinnlich schimmernde Spur von lustvollen Genüssen, denn »das ewig Weibliche« zog ihn mächtig an.
Januar 2012 8)
Albrecht Dürer: Kunst – Künstler – Kontext
»Ein guter Maler ist inwendig voller Figur«
Albrecht Dürer
Das »Städel«-Museum in Frankfurt ermöglicht in einer beachtlichen Ausstellung10) - nicht weniger als 200 Werke werden präsentiert - Einblicke in das Schaffen von Albrecht Dürer, dem bekanntesten Renaissance Künstler par excellence nördlich der Alpen.
In der Vorankündigung weisen die Veranstalter darauf hin, dass diese Präsentation sich von den früheren dadurch unterscheide, da Albrecht Dürer diesmal nicht nur als Künstler seiner Zeit, sondern gleichzeitig auch als Gestalter dieser Zeit vorgestellt werde.
Deshalb werden nun im »Städel« auch Künstler, die Albrecht Dürer auf seinen Reisen nach Oberitalien und in die Niederlande gesehen und mit denen er sich auseinander gesetzt hat, durch ungefähr 80 Arbeiten repräsentiert. Es sind dies u.a. Martin Schongauer, Giovanni Bellini und Lucas van Leyden.
Auf diese Weise wird der Blick auf das zu Dürers Zeit künstlerisch wie technisch Mögliche gerichtet. Gleichzeitig wird dadurch nachvollziehbar verdeutlicht, wie sensibel und unmittelbar Dürer auf seine Künstlerkollegen reagierte und deren Anregungen kreativ in sein eigenes Kunstschaffen anzuwenden wusste. Dadurch wird aber auch das Besondere, das Einmalige im Schaffenswerk Albrecht Dürers erkennbar.
Es ist erstaunlich, wie weit verbreitet Dürers graphische Arbeiten damals schon in ganz Europa waren, was durch seine künstlerischen Innovationen und seine theoretischen Forschungen gefördert wurde. Nicht zuletzt dürfte dabei aber auch sein Geschick, sich zu inszenieren und zu vermarkten, eine Rolle gespielt haben. So führte Dürer selbstbewusst als Erster ein Monogramm als kompositorisches Element ein, das bekannte »AD«. Als sein persönliches Zeichen für das »Copyright« wurde es das Symbol dafür, dass ein künstlerisches Werk nunmehr untrennbar mit dem Namen seines Urhebers verbunden bleiben würde.