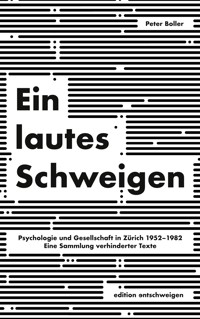
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Tiefenpsychologie in Zürich hat einen grossen blinden Fleck. Trotz wissenschaftlicher Aufarbeitung tut sich die Presse und tun sich historische Zeitschriften schwer damit, die einst progressiv auftretende 'Zürcher Schule' (gegründet von Friedrich Liebling und Josef Rattner) als historischen Gegenstand zu anerkennen. Das liegt vermutlich an der erfolgreichen Tätigkeit, die niederschweflig und gesellschaftskritisch, vor allem aber unabhängig von grossen Institutionen war. Die Wirren nach Lieblings Tod (1982) trüben noch immer den Blick auf ein Experiment, das ein erstaunlich modernes Menschenbild vertrat und für eine freiheitlich-humanistische Praxis steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Unerhörte Zwischentöne
Textsammlung:
1 Psychologie und Gesellschaft: Die Zeitschrift “Psychologische Menschenkenntnis“ in den Jahren 1964-1974. (Lizentiatsarbeit, 1996)
2 Vielschichtige Erinnerung (Zeitschrift “Biographieforschung und Oral History“, BIOS, 2008)
3 The Elephant in the Room (Das Magazin, 2012)
4 Ein lautes Schweigen (Das Magazin, 2014)
Honorarabrechnung des Magazins
5 Zürichs “heisse Kartoffel“ (A-Bulletin, 2015)
6 Geheimtipp: Psychologie (A-Bulletin, 2015)
7 Zürichs Wege der Psychologie (NZZ, 2016)
8 Recollections of psychological learning (Oral History, 2018)
9 Zürich entschweigen – wirklich nötig? (div. Zeitschr. 2022)
Editorische Notiz
Veröffentlichte Beiträge
Einleitung
Unerhörte Zwischentöne
Die Geschichtsforschung interessiert sich heute für ein weites Spektrum von Lebensrealitäten (soziale Abweichung, Drogen, Homosexualität, Psychiatrieerfahrung) oder politischen Aktivismus (Hausbesetzungen, migrantische Biografien und Netzwerke) und die Medien berichten selbstverständlich darüber. Allerdings scheinen manchmal interessante historische Entwicklungen schlicht vergessen zu gehen, auch wenn Forschungsbeiträge dazu vorliegen.
Ein solches Beispiel ist die Tiefenpsychologie im Zürich der Nachkriegszeit, genauer von 1952–1982. Die grösste deutschsprachige Stadt ausserhalb des Einflussbereichs des Nationalsozialismus eignete sich nach dem Krieg besonders für aus dem Exil zurückkehrende Vertriebene sowie um anzuknüpfen an Wissenschaftstraditionen, die unter der braunen Diktatur ausgelöscht worden waren.1 Ausserdem hatte hier schon früher eine psychologieaffine Atmosphäre bestanden (Eugen Bleuler, Oskar Pfister, das Institut für Angewandte Psychologie).
Die 1952 von Friedrich Liebling und Josef Rattner gegründete “Psychologische Lehr- und Beratungsstelle“ (ab 1967 auch “Zürcher Schule für Psychotherapie“) ist zusammen mit anderen Schulen wie der klassischen Psychoanalyse, der Jungschen Psychologie, der Schicksalsanalyse, der Daseinsanalyse und weiteren Gruppierungen lebendiger Ausdruck einer ungebrochenen Auseinandersetzung mit und der Weiterentwicklung von tiefenpsychologischen Ansätzen. In einigen Punkten unterscheidet sich jedoch die “Zürcher Schule“ von den übrigen Strömungen. Sie hatte eine lange Vorlaufszeit (nachweisbar bereits ab 1938), sie war eine Gründung von Migranten, ihre Altersstruktur und die soziale Durchmischung war ausgeprägter. Die Absicht, breiteren Bevölkerungsschichten psychologisches Wissen zu vermitteln und den eigenen Charakter und Gefühlshaushalt zum Gegenstand des Lernens zu machen, ist ein soziales Engagement von grosser Tragweite. Dass diese psychologische Auseinandersetzung auch gesellschaftliche Missstände einer Kritik unterzog, Politik, Patriarchat und Herrschaftsdenken allgemein, aber auch religiöse Denkblockaden in Frage stellte, trägt hochpolitische Züge, gerade auch wenn man sich der Farce der Tagespolitik entzog – man verstand sich als “Avantgarde“.2
Die “Zürcher Schule“ ist der Schwerpunkt dieser Beiträge, da ich mich in meiner Dissertation3 vertieft damit auseinandergesetzt habe und da ohne diesen Arbeitskreis die Geschichte der Tiefenpsychologie unvollständig bliebe. Das Interesse galt aber stets einem Gesamtbild, das auch universitäre Entwicklungen, verwandte psychologische Richtungen berücksichtigt, sowie auch die Alltagserfahrungen der Menschen. Eine Schwierigkeit bei der Erforschung dieser Gruppierung ist die verwirrende Entwicklung nach Lieblings Tod 1982. Inzwischen ist bekannt, dass die Zerstörung der “Zürcher Schule“ sowie der später gegründete autoritär-konservative “Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis“ (VPM, 1986–2002) keine zwangsläufige Entwicklung war, sondern erst durch eine Missachtung der Nachfolgeregelung und die Duldung der zuständigen Behörden möglich wurde (Text 9). Zur skandalösen Dynamik im Innersten kam eine ungenaue Berichterstattung, die die Fehler nicht aufdeckte, sondern an klassischen Schwarz-Weiss-Mustern festhielt. Wer als Lehrer, Psychologin, Journalist beruflich überleben und sozial nicht geächtet werden wollte, tat nun gut daran, jeden Bezug zu Liebling zu leugnen, abzuwerten, zu verschweigen (Texte 6 und 9). – Wo es gelingt, einen Blick unter die Oberfläche zu werfen, zeigt sich eine ungeheuer progressive, kritische, weltoffene Bewegung, die ihrem Anspruch weitgehend gerecht wurde und für ihre Zeit und die Schweiz alles andere als typisch war. Deutlicher als an anderen Beispielen zeigt sich hier das kritische und fortschrittliche Potential für Individuum und Gesellschaft. Sei es, wenn ein ehemaliger Seemann, der im Osten Deutschlands geboren wurde, berichtet, wie er in Zürich hängengeblieben war (Text 6), sei es dass ein politisch engagierter Lehrer erläutert, dass man zwar progressive Autoren wie Bakunin lesen und doch von der Persönlichkeitsstruktur her noch sehr unfrei sein kann (Text 2), oder dass man bei der Analyse einer Monatszeitschrift unter den Autoren auf einen Frauenanteil von 42% stösst (Text 1).
An Widerständen und Vorurteilen gegenüber der Tiefenpsychologie hat es in ihrer Geschichte nie gefehlt. Zu denken ist an die Debatte zwischen Freud und Wagner-Jauregg zu den “Kriegszitterern“ 1920 oder an eine Klage gegen Alfred Adler 1927 im Zusammenhang mit Diplomen. Im schweizerischen Kontext stiessen Marie Meierhofer und Martha Eicke-Spengler, aber auch Alice Miller oder Ruth Cohn auf bemerkenswerte Hindernisse.4 Was braucht es, damit sich die Ängste vor dem gesellschaftlichen Fortschritt überwinden lassen?
Wenn ab den 1980er-Jahren viele psychologische Institutionen entstanden, neoliberale Reformen bald darauf Entfremdung und Überlastung besonders in sozialen Berufen hervorrufen, gleicht das einem Nullsummenspiel. – Es verwundert nicht, dass systemkritische Ansätze kaum Eingang in die universitäre Lehre und das Alltagswissen gefunden haben. Oberflächlich betrachtet scheint die Forschung heute viel weiter zu sein als in den 1960er- und 1970er-Jahren, unterschwellig aber bleiben wesentliche längst bekannte Zusammenhänge systematisch ausgeblendet (Moral, Menschenbild, Erziehungsfrage). Noch immer ist die Tiefenpsychologie in der Geschichtswissenschaft eine weitgehend unbekannte Grösse.5
Die “Zürcher Schule“ ist Geschichte, die psychologische Landschaft hat sich verändert. Und doch fragt sich, weshalb eine differenzierte Aufarbeitung und Korrektur – gegebenenfalls eine Rehabilitierung Lieblings – bisher unterblieb. Irritierend ist insbesondere, wie in meinem Fall journalistische Beiträge bestellt und dann meist nicht abgedruckt wurden, obwohl in einem Fall ein ordentliches Honorar floss.6 Der Eindruck einer zumindest teilweise dysfunktionalen Öffentlichkeit ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Die Ausstellung im Frühjahr 2022 im Museum Strauhof in Zürich zeigte einmal mehr ein reges Interesse am Thema.7 Die Veröffentlichung der zahlreichen “verhinderten Beiträge“ aus den Jahren 1996–2022, schafft die Grundlage für weitere Nachforschungen und ein vertieftes Verständnis des Gegenstandes der Tiefenpsychologie in Zürich.
1 Müller, Max: Erinnerungen. Erlebte Psychiatriegeschichte 1920–1960. Berlin, Heidelberg 1982. Fischer, Anton M.: Sigmund Freuds erstes Land. Eine Kulturgeschichte der Psychotherapie in der Schweiz. Giessen 2013.
2 Boller, Peter: “Tabuisierte Avantgarde“? Eine neue historische Untersuchung zu Friedrich Lieblings Zürcher Schule, 1952–1982. In: Zeitschrift für Individualpsychologie 36/3 (2011), S. 246–259.
3 Ders.: “Mit Psychologie die Welt verändern“. Die Zürcher Schule Friedrich Lieblings und die Gesellschaft 1952–1982. Chronos Zürich 2007.
4 Ders.: “Zürich entschweigen“, Psychologie in Zürich – eine Spurensuche. Ausstellung 7. – 15. Mai 2022, Museum Strauhof Zürich. (Wild Card 14)
5 Eine Ausnahme zu dieser verbreiteten Tendenz bildet: Bregman, Rudger: Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit. 2019. – Zur Unterschätzung individualpsychologischer Konzepte siehe: Leidinger, Hannes u.a.: Freud, Adler, Frankl. Die Wiener Welt der Seelenforschung. Wien 2022. Maier, Lilly: Auf Wiedersehen, Kinder. Ernst Papanek. Revolutionär, Reformpädagoge und Retter jüdischer Kinder. Wien 2021. – Verwunderlich ist allerdings, dass die Ausstellung zum Roten Wien das Thema Individualpsychologie fast komplett ausklammerte , obwohl es in diesem Zusammenhang wesentlich bedeutender war als etwa die Psychoanalyse. Werner M. Schwarz u.a. (Hg.): Das Rote Wien. 1919– 1934. Ideen, Debatten, Praxis. (Wien Museum). Basel 2019. Das Themenheft einer historischen Fachpublikation zur Psycholgie im 20. Jahrhundert blendet die Tiefenpsychologie gleich komplett aus. Arend, Jan; Elberfeld, Jens: Psychologien der Menschenführung. Gouvernementalität und Therapeutisierung in Ost und West (1960er– 1980er Jahre). In: Geschichte und Gesellschaft. Nr. 48/2022, S. 177–196. Begriffe wie “Psychowissen“ oder “Psychotechniken“ (Sven Reichhard, 2014, Philipp Sarasin, 2021) erfassen tiefenpsychologische Zugänge nur ungenau.
6 Die Texte waren für Zeitschriften in der Schweiz und Deutschland vorgesehen. Der englischsprachige Text wurde bei einer britischen und US-amerikanischen Zeitschrift eingereicht. Die Honorarrechnung bezieht sich auf Text 4 und ist auf S. 263 in dieser Dokumentation abgedruckt. – Eine Liste mit den veröffentlichten Beiträgen befindet sich auf S. 313 der vorliegenden Sammlung.
7 Siehe Anm. 4
Text 1
Psychologie und Gesellschaft: Die Zürcher Zeitschrift «Psychologische Menschenkenntnis» in den Jahren 1964 bis 1974
Lizentiatsarbeit der Philosophischen Fakultät I, eingereicht bei Prof. Dr. Bruno Fritzsche am Historischen Seminar der Universität Zürich
Peter Boller Mutschellenstrasse 17 8002 Zürich Telefon 01 281 03 69
Zürich, 18. Mai 1996
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Psychologie und Geschichte
Psychologie in Zürich
Die «Psychologische Menschenkenntnis»
Quellenlage
Leitfragen
Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund: «Schule und Elternhaus»
Friedrich Liebling und die «Zürcher Schule»
Die «Psychologische Menschenkenntnis»
Formelle Aspekte
Das äussere Erscheinungsbild
Das Impressum
Die Redaktion
Druck und Verlag
Preise
Inseratenpreise
Die Auflage
Die Verbreitung
Die Autoren
Akademische Titel
Das Geschlechterverhältnis
Erwachsene, Jugendliche und Kinder als Autoren
Das Verhältnis Artikel – Autoren
Anonyme Verfasser
Die Textsorten
Textsorten im Überblick
A. Abbrechende Textsorten
«Psychologische Beratung»
«Fremdartikel»
«Das psychologische Buch»
Erscheinungen der frühen Jahre
B. Neu entstehende Textsorten
1. Exkurs: «Gruppengespräche»
1. «Gespräch»: Aus der Erziehungsberatung
2. «Gespräch»: Über die Sexualität
Kommentar
Die Offenlegung
Die Einfühlung
Charakter und Kindheit
Die Gefühle können verändert werden
Die Eltern sind nicht informiert
2. Exkurs: «Vorträge»
1. «Vortrag»: Mensch und Arbeit
2. «Vortrag»: Was ist Freiheit?
3. «Vortrag»: Jugendfragen
Kommentar
«Leserbriefe»
«Aufsätze»
Weitere Aspekte
C. Mehr oder weniger kontinuierliche Textsorten
«Eigene Artikel»
3. Exkurs: «Redaktionelles»
Geleitworte und Jahreswechsel
Die Vorworte
Fazit
«Persönliche Zeugnisse» (Briefe, Lebensberichte
)
«Zitate und Anekdoten»
Die «Psychologische Menschenkenntnis» und andere zeitgenössische Publikationen
«Schweizerische Zeitschrift für Psychologie»
«Der Psychologe»
«Der Freidenker»
Rezensionen über die «Psychologische Menschenkenntnis»
Fazit
Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zeittafel
Glossar
Bibliographie
Bibliographien
Quellen
Literatur
Telefonische Auskünfte
Anhang
Beispiel eines «Fremdartikels» (Jürgen Bartsch und diese Gesellschaft
)
Beispiel eines «Eigenartikels» (Vom Sinn des Lebens
)
Beispiel eines «Vortrags» (Psychologie und gesellschaftliche Entwicklung
)
Beispiel eines «Gruppengesprächs» (Eifersucht stört die Ehe
)
Tabellen zu den Textsorten
Inhalt der «Psychologischen Menschenkenntnis» 1964–74
Autoren der «Psychologischen Menschenkenntnis» 1964–74
Das psychologische Buch
Friedrich Liebling und Josef Rattner im «Psychologen»
Vorwort
Wo informiert sich ein Elternpaar bei Schwierigkeiten in der Kindererziehung? Wer hilft dem Liebes- oder Ehepaar bei Problemen im Zusammenleben? Wohin soll sich ein Mensch mit ungelösten Lebensfragen wenden, wenn er etwa im Berufsalltag nicht zurechtkommt? Professionelle Beratungsdienste wurden in den letzten Jahrzehnten geschaffen, und es gibt immer mehr psychologische Stellen in der Schweiz, in den USA, international. Eine zusätzliche Möglichkeit, sich zu informieren und psychologisches Wissen anzueignen sind psychologische Zeitschriften, die man am Kiosk oder anderswo bekommt. – Aber auch diese Zeitschriften mussten erst entstehen.
Als ich mit der Lizentiatsarbeit über die «Psychologische Menschenkenntnis» begann, war ich ziemlich erstaunt über diese Zeitschrift. Unkonventionell kam sie daher, einzigartig erschien mir die Offenheit. Lange Zeit erwartete ich Grenzen oder Tabus. Wie weit würde diese Offenheit gehen? Oder wurden hier etwa nur alte Dogmen durch neue ersetzt? – Je genauer ich die Zeitschrift aber studierte, desto mehr konnte ich mich davon überzeugen, dass die «Psychologische Menschenkenntnis» wirklich kein Blatt vor den Mund nahm. Fragen und Themen, die man rundherum kaum erörterte, wie z. B. die Sexualität, wurden hier selbstverständlich behandelt. Alles Menschliche kam zur Sprache. Sie war keine Zeitschrift der Parolen und Schlagworte. Themen, Fragen und Geschichten aus dem täglichen Leben wurden abgehandelt neben Philosophischem und theoretischen Überlegungen. In der Vielfalt dieser Zeitschrift scheint die engagierte Auseinandersetzung mit dem Leben die einzige Konstante zu sein. Hier schreiben nicht Lehrer für Schüler, sondern jeder ist Lehrer und Schüler zugleich. Die «Psychologische Menschenkenntnis» erscheint als Forum des Lernens, Erklärens und Verstehens. Mehr beiläufig aber regelmässig plädiert sie für eine gewaltfreie Erziehung und für die sexuelle Aufklärung. Mann und Frau sollten gleichberechtigt sein; der Gedanke einer gerechteren, menschenwürdigen Welt ist allgegenwärtig. Die Religion erscheint als Gängelband der Menschheit, der Krieg als Relikt aus früheren Stufen der Kulturgeschichte, das eine aufgeklärte Menschheit hinter sich lassen werde. Die Aufklärung des Menschen, dass er Klarheit bekomme über sich und die Welt, und dass er die Verantwortung übernehme für sein Tun und Lassen, diese Haltung spricht immer wieder aus der «Psychologischen Menschenkenntnis». Stetes Lernen spiegelt sich in ihr. – Doch wie zeigt sich dieses Lernen? Wie präsentiert sich diese Zeitschrift im Rückblick?
Einleitung
Psychologie und Geschichte
«Die historischen Tatsachen sind wesentlich psychologische Tatsachen.»
Marc Bloch1
Was ist Psychologie? Was meint eigentlich dieses Wort? Die Brockhaus-Enzyklopädie (1992) umschreibt Psychologie als
«die Wissenschaft von den Formen und Gesetzmässigkeiten des Erlebens und Verhaltens, bezogen auf Individuen und Gruppen.»
Das grosse Wörterbuch von Duden (1994) und das Schweizer Lexikon (1993) definieren Psychologie übereinstimmend als die
«Wissenschaft von den bewussten und unbewussten seelischen Vorgängen vom Erleben und Verhalten des Menschen.»
Zweifelsohne öffnet die Psychologie ein weites Feld zur Erforschung des Menschen. Was hat nun aber die Psychologie mit der Geschichte zu tun? – Mindestens dreierlei:
Die Psychologie als Wissenschaft hat erstens für sich eine Geschichte und nahm, seitdem Sigmund Freud (1856–1939) die Tiefenpsychologie begründet hatte, einen vielfältigen Verlauf. Richten wir zweitens den Blick auf das gesellschaftliche Leben, so gewann, nach einer ersten Blüte in den 20er Jahren (Psychoanalyse), die Psychologie in den 60er Jahren zunehmend an Bedeutung. In der Eltern- und Lehrerbildung wurden psychologische Einflüsse spürbar. Zahlreiche Veranstaltungen stellten psychologische Gesichtspunkte ins Zentrum.
Anerkennend schrieb die Schweizerische Lehrerzeitung 1972:
«Die Psychologie ist wahrscheinlich das potentiell revolutionärste geistige Abenteuer, das die Menschheit bisher unternommen hat.»2
Und derselbe Autor fordert im Sinne einer demokratischen Zukunft, dass die Psychologie nicht einem kleinen Kreis von Spezialisten vorbehalten bleiben dürfe:
«Wir müssen die Psychologie jenen geben, die sie wirklich brauchen: Jedermann!»3
Der zunehmenden Öffnung gegenüber psychologischen Betrachtungen trägt auch das Zürcher Schulamt Rechnung. 1973 äusserte sich auch der Schulvorstand und Stadtrat von Zürich, J. Baur in einer offenen und anteilnehmenden Weise:
«Liebe Eltern, Haben Sie Erziehungsprobleme mit Ihren Kindern in der Familie, in der Schule? – Diese Frage wird wohl niemand mit einem spontanen Nein beantworten können, denn es liegt in der Natur von Erziehung und Ausbildung selbst, problematisch zu sein: Sie stellt Eltern, Lehrer und Erzieher immer wieder vor neue Situationen, wo Entscheidungen zu fällen sind, intuitiv oder bewusst, überlegt.»4
Und im Jahr 1974 hält wiederum die Publikation des Zürcher Schulamtes «Schule und Elternhaus» fest:
«Anstelle von psychologischen Einzel- bzw. Ehepaar-Beratungen oder in Ergänzung dazu werden in neuerer Zeit in zunehmendem Umfang Gruppengespräche veranstaltet, um menschliche Konflikte und Probleme lösen zu helfen, die sich aus dem Zusammenleben in der Ehe, Familie und Partnerschaft ergeben. Das ist mehr als nur eine Modeerscheinung. Langjährige Erfahrungen vor allem in den angelsächsischen Ländern haben ergeben, dass wir viele zwischenmenschliche Probleme besser und innert kürzerer Zeit lösen oder einer Lösung näher führen können, wenn wir sie gemeinsam mit anderen Ratsuchenden in einer grösseren Gruppe (etwa 12 bis 18 Teilnehmer) besprechen anstatt im psychologischen Zweier- oder, im Fall der Eheberatung, Dreier-Gespräch. [...]5 Der erste Schritt zur Lösung unserer Lebensprobleme besteht im Wagnis, sich andern Menschen anzuvertrauen. Gerade dieser erste Schritt aber fällt vielen von uns sehr schwer, obwohl es sich doch allmählich herumgesprochen haben dürfte, dass wir alle mehr oder minder an den gleichen oder ähnlichen Schwierigkeiten kranken.»6
Diese Stellungnahmen verraten deutlich, dass sich die Psychologie bis Anfang der 70er Jahre ein gutes Ansehen verschafft hatte.
Drittens schliesslich wurde die Psychologie in Bereichen der Geschichtsforschung zur Hilfswissenschaft. In der Mentalitätsgeschichte, die aus der französischen «Annales-Schule» der 20er Jahre erwuchs (Lucien Febvre, Marc Bloch), erkannte man bald, dass für die Werthaltungen und Denkweisen der Menschen das sogenannte Unbewusste eine Rolle spielt und also der Mentalitätshistoriker auch tiefenpsychologischer Kenntnisse bedarf.7 Die Oral History, welche die neuere Geschichte des Alltags untersucht, greift ebenfalls auf psychologische Deutungskonzepte zurück. Anhand von Gesprächen und Lebensgeschichten, die im günstigsten Fall auf Tonband oder Video aufgezeichnet werden, sucht man in der Oral History Erkenntnisse über eine Zeit aus der Sicht des «gewöhnlichen» Menschen. Um dem Gesagten das richtige Gewicht zu verleihen, muss berücksichtigt werden, welche Mechanismen in einem solchen Gespräch wirken, welche Erzählpassagen als Beschönigung zu sehen sind, und welche Erlebnisse oder Sichtweisen ein Befragter vermutlich unterschlägt. Auch hier bedient sich der Historiker der Psychologie.8 – Da die Geschichtsforschung, bezeichnenderweise in jüngster Zeit, das Gespräch als vielfältige Quelle für die Erforschung alltäglicher Denk- und Handlungsweisen entdeckt hat,9 erscheint es sinnvoll, auch das psychologische Gespräch, wie es hier zugänglich ist, für die Geschichtsforschung auszuwerten.
Psychologie ist also eine geschichtliche und eine gesellschaftliche Tatsache, welche heute die Aufmerksamkeit des Historikers und der Historikerin verdient. – Es lässt sich kaum quantifizieren, in welchem Ausmass und von welchem Zeitpunkt an Psychologie zu einem beachtlichen gesellschaftlichen Faktor geworden ist. Man spricht in den 60er Jahren ganz einfach wieder davon, man ist sensibler für und interessierter an psychologischen Erscheinungen. In der Literatur spricht man von einer weltweiten «Renaissance» der Individualpsychologie seit Mitte der 60er Jahre.10 – Viele Ereignisse und Entwicklungen wären zu nennen, Richtungen, Schulen und Namen vorzustellen. Das Modell der «Psychologischen Menschenkenntnis» sei hier herausgegriffen und von nahem besehen.
Psychologie in Zürich
Schauen wir zurück, so haben wir in Wilhelm Wundt bereits 1874 einen renommierten Psychologieprofessor, der in Zürich lehrte. «Seelenärzte» wie Auguste Forel, Eugen Bleuler oder C. G. Jung wirkten hier. Nennenswert für die Nachkriegszeit ist zum Beispiel, dass Psychologie 1956 an der Universität Zürich Hauptfach wird und dass in Zürich 1957 der erste Internationale Kongress für Gruppentherapie stattfindet. 1960 war das «Jahr der geistigen Gesundheit». 1963 nimmt das Institut für angewandte Psychologie (gegründet 1923) die Form einer Stiftung an. In Bern eröffnet anfang August 1964 Bundesrat Tschudy den Kongress des Weltbundes für psychische Gesundheit. Das Szondi-Institut wurde 1969 gegründet. Die «Psychologischen Lehr- und Beratungsstelle» unter der Leitung von Friedrich Liebling wurde im Jahre 1974 zu einer eidgenössischen Stiftung. Das Zürcher Alfred-Adler-Institut wird 1977 gegründet. Nachdem die Wirksamkeit der Psychotherapie feststand, begannen die Krankenkassen, sie in ihre Leistungen aufzunehmen. – Viele Beispiele und Begebenheiten zeugen davon, dass die Psychologie an Bedeutung gewann. Es erschienen psychologische Zeitschriften für ein breiteres Publikum. «Der Psychologe» musste 1964 jedoch sein Erscheinen einstellen.11 Die bekannte Illustrierte «Psychologie heute» erschien ab 1974. Dazwischen liegt das erste Jahrzehnt der «Psychologischen Menschenkenntnis».
Die «Psychologische Menschenkenntnis»
Zunächst einmal ist folgendes festzuhalten: Die Zeitschrift «Psychologische Menschenkenntnis» erscheint ab 1964 in Zürich. Während mehr als zehn Jahren kommt sie monatlich heraus, ohne Werbung, sauber redigiert, in einer Auflage von etwa 2000 Stück. Beziehen konnte man sie im Abonnement oder am Kiosk.
Die Zeitschrift «Psychologische Menschenkenntnis» wurde von der Psychologischen Lehr- und Beratungsstelle in Zürich herausgegeben. Als Schriftleiter und Herausgeber zeichneten Friedrich Liebling und Dr. med. et phil. Josef Rattner. – Es ist nicht selbstverständlich, dass eine psychologische Beratungsstelle oder Schule eine eigene Zeitschrift herausgibt. Das traditionsreiche Institut für angewandte Psychologie (IAP Zürich) zum Beispiel edierte nie eine solche. Umgekehrt steht auch nicht automatisch eine Schule oder psychologische Einrichtung hinter einer psychologischen Zeitschrift. «Der Psychologe» zum Beispiel, von Dr. G. H. Graber in den Jahren 1949 bis 1964 herausgegeben, bestand ohne eigentliche Schule. Dasselbe ist bei der «Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen» der Fall.
Zeitschriften mit dem Wort Psychologie im Titel gibt es mehrere. Meist wenden sie sich jedoch nur an die akademische Fachwelt. Die «Psychologische Menschenkenntnis» versucht dagegen die Psychologie einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen. Im Geleitwort heisst es:
«Unsere neue Zeitschrift wendet sich an Leser aus allen Volksschichten und Bildungskreisen und wird sich bemühen, tiefenpsychologische Einsichten in allgemeinverständlicher Sprache darzustellen.»12
Das psychologische Wissen solle nicht einem primär akademischen Kreis Vorbehalten bleiben, es stehe jedermann zu. Diesen Anspruch teilte bereits Dr. G. H. Graber vom «Psychologen»:
«DER PSYCHOLOGE will eine Brücke bauen von den Fachvertretern der Psychologie - auch die Psychologin wirkt mit - zu der psychologisch interessierten Bevölkerung.»13
Das Scheitern des «Psychologen» hielt Liebling und Rattner jedoch nicht davon ab ihrerseits eine breitere Öffentlichkeit zu suchen. - Erwähnenswert ist hier, dass die Zeitschrift «Schule und Elternhaus» (siehe unten), die in den 50er Jahren öfters über psychologische Fragen schrieb, von 1963 bis 1973 gänzlich schwieg zu diesem Thema. – Bei derselben Druckerei, die den «Psychologen» druckte, kommt nahtlos anschliessend die «Psychologische Menschenkenntnis» heraus und kann während siebeneinhalb Jahren ohne Preiserhöhung bestehen. Per Januar 1972 wechselt sie die Druckerei und erscheint im Eigenverlag.
Wie schon gesagt wurde, ist die «Psychologische Menschenkenntnis» mit der Geschichte der Psychologischen Lehr- und Beratungsstelle (auch «Zürcher Schule» oder «Zürcher Schule für Psychotherapie» genannt) verbunden. Um die Distanz zu den Entwicklungen nach 1982 zu wahren, lasse ich meine Betrachtungen 1974 enden. 1974 ist zudem das Jahr, in welchem die Psychologische Lehr- und Beratungsstelle eine eidgenössische Stiftung wird. Die «Psychologische Menschenkenntnis» erschien bis in die 80er Jahre. Das erste Jahrzehnt dieser Zeitschrift birgt hingegen mehr als genug Material für eine historische Arbeit.
1 Bloch, Marc: Apologie der Geschichte oder Der Beruf des Historikers. Stuttgart 1974 [182]. – Anmerkung zur Zitierweise: Die Seitenzahlen gebe ich in eckigen Klammem an. Wenn die «Psychologische Menschenkenntnis» zitiert wird, gebe ich Monat und Jahr, den Jahrgang und die Seitenzahl der Stelle an. Der Zeitschriftenname fehlt dann in der Angabe.
2 Albisser, S.: Unsere Gesellschaft braucht Psychologen. In: «Schweizerische Lehrerzeitung», Juni 1972 [850].
3ebd. [851].
4 Baur, J. Grusswort zu: «Schule und Elternhaus» Heft 3 1973 (Thema: Elternbildung) [3].
5 Eckige Klammem stehen, wenn ganze Sätze ausgelassen wurden. Fehlt nur der Satzanfang, so setzte ich drei Punkte.
6 Wintsch, Dr. phil. Hans Ulrich: Psychologische Gruppengespräche mit Eltern. In: Schule und Elternhaus. Heft 3 1974 (Thema: Erziehungsalltag) [12].
7 vgl. Dinzelbacher, Peter (Hg.): Europäische Mentalitätsgeschichte. Kröner, Stutgart 1993.
8 vgl. Weiss, Florence: Die Beziehung als Kontext der Datengewinnung. Ethnopsychoanalytische Gesichtspunkte im Forschungsprozess. In: Spuhler, Gregor u. a.: Vielstimmiges Gedächtnis. Beiträge zur Oral History. Chronos, Zürich 1994 [23-47].
9 Die englische Zeitschrift «Oral History» wurde im Jahr 1971 gegründet.
10 vgl. Titze, Michael: Individualpsychologie. In: Lück, Helmut u.a.: Geschichte der Psychologie, München 1984 [120] oder auch Pongratz, Ludwig J.: Hauptströmungen der Tiefenpsychologie. Kroner, Stuttgart 1983 [300].
11 Näheres dazu im Kapitel «Die ›Psychologische Menschenkenntnis› und andere zeitgenössische Publikationen».
12 Zum Geleit. In: «Psychologische Menschenkenntnis», Juli 1964 [1].
13 Zum Geleit. In: «Der Psychologe», Feb. 1949 [1].
Quellenlage
Die Hauptquelle ist die «Psychologische Menschenkenntnis». Als weitere Quellen benutzte ich pädagogisch-psychologische Zeitschriften, die sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden. Daneben untersuchte ich «Schule und Elternhaus», «Der Psychologe», den «Freidenker» und diverse weitere Zeitschriften, die in unterschiedlichem Ausmass Informationen beisteuerten.
Zusätzliche Dokumente aus einem allfälligen Verlagsarchiv der «Psychologischen Menschenkenntnis» standen mir nicht zur Verfügung. (Eine diesbezügliche Anfrage beim heutigen Verlag blieb unbeantwortet.14) – Nachforschungen im Bundesarchiv15, im Staatsarchiv Zürich und in verschiedenen Verwaltungsarchiven Zürichs blieben ohne Erfolg.
Für die Geschichte der Zürcher Schule und Friedrich Liebling diente mir neben der «Psychologischen Menschenkenntnis» (hier v. a. der Vortrag von Beatrice Bissoli «10 Jahre Gruppentherapie: Rückblick und Ausblick» vom Januar 1969) die Bücher «Lieblings-Geschichten» (1991) und «Friedrich Liebling, Aufsätze» (1992), ferner ein Aufsatz Josef Rattners «Der Tod Friedrich Lieblings» (1986). – Besprechungen der «Psychologische Menschenkenntnis» fanden sich im «Schweizerischen Kindergarten», im «Freidenker» und in der «Bibliographie der deutschsprachigen psychologischen Literatur».
Es wurde bis heute weder eine psychologische Geschichte Zürichs (also eine umfassende Darstellung der Geschichte unter Berücksichtigung psychologischer Gesichtspunkte) noch eine Geschichte der Psychologie in Zürich gescchrieben. In der neuesten Geschichte des Kantons Zürich von 1994 ist zur Psychologie nichts und zur Psychoanalyse gerade ein Hinweis enthalten. In der «Psychologie des 20. Jahrhunderts» verhält es sich ähnlich.16 Die «Renaissance» der Individualpsychologie17 wurde für Zürich ebensowenig dokumentiert wie die Entstehung psychologischer Gruppen. – In den zahlreichen Geschichtswerken zur Psychologie werden fast ausschliesslich die akademischen Karrieren und
Theorien, der «Diskurs», behandelt. (Auch wenn an der Psychologischen Lehr- und Beratungsstelle viele Akademiker verkehrten, so war diese Schule gerade nicht nur Akademikern vorbehalten, sondern allen interessierten Lehrern, Eltern, Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern offen.)
Dass die Psychologie und auch die Sozialpädagogik in den letzten Jahrzehnten im ganzen deutschsprachigen Raum eifrig nach Lösungen für die immer deutlichen Probleme suchen, wird vielerorts beschrieben, so auch bei Klaus Sanders.
«In Einrichtungen der Gesundheitsvor- und Nachsorge wie in Beratungsstellen für Kinder, Eltern und Jugendliche, sozialpsychiatrischen Diensten, Drogen- und Suchtberatungsstellen, kinder- und jugendpsychiatrischen Diensten, Telephonseelsorgestellen, schulpsychologischen Diensten, Familienberatungsstellen und heilpädagogischen Einrichtungen vollzieht sich z. Zt. ein besonders reger Austausch unterschiedlicher Erklärungsansätze und praktisch-methodischer Vorgehenskonzepte.»18
Die steigende Bedeutung der Gruppenpsychotherapie stellt Rudolf Krausen nicht so sehr als zeitgeschichtliches Phänomen dar, sondern als natürliche Folge. Krausen über Slavson:
«Slavson [...] rechnet den ‹sozialen Hunger› zu den stärksten menschlichen Antrieben, womit er, durchaus konform mit der Individualpsychologie, die Grundlage der Gruppendynamik beim Namen nennt.»19
Dass die Zürcher Schule und die Zeitschrift «Psychologische Menschenkenntnis» in den Jahren bis 1974 nicht besser dokumentiert ist, liegt zum einen vermutlich daran, dass sie auf eine private Initiative zurückging und nicht einer staatlichen oder universitären Abteilung angegliedert war. Zum anderen lag der Schwerpunkt jener Arbeit nicht im Publizieren oder in neuen Theorien, sondern in der praktischen Hilfe am Menschen.
Oder wäre es schliesslich denkbar und möglich, dass Friedrich Liebling, einem Schüler Alfred Adlers, ein ähnliches Schicksal wie seinem Lehrer wiederführe?
Ein halbes Jahrhundert nach Adlers Tod kam Krausen zum Schluss, dass dessen Bedeutung wesentlich grösser war, als allgemein zugestanden worden ist.
«Alles Todschweigen konnte nicht verhindern, dass sich der Einfluss Adlers fortsetzte. In der neuesten Psychologie werden zunehmend die sozialen Determinanten gewürdigt. Man stösst hierbei auf alte Einsichten Adlers.»20
Zu Adlers und Lieblings Leistungen zählt ferner, dass sie Erziehungsberatungsstellen errichteten: Adler in Wien in der Zwischenkriegszeit, Liebling in Zürich in den 60er und 70er Jahren. Wolman schreibt über Adler:
«Es muss festgestellt werden, dass Adlers Einfluss viel grösser ist, als man gemeinhin annimmt.»21
Und Handlbauer geht dann nahtlos von Adlers Beispiel zu Rattners Grossgruppen in Berlin über. Die unerlässlichen Zwischenstationen Psychologische Lehr- und Beratungsstelle Zürich und Friedrich Liebling lässt er aus. Zum ersten Mal wurde Liebling 1991 in einer psychologischen Darstellung erwähnt, wiederum aber nur im Zusammenhang mit Rattner.22
Einig ist man sich wenigstens darin, dass die Individualpsychologie von den 60er Jahren an wieder an Bedeutung gewann.
«Seit Mitte der 60er Jahre hat die Individualpsychologie eine weltweite ‹Renaissance› erlebt.»23
«Im ganzen kann man von einer Renaissance der Individualpsychologie, der oft totgesagten, sprechen.»24
Beispiele fehlen aber auch hier. – Kurz: Die Geschichte der Psychologie in Zürich ist bis heute ungenügend dokumentiert. Dass die Psychologische Lehr- und Beratungsstelle bis 1974 sechs Einträge im Telefonbuch der Stadt Zürich (fünf Telefonnummern, vier Adressen) verzeichnen konnte, zeigt, dass sie einigen Einfluss gehabt haben dürfte. – Die «Psychologische Menschenkenntnis» füllt hier als herausragende und facettenreiche Quelle eine Lücke. (Die unveröffentlichte Dissertation von Gerda Fellay über das Erziehungskonzept von Friedrich Liebling konnte ich für die Arbeit nicht berücksichtigen, da ich sie erst beim Abschliessen meiner Liz-Arbeit einsehen konnte. Sie kommt nicht zu anderen Resultaten als ich und ist sehr detailreich. Bezeichnend ist allerdings, dass sie im französischen Sprachraum erschien.)
Leitfragen
In der vorliegenden Arbeit untersuche ich verschiedene Fragen zur Zeitschrift an sich, über ihren Bezug zu anderen Zeitschriften und zur öffentlichen Wahrnehmung der Psychologie. Es sind dies:
Wie präsentiert sich die «Psychologische Menschenkenntnis» in den Jahren 1964 bis 1974, und wie verändert sie sich in diesem Zeitraum?
In welchem Bezug steht die «Psychologische Menschenkenntnis» zu anderen Zeitschriften?
Welcher Kontrast ergibt sich aus der «Psychologischen Menschenkenntnis» und dem zeitgeschichtlichen Hintergrund von 1964 bis 1974?
Vermutlich ist der Erfolg der «Psychologischen Menschenkenntnis» in ihrem besonderen Charakter begründet. Dass eine Zeitschrift, deren Sinn und Ziel das psychologische Lernen und die Aufklärung breiter Kreise bestehen konnte und gelesen wurde, weist auf ein Bedürfnis nach dieser Aufklärung hin.
14 Ich schrieb an die Stiftung Psychologische Lehr- und Beratungsstelle, Susenbergstrasse 53, 8044 Zürich und telefonierte mit einer Frau Vonwiller, Tel. 261 11 82.
15 Im Bundesarchiv befand sich unter der Signatur P. 069965 zwar Material zu Friedrich Liebling, dieses umfasste aber nur den Zeitraum von 1950 bis 1960 und beschäftige sich mit den Umständen seiner Flucht von Österreich in die Schweiz.
16 Walser, Hans H.: Psychoanalyse in der Schweiz. In: Eicke, Dieter: Die Psychologie des 20. Jahrhunderts II. Freud und die Folgen (1). Kindler, Zürich 1976 [1192-1218],
17 siehe: Titze, Michael: Individualpsychologie. In: Lück, Helmut u. a.: Geschichte der Psychologie. München 1984 [120] oder: Pongratz, Ludwig J.: Hauptströmungen der Tiefenpsychologie. Kroner, Stuttgart 1983 [300],
18 Sander, Klaus: Pädagogik und Sonderpädagogik. In: Lück, Helmut u. a.: Geschichte der Psychologie. Schwarzenberg 1984 [241].
19 Krausen, Rudolf: Die Wirkungen der Individualpsychologie heute. In: Eicke, Dieter: Die Psychologie des 20. Jahrhunderts III. Freud und die Folgen (3). Kindler, Zürich 1977 [652f.].
20 ebd. [654].
21 Handlbauer, Bernhard: Die Entstehungsgeschichte der Individualpsychologie Alfred Adlers. Geyer, Wien 1984 [343].
22 Bruder-Bezzel, Almuth: Die Geschichte der Individualpsychologie. Fischer, Frankfurt am Main 1991 [237].
23 Titze, Michael: Individualpsychologie. In: Lück, Helmut u. a.: Geschichte der Psychologie. München 1984 [120].
24 Pongratz, Ludwig J.: Hauptströmungen der Tiefenpsychologie. Kroner, Stuttgart 1983 [300].
Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund: «Schule und Elternhaus»
«Es ist paradox und absurd: Was mich am meisten von meinem Mitmenschen trennt, ist das Problem, das ich mit ihm gemeinsam habe!»
Hans Ulrich Wintsch25
Die Zeitschrift «Schule und Elternhaus» wird vom Schulamt herausgegeben und an alle Familien mit schulpflichtigen Kindern abgegeben. Sie ist nicht für ein spezialisiertes Publikum verfasst, sondern möchte alle Gesellschaftsschichten erreichen. Sie hat also für Familien mit schulpflichtigen Kindern in der Stadt Zürich eine Monopolstellung inne. «Schule und Elternhaus» eignet sich daher - bedingt –, um einen gesellschaftlichen Rahmen für die 50er bis 70er Jahre zu skizzieren, handelt es sich doch um Stellungnahmen des Schulamtes.
1945 wurde in der Stadt Zürich eine ärztlich-psychologische Beratungsstelle eingerichtet, 1960 ein schulpsychologischer Beratungsdienst.26 Im Dezember 1953 stellt Dr. med. W. Deuchler das Wesen des schulpsychologischen Dienstes und der Psychologie im allgemeinen der Elternschaft genauer vor:
«Bei diesen Beratungen haben wir oft den Eindruck, dass noch allzu viele Menschen sich unter Psychologie so etwas wie Wahrsagerei vorstellen. Ein Psychologe ist ein Mensch, der, mit magischen Fähigkeiten ausgerüstet, den Ratsuchenden durchschaut und ihm Vergangenheit und Zukunft neben der Auslegung seines Charakters und seiner Fähigkeiten zu deuten vermag. Die Psychologie ist aber keine solche magische Wissenschaft und muss oft zu Enttäuschungen Anlass geben, weil sie keine fertigen Lösungen bieten kann, ja eigentlich ganz im Gegenteil vom Ratsuchenden nur zu oft mehr verlangt, als sie ihm zu geben vermag.»27
Wenn die Eltern jedoch merkten, dass es auch um sie gehe und nicht nur ums Kind, würden sie oft bald das Interesse an der Psychologie verlieren:
«Die Magie der Psychologie ist verschwunden, und es handelt sich um ganz einfache Forderungen des Alltags, wie Selbstbeherrschung, Aufgeben alter Gewohnheiten oder Bequemlichkeiten, Erkenntnis eigener Fehler und Unzulänglichkeiten, Dinge, die nicht sehr angenehm zu hören sind, Haltungen, die man nicht so leicht ändern kann. Nicht allzu selten heisst es dann plötzlich, es gehe mit dem Kinde besser und weitere Beratungen seien nicht erwünscht; man will die Konsequenzen lieber nicht ziehen und empfindet die Beratung als unangenehm, weil sie zu sehr ins Persönliche überzugreifen droht und man sich nicht zu ändern wünscht. Man tröstet sich schliesslich damit, dass es beim Kind eines Tages doch besser gehen werde; wenn es älter werde, dann gehe ihm der (berühmte) Knopf auf, oder es komme zum Verstand oder so ähnlich.»28
Es gibt so etwas wie eine Volksmeinung zur Vererbung. Verbreitet ist die Idee, Intelligenz, Begabung oder auch typische Schwächen seien die Folge eines besonderen Erbgutes. «Der Grossvater hatte auch schon Probleme mit dem Französisch» heisst es etwa, und schon glaubt man, eine Erklärung für die Schulschwierigkeiten des Kindes zu haben. Solche Ansichten weist die «Psychologische Menschenkenntnis» jedoch weit von sich. Eltern und Erzieher würden Haltungen und den Charakter formen. Sogar hier ist «Schule und Elternhaus» durchaus einer Meinung.
Zur Frage der Vererbung meint nämlich Deuchler, dass es nicht so relevant sei, ob charakterliche Komponenten vererbt werden könnten oder nicht, man sollte auf jeden Fall so tun, als hätte die Vererbung keinen Einfluss.
«Die meisten Eltern suchen die Ursachen nicht bei sich, sondern in den äusseren Umständen oder gar in der Vererbung.[...] Im Vergleich zu dem, was wir heute über die Vererbung bei Tieren und Pflanzen wissen, ist das, was man über Vererbung beim Menschen als sicher bezeichnen kann, sehr wenig, namentlich wenn es um Eigenschaften des Charakters geht. Wir müssen die Anschauung, ein bestimmter Charakterzug beim Kinde sei nun eben einmal vererbt, eher bekämpfen als bestärken. Wir müssen uns als Erzieher zunächst einmal so einstellen, als ob es keine Vererbung gäbe!»29
Die Psychologie stelle hohe Anforderungen an die Ratsuchenden, und es sei nicht immer angenehm, was man dabei zu hören bekomme. Auch mobilisiere eine Psychotherapie mit dem Kind oft den Widerstand der Eltern, wobei eigentlich nicht selten die Eltern selbst zu behandeln wären, schreibt der Schularzt.
Der Autor macht deutlich, dass die sogenannten Schwererziehbaren nicht völlig anders seien. Die Unterschiede seien bloss gradueller Art. Manchmal komme es vor, dass Eltern die Schwierigkeiten ihrer Kinder zu tragisch nähmen. Aber das seien die selteneren Fälle. – (Deuchler schreibt von Verwahrlosungstendenzen der Jugend, was er auf fehlende autoritäre Erziehung zurückführt.)
Als Hauptschwierigkeit gibt er jedoch an, dass man auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen sei. Elternschulen seien geplant.
«Es zeigt sich eben oft, dass es die Eltern sind, die sich behandeln lassen sollten oder die doch zum mindesten aus unseren Befunden und Ratschlägen nicht nur Konsequenzen für das Kind, sondern auch Konsequenzen für sich selber ziehen sollten. Das ist schwer. Seine eigenen Erziehungsmethoden, seine eigene Einstellung zum Kind ändern zu müssen, das ist schwer und wird unter Umständen als Zumutung, wenn nicht gar als Beleidigung aufgefasst. Um dieser Erziehungsnot, die heute sicher weit herum besteht und vielleicht auch als Nachkriegserscheinung zu bezeichnen ist, abzuhelfen, hat man Mütterschulen und Väterschulen geplant und auch schon eingerichtet. Die Mütter kann man wohl leichter zu einer solchen Schulung gewinnen, aber die Väter? Sie haben zumeist keine Zeit und finden, die Erziehung sei doch in erster Linie Aufgabe der Frauen, der Mütter. Viele unserer Beratungskinder leiden aber nicht etwa an der mangelnden Muttererziehung, sondern an der mangelnden Vatererziehung. [...] Kann man Erziehung lehren, kann man Erziehung lernen, so wie irgendein Fach? Das ist die Frage. Müssen denn in jeder Generation die Eltern zuerst wieder bittere Erfahrungen machen, für die dann meist das erstgeborene Kind herhalten muss? [...]
Um der Not des schwierigen Kindes zu begegnen, haben wir heute die Erkenntnisse der Kinderpsychologie und der Kinderpsychiatrie zur Verfügung. Diese Erkenntnisse nützen aber praktisch nicht sehr viel, wenn wir die erzieherische Haltung der Eltern nicht zu beeinflussen vermögen. Der Schule kann nicht zugemutet werden, Lückenbüsser für das Versagen der Eltern zu sein. [...] Vermehrte Beobachtungsmöglichkeiten [...] sind daher notwendig. Aber auch diese genügten nicht, wenn es nicht gelänge, die Eltern zu vermehrter Einsicht in die Natur des Kindes zu gewinnen. Es stellt sich daher die Frage nach einer besseren Vorbereitung der Eltern auf die Erziehungsaufgabe: Hier ist die Stelle, wo wir den Teufelskreis vielleicht durchbrechen könnten, der dadurch entsteht, dass Kinder, die keine genügende Erziehung erhielten, zu Eltern werden, die in der Erziehung ihrer Kinder wiederum versagen. Damit ist das schwierigste Problem, nämlich die Elternerziehung, gestellt, das wir hier nur andeuten möchten.»30
Erziehungskurse für Eltern werden in «Schule und Elternhaus» erstmals im Dezember 1956 empfohlen, dann im Februar 1957 und im Dezember 1958 wieder. (Eine Übersicht im Februarheft 1957 nennt u. a. die Klubschule Migros; die Psychologische Lehr- und Beratungsstelle bleibt dagegen ungenannt.)
Sexualaufklärung wird als Schutz gegen Sittlichkeitsverbrecher gutgeheissen (Feb. 1957). Im September 1957 lautet das Thema «Erziehungsprobleme». Hans Künzli schreibt den Artikel «Eifersüchtige Kinder». Das Sonderheft zum Thema «Geschwister» vom August 1959 setzt die pädagogische Reihe von «Schule und Elternhaus» fort. Im Juni 1960 ist das Thema «Geistige Gesundheit und Schule». 1960 ist das Jahr der geistigen Gesundheit. Deuchler schreibt über die ärztlichpsychologische Beratung, Schelling über den schulpsychologischen Beratungsdienst. Viele Rätsel würden sich aufklären, schreibt Deuchler, wenn die Eltern mit der Selbsterkenntnis beginnen würden.
«Heute [...] stehen die Eltern, die ihre erzieherische Aufgabe erfüllen wollen, nicht mehr allein. Es gilt, die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus zu überwinden.»31
Schelling nimmt Bezug auf die neugeschaffene Stelle des schulpsychologischen Beratungsdienstes. Nicht nur organische Faktoren würden zu Schulproblemen führen, hält er fest. Im raschen Wachstum der Stadt sieht Schelling einen Grund für die grössere Nachfrage in spezialisierter Beratung. Bei Schwierigkeiten eines Schülers seien früher in manchen Schulhäusern die Pädagogen im Lehrerzimmer zusammengesessen. Erfahrene Lehrer hätten dann ihre jungen Kollegen beraten. Heute hätten sich die Strukturen gewandelt.
«Mit dem raschen und anhaltenden Wachstum der Stadt nahm während der letzten fünfzehn Jahre das Bedürfnis nach Beratung in praktischen Fragen der Schulung und Erziehung allgemein zu. Diese Tatsache liess sich sowohl bei den Eltern als auch bei der Lehrerschaft feststellen.»32
Dass der schulpsychologische Beratungsdienst freiwillig ist, legt Schelling als Vorteil aus. So könne eher Vertrauen hergestellt werden. Und es bestehe eine markante Nachfrage.
«Der schulpsychologische Beratungsdienst ist eine relativ junge Einrichtung. Die bisherige Inanspruchnahme zeigt aber deutlich, dass er einem Bedürfnis entspricht. Bis Ende des vergangenen Schuljahres wurden rund 1500 Schüler, nämlich etwa 1000 Knaben und 500 Mädchen, angemeldet. An den Beratungen nahmen bis zu diesem Zeitpunkt ausser den Klassenlehrern 1550 Eltern, nämlich rund 1100 Mütter und 450 Väter, teil.»33
Im November 1961 hat der Psychologieprofessor Wilhelm Keller das Wort. Probleme der frühen Kindheit sind das Thema des Heftes. Keller erklärt dort, dass Freuds Auffassung überholt sei. Die Probleme des Menschen im wesentlichen auf Triebkonflikte zurückzuführen, gehe nicht mehr an, seit man die eminente Bedeutung der ersten Kindheitsjahre erkannt habe.34 Abgesehen davon, dass Keller die Vererbung einer Neigung zum Verbrechertum für möglich hält, versucht er deutlich zu machen, wie ausserordentlich wichtig für das Gedeihen eines Menschen die soziale Beziehung sei. Ein Kind ohne ausreichende menschliche Betreuung verkümmere in seiner Entwicklung und sterbe möglicherweise schon jung, selbst wenn seine körperliche Versorgung einwandfrei sei.
Im Mittelpunkt des Heftes vom August 1963 stehen Aufsätze von Rekruten, die 1961 über ihre Kindheit schrieben. Sonnen- und Schattenseiten verschiedener Kindheiten werden beschrieben. Rückblickend erklären viele Rekruten, die Strafen ihrer Erzieher seien gerecht und angebracht gewesen, was der Kommentator mit Befriedigung zur Kenntnis nimmt.35
Ohne psychologische Fragen auch nur zu streifen, hält der Kommentator die traditionelle Erziehungspraxis für genügend. Vergessen ist die «Krise der häuslichen Erziehung», von der «Schule und Elternhaus» im Dezember 1951 berichtete.
«Zerfall der Familie? In unserer Zusammenstellung finden sich viele beklemmende Bekenntnisse. Sie stammen fast ausschliesslich von Waisen und von Scheiditngskindern oder von Rekruten, deren Eltern im Streit leben. Ihre Zahl ist gross. Hier ist die Familie zweifellos zerfallen. Dass sie jedoch in unserem Land allgemein in Auflösung begriffen sei, dafür liefert unsere Untersuchung keinen Beweis. Die jungen Soldaten, die sich in den Arbeiten so natürlich und offen geben, machen in ihrer Gesamtheit den Eindruck, dass sie aus einem Elternhaus kommen, das diesen Namen verdient.»36
Indem der Autor dementiert, dass in der Erziehung generell Probleme bestehen, indem er am Mythos der intakten Familie festhält, wird einem Versuch der Öffnung und Sensibilisierung der Menschen eher entgegengewirkt. – Tatsächlich wird es in «Schule und Elternhaus» nun still um die Psychologie (1963 bis 1973).37
Das Blatt wendet sich dann 1973 (das Heft «Schule und Elternhaus» erscheint nun ab dieser Nummer auch in einer neuen Aufmachung), als der Stadtrat J. Baur in seinem Geleitwort schreibt:
«Liebe Eltern, Haben Sie Erziehungsprobleme mit Ihren Kindern in der Familie, in der Schule? – Diese Frage wird wohl niemand mit einem spontanen Nein beantworten können [...].»38
Obwohl nun zehn Jahre nicht auf Erziehungsprobleme eingegangen wurde, erklärt Stadtrat Baur sehr verständnisvoll, das Erziehen sei in der modernen Gesellschaft schwieriger geworden. Vom Schulamt würden deshalb Elternkurse angeboten.
«Mit dem Bezweifeln und Kritisieren von alt Bewährtem, ohne dafür etwas besseres Neues bieten zu können, wird aber auch viel Unheil angerichtet. In einer gewissen Unsicherheit weiss man oft nicht mehr, was in der Erziehung falsch und richtig ist. Unsere Elternkurse wollen hier wertvolle Hilfe sein. Aussprachen mit anderen Eltern über gemeinsame Probleme unter Führung eines erfahrenen Erziehers und Vorträge über wichtige Erziehungsfragen, über das Zusammenleben in der Familie und den anderen Mitmenschen bieten wertvolle Anregungen.»39
Baur hält fest, dass es aber in der Erziehung keine Rezepte gebe. Er macht auf die Elternbildung aufmerksam (plötzlich werden wieder Kurse dafür angezeigt). Dann hat die Zürcher Kinderpsychologin Veronika Steinmann-Richi das Wort. Sie versucht mit Vorurteilen gegenüber Erziehungskursen aufzuräumen.
«Väter und Mütter, die Erziehungskurse besuchen, möchten gute Eltern sein. Es genügt ihnen nicht, oberflächlich und mit raschen, vordergründigen Massnahmen zu erziehen. Noch weniger wollen sie in einem bequemen ‹laisser faire› und ‹laisser aller› die Entwicklung ihrer Kinder hauptsächlich den Fremdeinflüssen überlassen. Sie suchen Wege zu einem bestmöglichen, elterlichen Verhalten.»40
Elternbildung müsse im Bereich der Erkenntnis und im Bereich des Gefühles einsetzen. Explizit wird auch die Gruppe erklärt, und die Autorin gibt wertvolle Einblicke in die Vorgänge in einer Gruppe.
«Zeit und Kraft für wahre Anteilnahme scheinen an vielen Orten zu fehlen. Einsamkeit lässt kleine Probleme riesig werden, verstärkt negative Gefühle wie Hass, Groll, Abneigung und verschlingt sehr viel seelische Kraft. Die Kurse in den Elternschulen sind ein ausgezeichnetes Kontaktfeld, wo nachbarliche Hilfe gedeiht, wo Freundschaften entstehen und gegenweitige Anteilnahme selbstverständlich wird. In offenem Gedankenaustausch entsteht eine positive, tolerante Einstellung, welche der ganzen Familie zugute kommt. Erleben sich die Eltern in der Gruppe gefühlsmässig geborgen, so lernen sie die Bejahung der Gefühle zu schätzen, den Wert des nicht-kritischen Zuhörens zu erkennen. Sie erfassen auch, welche Gefühle hinter den Handlungen ihrer Kinder stehen. Sie sehen ihr Kind als reagierendes Individuum und entwickeln ein immer feineres Empfinden für die Wirkung ihrer eigenen Verhaltens- und Handlungsweisen auf sein Gewissen und Benehmen.»41
Und einige Zeilen später:
«Durch das Aufgehobensein in einer Kursgruppe geschieht es auch immer wieder, dass bei Eltern schwere, unverdaute Kindheitserlebnisse aufsteigen und verarbeitet werden können. [...] Im Kursgespräch ist die Erfahrung: wie wirke ich auf eine Gruppe und wie wirkt die Gruppe auf mich? wohl die stärkste Hilfe zur Selbstkontrolle.»42
Noch einmal betont Steinmann-Richi, dass in Elternschulen keine Rezepte angeboten werden könnten. Geleistet werde Arbeit an der eigenen Persönlichkeit.
«Wir Elternkursleiter werden oft skeptisch gefragt: Kann man denn Eltern noch ändern?
Nicht wir Kursleiter ändern die Teilnehmer, aber in den Gruppengesprächen geschieht laufend, dass sie sich selbst ändern. Ihre Einstellung, ihre Grundhaltung – und dann auch verfeinern sich ihre Handlungsweisen: Eine Mutter berichtet: ‹Nicht wahr, Mami, seit du in die Elternschule gehst, machst du es anders mit uns?› und: ‹Mami, schimpfst du eigentlich nicht mehr?› Eine Mutter sagt von sich selbst: ‹Seit ich Kurse besuche, bin ich viel feinfühliger geworden.› Ist das nicht Erziehungshilfe und Persönlichkeitsbildung im wahrsten Sinn des Wortes?»43
Dr. Willy Canziani, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Elternbildung des Kantons Zürich, erklärt, dass die modernen Kommunikationsmittel wie Massenmedien, wenn sie Erziehungshilfe bieten wollten, alle einen Mangel aufweisen würden und zwar, dass sie den Dialog nicht ermöglichten.
«Es ist wohl leicht, Eltern ein bestimmtes Erziehungswissen zu vermitteln; schwerer aber ist es, sie davon zu überzeugen, dass die Ursache mancher Erziehungsschwierigkeit bei ihnen selbst liegt. Die Eltern besuchen zwar Elternkurse bestimmter Erziehungsprobleme wegen, für die sie eine Lösung in Form eines Rezeptes suchen. Sie wehren sich aber in der Regel dagegen, die Erziehungsschwierigkeiten als ihre eigene Erziehernot zu anerkennen. Die Elterngruppe ist dadurch, dass sie den gegenseitigen Beziehungen unter den Teilnehmern grosse Bedeutung zuerkennt, in der Lage, Einsichten in das eigene Verhalten zu fördern und an den Erfahrungen der anderen Gruppenmitgliedern zu messen.»»44
Canziani plädiert für eine Betrachtung, die den Menschen als soziales Wesen erkennt. Zu lange habe man den Menschen nur als Einzelwesen untersucht. Für eine funktionierende Gruppe erachtet es der Autor als wichtig, dass der Gruppenleiter nicht eine dominierende Rolle übernehme. Ein Solidaritäts- und Verantwortungsgefühl im weiteren Sinne könne in der Gruppe entstehen.
«Hat ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin das Vertrauen der Gruppe, um eine bedrückende Erfahrung oder einen Konflikt der Gruppe zur Beratung vorzulegen, so entsteht die verbindende Bewegung der Mitverantwortung der Elterngruppe.»45
Viele Eltern würden sich einsam fühlen, man habe das Gespräch verlernt, und hier biete die Gruppe Gelegenheit, das nachzuholen. Hier erkenne der Einzelne, dass er mit seinen Sorgen und Nöten nicht allein sei. In der Gruppe werde ein Reifungsprozess möglich, der über Monate und Jahre dauere. Aber auch das Miteinander in der Gruppe müsse erst erlernt werden.
«Die einzelnen Phasen des Gruppenprozesses, insbesondere die mehrere Abende dauernde Anlaufzeit, sind dem erfahrenen Gruppenleiter gut vertraut, und er wird darum abwarten, bis Hemmungen, Geltungsdrang, Zurückhaltung und Schweigen einer allgemeinen Toleranz und Aufgeschlossenheit Platz gemacht haben. Wenn sich der Gruppenprozess in dieser Weise entwickelt, so stellt sich das pädagogisch fruchtbare Klima ein.»46
Es entspreche dem Stand der aktuellen Bildungsforschung, sich gesprächsweise in Pädagogik fortzubilden.47 Ferner macht Canziani Angaben zu geschichtlichen Wurzeln der Elternbildung und stellt Betrachtungen zur Gruppenarbeit für Eltern in der heutigen Zeit an. (Im selben Heft lag eine Antwortkarte bei, womit das Schulamt sich Klarheit über die Elternbildung verschaffen wollte. Auf verschiedene Veranstaltungen der Elternbildung wird hingewiesen. – Eine Auswertung wurde nicht abgedruckt.)
Die Nachfrage in Elternbildung beschreibt er als eine Erscheinung der letzten fünf Jahre.
«In den vergangenen fünf Jahren hat das allgemeine Interesse an Elternbildungskursen stark zugenommen. Einerseits bieten Elternkurse die Möglichkeit, die durch Massenmedien, Zeitschriften und Bücher verbreitete Information zur Kindererziehung zu besprechen und zu verarbeiten. Andererseits aber haben viele Eltern im Gruppengespräch eine Hilfe zur
Überwindung von Kontaktschwierigkeiten entdeckt. Auf diese Weise hat die Elternbildung als Erziehungshilfe an Bedeutung gewonnen.»48
Im letzten Heft des Jahres 1974 von «Schule und Elternhaus» steht der Erziehungsalltag im Zentrum.49 Während andere Artikel die Lage der Familie und der Eltern-Kind-Beziehung behandeln, schreibt Dr. phil. Hans Ulrich Wintsch über psychologische Gruppengespräche mit Eltern. Er erklärt, dass sich allmählich auch in Europa diese Form der Problemlösung durchsetze. Entstanden seien Gruppengespräche aus einer Not, nämlich aus der grossen Nachfrage an psychologischer Beratung.
«Die psychologischen Gesprächsgruppen aller Art [...] sind anfänglich weniger aus wissenschaftlichen Erwägungen als aus einer Notlage entstanden, aus einer Not, die heute auch noch allenthalben besteht: Die praktizierenden Berater, Therapeuten und Ärzte sind längst nicht mehr in der Lage, der ständig zunehmenden Nachfrage nach psychologischer Beratung zu genügen. Hinzu kommt noch, dass für zahlreiche Familien mit niederen und auch mittleren Einkommen die Kosten für psychologische Einzelberatungen und -therapien unverhältnismässig hoch sind. Das psychologische Gruppengespräch eröffnet somit auch einen Weg zur Lösung der problematischen wirtschaftlichen und sozialen Seite des psychologischen Dienstes am Mitmenschen.»50
Wintsch schreibt dann an gegen Vorbehalte in Gruppen zu sprechen. Eine Ursache vermutet er in der isolierten Betrachtung des Menschen. Man glaube in der Regel, der Mensch schaffe sich seine Probleme selber, und die anderen hätten damit nichts zu tun. Die Eltern verstünden ihr Kind nicht und sagten, es habe doch alles, was es brauche. Dazu meint Wintsch:
«Wenn Eltern seit jeher unwillig oder gar ärgerlich werden, falls ein Kind zuhause Schwierigkeiten oder gar Unbehagen äussert, so reagieren sie gefühlsmässig im Grunde genommen ganz konsequent. Sie spüren nämlich unbewusst, dass sie am Problem des Kindes mitbeteiligt sind, aber sie können mit diesem Gefühl nichts anfangen. Es fehlt ihnen weitgehend an Einsicht in die tieferen Zusammenhänge der zwischenmenschlichen Beziehungen und damit an der Möglichkeit, den Anteil des Problems, der bei ihnen selbst liegt, zu verarbeiten.»51
Überdies hätten Kinder bei Problemen oft Schuldgefühle den Eltern gegenüber. Als Erwachsener habe man diese Schuldgefühle immer noch, und viele würden sich deshalb isolieren. Der Autor kommt zum interessanten Schluss:
«Es ist paradox und absurd: Was mich am meisten von meinem Mitmenschen trennt, ist das Problem, das ich mit ihm gemeinsam habe! Um diese Trennung aufzuheben, müssen wir deshalb allmählich lernen, offen miteinander über die Probleme zu reden, die uns gemeinsam beschäftigen und die wir miteinander haben.»52
Der hauptsächliche Sinn von Gruppengesprächen ist nach Wintsch der, Verantwortung zu übernehmen. Man könne nur insofern sensibel für den Mitmenschen oder das Kind sein, insofern man sensibel für sich selbst sei. Besonders wichtig sei das Vorbild des Gruppenleiters. Wachsende Sensibilität oder Gefühlskenntnis scheint ihm von herausragender Bedeutung.
«Die meisten und vor allem die schwierigsten Konflikte in engen Lebensgemeinschaften entstehen vermutlich durch seelische Spannungen, die wir kaum oder gar nicht wahrnehmen und deren Ursachen für uns ebenso meist im dunkeln liegen.»53
Ein besonderes Seelenzerstörungspotential ortet Wintsch bei Eltern, die ihre Probleme verdrängten.
«Eltern, die starke unverarbeitete Konflikte mit sich herumtragen, sind innerlich ständig angespannt und erzeugen in ihrer Umgebung offene und verdeckte Spannungen und Ängste. Das Perfide daran ist, dass ich als Erzieher mit meiner inneren Gespanntheit und Unruhe – auch, oder gerade wenn ich sie äusserlich in ‹Kontrolle› habe – vor allem besonders sensible Kinder zu gestörtem Verhalten unbewusst ‹anstifte› und sie schliesslich noch dafür bestrafe. Ein Erzieher, der seine Probleme nicht kennt oder verleugnet, wird damit zum Fallensteller für das Kind!»54
Gruppengespräche haben nach Wintsch zunächst einmal die Funktion, Spannungen abzubauen. Es sei ein Naturgesetz, dass in Gruppen eine Art Familienatmosphäre, eine grosse Vertrautheit aufkomme. Jeder bringe seine Art mit und neige auch dazu, erneut die Lieblingsprobleme zu erzeugen, wie er es in seiner Herkunftsfamilie gelernt habe. Nur könnten in der Gruppe die Ursachen gefunden und das Verhalten korrigiert werden. Der individuelle «blinde Fleck» könne so erkannt werden.
«Erst wenn in einer Gruppe das tiefe Gefühl aufkommt, dass wir hier ‹alle in einem Boot sitzen› und dass aber ausserdem ‹wir da drinnen› nicht etwa besser sind als ‹die da draussen›, kann ein wirklicher Lernprozess in Gang kommen.» 55
Schliesslich beschreibt Wintsch auch noch die Möglichkeit, dass eine Gruppe wieder auseinanderfallen könne: Wenn die Ursachen von Problemen auf Aussenstehende projiziert würden, man einen äusseren Feind verantwortlich mache. Doch sei dies eine altbekannte Erscheinung.
«Wir haben es hier mit einem wohl uralten menschlichen Verhalten zu tun, mit der Angst nämlich, der Friede in einer Gruppe könnte in Brüche gehen, wenn über aufkommende Spannungen gesprochen wird. Die Erfahrungen mit psychologischen Gesprächsgruppen zeigen uns, dass diese Befürchtungen nicht mehr stimmen, wenn wir alle mit der gleichen Offenheit über das sprechen lernen, was wir bisher ängstlich voreinander verschwiegen haben.»56
Wenn «Schule und Elternhaus» auch nicht regelmässig psychologische Fragen erörtert, so bemüht sie sich doch seit den 50er Jahren sichtlich, den Eltern die Psychologie nahe zu bringen. Immer deutlicher erklärt man die Psychologie zum unerlässlichen Hilfsmittel für Erzieher. Mehrere Autoren schreiben dabei gegen die Scheu und die Vorurteile von Eltern an.
Erstaunlich ist, wie unmissverständlich «Schule und Elternhaus» die psychologische Aufklärung von Eltern und Erziehern fordert. Erstaunlich, weil sie von 1963 bis 1973 ein glattes Jahrzehnt zum Thema schweigt. Psychologie und psychologische Elternkurse werden dringend empfohlen, ein grosses Unwissen und starke Vorurteile diagnostizieren die Autoren in der Bevölkerung. Wieso leistet man sich das Schweigen, wo das Problem anscheinend so klar ist? – Nach einer spärlichen, aber doch gelegentlichen Berichterstattung von 1945 bis 1963, klafft eine Lücke bis 1973. 1973 bis 1975 erscheinen einige wenige Artikel, das Schweigen dominiert jedoch fortan in «Schule und Elternhaus». Weshalb dies so ist, bleibt ebenfalls verschwiegen. Gegen die Psychologie wird nie etwas gesagt. Hans Ulrich Wintsch betont überhaupt, dass «es sich doch allmählich herumgesprochen haben dürfte», dass die Menschen die gleichen Probleme hätten. – Wie fest hatte es sich aber wirklich herumgesprochen?
25 Wintsch, Dr. Hans Ulrich: Psychologische Gruppengespräche mit Eltern. In: «Schule und Elternhaus» Heft 3, 1974 [12]
26 «Schule und Elternhaus» Juli 1945, Juni 1960.
27 Deuchler, Dr. med. W.: Die ärztlich-psychologische Beratung des schulärztlichen Dienstes. In:
«Schule und Elternhaus», Dez. 1953.
28 ebd.
29 ebd.
30 ebd.
31 Deuchler, Dr. W.: Die Aufgabe der ärztlich-psychologischen Beratung. In: «Schule und Elternhaus», Juni 1960.
32 Schelling, Rudolf: Der schulpsychologische Beratungsdienst. In: «Schule und Elternhaus», Juni 1960.
33 ebd.
34 Als Wegbereiter einer neuen Sicht nennt Keller die Schweizerin Séchehaye mit ihrem Begriff der «Verlassenheit» und René Spitz' Forschungen aus den 40er Jahren.
35 «Schule und Elternhaus», August 1963 [12J.
36 ebd. [15].
37 Keine Ausnahme dazu bilden die Hefte vom März 1969 «Anregungen zur Erziehung» und vom Juni 1972 «Autorität und Erziehung in Elternhaus und Schule».
38 Baur, J.: Liebe Eltern. In: «Schule und Elternhaus», Heft 3 1973 [3].
39 ebd.
40 Steinmann-Richi, Veronika: Elternbildung als Erziehungshilfe. In: «Schule und Elternhaus», Heft 3 1973 [51].
41 ebd. [5f.].
42 ebd. [6].
43 ebd.
44 Canziani, Dr. Willy: Warum brauchen wir Elternbildung? In: «Schule und Elternhaus», Heft 3 1973 [7|.
45 ebd. [8].
46 ebd. [9].
47 Der Autor gibt hier Zahlen an: «Im Durchschnitt haftet beim Menschen 20% vom dem, was er hört, 30% von dem, was er sieht und 50% von dem, was er hört und sieht im Gedächtnis. Was er selber spricht, bleibt zu 70% und was er tut zu 90%.» Diese Erkenntnis hätte dazu geführt, dass man in der Erwachsenenbildung mehr Gruppen- und Gesprächsmethoden anwende (ebd. [9]).
48 ebd. [10].
49 Für «Schule und Elternhaus» ist dies vorläufig der Höhepunk, was die Thematisierung der Psychologie angeht. Spätere Hefte gehen praktisch nicht mehr auf solche Fragestellungen ein. Am ehesten noch Heft 3/1977 und 3/4/1978.
50 Wintsch, Dr. Hans Ulrich: Psychologische Gruppengespräche mit Eltern. In: «Schule und Elternhaus», Heft 3 1974 [12].
51 ebd.
52 ebd.
53 ebd. [13].
54 ebd.
55 ebd.
56 ebd.
Friedrich Liebling und die Zürcher Schule
«Man muss die Menschen besser lieben, um sie besser zu verstehen.»
Friedrich Liebling57
Die Psychologische Lehr- und Beratungsstelle in Zürich, auch Zürcher Schule oder Zürcher Schule für Psychotherapie genannt, war das Modell einer psychologischen Schule. Aus der anfänglich kleinen psychologischen Praxis an der Stationsstrasse 33 in Zürich Wiedikon entwickelte sich bis in die 70er Jahre eine psychologische Einrichtung mit einem umfangreichen Angebot. Für Ehe- und Erziehungsberatung sowie psychologische Hilfe in allgemeinen Lebensfragen konnte man sich 1974 in der Stadt Zürich an mehrere Adressen dieser Beratungsstelle wenden. Neben Gruppengesprächen wurden Kongresse durchgeführt, gemeinsame Ferien veranstaltet und nicht zuletzt eine Zeitschrift herausgegeben: die «Psychologische Menschenkenntnis». – In welcher Beziehung standen nun aber Friedrich Liebling und die Psychologische Lehr- und Beratungsstelle?
Friedrich Liebling (1893–1982) stammte aus Wien.58 Aus rassischen Gründen verfolgt fand Liebling, seine Frau Maria Liebling-Ulbl (1894–1972), ihre beiden Töchter Erna (1921) und Lilly (1925) und die Pflegesöhne Leo (1925) und Josef Rattner (1928) im Jahr 1938 in Schaffhausen Aufnahme. Ursprünglich wollten sie in die USA Weiterreisen, was Erna, Lilly und Leo später auch taten. Gesundheitlich und finanziell war das Ehepaar Liebling in einer schlechten Verfassung. Nach dem Krieg siedelten Friedrich Liebling, seine Frau und Josef 1951 nach Zürich an die Stationsstrasse 33 in Wiedikon über. Am Institut für angewandte Psychologie erwarb Rattner 1949 sein Diplom, an der Universität studierte er Philosophie und Medizin.59 In dankbarer Erinnerung beschreibt er Friedrich Liebling als seinen Lehrer und Förderer.
Die Arbeiterzeitung «Schaffhauser AZ» veröffentlichte von Friedrich Liebling, Josef und Leo Rattner über 100 Beiträge mit politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Inhalten.60 In der Zeit von 1955 bis 1963 erschienen zahlreiche Artikel Friedrich Lieblings in folgenden Organen: «Der Psychologe», «Die Tat», «Freidenker»,61 «Neue Zürcher Zeitung» und «Wir Brückenbauer».
1954 laden Friedrich Liebling und Josef Rattner öffentlich zu einer Filmmatinée in Zürich-Oerlikon ein. Den ersten Hinweis auf solche Veranstaltungen fand ich im «Tagblatt der Stadt Zürich» im November 1954.
Tagblatt der Stadt Zürich, Sa, 20. Nov. 1954
Der Name «Psychologische Lehr- und Beratungsstelle» erscheint also bereits 1954. Später wird auch in der «Psychologischen Menschenkenntnis» vereinzelt zu Filmmatinéen eingeladen (zum Beispiel im Oktober 1964).
In den 50er Jahren liegt auch der Anfang der gruppentherapeutischen Praxis Lieblings (Gesprächsrunden). In einem grösseren Kreis diskutierte man über die
Psychologie, über die Natur des Menschen, über Evolution, Vererbung, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Menschenwürde, Krieg und Frieden, über Religion, Sexualität und Erziehung. Man traf sich während zweier Jahre in einem Raum des Lokals «Zurlindenhof», dann im «Frohsinn». 1958 wechselte man dann ins «Haus zum Korn» in Wiedikon.62
Ab 1964 geben Friedrich Liebling und Josef Rattner die «Psychologische Menschenkenntnis» in regelmässiger Folge und sauber redigiert heraus. Man verschreibt sich der psychologischen Aufklärung und dem Humanismus. Rattner spricht einmal von der «Erziehung der Menschheit».
«Diese ‹Erziehung der Menschheit›, bei der sich die Tiefenpsychogie solcher Ahnen wie Lessing, Hegel, Marx und allen Repräsentanten des philosophischen Idealimus von Plato bis Kant erinnern darf, wird sich unweigerlich der Form der Gruppentherapie bedienen müssen.»63
Zu festen Einrichtungen werden die ab 1967 regelmässig stattfindenden Tagungen und ab 1972 auch Kongresse.





























