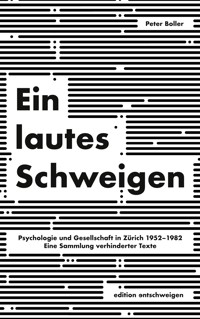Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Mai 2022 fand im Museum Strauhof eine Ausstellung zum Thema Tiefenpsychologie in Zürich statt. Die Stadt an der Limmat zwar zwar mehrmals ein bedeutender Schmelztiegel für die Weiterentwicklung tiefenpsychologischer Konzepte und Modelle. Paradoxerweise ist das Bewusstsein dafür sowohl im öffentlichen Raum als auch in der akademischen Welt eher kümmerlich. Das könnte auch daran liegen, dass Tiefenpsychologie nicht nur auf persönliche Leiden Antworten sucht, sondern auch gesellschaftliche Widersprüche aufzeigt. Unterschiedliche Quellen - Dokumente aus privaten und öffentlichen Archiven, Oral History-Interviews -, aber auch Übersichtstafeln und Stadtrundgänge dienten sowohl der Einordnung als auch dem Ziel, weiterführende Gespräche und Forschungsfragen zu ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Einleitung: Psychologie hat viele Gesichter
2 Exponate
3 Verzeichnis der Dokumente
4 Zitate aus Interviews: Hörstationen
5 Menschenbilder und ihre Funktion
6 Flyer
1 Psychologie hat viele Gesichter
Dass Zürich zu unterschiedlichen Zeiten ein Zentrum der Psychologie war, ist kein Geheimnis. Dennoch erstaunt bei näherer Betrachtung, wie lückenhaft und holzschnittartig das Wissen um Inhalte und Zusammenhänge ist. Auch wenn sich hier die Wege von Alice Miller und Alexander Mitscherlich kreuzten, Friedrich Liebling, Josef Rattner, Paul Parin, Mario Erdheim, Martha Eicke-Spengler, Oskar Pfister, Sabina Spielrein, Berthold Rothschild, Eugen Bleuler, C. G. Jung, Medard Boss, Ruth Cohn, Otto Gross, Arno Gruen und andere in Zürich Inspirationen holten oder bestehende Ansätze weiterentwickelten, so finden sich kaum Spuren dazu im öffentlichen Bewusstsein. Woher rührt diese bemerkenswerte “Erinnerungsschwäche“? Es scheint sich um eine einseitige “Amnesie“ zu handeln, denn gewisse Autoritäten – Bleuler oder Jung – galten lange als Referenzpunkte.
Im Unterschied zu anderen Wissenschaften drangen die Erkenntnisse der Psychologie jedoch nicht durchgehend ins allgemeine Bewusstsein ein. Hilfesuchende, Künstlerkreise oder gesellschaftskritische Intellektuelle mochten die neuen Ideen seit Freud dankbar aufnehmen, doch in anderen Kreisen erregten sie Missfallen. Noch 1958 warnte etwa der Papst vor einer “Überschätzung des Unterbewussten“ (Dok 054).1 Unter besonderer Beobachtung standen Psychologen, wenn sie sich zu militärischen Fragen äusserten, wie Freud, der 1920 ein Gutachten zu Wagner-Jauregg verfasste (Dok 021). Eine kritische Äusserung zum Koreakrieg beendete im Beispiel des Zürcher Psychiaters Rudolf Brun 1952 gar dessen Karriere (Dok 040). Noch Ende der 60er Jahre war die Skepsis in der Ärzteschaft gegenüber psychoanalytischen Themen so gross, dass Martha Eicke-Spengler dazu keine medizinische Doktorarbeit schreiben durfte. Da sie berufspraktische Erfahrungen darin hatte, hielt man sie überdies für voreingenommen (Dok 061). Dennoch erkannten manche Praktiker in den 1970er Jahren, dass eine psychologische Weiterbildung ein Vorteil im Lehrerberuf ist.2 2016 wiederum berichtete eine Zeitung, man habe lieber Lehramtskandidaten ohne psychologische Vorbildung (Dok 101). Die meisten psychologischen Richtungen durchlebten Spaltungen. Im Fall des Psychoanalytischen Seminars folgte eine produktive Blüte. In anderen Fällen litt die fachliche Arbeit darunter. Und während Neurologen mit ihren Methoden ein optimistisches Menschenbild nahelegen, wie es die Individualpsychologie und Neopsychoanalyse bestätigen können, tun sich die Medien ganz offensichtlich schwer, das “verminte Feld“ zu verlassen und im Sinne der Prävention aufzuklären.3
Die grössere Toleranz gegenüber Drogenabhängigen oder sexuellen Minderheiten steht wohl auch im Zusammenhang mit einer grösseren psychologischen Sensibilität der Öffentlichkeit. Auch die Liberalisierung der Psychotherapie von 2022 (direkte Abrechnung der Therapeuten mit Krankenkasse) ist ein Fortschritt. Ob allerdings die Institutionalisierung und die Akademisierung der Psychologenausbildung die Qualität tatsächlich verbessert, wird sich weisen. Immerhin haben sich Freud und fast alle Tiefenpsychologen für die “Laienanalyse“ ausgesprochen.
Neben den bekannten und anerkannten psychologischen Konzepten, die sich in den psychologischen Ausbildungsgängen integrierten und behaupteten, gab es zahlreiche Ansätze, die vergessen gingen oder verdrängt wurden, nicht nur, weil sie reaktionär oder wissenschaftlich unhaltbar waren – Beispiel Lavaters Charakterstudien – sondern weil sie im Gegenteil eine sehr berechtigte und schonungslose Kritik übten oder gar ihrer Zeit voraus waren. Die Ausstellung im Museum Strauhof (“Wild Card 14“) ist eine gute Gelegenheit, die verlorenen Fäden zusammenzuführen und auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund einzuordnen. Welche Fragen sind heute erlaubt, sinnvoll, nötig? Wie offen darf man sprechen? Wie aktuell sind die zu entdeckenden Modelle und Perspektiven? Dies möchte die Ausstellung zur Diskussion stellen.
Abschliessend noch ein paar Hinweise zum Aufbau der Ausstellung: Hauptelement der Ausstellung ist eine Art Wäscheleine als Zeitstrahl. Daran hängen an Klammern rund 100 Dossiers zu einer Jahreszahl, die sich mit einem Namen oder Ereignis verbinden. Einige dieser Zettel sind leer, was den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit gibt, Ereignisse und Erinnerungen, die ihrer Meinung nach auch in die Ausstellung gehören, einzufügen. – In einem Raum befinden sich um einen Tisch angeordnet zehn Hörstationen mit Ausschnitten aus biografischen Interviews. Diese stammen teilweise von Therapeuten unterschiedlicher Richtungen und teilweise von Zeitzeugen, die sich über einen längeren Zeitraum psychologisch weiterbildeten. – Mehrere Schaukästen enthalten Bücher, Bilder oder Zeitdokumente. Dabei sind sowohl der Testbericht von Leopold Szondi über Adolf Eichmann wie auch die Staatschutz-Fiche zu Szondi von besonderem Interesse. Aber auch Fälschungen, wie sie der Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis (VPM: 1986-2002), vorgenommen hatte, um die eigene Geschichte zurechtzubiegen und Kritiker der skandalösen Entwicklung nach Lieblings Tod aus dem Gedächtnis zu löschen. Ausserdem finden sich hier auch Bilder aus dem Umfeld des Psychoanalytischen Seminars Zürich. – Schaubilder zur Entwicklung der Psychiatrie einerseits und der psychologischen Strömungen andererseits dienen der geschichtlichen Einordnung. – Nebst Führungen durch die Ausstellung waren schliesslich auch Stadtrundgänge an Orte der Geschichte der Tiefenpsychologie in Zürich Teil der Veranstaltung. Diese sollten Gelegenheit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen und Verbindungen zur heutigen Situation der Psychologie in dieser Stadt aufzuzeigen. Der hier abgedruckte Text “Menschenbilder und ihre Funktion“ war nicht Teil der Ausstellung. Er erscheint an dieser Stelle erstmals als Diskussonsbeitrag.
“Zürich entschweigen“ war ein Erfolg. Über 400 Interessierte besuchten den Strauhof oder nahmen an einer Führung teil. Für eine Veranstaltung, die nur neun Tage lang dauerte und nicht mit Inseraten beworben wurde, ist das ein regelrechter Ansturm. Von verschiedenen Seiten war der Wunsch zu hören, die Ausstellung über einen längeren Zeitraum zu zeigen oder an weiteren Orten fortzusetzen. – Besonderen Dank geht an Rémi Jaccard und Philip Sippel vom Museum Straufhof, die diese Wild Card ermöglicht haben, an die Interviewpartnern für Ihre Bereitschaft und Offenheit (Alois Altenweger, Ingrid Feigl, Dr. Olaf Knellessen John Hill, Samuel Müri, Thomas Steiner, an Fritz Müller, Vera Schneider*, Dr. Felix Notter*), ferner an das Psychoanalytische Seminar und das Szondi-Institut. Wertvolle Hinweise im wissenschaftlichen Austausch habe ich von Prof. Gerald Hüther, Prof. Jakob Tanner, von Thomas Kurz, Dr. Jürg Rüedi, Marianne Schuler und last not least von Verena Poestgens erhalten. Allfällige Fehler in den Texten stehen alleine in meiner Verantwortung.
* Pseudonyme
1 Der Kürzel “Dok“ verweist auf die gezeigte Dokumente der Ausstellung. Eine Übersicht dazu befindet sich in diesem Katalog auf den Seiten 9-31 jeweils auf der unteren Seitenhälfte.
2 Schuler, Marianne: Zum 40. Todestag von Friedrich Liebling. In: Zeitschrift für Individualpsychologie 4/47 (2022), S. 379 (erscheint demnächst).
3 Roth, Gerhard: Über den Menschen. Berlin 2021, S. 233.
2 Exponate
Aus Dok 002:
„Ein großer Theil der Unglücklichen, hier Eingesperrten, sind Soldaten. Viele sind nicht in die Behältnisse eingekerkert, sondern sitzen und laufen in den Gängen umher. Manche liegen an Ketten in ihren Kerkern, und sind an die Wände angeschlossen.“ (Wikipedia zu „Narrenturm“)
Aus Dok 004:
Nadeschda Suslowa schliesst als erste Frau in Europa an der Universität Zürich ihr Medizinstudium mit dem Doktorexamen ab. In den Reformen nach dem Krimkrieg schaffte Zar Alexander II. die Leibeigenschaft ab (1861) und verbot zugleich das Frauenstudium (1863), da er in studierenden Frauen ein revolutionäres Wesen erkannte. Nadeschda Suslowa schloss 1867 als erste Frau ihr Medizinstudium ab und wurde damit zum Vorbild einer ganzen Generation, was auch die Anziehung Zürichs für junge Russinnen und Russen erklärt. Die Limmatstadt hatte ein eigentliches ‘russisches Viertel’ mit einer russischen Bibliothek etc. Nadeschda Suslowa war in erster Ehe mit Friedrich Erismann verheiratet, der später Gemeinderat in Zürich war. Die Wohnbausiedlung Erismannhof (1928) in Aussersihl ist nach ihm benannt. Erst seit dem Jahr 2020 erinnert eine Ehrentafel an der Universität Zürich an die russische Pionierin.
(Bild: https://schweiz-russland.ch/nadeschda-suslowa.html
3 Verzeichnis der Dokumente
001: 1772, Lavater Physiognomik – 002: 1784, Narrenturm Wien – 003: Entschweigen erwünscht – 004: 1867, Frauenstudium Universität Zürich – 005: 1874, Wilhelm Wundt in Zürich – 006: 1887, Alfred Ploetz in Zürich – 007: 1899, Freud: Die Traumdeutung – 008: 1900, Jung stösst durch Bleuler auf Freud – 009: 1904, Sabina Spielrein ist Jungs Patienin in der Klinik Burghölzli – 010: Entschweigen erwünscht – 011: 1908, Max Rascher Verlag am Limmatquai gegründet, der Exil-