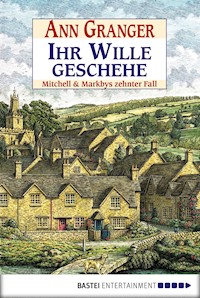9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Viktorianische Krimis
- Sprache: Deutsch
Oktober 1867. Wie ein Leichentuch legt sich der Nebel über die Stadt. In solchen Nächten, heißt es, geht es um - das Flussphantom. Und tatsächlich: Am nächsten Morgen findet man im Green Park eine Tote: Allegra Benedict, die bildschöne Frau eines renommierten Kunsthändlers. Was sie an diesem Tag in London gemacht und warum sie sich nur wenige Stunden vor ihrem Tod von ihrer Begleiterin heimlich getrennt hat, bleibt erst einmal ein Rätsel. Inspector Benjamin Ross vom Scotland Yard wird auf den Fall angesetzt. Die Zeit drängt, denn möglicherweise ist Allegra nicht die letzte Tote ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die AutorinTitelImpressumAnmerkung der AutorinKAPITEL EINSKAPITEL ZWEIKAPITEL DREIKAPITEL VIERKAPITEL FÜNFKAPITEL SECHSKAPITEL SIEBENKAPITEL ACHTKAPITEL NEUNKAPITEL ZEHNKAPITEL ELFKAPITEL ZWÖLFKAPITEL DREIZEHNKAPITEL VIERZEHNKAPITEL FÜNFZEHNKAPITEL SECHZEHNKAPITEL SIEBZEHNKAPITEL ACHTZEHNÜber die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
EIN MORD VON BESSRER QUALITÄT
EIN FALL FÜR LIZZIE MARTIN UND BENJAMIN ROSS
Kriminalroman Aus dem Englischen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe: Copyright © 2010 by Ann Granger Titel der englischen Originalausgabe: »A Better Quality of Murder«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2010 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Gerhardt Arth, Molzhain Lektorat: Stefan Bauer Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau Umschlagmotiv: © David Hopkins / phosphorart E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-0216-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Anmerkung der Autorin
Ein Besucher könnte den ganzen Londoner Green Park durchstreifen und würde doch die große Eiche nicht finden, die nach den Worten von Park Constable Hopkins auf Anordnung von King Charles II gepflanzt wurde, genauso wenig wie das Gebüsch gleich daneben. Der Grund liegt darin, dass Baum wie Gebüsch nur in meiner Fantasie dort stehen – ich vertraue darauf, dass man mir diese künstlerische Freiheit mit einem königlichen Park verzeihen möge. In ähnlicher Weise würde ein Besucher der Piccadilly vergeblich nach der Fine Arts Gallery von Sebastian Benedict Ausschau halten – der gesamte Block musste vor langer Zeit der imposanten Masse des Ritz Hotels weichen.
KAPITEL EINS
Inspector Benjamin Ross
Einmal bin ich einem Mann begegnet, der auf dem Weg war, einen Mord zu verüben. Ich wusste es damals nicht. Vielleicht wusste er es selbst noch nicht. Was zu einem Verbrechen wurde, war vielleicht zuerst nur ein verschwommener Gedanke, ein kranker Traum in seinem Kopf. Hätte er den Entschluss bereits gefasst gehabt, wäre er vielleicht trotzdem vor der Tat zurückgeschreckt, hätte ihn eine natürliche Abscheu im letzten Moment abgehalten. Ein Wort hätte genügt. Ich hätte ihn vielleicht aufgehalten, indem ich ihn nur gefragt hätte, wohin des Weges, und ihn ermahnt, auf seinen Schritt zu achten. Ganz so, wie es von Polizeibeamten in der Öffentlichkeit erwartet wird. Er hätte noch genügend Zeit gehabt, sein Vorhaben zu überdenken. Vielleicht hätte er seinen Plan geändert, hätte ich ihn angesprochen. Doch wir gingen aneinander vorbei wie die sprichwörtlichen Schiffe in der Nacht, ohne uns zu sehen, und eine Frau starb.
Ich war noch nicht lange dabei, als ich von der uniformierten Polizei zur zivilen Abteilung wechselte, kaum mehr als zwei, drei Jahre. Es war zur Weltausstellung von 1851. Ich sollte mich unter das Volk mischen, lautete der Plan, um Taschendiebe und Falschgeldschieber unter den Besuchern des Crystal Palace im Hyde Park ausfindig zu machen. Ich war halbwegs erfolgreich, obwohl ich rasch herausfand, dass die kriminelle Bruderschaft (und auch die Schwesternschaft) einen Polizeibeamten innerhalb von Sekunden nach seinem Eintreffen vor Ort erkennt – gleichgültig, wie er gekleidet ist.
Mag dies sein, wie es will, ich war jedenfalls seither bei der zivilen Abteilung mit Sitz am Scotland Yard und im Lauf der Jahre bis in den Dienstrang eines Inspectors aufgestiegen. Was, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, gar nicht schlecht ist für jemanden, der sein Arbeitsleben als Kohlenjunge in seiner Heimat Derbyshire begann, bevor er nach London kam, um dort sein Glück zu versuchen. Die Weltausstellung jedoch werde ich nie vergessen. Ich kannte die großen Maschinen von den Zechen und Fördertürmen, doch das war gar nichts im Vergleich zu dem, was der Crystal Palace zu bieten hatte. Alle möglichen Apparate und Vorrichtungen wurden ausgestellt, prachtvolles Mobiliar und Haushaltsgeräte, wie sie der Queen zur Ehre gereicht hätten, was immer man sich nur vorstellen konnte – selbst eine Dampflokomotive, die ihre Fahrgäste über das Gelände beförderte.
Eine Sache wurde nicht in der Ausstellung gezeigt, doch sie war überall zu sehen, als ich an jenem Samstagabend sechzehn Jahre später nach Hause ging, Anfang November 1867, um genau zu sein. Eine Sache, die, wie ich schwören könnte, in der Welt außerhalb Londons ihresgleichen suchte. Nicht aus Metall, Holz, Porzellan oder Tuch geschaffen und nicht dem Kopf eines genialen Erfinders oder Handwerksmeisters entsprungen. Es kommt nicht ratternd und Dampf speiend und Öl verspritzend daher, und es ist nicht in sämtlichen Farben des Regenbogens bemalt, sondern von schmutzig gelblicher oder stumpfer grauer Farbe. Es ist lautlos, und es bildet sich aus dem feuchten Atem der Stadt daselbst. Es ist der Londoner Nebel.
Der Londoner Nebel ist wie ein lebendes Tier. Er wirbelt um einen herum und greift von allen Seiten an, er schleicht sich in die Kehle und kriecht in die Nasenlöcher. Er blendet und raubt einem die Sicht, und manchmal ist er so dicht, dass man meint, nur die Hand ausstrecken zu müssen, um eine Faustvoll davon packen zu können, wie Watte. Doch das geht natürlich nicht. Er schlüpft einem spöttisch durch die Finger und hinterlässt nichts als den teerigen Gestank auf der Kleidung, den Haaren, der Haut. Und mag man noch so angestrengt versuchen, ihn aus der eigenen Wohnung herauszuhalten, die Tür vor ihm zu versperren, er findet selbst den Weg in die heimische Stube.
An jenem Tag im November legte sich der Nebel am frühen Nachmittag auf die Stadt, und um vier Uhr hatte er Central London fest in seinem feuchten, kalten Griff und streckte die klammen Finger bis in die abgelegensten Vororte aus. Den ganzen Tag über war es mehr oder weniger ruhig gewesen. Das Wetter hatte viel damit zu tun – auch die Ganoven und Taschendiebe blieben bei Nebel lieber zu Hause. Durch die Fenster meines winzigen Büros im Scotland Yard hatte ich verfolgt, wie der Nebel dichter und dichter geworden war, und nun ging die Sonne, wo auch immer sie stehen mochte über diesem dichten grauen Leichentuch, allmählich unter, und Dunkelheit zog auf. Die Gasbeleuchtung im Gebäude machte die Welt drinnen hell und klar, doch die Düsternis vor den Fensterscheiben war bedrückend und verhöhnte unsere Bemühungen, sie auf Distanz zu halten. Beamte kamen hustend und schnaufend herein und beschwerten sich fluchend, man könne kaum die Hand vor Augen sehen. Als ich mich schließlich auf den Nachhauseweg machte, konnte man sie tatsächlich nicht mehr sehen, außer man hielt sie direkt vor seine Nase.
Superintendent Dunn ging um vier Uhr und murmelte etwas von einem Abendessen, zu dem er und seine Frau eingeladen waren, auch wenn es mir ein Rätsel war, wie er bei diesem Wetter rechtzeitig nach Hause kommen wollte, um sich fertig zu machen. Und mehr noch, wie er und Mrs. Dunn anschließend das Haus ihrer Gastgeber in Camden erreichen wollten.
»Sie können meinetwegen auch nach Hause gehen, Ross«, sagte er zu mir.
Also nahm ich ihn beim Wort und verließ das Dienstgebäude nicht lange nach ihm. Meine Absicht war es, den Fluss nicht über die Westminster Bridge zu überqueren, wie ich es normalerweise tat, sondern über die Waterloo Bridge. Es war nicht so weit zu laufen, hätte klares Wetter geherrscht. Doch bei diesem Wetter benötigte ich eine Dreiviertelstunde, bevor ich nach einigen nahezu desaströsen Zusammenstößen mit einem Dutzend verschiedener Hindernisse am schlimmer werdenden Gestank erkannte, dass ich die große Baustelle des Uferdamms entlang der Themse erreicht hatte. Der Nebel hatte auch diese Arbeiten für den Rest des Tages zum Erliegen gebracht.
Was den Gestank anbetraf, der stieg aus der Themse auf. Außerstande, in die Höhe zu steigen, und vom Nebel an den Boden gedrückt, vermischte sich das wässrige Miasma mit all den anderen Gerüchen. Immer noch wird alles in den Fluss gekippt, obwohl Mr. Bazalgettes wundervolles neues Kanalisationssystem, das zum Teil unter meinen Füßen in der Uferböschung vergraben lag, dazu geschaffen worden war, eine von vielen Quellen der Verunreinigung zu beseitigen. Der Schiffsverkehr auf dem Fluss entlud seine Abfälle ebenfalls in das Wasser, und wenn irgendjemand aus der Gegend irgendetwas loswerden wollte, sei es Müll aus dem Haushalt oder einem Gewerbe, legal oder nicht, dann bestand der einfachste Weg darin, es zum Fluss zu schaffen und hineinzuwerfen.
Kadaver und gelegentlich auch Leichen fanden ebenfalls ihren Weg in den Fluss. Mörder rollten ihre Opfer in der Nacht lautlos über die Uferkante. Selbstmörder stürzten sich von den Brücken. Ich bin froh, dass ich nicht bei der Flusspolizei bin. Der Qualm der Lokomotiven vom großen Bahnhof von Waterloo trug seinen unverkennbaren Teil zum allgemeinen Gestank bei. Ich war daran gewöhnt. Er war mein Begleiter an jedem Abend.
Ich erreichte die große Steinbrücke mit den neun Bögen und betrat sie. Kein Wärter saß im Zollhäuschen – vermutlich, weil er annahm, dass bei diesem Wetter sowieso niemand den Fluss überqueren würde. Die Droschkenkutscher hatten den Betrieb mehr oder weniger eingestellt. Selbst bei bestem Wetter war der Verkehr über die Brücke eingeschränkt angesichts der Tatsache, dass die Londoner eine natürliche Abneigung gegen den Brückenzoll hatten und aus diesem Grund den Fluss, wenn es sich irgendwie einrichten ließ, lieber an anderer Stelle überquerten. Wenn ich mich nicht irre, haben die Erbauer der Brücke ihre Investition nie wieder hereingeholt. Es heißt sogar, am Ende müsse die Regierung die Kosten übernehmen, und das wäre das Ende des Brückenzolls, weil der Steuerzahler die Rechnung begleichen würde.
Ich marschierte los und hielt mich wohlweislich dicht an der steinernen Brüstung auf der linken Seite, die ich alle paar Schritte sicherheitshalber ertastete.
Es dauerte nicht lange, bis ich mich fühlte, als wäre ich ganz allein in dieser lautlosen Welt. Das einzige Geräusch war das gelegentliche dumpfe Hupen eines Nebelhorns. Der Flussverkehr war zum Erliegen gekommen, und die Leichter und Kähne warteten vor Anker auf das Ende des Nebels. Warnlichter waren nutzlos in diesem Wetter. Die Gaslaternen der Brücke brannten und erreichten doch nicht mehr, als dem Nebel in kleinem Umkreis einen safrangelben Schimmer zu verleihen. Ich hörte das Echo meiner eigenen Schritte von der Brüstung widerhallen. Obwohl ich mir den Schal um die untere Gesichtshälfte geschlungen hatte und meine Nase bedeckt war, fand der elendige Nebel dennoch einen Weg in meine Kehle und brachte mich zum Husten.
Ich musste die Hälfte erreicht haben, soweit ich es beurteilen kann, als mir bewusst wurde, dass ich nicht länger allein war. Schritte kamen mir entgegen. Der Nebel spielt dem Gehör manchen Streich, deswegen blieb ich stehen, für den Fall, dass ich nichts weiter gehört hatte, als mein eigenes vorsichtiges Schreiten. Doch es waren schnelle Schritte – diese andere Person rannte fast, daran bestand kein Zweifel. Diese andere Person rannte ungeachtet der schlechten Sicht und fürchtete sich offensichtlich nicht vor einer Kollision.
Mit einem Schlag war der Polizeibeamte in mir hellwach. Es ist nicht nur Furchtlosigkeit, die jemanden dazu bringt, den Hals zu riskieren. Manchmal ist es das genaue Gegenteil. Dieser anderen Person war es egal, wohin sie rannte oder ob ein Hindernis vor ihr lag. Sie lief vor etwas oder jemandem davon, so viel schien offensichtlich.
Ich wartete, wo ich war, spitzte die Ohren, lauschte. Ich schätzte, dass es sich um eine Frau handelte. Die Schritte waren leicht, nicht das massive Stampfen schwerer Männerstiefel. Tapp-tapp-tapp näherte sich das Trippeln immer mehr und schien mir so etwas wie Verzweiflung zu signalisieren. Eine Frau, allein, verängstigt, in heller Flucht über die Brücke hinweg und durch den dichten gelblichen Nebel.
»Verdammter Nebel!«, murmelte ich in meinen Schal. Ich war orientierungslos. Ich meinte sie direkt vor mir zu hören, auf der gleichen Seite der Brücke, doch sie konnte genauso gut auf der rechten Seite laufen oder sogar mitten auf der Fahrbahn. Ich bewegte mich meinerseits ein wenig mehr in die Brückenmitte. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Gespann vorbeigerattert kam, konnte ich leicht zu einer Seite ausweichen. Andererseits konnte ich in dieser zentralen Position genau erkennen, ob sie rechts oder links vorbeikam, und sie – mit ein wenig Glück – abfangen. Schließlich war die Brücke nicht besonders breit. Ich überlegte kurz, ob ich sie anrufen und wissen lassen sollte, dass Hilfe nah war. Doch da sie offensichtlich bereits so verängstigt war, dass sie Leib und Leben in ihrer heillosen Flucht riskierte, konnte das unerwartete Geräusch einer fremden Stimme weiter vorn ihre Panik nur noch stärker schüren.
Biff!
Bevor ich mich’s versah, materialisierte auf Armeslänge vor mir wie aus dem Nichts eine dünne Gestalt. Ich fand gerade noch Zeit zu bemerken, dass sie einen Rock trug und dass ihr Kopf mit einer Art Hahnenkamm gekrönt war, bevor die Person im vollen Lauf gegen mich prallte. Die Kollision raubte mir den Atem. Die Welt schien auf dem Kopf zu stehen. Ich stolperte rückwärts und wäre beinahe gestürzt und hielt nur mit äußerster Mühe mein Gleichgewicht. Durch reinstes Glück erwischte ich mit rudernder Hand ein Büschel leichtes Gewebe – ein Frauenkleid –, und als ich zupackte, veranlasste mich ein entsetzter Schrei dicht neben meinem rechten Ohr um ein Haar, das Kleid wieder loszulassen. Glücklicherweise war ich geistesgegenwärtig genug, dies nicht zu tun.
»Madam!«, rief ich der Unbekannten zu, von der immer noch nichts außer einer Silhouette zu erkennen war. »Ich bin Polizeibeamter. Haben Sie keine Angst!«
Sie stieß einen weiteren schrillen Schrei aus und trommelte mit geballten Fäusten gegen meine Brust und meinen Kopf. Durch die Gerüche des Nebels stieg mir ein weiterer in die Nase: der nach billigem Parfum.
»Lassen Sie mich auf der Stelle los!«, kreischte sie. »Ich habe nichts Unrechtes getan!«
»Ich will Ihnen nichts Böses«, rief ich zurück, während wir miteinander rangelten.
Sie begriff, dass ich sie nicht loslassen würde. Es war mir sogar gelungen, ihren Arm zu packen. Unvermittelt stellte sie ihre Gegenwehr ein und flehte mit leiserer, mitleiderregender Stimme: »Tun Sie mir nichts!«
»Ich tue Ihnen doch gar nichts!« Ich hätte sie am liebsten angebrüllt, doch das hätte nur einen weiteren Anfall von Panik hervorgerufen, also bemühte ich mich nach Kräften, wie ein vernünftiges menschliches Wesen zu klingen. »Ich sagte Ihnen doch bereits, ich bin Polizeibeamter.«
Ihr freier Arm kam aus dem Dunst, und eine Hand tippte auf eine mir von früher noch recht vertraute Weise suchend über die Brust.
»Sie sind kein Constable!«, protestierte sie anklagend. »Sie tragen keine Uniform. Wo sind Ihre Messingknöpfe?«
Ich bemerkte, dass der eigenartige Kamm auf ihrem Kopf aus einer Art Hut bestand, der mit daran angehefteten Seidenblumen oder Federn verziert war. Inzwischen war ich ziemlich sicher, dass ich eine von jenen Frauen am Arm gepackt hatte, die im Allgemeinen ihre Dienste auf der Straße anbieten. Ich konnte mich täuschen. Schon möglich, dass sie eine respektable Person war. Doch das blumige Parfum, das der Jahreszeit nicht angemessene dünne Kleid und der frivole Kopfschmuck, ganz zu schweigen von der Geschwindigkeit, mit der sie meine Aussage durch Abklopfen meiner Kleidung auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft hatte, legten etwas anderes nahe.
»Ich bin in Zivil«, sagte ich.
»Ach, tatsächlich?« Jetzt wurde sie sarkastisch. »Das ist mal was Neues. Die Kerle erzählen mir alle möglichen Geschichten, aber ein Bulle in Zivil ist mir bisher noch nicht untergekommen.«
»Mein Name ist Inspector Benjamin Ross«, sagte ich bestimmt. »Und Sie laufen vor jemandem davon.«
»Tue ich nicht!«, widersprach sie aufgebracht. »Lassen Sie mich los!«
»Bestimmt nicht«, sagte ich. »Vielleicht haben Sie jemandem die Geldböse gestohlen oder seine Uhr und Kette und laufen vor dem Gesetz davon.«
Diesmal holte sie mit der freien Hand aus und versetzte mir mit der geballten Faust einen kräftigen Hieb mitten auf die Brust. »Ich bin keine Diebin! Ich bin ein ehrliches Mädchen!«
»Sie sind ein Freudenmädchen«, entgegnete ich. Ich hätte sie auch als »gewöhnliche Straßendirne« bezeichnen können, doch vermutlich hätte mir das eine ganze Serie von Faustschlägen eingebracht. »Und Sie haben soeben einen Gesetzesbeamten geschlagen. Allein dafür kann ich Sie bereits unter Arrest stellen.«
Sie hatte während unserer Unterhaltung unablässig versucht, sich aus meinem Griff zu befreien, doch nun entspannte sie sich, was mir angesichts meiner Drohung als eigenartig erschien. Sie schwieg sekundenlang. Vielleicht dachte sie über meine Worte nach, doch ich spürte, dass es etwas anderes war. Sie lauschte. Auf einen Verfolger?
»Also schön«, sagte sie unvermittelt. »Stellen Sie mich unter Arrest.«
»Sie möchten, dass ich Sie unter Arrest stelle?« Ich versuchte mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen.
»Sicher. Nur zu! Stellen Sie mich unter Arrest!« Sie beugte sich vor, während sie sprach, und in den Geruch des billigen Parfums mischte sich der Geruch von Alkohol. Sie hatte eine Fahne.
»Ah«, sagte ich. »Sie nehmen offensichtlich an, in meinem Gewahrsam sicherer zu sein als in Freiheit. Sie fürchten eine Begegnung mit ihm.«
»Ihm?«, fragte sie erschrocken.
»Dem Mann, vor dem Sie davonlaufen. Wer ist er?«
Ich zögerte, sie zu verhaften. Sie klang sehr jung. Das war nicht anders zu erwarten. Die Mädchen auf den Straßen sind meistens jung, manche erschreckend jung, noch Kinder. Doch ich hatte sie nicht dabei ertappt, wie sie sich angeboten hatte. Ich hatte eine verängstigte junge Frau auf der Flucht angehalten. Sie nun zu einer Polizeiwache zu schleifen erschien mir nicht verhältnismäßig.
»Wie heißen Sie?«, fragte ich.
»Was interessiert Sie das?«, entgegnete sie mürrisch.
»Eine ganze Menge. Hören Sie, ich habe Ihnen auch meinen Namen genannt. Nun sprechen Sie schon. Es ist nur fair.«
»Daisy«, sagte sie nach kurzem Zögern.
»Und mit Nachnamen?«
Ein weiteres Zögern. »Smith.«
»Das glaube ich nicht«, sagte ich.
»Glauben Sie, was Sie wollen. Wenn ich sage, ich heiße Daisy Smith, dann beweisen Sie mir doch, dass es nicht stimmt.«
»Schön, Daisy Smith«, sagte ich. »Dann verraten Sie mir doch, was Sie so in Angst versetzt hat.«
»Sie haben mir Angst gemacht!«, erwiderte sie schlagfertig. »Ein Mädchen einfach so am Arm zu packen und festzuhalten! Sie haben mir vielleicht einen Schrecken eingejagt!«
»Das mag sein, aber ich wage zu behaupten, dass jemand anders Ihnen bereits einen größeren eingejagt hat.«
Weiteres Schweigen folgte. Dann wehte das traurig klagende Echo eines Nebelhorns über den Fluss. Unter unseren Füßen knirschte Holz an Stein, und eine Männerstimme rief eine Warnung. Irgendjemand war tollkühn – oder dumm – genug, um bei diesem Wetter auf dem Fluss zu fahren.
»Es steckt dahinter«, sagte sie plötzlich und so leise, dass ich es beinahe überhört hätte.
»Sagen Sie mir, wer, Daisy. Wer ist ›es‹? Ich kann Sie vor ihm beschützen«, antwortete ich genauso leise.
Sie stieß ein eigenartig gezwungenes leises Lachen aus. »Das kann niemand. Es ist nicht zu fassen, Inspector Benjamin Ross. Niemand kann es fassen, nicht ich und nicht Sie.«
»Und warum nicht?«, fragte ich.
Ein weiterer Schwall von warmem Bieratem und Parfum, so stark, dass es mich in der Nase juckte. Sie hatte ihre Lippen dicht an mein Ohr gebracht.
»Weil es schon tot ist, verstehen Sie? Es war das Phantom. Das Phantom aus der Themse. Es kriecht in nebligen Nächten ans Ufer und streift durch die Straßen. Es ist in sein Leichentuch gehüllt und versteckt sich in Türen und Gassen. Man hört und sieht es niemals, doch plötzlich spürt man die Berührung seiner Hand und seinen Geruch. Es riecht wie das Grab, nach toten Dingen und nach Blut. Das hat mich so erschreckt vorhin. Seine kalten Hände kamen aus dem Nebel und packten mich an der Kehle. Zum Glück konnte ich mich losreißen.«
»Wie das?«, fragte ich zweifelnd. Ich war daran gewöhnt, dass die Mädchen alle möglichen Geschichten erzählten, wenn sie verhaftet wurden, doch diese hier war mir neu.
Mit plötzlich nüchterner, sachlicher Stimme fuhr sie fort: »Ich habe ihm meine Finger in die Nasenlöcher gestoßen.«
Ah, richtig. Ein Mädchen, das seine Dienste auf der Straße anbot, musste diese Tricks beherrschen. Trotzdem hatte sie mir mein nächstes Argument geliefert.
»Daisy«, sagte ich leise. »Es ist kein Flussphantom oder was auch immer – nicht, wenn es Schmerz verspürt. Wer auch immer Sie gepackt hat, es war kein Geist. Es war ein Mensch aus Fleisch und Blut.«
»Und warum kommt es immer nur dann, wenn Nebel herrscht?«, wollte sie wissen.
»Weil er sich im Nebel verstecken kann«, erwiderte ich schlicht. »Und weil er nicht gesehen werden will. Das tun die meisten Kriminellen und andere Leute mit üblen Absichten.«
»Aber sie laufen nicht in Leichentüchern herum«, konterte Daisy.
Ich war entschlossen, ihr dieses überspannte Bild von ihrem Angreifer auszureden. »Sie haben ihn also gesehen? In seinem Leichentuch?«, fragte ich.
Das ließ sie für eine Sekunde zögern, bevor sie genauso bestimmt wie schon zuvor antwortete: »Nein, habe ich nicht. Aber andere. Andere haben es gesehen. Eine Freundin von mir hat es sogar ganz deutlich gesehen. Sie wartete auf Kundschaft, doch die Nacht lief schlecht, und sie hatte niemanden gefunden und Angst, ohne Geld nach Hause zu gehen.«
Das klang schon näher an der Wahrheit. Ich wusste, dass es so gut wie immer irgendeinen Mistkerl gab, der den Mädchen das Geld abnahm. Dieser »Freund« war in der Regel auch schnell mit den Fäusten dabei, wenn »sein« Mädchen am Ende der Nacht ohne Geld nach Hause kam. Ich fragte mich, ob Daisy auch so einen widerwärtigen Beschützer hatte oder ob es ihr gelungen war, ohne fremde Hilfe zu überleben.
»Sprechen Sie weiter«, forderte ich sie auf.
»Na ja, sie hörte Schritte und dachte, hey, vielleicht ist es ein Kunde! Also vertrat sie ihm den Weg. Dann teilte sich der Nebel, wie er das manchmal so tut, und der Kerl stand direkt vor ihr. Sie hat mir alles genau erzählt, das Leichentuch, einfach alles. Ganz weiß war es, und es hüllt ihn von oben bis unten ein. Auch das Gesicht, nur die Augen nicht. Aber er hat überhaupt keine Augen. Nur große schwarze Augenhöhlen, wo normalerweise Augen sein müssten. So, jetzt wissen Sie’s!«, schloss sie triumphierend.
Ich glaubte nicht an verhüllte Phantome, bei keinem Wetter. Doch hier war ein Rätsel zu lösen, und ich wollte ihm auf den Grund gehen, vorzugsweise in einer mehr komfortablen Umgebung. Ich begann zu frösteln auf der eisigen Brücke, und meine Begleiterin in ihrem dünnen Kleidchen musste halb erfroren sein.
»Gehen wir zurück über die Brücke und suchen uns ein Kaffeehaus«, schlug ich daher vor. »Sie können etwas Heißes zu trinken vertragen und mir bei einem Kaffee alles über dieses Phantom erzählen.«
Sie wand sich in meinem Griff. Sie hatte ihre Meinung geändert, was das Mitkommen anging, das war nicht zu übersehen. Vielleicht glaubte sie, ihren Verfolger abgeschüttelt zu haben. Oder dass meine Anwesenheit ihn vertrieben hätte.
»Ich gehe nirgendwohin mit einem Polizisten!«, keifte sie böse. »Nicht einmal mit einem Inspector. Sie wollen mich gar nicht in ein Kaffeehaus bringen. Ich lande ja doch nur auf dem Revier, und morgen früh stehe ich dann vor dem Friedensrichter!«
»Ich verhafte Sie doch gar nicht, Daisy«, versuchte ich sie zu beschwichtigen. »Ich will Ihnen helfen. Hören Sie mich an. Hat dieses sogenannte Flussphantom Sie schon einmal angegriffen? Und wann ist es zum ersten Mal aufgetaucht?«
»Vor vielleicht sechs Monaten«, antwortete sie vage, um dann munterer hinzuzufügen: »Sie können die anderen Mädchen fragen. Mehr als eine hatte Glück, ihm zu entwischen. Ich erfinde das nicht alles. Fragen Sie nur, fragen Sie irgendeines der Mädchen, die in der Nähe vom Fluss arbeiten, egal auf welcher Seite.«
»Und diese anderen Mädchen wurden tatsächlich angegriffen? Und das seit sechs Monaten?«
»Allerdings, das wurden sie! Wenngleich nur in Nächten wie heute, wenn sich der Nebel herabsenkt und man kaum die Hand vor Augen sehen kann. Es macht ihm nicht das Geringste aus. Es kann sehen, als wäre klarer, helllichter Tag! Es ist kein normaler Mensch wie Sie und ich. Ich stehe hier vor Ihnen, und trotzdem wissen Sie nicht, wie ich aussehe, und ich weiß nicht, wie Sie aussehen. Ich kann nicht klar sehen in diesem Nebel, und Sie können es auch nicht. Aber das Phantom aus der Themse kann es!«
Bei diesen letzten Worten wand sie sich unvermittelt wie ein Aal, und ihr Arm löste sich aus meinem Griff. Bevor ich nachfassen konnte, war sie auf und davon und im Nebel verschwunden. Ich hörte, wie sich ihre Schritte in höchster Eile entfernten.
»Flussphantom!«, murmelte ich wütend. »Pah! Das Mädchen ist nicht ganz richtig im Kopf.«
Trotzdem. Irgendjemand oder irgendetwas hatte sie angegriffen. Und dieser Irgendjemand oder dieses Irgendetwas hatte sie in kopflose, panische Flucht geschlagen.
Ich setzte meinen Weg über die Brücke fort. Inzwischen konnte ich deutlich die mächtigen Lokomotiven riechen, und ich hörte ihr dumpfes Rattern und das metallische Klirren ihrer Räder auf den Gleisen und Weichen, die in den Bahnhof von Waterloo hinein- und hinausführten. Die Lokführer ließen sich viel Zeit; die Züge wurden erst schneller, wenn sie den Bereich von Central London hinter sich gelassen hatten und der Nebel wieder aufklarte. Wie dem auch sein mochte, ich war beinahe zu Hause. Ich hatte das andere Ufer noch nicht ganz erreicht, als sich erneut Schritte näherten. Diesmal klangen sie gemessen und schwer. Männerstiefel. Der Mann marschierte munteren Schrittes voran. Ich hörte keinen Gehstock. Vielleicht machte der andere es wie ich und tastete sich an der Balustrade entlang.
Seine Silhouette tauchte vor mir auf: Männlich, eher klein, mit einem langen dunklen Mantel und einer Art Tasche in der Hand. Vermutlich ein Reisender, der soeben mit dem Zug eingetroffen war.
»Was für ein Abend, Sir!«, rief ich ihm freundlich zu.
Ein Grunzen war die einzige Antwort. Er beschleunigte seine Schritte und eilte an mir vorbei. Ich konnte sehen, dass er sich wegen des allgegenwärtigen Gestanks das Taschentuch vors Gesicht hielt und offensichtlich nicht geneigt war, es zu entfernen, um meinen Gruß zu erwidern.
Oder vielleicht wollte es mir auch beim allerbesten Willen einfach nicht gelingen, nicht wie ein Polizeibeamter zu klingen.
Andererseits bewegte ich mich in die Richtung, aus der er gekommen war, und mit jedem Schritt von ihm und mir vergrößerte sich der Abstand zwischen uns wieder, und vielleicht beruhigte ihn das aus irgendeinem Grund.
Wie dem auch sein mochte, je näher ich meinem Zuhause kam, desto beschwingter wurden meine Schritte, und bald darauf hatte ich die beiden Begegnungen auf der Brücke fast vergessen. Bis zu dem Augenblick, als es – soll man es glauben – erneut geschah!
Eine zweite Gestalt rannte in mich hinein, und eine vertraute weibliche Stimme stieß einen überraschten, erschrockenen Laut aus. »Oh. Es tut mir leid, bitte verzeihen Sie! Ich habe Sie nicht gesehen!«, ächzte sie.
Mit diesen Worten wich sie zur Seite aus und wollte an mir vorbei. Ich streckte die Hand aus und erwischte sie beim Arm.
»Lizzie? Bist du das?«
»Ben!«, rief meine Ehefrau erleichtert. »Oh Ben! Du bist es! Was für ein schrecklicher Abend!«
KAPITEL ZWEI
Elizabeth Martin Ross
Was zum Teufel ich bei diesem Wetter in der Dunkelheit hier draußen zu suchen habe, lautete Bens erste Frage, nachdem er herausgefunden hatte, wer sein Fang im Nebel war.
Ich informierte ihn, dass ich Bessie suchte.
»Was macht Bessie hier draußen in dieser Waschküche?«, wollte er wissen.
»Das erkläre ich dir später«, sagte ich zu ihm. »Es hat mit Äpfeln zu tun.«
Ich hörte Ben aufgebracht schnaufen. Er atmete Nebel ein, und das Schnaufen wich einem Husten.
»Lass uns nach Hause gehen«, sagte er. »Bei diesem Wetter findest du sie sowieso nicht, und wahrscheinlich ist sie längst selbst daheim.«
Bens Aufforderung kam mir nicht ungelegen, und so stolperten wir gemeinsam nach Hause, indem wir uns an den Händen hielten wie zwei Blinde.
Nach unserer Hochzeit hatten wir unsere wenigen Ersparnisse zusammengelegt und uns ein kleines Backstein-Reihenhaus nicht weit von der Waterloo Station gekauft. Wir waren dazu in der Lage gewesen, weil die vorherige Eigentümerin die Witwe meines Patenonkels war, meine »Tante« Parry. Es war erst zwanzig Jahre alt und hatte zu den besseren der vielen Häuser in ihrem Besitz gehört. (Andere Häuser waren heruntergekommene Mietskasernen und Elendsquartiere, in denen niemand freiwillig gewohnt hätte – die Mieten reichten jedoch, um Tante Parry ein bequemes Leben zu ermöglichen.) Nichtsdestotrotz hatte sie uns unser neues Heim zu einem sehr entgegenkommenden Kaufpreis überlassen.
Nachdem wir jedoch all unsere Ersparnisse für das Haus ausgegeben hatten, waren wir nicht mehr in der Lage gewesen, es vollständig auszustaffieren und uns besseres Dienstpersonal zu leisten. (Obwohl Ben ein äußerst respektables Gehalt verdiente und Aussichten auf eine Beförderung hatte.) Wie dem auch sei, das Haus war sowieso nicht groß genug, um Personal unterzubringen. Doch wenn mir die schlimmste Hausarbeit erspart bleiben sollte, brauchte ich Hilfe. Am Dorset Square, wo ich bei Tante Parry als Gesellschafterin angestellt gewesen war, hatte Bessie als Küchenmagd gearbeitet – die niedrigste Stellung von allen Dienstboten. Sie war mehr als willens, sich dem scharfen Blick von Mrs. Simms, der Köchin, zu entziehen und als Mädchen für alles zu uns zu kommen. Und so waren wir alle drei in unser neues Haus gezogen.
Als ich noch Tante Parrys Gesellschafterin gewesen war, hatte ich Mrs. Simms stets für ungebührlich streng mit der armen Bessie gehalten. Doch ich hatte andererseits bislang nie die Verantwortung für ein fünfzehnjähriges Mädchen gehabt, und nach sehr kurzer Zeit begann ich Mitgefühl mit Mrs. Simms zu entwickeln.
Bessie arbeitete hart; sie war fleißig und loyal, und ich wusste, dass sie intelligent und schlagfertig war. Doch sie besaß auch einen unabhängigen Verstand und scheute sich sicherlich nicht, ihre Meinung kundzutun. Außerdem erwies sie sich als unerwartet verschlagen. Das Problem hatte sich noch verschärft, als Bessie nicht lange nach unserem Einzug die Tugend der Mäßigung entdeckte.
Das erste Mal bemerkte ich dies, als Bessie, nachdem wir gerade einen Monat in unserem Haus wohnten, kleinlaut um Erlaubnis fragte, ob sie zu einer regelmäßigen Betstunde jeden Sonntag um fünf Uhr nachmittags gehen dürfe.
Ich hatte nicht erwartet, dass Bessie Eifer für die Religion entwickeln würde, doch ihre Bitte erschien mir als geziemend, ja sogar löblich. Nichtsdestotrotz stellte ich ihr die ein oder andere Frage. »Und halten Sie bloß Ausschau nach Verehrern, Mrs. Ross!«, hatte eine düster geflüsterte Empfehlung von Mrs. Simms gelautet, als sie Bessie in meine Obhut übergeben hatte.
Nun war Bessie, wie ich gestehen muss, nicht das hübscheste Mädchen. Sie war drahtig bis mager, und angesichts der Tatsache, dass das arme Kind seit seinem zwölften Lebensjahr Töpfe gescheuert und Böden geschrubbt hatte, waren ihre Hände rot und rau wie die einer Vierzigjährigen. Dazu ihr krauses, mausfarbenes Haar und die schiefen Zähne – nein, »Verehrer« war gewiss nicht das Wort, das mir als Erstes in den Sinn kam, als sie mich um Freizeit für den Besuch der Betstunde bat. Ich erkundigte mich dennoch, was für eine Art von Betstunde es denn sei, wo sie gehalten werde und wer sie leite.
Ich erfuhr, dass ein gewisser Reverend Fawcett in einem Saal ganz in der Nähe die Stunde abhielt und dass es sich um einen Ableger der Abstinenzlerbewegung handelte. Ich beriet mich mit Ben.
»Ich habe genügend Gewalt und Kriminalität erlebt, die ihren Ursprung in Trunkenheit hatten«, lautete seine Antwort. »Wenn Bessie dem Alkohol abschwören möchte, dann habe ich nichts dagegen.«
Ich hätte es ebenfalls akzeptabel gefunden, hätte Bessie nicht einen geradezu fanatischen Eifer entwickelt, die Botschaft des Reverends zu verbreiten. Um es kurz zu machen: Ben und ich sollten nach Bessies Dafürhalten ebenfalls dem Dämon Alkohol abschwören. Nicht, dass wir viel getrunken hätten. Ben nahm gelegentlich ein Glas Porter zum Essen. Während seiner Zeit in London hatte er dieses starke, dunkle Bier schätzen gelernt, das sich bei den Tagelöhnern der Londoner Fisch- und Fleischmärkte großer Beliebtheit erfreute. Eine Flasche Porter auf dem Tisch ist jedoch unansehnlich, und so entfernte ich sie bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen wir Gäste hatten, und ersetzte sie gegen eine Flasche preiswerten Weißweins. Wir hatten keinen Weinkeller, wie man schon daran sehen kann. Doch ob es nun Porter war oder Weißwein, Bessie schwebte hinter uns wie ein griechischer Chorus. Sie rang vielleicht nicht die Hände, doch sie hatte die Kunst des sorgenvollen Kopfschüttelns und des tadelnden Blickes bis zur Meisterschaft entwickelt.
»Ignorier sie einfach«, empfahl mir Ben, der Bessies Pantomime amüsiert verfolgte. »Du wirst sehen, sie gibt bald wieder auf.«
Bessie kam also durch mit ihrem Benehmen. Als Nächstes wurden wir zum Ziel einer mehr offen zum Ausdruck gebrachten Kritik.
Ich fand sie in der Küche, wo sie vor dem Abwasch stand und auf zwei Weingläser starrte, während sie trübselig den Kopf schüttelte.
»Ich kann das nicht tun, Missus«, sagte sie, sobald ich mich ihr näherte. Ich wünschte mir, sie würde nicht dauernd »Missus« zu mir sagen, und ich hatte ihr zahlreiche Alternativen vorgeschlagen, doch Bessie hatte mit dem ihr eigenen Kopf beschlossen, dass »Missus« mein mir zustehender Titel war. Ben wurde stets als »der Herr Inspector« bezeichnet und auch als solcher angesprochen.
»Du kannst nicht abwaschen, Bessie?«, fragte ich erstaunt. »Aber warum denn nicht?«
»Ich kann die Teller und Töpfe abwaschen«, antwortete Bessie, »aber nicht diese Gläser, weil darin starker Alkohol war. Wenn ich sie abwasche, helfe ich Ihnen und dem Herrn Inspector bei einem Tun, von dem ich weiß, dass es falsch ist.«
Am liebsten hätte ich sie angebrüllt. »Unsinn! Sieh zu, dass du weitermachst!« Doch ausnahmsweise einmal gelang es mir, nicht das Erstbeste zu sagen, das mir in den Sinn kam. Ich hatte eine bessere Idee, wie ich mit diesem Problem fertig werden konnte.
»Oh. Ich verstehe, Bessie«, sagte ich. »Nun ja. Ich denke, es ist vielleicht besser, wenn du die Gläser an der Seite stehen lässt und ich sie selbst abwasche. Die Gläser sind ein Hochzeitsgeschenk von meiner Tante Parry, und ich möchte nicht, dass sie zerbrechen.«
Bessie sah mich mit einem Gesicht an, dass ich beinahe laut aufgelacht hätte. Sie öffnete den Mund zu einer Antwort, doch zu meiner und ihrer eigenen Überraschung kam ausnahmsweise einmal kein Laut hervor. Ich nahm die beleidigenden Gläser und stellte sie zur Seite. Bessie wusch das restliche Geschirr mit großem Geklirre und Töpfeklappern ab und verfiel ansonsten in aufrührerisches Schweigen. Noch einige Zeit später fragte sie mich bei jeder Gelegenheit, ob ich sicher wäre, dass sie diesen oder jenen Teller abwaschen sollte, immerhin könnte er dabei kaputtgehen.
Sie sah mich dabei aus unschuldigen Augen an, doch ich hatte die Runde gewonnen, und wir wussten es beide.
An jenem Tag, als der dichte Nebel herrschte, wollte ich Schweinekoteletts zum Abendessen zubereiten und stellte fest, dass wir keine Äpfel im Haus hatten, die für die zugehörige Soße erforderlich waren.
»Wir hatten noch zwei Äpfel in der Schale, Bessie«, sagte ich zu ihr. »Was ist daraus geworden?«
»Der Herr Inspector hat sie eingesteckt, Missus, als er heute Morgen aus dem Haus gegangen ist.«
»Aber es waren saure Äpfel, nur zum Kochen geeignet.«
»Das habe ich ihm auch gesagt«, antwortete sie ernst. »Er hat sie trotzdem mitgenommen. Er wird sicherlich ein grauenhaftes Rumpeln im Darm haben. Soll ich vielleicht zum Gemüsehändler laufen und neue kaufen?«
»Im Magen, Bessie, nicht im Darm«, verbesserte ich sie automatisch und zögerte. Der Nebel, der den ganzen Nachmittag über dichter geworden war, hatte sich in eine richtige Waschküche verwandelt.
»Es ist nicht weit«, sagte Bessie. »Ich kenne den Weg. Ich bleibe dicht an den Hauswänden.«
Gegen mein besseres Wissen erklärte ich mich einverstanden. Bei normalem Wetter hätte sie höchstenfalls fünfzehn Minuten benötigt. Der Laden war mehr oder weniger um die Ecke. Selbst unter Berücksichtigung des Nebels hätte sie innerhalb einer halben Stunde zurück sein müssen. Doch als nach einer Dreiviertelstunde immer noch keine Spur von ihr zu sehen war, warf ich mir einen Schal über die Schultern und ging nach draußen, um sie zu suchen. Statt ihrer fand ich Ben.
Wir eilten zurück in unser Haus, so schnell wir konnten. Sobald wir durch die Eingangstür waren, lauschte ich auf Geräusche aus der Küche, von Bessie, doch es herrschte völlige Stille. Ich ging nachsehen. Die Küche war leer. Ich kehrte zu Ben zurück.
»Ich gehe raus und suche nach ihr«, sagte er.
Er wandte sich zum Gehen, doch ich hielt ihn fest.
»Du hast keine Chance, sie in diesem Nebel zu finden, Ben. Außerdem bist du selbst gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen. Setz dich ans Feuer und wärm dich ein wenig auf, und wenn sie in zwanzig Minuten immer noch nicht wieder da ist … tja, dann weiß ich auch nicht, was wir tun können.«
Ben sah mich unglücklich an. »Warum muss sie auch ausgerechnet heute Nacht rausgehen!«
»Wieso? Was ist so besonders an heute Nacht?«
Ben zögerte zunächst, doch dann erzählte er mir von seiner Begegnung mit dem Freudenmädchen auf der Brücke. »Das muss zwar noch nicht heißen, dass Bessie etwas zugestoßen ist, aber es gefällt mir nicht, dass sie so lange wegbleibt.«
»Es klingt jedenfalls beängstigend«, sagte ich sorgenvoll. »Aber stimmt es auch? Glaubst du dieser Person? Die Geschichte von diesem Flussphantom im Leichentuch, meine ich.«
Ben dachte kurz nach, bevor er antwortete. »Ich weiß, es klingt verschroben, aber sie schwört, dass die anderen Mädchen, die in der Gegend arbeiten, auch von ihm wissen. Eines der Mädchen hat sogar sein Gesicht gesehen, sagt sie.« Er stöhnte frustriert auf. »Ich wünschte, ich könnte dieses Mädchen finden und eine Beschreibung von diesem Flussphantom bekommen. Jedes Detail würde helfen. Aber zuerst muss ich diese Daisy Smith finden, falls das ihr richtiger Name ist, und sie nach dem Namen des Mädchens befragen, das das Gesicht dieses Flussphantoms gesehen hat. Ich weiß nichts über Daisy Smith, außer, dass sie ein Freudenmädchen ist und einen eigenartigen Hut mit Federn trägt.«
Im Licht der Gasbeleuchtung bemerkte ich etwas auf dem Revers von Bens Übermantel. Ich streckte die Hand aus und pflückte es behutsam herunter. Es war ein einzelnes Haar, so intensiv rot, dass es beinahe purpurn schimmerte.
»Eines wissen wir schon«, sagte ich. »Sie hat hellrotes Haar.«
Ben stieß einen überraschten Laut aus und nahm das Haar in die Hand. Er eilte in den Salon und an den Sekretär, wo wir Schreibutensilien aufbewahrten. Er zog ein frisches Blatt Papier hervor, legte das Haar hinein und faltete das Papier sorgfältig zu einem kleinen Brief zusammen. Auf die Außenseite schrieb er sodann den Namen Daisy Smith sowie das Datum.
»Beweise sichern, Inspector Ross?«, fragte ich ihn lächelnd.
»Bis jetzt haben wir noch kein Verbrechen«, antwortete er. »Aber es könnte durchaus sein, dass am Ende eines geschieht.«
In diesem Augenblick erklang ein leises Klicken im hinteren Teil des Hauses, und wir wussten sofort, dass jemand versuchte, das Haus unbemerkt durch die Hintertür zu betreten.
Wir stürzten beide in die Küche, wo wir Bessie vorfanden, noch mit Haube und Schal. Sie hielt einen Korb mit Äpfeln in den Händen.
Wir wollten von ihr wissen, wo sie so lange geblieben war.
»Es ist der Nebel, Missus«, sagte sie ausweichend. »Ich habe länger gebraucht, als ich selbst für möglich gehalten hätte.«
»Du warst über eine Stunde weg, Bessie!« Ich streckte die Hand nach dem Korb mit Äpfeln aus. Sie gab ihn nur widerwillig her, und ich erkannte sogleich den Grund dafür. »Was ist denn das?«
Unter den Äpfeln zog ich einen Stapel zweitklassig gedruckter Flugblätter hervor. »›Hüte dich vor den Gefahren starker Getränke!‹«, las ich laut. »Was um alles in der Welt ist das, Bessie? Woher hast du diese Flugblätter?«
Bessie sah elend aus. Doch sie war ein aufrichtiges Mädchen. »Ich war ganz schnell beim Gemüsehändler, Missus, und ich dachte, ich hätte Zeit, noch ein wenig weiter zu laufen und die Flugblätter abzuholen. Mr. Fawcett hat uns letzte Woche darum gebeten, die Flugblätter zu verteilen, wenn sie aus der Druckerpresse kommen. Heute Abend war ein Treffen im Saal, und anstatt bis morgen zu warten dachte ich, ich könnte sie gleich abholen und schon einige verteilen, bevor ich morgen zur Sonntagsbetstunde gehe.«
»Flugblätter verteilen!«, rief ich aus. »Erwartet Mr. Fawcett vielleicht, dass du dich an eine Straßenecke stellst und diese Dinger austeilst?« Ich hielt ihr die Blätter vor die Nase und schüttelte sie.
»Oh, nein«, antwortete Bessie ernsthaft. »Nur an Leute, die wir kennen. Um sie über Temperenz zu informieren.«
»Ich weiß nicht, was es mit dieser ›Temperenz‹ auf sich hat«, sagte Ben, »aber falls wir noch etwas Porter in der Speisekammer haben, dann würde ich gerne ein Glas zum Abendessen trinken.«
»Ach du gütiger Himmel, das Abendessen!«, rief ich erschrocken. »Bessie, wir müssen uns sputen, hörst du? Jetzt ist keine Zeit mehr, um darüber zu reden. Wir werden uns später unterhalten.«
»Jawohl, Missus«, antwortete Bessie bekümmert.
»Was willst du unternehmen?«, erkundigte sich Ben später über den Schweinekoteletts.
Im Kamin prasselte ein munteres Feuer, und sein Lichtschein spiegelte sich auf dem gusseisernen Grill und den Gitterstäben. Es war ein Anblick, der jeden entspannen konnte.
»Es ist zum Teil meine Schuld«, sagte ich. »Ich hätte mehr über diese Gebetsstunden herausfinden müssen, bevor ich Bessie erlaubt habe, regelmäßig dorthin zu gehen. Ich dachte, sie singen nur Kirchenlieder und hören sich die Temperenzpredigten dieses Mr. Fawcett an. Ich denke … ich denke, ich werde morgen mit Bessie zu dieser Gebetsstunde gehen und ein Wort mit dem Prediger reden. Ich werde ihm sagen, dass das Verteilen von Flugblättern überhaupt nicht infrage kommt, soweit es unsere Bessie betrifft.«
»Wie du meinst«, sagte Ben, indem er sich den Rest Bier aus seiner Flasche Porter einschenkte.
»Ben …?«, fragte ich. »Magst du wirklich saure Kochäpfel?«
»Aber sicher«, antwortete mein Ehemann. »Ich mochte sie schon immer, schon als Kind.«
Ben machte ein Nickerchen vor dem Kaminfeuer, als Bessie und ich am späten Nachmittag des nächsten Tages das Haus verließen. Der Nebel vom Vortag hatte sich völlig aufgelöst, obwohl aus jedem Schornstein dichter grauer Rauch stieg und über den Häusern und Straßen hing. Die Straßen waren leerer als unter der Woche und lagen in sonntäglicher Stille. Die meisten Menschen, denen wir begegneten, waren in ihren Sonntagsstaat gehüllt, auch wenn es wie immer die ein oder andere Bande von Gassenjungen in Lumpen gab. Sie rannten neben den sonntäglichen Spaziergängern her und bettelten im Vertrauen darauf, dass es der Tag der Kirche war und christliche Mildtätigkeit dazu führte, dass die Angebettelten eine Münze herausrückten.
Der Saal, in dem die Gebetsstunde stattfand, stand eingekeilt zwischen zwei größeren Gebäuden, und er sah aus, als hätte er seine Existenz als eine Art Waren- oder Lagerhaus begonnen. Das Mauerwerk war mit der gewohnten Schicht aus Dreck und Ruß überzogen, doch die hohen schmalen Fenster waren sauber, und auf einer Ankündigungstafel draußen war ein Blatt befestigt, auf dem die heutige Gebetsstunde annonciert wurde, »mit einem Vorwort von Reverend Joshua Fawcett. Im Anschluss Tee und Gebäck.«
»Manchmal helfe ich beim Tee oder beim Gebäck aus«, sagte Bessie stolz, als sie mich über die Schwelle führte. »Und manchmal passe ich auf die Kleinen auf.«
Der Saal im Innern wurde von einem qualmenden Ofen unzureichend geheizt. Er war spärlich möbliert mit Reihen von Holzstühlen, und unsere Stiefel klapperten auf den nackten Dielen. Am anderen Ende war ein Podium errichtet worden, und in seiner Mitte stand ein Rednerpult. Rechts davon und nahe dem fadenscheinigen Vorhang gab es ein verkratztes Klavier, das dringend einer Politur bedurfte. Unterhalb des Podiums und zur Linken stand ein langer Tisch mit einem großen Samowar, der leise zischend vor sich hin köchelte, beaufsichtigt von zwei Frauen, eine klein und dick, die andere groß und dünn.
»Die kleine Dicke ist Mrs. Gribble«, flüsterte Bessie mehr oder weniger unhöflich. »Die lange Dürre ist Mrs. Scott. Mrs. Scott ist Witwe. Ihr Mann war ein Soldat, aber er ist nicht in irgendeiner Schlacht gefallen. Er ging nach Indien und starb dort am Fieber.« Sie runzelte die Stirn. »Sieht so aus, als wäre Miss Marchwood heute gar nicht da. Ich frage mich, wo sie abgeblieben ist. Sie ist eigentlich immer da und verteilt den Tee. Ich hätte sie Ihnen gerne vorgestellt, Missus. Sie ist das Gleiche wie Sie früher, wissen Sie?«
»Wie ich früher?«, fragte ich verwirrt.
»Bevor Sie und der Herr Inspector geheiratet haben, meine ich. Sie ist Gesellschafterin einer Lady«, erklärte Bessie.
»Tatsächlich?«, murmelte ich, während ich Mrs. Scott musterte. Sie war nüchtern gekleidet, doch ihr Mantel aus feinem grünem Zwirn war mit Pelz besetzt. Unter dem Mantel trug sie ein Kleid mit einem Schottenkaro, wie es Ihre Majestät so populär gemacht hatte. Der Reifrock darunter war modern und hinten voller als an den Seiten, wie mir auffiel. Auf einem Chignon dunklen Haares saß ein runder Astrachan in russischem Stil. Ich vermutete, dass der Chignon nicht echt war, und schätzte seine Trägerin auf knapp über vierzig Jahre. Ich fragte mich, was eine offensichtlich gut betuchte Frauensperson mit so modischem Geschmack hier zu suchen hatte, am Teesamowar bei einem Treffen der Temperenzbewegung.
Mrs. Gribble sah im Gegensatz zu Mrs. Scott geradezu farbenfroh aus. Sie trug ein braunes Kleid mit Rüschenstreifen über einem vollkommen runden Reifrock, dazu ein grünes Mieder, ein Umhängetuch mit Paisleymuster sowie eine mit Seidenblumen verzierte Haube. Während ich die beiden Frauen beobachtete, bemerkte Mrs. Scott eine Unregelmäßigkeit in der langen Reihe von Teetassen, die für die nach der Predigt in Aussicht gestellte Erfrischung bereitgestellt worden waren, und Mrs. Gribble hastete errötend und verlegen, den Fehler zu korrigieren, sodass die Tassen so gerade standen wie eine Kompanie Soldaten in Habtachtstellung.
Ich nahm auf einem Stuhl im hinteren Teil des Saals Platz, von wo aus ich alles übersehen konnte.
»Wollen Sie denn nicht weiter vorne sitzen, Missus?«, drängte mich Bessie aufgeregt.
Ich dankte ihr und antwortete, dass ich sehr gut saß, wo ich war.
Bessie sah mich enttäuscht an. Vermutlich hatte sie sich mit mir brüsten wollen.
Nach und nach füllte sich der Saal. Eine Gruppe minderjähriger Abstinenzler wurde von einem kleinen, stämmigen Mann mittleren Alters mit blassem Gesicht und hahnentrittgemustertem Anzug nach vorn kommandiert. Vermutlich litt er unter vorzeitigem Haarausfall, denn er hatte die langen Strähnen über den Kopf nach vorn gekämmt und den resultierenden Rand in einer Reihe sorgsam angeordneter Locken über der Stirn arrangiert. Seine Frisur glänzte förmlich von großzügig applizierter Pomade, die jedes einzelne Haar sauber an Ort und Stelle hielt.
»Ist das etwa Mr. Fawcett?«, wandte ich mich ein wenig schockiert an Bessie.
»O nein!«, antwortete sie beinahe abfällig. »Das ist nur Mr. Pritchard.«
In diesem Augenblick erschien ein düster wirkender Gentleman mit kräftigem Backenbart und verteilte abgegriffene, eselsohrige Gesangbücher. Bessie identifizierte ihn für mich als einen gewissen »Mr. Walters«. Wie es schien, bestand kein Mangel an freiwilligen Helfern.
Unterdessen war eine Atmosphäre gespannter Erwartung entstanden, und leise geflüsterte Unterhaltungen mischten sich mit dem Zischen der Gaslampen an den Wänden ringsum. Aufgeregtheit stand in alle Gesichter geschrieben. Es war nicht zu übersehen: Mr. Fawcett war ein Magnet.
Doch wir sollten ihn immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Der backenbärtige Mr. Walters erklomm das Podium und bat uns aufzustehen, um das erste Lied zu singen. Während wir seiner Bitte nachkamen, ging er zum Klavier und schlug einen einleitenden Akkord an, der mir verriet, dass das Instrument nicht nur dringend aufpoliert werden musste, sondern auch gestimmt. Nichtsdestotrotz fielen wir alle eifrig in die Melodie ein.
Nach dem Lied setzten wir uns wieder. Mr. Pritchard geleitete seine minderjährigen Schützlinge in die Mitte, sodass sie uns anderen im Saal zugewandt standen, und nahm ihnen unter fleißigem Armefuchteln das feierlich gesungene Versprechen ab, niemals Wein oder Bier, nicht einmal Cidre anzurühren.
Sie eilten zurück auf ihre Plätze, und Mr. Pritchard drehte sich zu uns um, um sich mit geröteten Wangen und Schweißperlen auf der Stirn triumphierend zu verbeugen und unseren Beifall entgegenzunehmen. Ich klatschte für die Bemühungen der Kinder, auch wenn ich derartige Darbietungen nicht gutheißen konnte.
Doch der Augenblick des Abends war gekommen. Mr. Walters stieg ein weiteres Mal auf das Podium und bat uns, Mr. Fawcett einen begeisterten Empfang zu bereiten, dem Sprecher dieses Abends.
Alles brach erneut in frenetischen Applaus aus, Bessie klatschte mit ganz besonderer Energie, und auf dem Podium erschien der Reverend Joshua Fawcett.
Ich hatte keine Vorstellung gehabt, was ich zu erwarten hatte. Ich hatte Bessie auch nicht zu sehr ausfragen wollen, um mir nicht unnötig ihre Lobhudeleien anhören zu müssen. Er erwies sich als sehr viel jünger, als ich erwartet hatte. Er konnte nicht weit über dreißig sein, und wenn er ein Mann der Kirche war, dann zumindest nicht der Kirche von England. Er war groß und schlank und elegant in einen perfekt sitzenden dunkelblauen Gehrock gekleidet mit taubengrauen Hosen darunter. Sein Hemd war schneeweiß, und die Seidenkrawatte mit der diamantenen Nadel war das einzige schwarze Kleidungsstück an ihm. Er war glatt rasiert und trug das Haar lang wie ein Poet, und insgesamt war sein Erscheinungsbild viel eher das eines Dandys als eines Geistlichen. Jetzt begriff ich auch, wieso der größte Teil der Zuhörerschaft weiblich war. Und tatsächlich, bei seinem Auftritt ging ein kollektiver Seufzer des Wohlgefallens durch das Publikum.
»Meine lieben Freunde«, begann Fawcett, indem er das Rednerpult rechts und links umklammerte und den strahlenden Blick über unsere Ränge schweifen ließ. »Meine lieben, lieben Freunde … Was für ein wunderbares Vergnügen es doch ist, Sie alle hier und heute versammelt zu sehen. Es lässt mir das Herz in der Brust aufgehen, zu sehen, dass so viele so begierig sind, unsere wahrhaft noble Sache zu unterstützen. Ich sehe es in Ihren Gesichtern, dass Sie sich unserer großen Aufgabe mit Leib und Seele verschrieben haben.«
Seine Stimme war wohlklingend, doch seine Augen waren scharf und aufmerksam. Er hatte mich als Außenstehende erkannt, obwohl ich ganz hinten saß, dessen war ich mir sicher.
Dann wechselte er ganz unvermittelt das Tempo und den Stil, und es ging los. Meine Güte, sagte ich später zu Ben, eines musste man diesem Mann lassen – er war ein atemberaubender Prediger. Seine Stimme hob und senkte sich, wurde lauter oder leiser, ganz wie es die Situation erforderte. Er führte uns durch die Geschichte von Jona und dem Weinberg. Er erinnerte uns daran, dass aller Wein und jeglicher Weingeist die Sinne betäuben und die Ursache zahlreicher körperlicher Beschwerden (einschließlich ausgefallener Zähne) und für vorzeitiges Altern sind. Dass sie zu Gewalt führen und zu folgenschweren Fehleinschätzungen. Am schlimmsten von allem war die Abhängigkeit von Alkohol, ein erster Schritt auf einem steilen Weg nach unten, zu allen möglichen Arten von Sünde, angefangen bei unschicklicher Sprache und lautem Verhalten in der Öffentlichkeit bis hin zu verbotenen Wünschen und Lastern im Geheimen, von Gier und Neid bis hin zu Kriminalität und Mord.
Er erklärte weiter, dass es nicht ein einziges der Zehn Gebote gab, zu dessen Übertretung wir nicht verführt werden konnten, wenn wir nur genügend getrunken hätten. Was die sieben Todsünden anging, so würden wir sie überhaupt nicht mehr als solche wahrnehmen.
»Lust!«, kreischte Fawcett mit dröhnender Stimme durch den Saal.
Die Damen im Publikum erschauerten. Jede einzelne hatte verzückt an seinen Lippen gehangen. Nicht eine wand sich, kein Stuhl scharrte, niemand hustete. Ich befürchtete insgeheim, die jugendlichen Abstinenzler in den vorderen Reihen könnten unruhig werden, doch sie schienen genauso fasziniert von seiner Predigt zu sein wie jedermann sonst. Bessie saß mit leuchtenden Augen neben mir. Ich spürte, wie ich allmählich nervös wurde.
»Geht hinaus auf die Straßen!«, rief Fawcett und deutete mit ausgestreckter Hand zur Tür und auf die Welt außerhalb des Saals. Das lange Haar flog geschmeidig um seinen Kopf. Für einen kurzen Augenblick fühlte ich mich an ein Bleiglasbild des Erzengels Michael erinnert, der im Begriff stand, den Drachen des Bösen aufzuspießen. »Ihr werdet Höhlen voller Laster finden, aller nur erdenklichen Laster, meine Freunde! Ihr werdet heruntergekommene Menschen sehen, ohne Arbeit, ohne jede Selbstachtung, die in den Straßen betteln! Ihr werdet Frauen sehen, die sich in aller Öffentlichkeit verkaufen! Verschwenderische junge Männer aus guten Familien, die ihre Vermögen wegwerfen! Hungernde Mütter, die ihre elenden Säuglinge in den Armen halten und an den Türen von Pubs nach ihren Männern rufen, damit sie herauskommen, bevor sie den letzten Penny ausgegeben haben! Und was ist die Ursache für all dieses Elend? Alkohol!«, donnerte er.
Die Worte fielen in tiefstes Schweigen hinein. Wir warteten atemlos. Nach einer Pause fuhr Fawcett mit ruhigerer Stimme, jedoch genauso eindringlich fort. Er versank in Pathos und steigerte sich in höchste Indignation, während er die dramatische Geschichte eines Trunkenbolds wiedergab, der verantwortlich war für ein Pferd und einen Karren. Betrunken und orientierungslos überfuhr er eine junge Frau, die ihren alten, gebrechlichen Vater über die Straße geleitete.
Fawcett verschränkte die Hände wie zum Gebet. »Stellen Sie sich diesen Anblick vor, meine lieben Freunde, wenn Sie können. ›Meine Tochter, meine geliebte Tochter!‹, weinte der arme alte Mann und kniete an ihrer Seite nieder. ›Sprich mit mir!‹ Doch seine Tochter lag leblos darnieder und konnte nicht mehr sprechen, während der betrunkene Fahrer des Karrens hilflos danebenstand, von Entsetzen geschüttelt angesichts seiner Tat. Doch es war zu spät!«
Mehrere der anwesenden Ladys hatten inzwischen angefangen, schicklich in ihre spitzenbesetzten Taschentüchlein zu weinen.
Meine Reaktion war, wie ich gestehen muss, eine ganz andere. Selbstverständlich war es eine schreckliche Geschichte und ich weiß, dass derartige Tragödien geschehen. Mein Vater war Arzt gewesen und wurde gelegentlich aus der Praxis zu gerufen, um bei Unfällen auf den Straßen oder in den Fabriken und Gruben Hilfe zu leisten. Trunkenheit war häufig die Ursache dieser Unfälle gewesen. Ich habe mit eigenen Augen todunglückliche Frauen und halbnackte Kinder gesehen, die vor den Türen von Kneipen und Bars gewartet haben in dem beinahe sicheren Wissen, dass es wahrscheinlich Schläge regnen würde, sobald sich der »Ernährer« der Familie zeigte. Doch ich gestehe schamvoll, dass ich ganz plötzlich, als Mr. Fawcetts klingende Rede endete und er sich eine Hand auf die schwitzende Stirn legte, um seine in Unordnung geratenen Locken zurechtzurücken, einen heftigen Drang zu kichern verspürte und hastig den Blick in den Schoß lenkte. Mein Vater hätte diese Reaktion wahrscheinlich als emotionale Antwort auf einen Sprecher erklärt, der nicht zögerte, die Empfindungen seiner Zuhörer zu manipulieren. Doch ich schämte mich, und es gelang mir, das Grinsen zu unterdrücken. Als ich den Blick wieder hob, starrte Mr. Fawcett geradewegs zu mir, und ich war sicher, dass er es bemerkt hatte. Zu meiner Demütigung spürte ich, wie mir die Röte ins Gesicht stieg.
»Diejenigen, denen das Leben besser mitgespielt hat …«, begann Fawcett seidig (ich schwöre, dass er mich immer noch ansah), »… diejenigen sollten nicht glauben, dass sie nicht in Gefahr schweben. Welcher Gentleman sieht schon etwas Schlimmes an einem Glas Portwein oder auch zweien nach einem guten Dinner? Und welche ganz und gar respektable Lady schlägt ein Glas Sherry aus?«
Er schüttelte sorgenvoll den Kopf, und die langen Haare fielen ihm ins Gesicht. Er schob die widerspenstigen Strähnen zurück. »Und bevor wir’s uns versehen, trinkt besagter Gentleman Abend für Abend eine ganze Karaffe Port und versinkt jede Nacht in einen Vollrausch. Und was seine Frau angeht, schon bald verliert sie ihre tugendhafte Weiblichkeit. Ihre Wangen sind gezeichnet von geplatzten Äderchen, ihre Kleidung ist nachlässig und das Haar irgendwie hochgesteckt. Ihre Dienerschaft erhält keine klaren Anweisungen mehr und beginnt alsbald, sich vor der Arbeit zu scheuen. Und schon ist der ganze ehedem so vornehme Haushalt verlottert.«
Sah Fawcett in meine Richtung? Hatte Bessie ihm von Bens unschuldigem Glas Porter und unserer gelegentlichen Flasche Wein erzählt? Meine ursprüngliche Nervosität wich allmählich Ärger.
Doch die Ansprache war vorbei. Fawcetts Ton wurde pragmatisch. Er erinnerte uns daran, dass die alkoholabhängigen Armen viel Arbeit erforderten, und bat uns, großzügig zu spenden, um die zahlreichen Projekte unter seiner Leitung zu unterstützen. Unser Geld wäre nicht verschwendet, und der Dank des Himmels wäre uns gewiss.
Dann wischte er sich mit einem frisch gestärkten weißen Taschentuch den Schweiß von der Stirn und verließ das Podium, vermutlich, um sich zu erholen. Mr. Pritchard lud uns mit hoher Stimme ein, nach vorn zu treten und ein Gelöbnis zu unterschreiben, niemals wieder einen Tropfen starken Alkohols anzurühren. Das Dokument lag auf dem Pult. Drei oder vier Leute gingen hin. Während sie ihre Namen niederschrieben, setzte sich Mr. Walters an das Klavier. Wir erhoben uns für ein abschließendes Lied, während Mr. Pritchard, stark transpirierend, mit einem Körbchen herumging und die Kollekte einsammelte. Als es bei mir ankam, war es schon fast voll. Bewegt von Mr. Fawcetts Eloquenz und seiner abschließenden Bitte waren die Besucher der Betstunde großzügig gewesen. Ich ließ einen maßvollen Shilling in das Körbchen fallen und klopfte Bessie auf die Hand, als ich bemerkte, dass sie ihrerseits zwei Pence hineingeben wollte. »Ich habe für uns beide gespendet!«
Mr. Pritchard musterte mich mit einem tadelnden Blick, doch ich erwiderte ihn ungerührt, und er tippelte weiter. Allerdings blieb mir genügend Zeit, um festzustellen, dass es nicht Pomade war, die seine letzten Haarsträhnen so unverrückbar fest auf seinem Haupt haften ließ – es war vielmehr Schmalz. Das schmelzende Fett lief ihm in einer dünnen Schicht über die Stirn und ließ sie glänzen, als wäre sie poliert.
Vor dem Tisch mit dem Samowar bildete sich eine Menschentraube. Unter der strengen Anleitung von Mrs. Scott erwachte Mrs. Gribble zu hektischer Aktivität.
»Bleiben Sie hier sitzen, Missus«, sagte Bessie. »Ich bringe Ihnen eine Tasse Tee und Gebäck.«
»Nein, nein«, entgegnete ich ernst. »Ich möchte die anderen kennenlernen.« Ich rauschte mit einer nervösen Bessie im Schlepptau nach vorn.
Als ich mich dem Tisch mit dem Samowar näherte, stellte ich fest, dass es eine weitere Dose gab, in die wir wohlgewogen ein paar zusätzliche Münzen für unseren Tee geben durften, obwohl auf dem Anschlag draußen vor der Tür kostenlose Erfrischungen angekündigt worden waren. Doch Bessie hatte mir bereits Tee in einem der dickwandigen Becher besorgt. Sie hatte außerdem die Aufmerksamkeit von Mrs. Scott erhascht und flüsterte leise mit ihr. Mrs. Scott blickte auf und näherte sich mir, während sie mich unverhohlen von oben bis unten musterte und meinen Stand und die wahrscheinliche Höhe des Einkommens meines Ehemannes taxierte.
»Ich höre, Sie sind Bessies Arbeitgeberin, Mrs. Ross«, begann sie. »Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen.« Sie neigte würdevoll den Kopf.
»Ich bin hergekommen, weil ich selbst sehen wollte, wohin Bessie am Sonntagnachmittag geht«, erwiderte ich knapp. »Ich bin verantwortlich für sie.«
Mrs. Scott antwortete mit einem dünnen Lächeln. »Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie Ihre Verantwortung so ernst nehmen, Mrs. Ross. Bessie ist ein gutes Mädchen und macht sich hier im Saal sehr nützlich. Haben Sie etwas von diesem Nachmittag mitgenommen?«
»Mitgenommen?«, fragte ich verwirrt.
»Haben Sie sich ein Bild davon machen können, wo Bessie hingeht?« Sie hatte einen Unterton, der nicht wirklich sarkastisch klang, nur ein wenig trocken.
»Ich denke schon«, antwortete ich. »Was Bessies Hilfe angeht, so mag das alles schön und gut sein, doch da wäre noch die Frage gewisser Flugblätter …«
Doch Mrs. Scott hörte mir nicht mehr länger zu. Sie starrte auf jemanden hinter mir, und ein leichter Rotton färbte ihre blassen Wangen. Ich spürte einen Luftzug im Nacken, und der Duft von Veilchen und Cachou stieg mir in die Nase. Ich wandte mich um.
»Meine liebe Madam«, sagte Mr. Fawcett. »Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie die Arbeitgeberin von Bessie sind?« Er streckte die Hand aus und legte sie Bessie kurz väterlich auf ihre beste Sonntagshaube.
Bessie strahlte, als wäre Weihnachten. Fawcett lächelte mich auf eine wohlwollende Weise an, die kaum zu seiner Jugend passen wollte … und er war jung. Meine erste Einschätzung war mehr oder weniger korrekt gewesen. Er war nicht älter als dreißig. Seine Haut war glatt und gesund, seine Augen groß und weit auseinanderstehend und seine Nase leicht gebogen. Er hatte sich die Zeit genommen, das lange schwarze Haar ordentlich nach hinten zu kämmen. Ich fühlte mich erneut an einen Erzengel in einem antiken Bleiglasfenster erinnert.
»Ja«, antwortete ich abrupt. Ich wusste nicht warum, doch mein Hirn war plötzlich irgendwie ganz leer. All die Dinge, die ich hatte sagen wollen, waren verschwunden. Ich versuchte mich zusammenzureißen. »Sie sind ein sehr talentierter Prediger, Mr. Fawcett.«
Er verneigte sich leicht. Ich konnte den Blick nicht von seinen Augen abwenden, die von einer ganz außergewöhnlichen Farbe waren, beinahe Aquamarin. »Es ist ein ergiebiges Thema, Mrs. Ross, und eines, dem wir alle größte Aufmerksamkeit widmen sollten.«