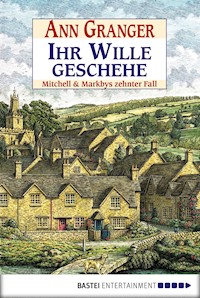9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jessica Campbell ermittelt
- Sprache: Deutsch
Idyllisch liegt das herrschaftliche Glebe House mitten am Fluss. Erst kürzlich ist der Schriftsteller Neil Stewart hier eingezogen. Die Idylle wird jedoch rasch getrübt, als die Leiche einer jungen Frau angeschwemmt wird. Neil kennt sie nur zu gut. Sie war die Bedienung in einer Gaststätte, in der der Autorenzirkel von Weston St. Ambrose das Ende eines Schreibkurses gefeiert hat, eines Kurses, den Neil gehalten hat. Nicht nur ein Mitglied des Zirkels scheint ein Motiv für den Mord zu haben. Verdächtige gibt es viele. Jessica Campbell beginnt zu ermitteln ...
Jessica Campbells vierter Fall
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Epilog
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
Ann Granger
MORDMIT SPITZERFEDER
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »Dead in the Water«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhardt Arth
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Titelillustration: © David Hopkin/Phosphorart
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1495-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieses Buch ist John gewidmet, meinem geliebten Mann, der auf so tragische Weise von uns gegangen ist, während ich letzte Hand an dieses Manuskript gelegt habe.
In all der Zeit, die wir miteinander verbracht haben,hat er mich bei meiner Arbeit stets unterstützt und ermutigtwie auch bei so vielem anderen. Ich habe noch immer das Gefühl,
Auf der einen Seite lag das Meer, auf der anderen ein Großes Wasser, und der Mond schien voll.
Alfred, Lord Tennyson
PROLOG
Das tote Mädchen trieb stumm auf den Wellen des angeschwollenen Flusses und schaukelte in der Strömung hin und her. Das Wasser packte ihr langes Haar, fächerte es auf der Oberfläche aus, verknotete es und löste es wieder, wie es ihm gerade gefiel. Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen, und der Mond lugte hinter den Wolken hervor, um die Leiche kurz mit silbernen Fingern zu berühren. Der Fluss machte hier eine Biegung, und die Strömung trieb die Tote ans Ufer, wo das Wasser aus seinem üblichen Korsett ausgebrochen war und ein mit Büschen und Bäumen bewachsenes Areal überschwemmt hatte. Zweige krallten nach der Kleidung, doch die Strömung wollte sich ihr Spielzeug nicht nehmen lassen. Es schien, als würde sie sich um die Leiche sorgen, und sie versuchte, sie wieder loszureißen. Der Mond verschwand, und Dunkelheit senkte sich über das Geschehen.
KAPITEL EINS
Mike Lacey, der Tierarzt, war kurz nach neun am Dienstagmorgen auf dem Weg zu Crocketts Farm. Immer wieder schaute er zum Fluss und beobachtete das Treibgut, das von der Flut vorbeigetragen wurde. Er hoffte, dass man ihn nicht gleich rufen würde, um im Wasser gefangenes Vieh zu retten. Doch was er entdeckte, war kein Tier. Mike trat auf die Bremse, griff nach dem Fernglas, das er immer im Auto liegen hatte, und sprang aus seinem verdreckten SUV. Ein Blick durch das Fernglas bestätigte, dass das Objekt, das zum größten Teil unter Wasser war, eine menschliche Gestalt besaß, und Mike glaubte, langes Haar zu erkennen. In den herabhängenden Weidenästen am Ufer, die als eine Art Filter für das Treibgut fungierten, hatte sich eine Leiche verfangen.
Mike starrte wie gelähmt auf den toten Körper und fluchte eine volle Minute lang vor sich hin. Dabei neigte er normalerweise gar nicht zu solchen Obszönitäten. Mike erkannte, dass er unter Schock stand, und so riss er sich rasch zusammen und analysierte die Situation. Der Wind blies über das Wasser, und hoch in der Luft kreisten Vögel und kämpften darum, auf Kurs zu bleiben. Unten schwappte das aufgewühlte Wasser gegen den Schlamm, und die Leiche hob und senkte sich mit ihm. Überall um Mike herum bewegte sich die Natur, doch er war wie erstarrt. Schließlich zwang er sich, die Situation als Problem zu betrachten, das es zu lösen galt, und nicht als menschliche Tragödie.
Um die Leiche zu befreien, brauchte er Hilfe. Nur kurz dachte Mike darüber nach, die Tote selbst herauszuziehen (das lange Haar legte nahe, dass es sich um eine Frau handelte). Doch sie war viel zu weit von ihm weg, und zu ihr zu waten war zu riskant, da er weder wusste, wie tief das Wasser war, noch ob der Untergrund ihn tragen würde. Mike schätzte, dass die Frau schon ein paar Stunden im Wasser lag. Er konnte sie unmöglich wiederbeleben. Hinter ihm, in seinem SUV, klingelte das Handy. Bei Crocketts warteten sie auf ihn, und vermutlich fragten sie sich, wo er blieb. Mike kehrte zu seinem Fahrzeug zurück, nahm den Anruf an (es war in der Tat die Farm) und rief dann die Polizei. Er erklärte die Situation, beschrieb so gut er konnte, wo er war, und versprach, sofort wieder zurückzukehren, sobald er seine Arbeit auf der Farm erledigt hatte.
Doch Murphys Gesetz wollte, dass bei seiner Rückkehr zwar die Polizei eingetroffen war – und das sowohl zu Lande als auch zu Wasser –, doch von der Leiche war keine Spur mehr zu sehen.
*
Jess Campbell hob schützend die Hand vor die Augen und wünschte sich, sie hätte eine Sonnenbrille mitgenommen. Das Funkeln der Sonne und die tanzenden Lichtfunken auf der Wasseroberfläche machten es äußerst schwierig zu sehen, was da vor sich ging. Jess kniff die Augen zusammen, und kurz kamen die dunklen Umrisse von Schultern und Kopf eines Menschen an die Oberfläche, doch nur um gleich darauf wieder unter den glitzernden Wellen zu verschwinden wie ein Flussgeist aus dem Märchen. Um Jess herum, im Schatten, wo die Sonne den Boden mit ihren feurigen Fingern noch nicht berührt hatte, war die Erde trotz des hellen Tages noch immer weiß von Frost.
»Kein Schnee weit und breit«, sagte eine Stimme hinter ihr. »Auf weiße Weihnachten werden wir wohl verzichten müssen. Schade. Die Kinder hatten so darauf gehofft.« Den Worten folgte ein Stapfen von Füßen auf der gefrorenen Erde. Detective Sergeant Nugent war kalt. Er wollte so schnell wie möglich in sein wohltemperiertes Büro zurück und sich gemütlich vor seinen Computer hocken.
»Ich kann Weihnachten nicht ausstehen«, knurrte eine andere Stimme. »Weihnachten kostet ein Vermögen, und das Einkaufen ist der Horror. Dabei ist alles nach vierundzwanzig Stunden schon wieder vorbei. Da kann man sich auch die Mühe sparen.«
»Wenn Sie was gegen Gedränge haben, können Sie ja online einkaufen«, erwiderte Nugent.
Um dem Gezänk ein Ende zu bereiten, warf Jess ein: »Also ich mag Weihnachten. Ich mag es, wenn in den Geschäften was los ist. Ich mag die Weihnachtsbeleuchtung auf der High Street, und ich mag den Schmuck an den Häusern. Das bringt wenigstens ein wenig Licht in eine dunkle, kalte Zeit.«
Es folgte ein kurzes Schweigen. Dann murmelte der andere Mann, eine moderne Ausgabe des Ebenezer Scrooge: »Unser Nachbar auf der anderen Straßenseite hat einen Weihnachtsmann, der seinen Kamin hinaufklettert. Der blinkt den ganzen Abend.«
Diese Worte weckten eine Erinnerung in Jess. Diese Sonnenflecken auf dem Wasser, die wie Lametta glitzerten, erinnerten sie an die Lichter am Weihnachtsbaum in ihrer Kindheit. Sowohl Jess als auch ihr Bruder hatten die funkelnden Diamanten zwischen den dunkelgrünen Tannennadeln geliebt. Dann, eines Heiligabends, während sie alle zugeschaut hatten, waren die Lichter mit einem hörbaren Zischen und Knistern verloschen und hatten nie wieder geleuchtet. »Mach die wieder ganz, Daddy!«, hatte Jess ihren Vater angebettelt, doch Dad hatte das Problem nicht beheben können. Die gesamte Lichterkette wurde abgenommen und entfernt, ›aus Sicherheitsgründen‹. Zwar waren die Christbaumkugeln hängen geblieben, und der Engel hatte weiter schief auf der Spitze gehockt, dennoch hatte der Baum nun nackt und leblos gewirkt. Weder Jess noch ihr Bruder hatten seinen Anblick ertragen. Es war, als hätte das Herz des Baumes aufgehört zu schlagen.
Aber wir reden hier nur um den heißen Brei, dachte Jess. Der Grund für diese sinnlose Diskussion war, dass niemand darüber sprechen wollte, was wirklich vor sich ging und was das bedeutete. Die drei Beamten standen einfach nur da und warteten. Wasser schwappte wenige Schritte entfernt auf die verschlammte Erde; dabei lag das eigentliche Ufer ein ganzes Stück von der Straße entfernt. Nur einem leichten Anstieg war es zu verdanken, dass nicht auch der Asphalt überschwemmt war. Jess wünschte, sie hätte Phil Morton mitbringen können, doch der hatte gerade erst geheiratet und war in den Flitterwochen zum Skifahren in die Hohe Tatra gefahren. Nugents Gezappel machte sie nervös.
Der Mann, der Weihnachten verabscheute, hörte auf den Namen Corcoran, und er war zusammen mit den Polizeitauchern angekommen. Jess kannte ihn nicht. Als die Taucher wieder an die Oberfläche kamen und signalisierten, dass sie nichts gefunden hatten, stapfte Corcoran ins Wasser. Seine großen Gummistiefel hinterließen tiefe Abdrücke im Schlamm, und Brackwasser schwappte über seine Füße. »Wie ist die Strömung?«, rief er.
»Der Typ ist wirklich ein richtiges Ekel, oder was meinen Sie, Ma’am?«, bemerkte Nugent nun, da Corcoran ihn nicht mehr hören konnte.
Jess seufzte zustimmend. Keiner von beiden war erfreut darüber, so kurz vor Weihnachten noch arbeiten zu müssen und das auch noch in einem so potenziell grausigen Fall. Und Corcorans mürrisches Auftreten machte das Ganze nur noch schlimmer.
Corcoran kam wieder zurück, und der Zweifel stand ihm ins teigige Gesicht geschrieben. »Im Wasser ist nichts. Auf dem Grund liegen nur zwei Einkaufswagen und ein paar leere Weinflaschen. Natürlich könnte die Strömung die Leiche inzwischen eine halbe Meile weitergetragen haben. Aber vielleicht hat der da sich das alles ja auch nur eingebildet.«
Corcoran nickte in Richtung von Mike Laceys SUV, der hinter ihnen am Straßenrand parkte. Hinter dem Steuer war die dunkle Silhouette des Fahrers zu erkennen, der gerade aus einer Dose trank. »Wir sollten den Kerl mal blasen lassen.«
»Wegen einer Dose 7UP? Wohl kaum«, entgegnete Jess. »Außerdem ist es noch früh am Morgen, und er stinkt nicht nach Alkohol. Und er ist ein angesehener Tierarzt aus der Gegend hier, der gerade auf dem Weg zu einem Notfall war, als er da drüben die Leiche mit dem Gesicht nach unten gesehen hat.« Sie deutete auf eine Stelle, wo die Äste der Bäume wie Finger ins Wasser ragten.
»Die schwimmen alle zuerst mit dem Gesicht nach unten«, erklärte Corcoran, der Experte, »bis sie schließlich sinken. Dann liegen sie bis zu zwei Wochen am Grund, bis sich genug Faulgase gebildet haben, um den Körper wieder an die Oberfläche zu tragen. Natürlich hängt das von Wassertiefe und Temperatur ab. Einige kommen nie wieder hoch.« Er schüttelte den Kopf. »Zeugen machen Fehler. Vielleicht hat das, was er gesehen hat, nur wie ein Mensch ausgesehen. Vielleicht war es nur ein großer Ast, der gestern abgebrochen und im Fluss gelandet ist. Oder ein Sack Müll, der sich im Geäst verfangen hat, oder ein Kleidungsstück, das irgendwie im Wasser gelandet ist … oder ein Tierkadaver. Aber was auch immer es war, die Strömung hat es mitgerissen, und wir müssen weiter flussabwärts suchen.«
»Der Mann ist Tierarzt!«, schnappte Jess. »Er hat in seinem Leben wahrscheinlich schon genügend tote Tiere gesehen, um einen Tierkadaver erkennen zu können.«
»Die Sonne scheint«, konterte Corcoran. »Da kann es schon mal zu optischen Täuschungen kommen.«
Corcoran war ein stämmiger Mann mit vom Wetter gegerbter Haut und zottigem Schnurrbart. Während er sprach, strich er sich mit der Hand über das Gestrüpp an seiner Oberlippe, und Jess erhaschte einen Blick auf seine Zähne. Sie waren auffallend weiß und ungewöhnlich gleichmäßig. Das musste eine Prothese sein.
Dave Nugent war ebenfalls groß und kräftig gebaut. Jess stand zwischen den beiden Männern, und sie war sich nur allzu bewusst, dass sie mit ihrer schlanken Gestalt und den kurzgeschorenen roten Haaren wie ein Kind zwischen zwei Erwachsenen wirkte … wie ein jugendlicher Delinquent zwischen zwei Beamten.
Jess öffnete den Mund, um zu erwidern, dass Lacey sich die Situation mit seinem Fernglas genau angeschaut hatte und dementsprechend sicher war, doch Corcoran war fest entschlossen, alles in Frage zu stellen. »Gehen Sie bitte rüber, und sprechen Sie noch mal mit dem Zeugen, Sergeant«, sagte sie stattdessen zu Nugent, der daraufhin gehorsam und mit den Händen in den Taschen zu dem Range Rover stapfte.
Jess’ Handy meldete sich mit seinem fröhlichen Klingelton. Sie hob es ans Ohr und hörte Ian Carters Stimme.
»Und? Was gefunden?«
»Noch nicht. Aber ich sollte erwähnen, dass Sergeant Corcoran glaubt, der Zeuge habe sich geirrt. Ein Objekt im Wasser zu identifizieren kann ziemlich schwierig sein. Was auch immer es war, jetzt ist es weg. Wir werden ihm den Fluss hinunter folgen müssen. Sergeant Corcorans Meinung nach hat die Strömung das Objekt – egal ob nun Leiche oder Müllsack – gut eine halbe Meile weiter flussabwärts getragen, seit der Zeuge seine Entdeckung gemeldet hat. Da es in der letzten Zeit viel geregnet hat, ist die Strömung ungewöhnlich stark. Alles Mögliche ist inzwischen schon an uns vorbeigetrieben. Es ist durchaus plausibel, dass auch die Leiche weitergetragen worden ist.«
»Kommt man flussabwärts denn gut ans Ufer ran?«
»Ich glaube, dort gibt es mindestens ein Haus, ein großes. Wir werden den Besitzer bitten müssen, uns auf sein Grundstück zu lassen.«
»Das kann er Ihnen unter den gegebenen Umständen ja wohl kaum verweigern. Uns liegt übrigens keine Vermisstenmeldung vor. Aber was ist mit dem Zeugen? Ist der glaubwürdig?«
»Ich würde sagen, er ist sogar sehr glaubwürdig. Es handelt sich um den hiesigen Tierarzt. Er sagt, er habe langes Haar und einen schlanken Körper gesehen. Er glaubt, dass es sich um eine Frau gehandelt haben könnte, deren Kleidung sich in den Weidenästen verfangen hatte. Um sicherzugehen, spricht Dave Nugent gerade noch mal mit ihm. Unglücklicherweise musste er – der Tierarzt – zu einem dringenden Notfall auf einer nahegelegenen Farm, nachdem er uns angerufen hatte. Anschließend ist er wieder zurückgekommen, um sich mit uns zu treffen, doch die Leiche war verschwunden, und er hat keine Ahnung, ob die Strömung sie wieder losgerissen oder ob irgendjemand sie rausgefischt hat. Allerdings ist die starke Strömung wohl die wahrscheinlichere Erklärung.«
»Hätte sonst noch jemand sie gesehen und ans Ufer gezogen, dann hätten wir mit Sicherheit davon gehört. Wenn Sie in der nächsten halben Stunde nichts finden, dann brechen Sie die Suche erst einmal ab und kommen wieder zurück«, befahl Carter.
»Wir werden es noch mal weiter flussabwärts versuchen, Sir.« Jess steckte das Handy wieder in die Tasche.
Dave Nugent war zurück, und die beiden Polizeitaucher waren aus dem Wasser und in ihr Boot geklettert. Corcoran winkte ihnen, weiter flussabwärts zu fahren, und die restlichen Beamten schickten sich an, ihnen zu folgen. Nur der Zeuge fuhr in die entgegengesetzte Richtung.
»Er hat noch zu tun«, erklärte Nugent. »Ich habe ihm gesagt, er könne ruhig fahren. Wenn wir ihn brauchen, finden wir ihn schon. Und er bleibt bei seiner Geschichte.«
Das könnte ein langer Tag werden, dachte Jess.
KAPITEL ZWEI
»Neil?« Beth steckte den Kopf zur Arbeitszimmertür hinein. Liegengebliebene Arbeit stapelte sich auf dem Schreibtisch am Fenster, und ein bunter Bildschirmschoner deutete darauf hin, dass Neil schon länger weg war. Der Papierkorb war voller zerknülltem Papier; dabei hatte Beth ihn erst heute Morgen geleert. Also hatte ihr Mann doch etwas gearbeitet, auch wenn er anschließend alles aus Wut oder Verzweiflung weggeworfen hatte.
»Vermutlich sowohl als auch«, murmelte Beth vor sich hin.
Sie ging zum Fenster und schaute hinaus. Der Tag war hell und sonnig und die Pfützen des letzten Schauers schon fast im Rasen versickert. Trotzdem war der Boden noch immer tückisch weich. Dann erregte eine Bewegung Beth’ Aufmerksamkeit. Ihr Mann kehrte Laub zusammen. Das war nicht leicht, so feucht wie alles war. Das Laub klebte an dem Besen, und Neil schüttelte ihn wütend hin und her, um ihn davon zu befreien.
Neil war groß und dünn. Das hatte jedoch nichts damit zu tun, dass er wenig aß. Neil aß alles, was Beth ihm vorsetzte – häufig sogar, ohne vorher nachzusehen, was da überhaupt auf seinem Teller lag. Sein ungepflegtes, glattes blondes Haar fiel ihm in die Stirn, und während er wild mit dem Besen wedelte, reichte es ihm fast bis an die Brille. Ein Lächeln huschte über Beth’ Gesicht. Neil sah so komisch aus. Offensichtlich verlor er den Kampf gegen das Gartenlaub. Doch Neil fand das gar nicht witzig. Während sein Frust wuchs, wurden seine Bewegungen immer zorniger, und er schlug mit seiner Besenwaffe um sich, als würde er einen unsichtbaren Feind abwehren.
Zur Straße hin wuchsen mehrere Bäume an der hohen Mauer, die aus dem für die Gegend typischen Stein errichtet worden war, der einen besonders warmen Farbton besaß. Ein paar davon waren sogar älter als das Haus, wie beispielsweise die Eiche, die über ihren dürren Nachbarn aufragte. Sie stand unter Naturschutz und durfte nicht gefällt werden. Doch Beth und Neil wollten ohnehin keinen Baum fällen. Die Bäume bildeten eine Sichtschutzwand zur Straße hin, und sie schluckten auch einen großen Teil des Lärms der LKWs, die vom Steinbruch kamen oder zu ihm fuhren. Dabei war die kleine Straße eigentlich gar nicht für den Schwerlastverkehr geeignet. Sie war viel zu schmal, und kam einem LKW ein PKW entgegen, dann musste der ihm in eine der in unregelmäßigen Abständen angelegten Buchten ausweichen. Das Haus war außerdem geradezu lächerlich billig gewesen, da Neil und Beth die einzigen Verrückten gewesen waren, die hier hatten leben wollen. Und es musste dringend renoviert werden.
»Eine vernünftige Doppelverglasung wird den Lärm schon draußen halten«, hatte Neil in einem Anflug von Optimismus erklärt. »Das ist der ideale Ort für mich zum Arbeiten. Hier stört uns nichts und niemand.«
Sie hatten ihre Wohnung in London für einen unheimlich guten Preis verkauft und waren hierhergezogen. Und wenn man die Lastwagen ignorierte – und man musste fairerweise zugeben, dass sie zumindest nicht an den Wochenenden oder nach fünf Uhr nachmittags fuhren –, dann war man hier tatsächlich ungestört. So hatte Beth schließlich all ihre Vorbehalte aufgegeben, doch nach nur einem Monat hatte die Abgeschiedenheit begonnen, ihr zu schaffen zu machen.
Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann, der jedem (egal ob er gefragt hatte oder nicht) erzählte, dass es die beste Entscheidung seines Lebens gewesen sei hierherzuziehen. Und tatsächlich hatte er bis vor Kurzem den Anschein erweckt, hier glücklich zu sein – vorausgesetzt natürlich, es funktionierte mit dem Schreiben.
Neil hatte sich ein Vogelkundebuch gekauft und Tierdokumentationen im Fernsehen angesehen. Oft ging er mit einem Notizbuch bewaffnet auf lange Spaziergänge, und sorgfältig schrieb er alles auf, was er gesehen oder gefunden hatte. Manchmal musste er sich bei den Recherchen für ein Buch allerdings auch unter Menschen begeben. Das schloss Fahrten nach Gloucester mit ein, um von dort mit dem Zug nach London zu fahren, oder nach Oxford zur Bodleian Library und ins Naturkundemuseum der Universität. Neil schrieb Fantasyromane über eine Welt, die zuerst nur in seinen Gedanken existiert hatte, doch nun lebte sie auch in den Köpfen seiner zahlreichen, treuen Leser. Stets war er auf der Jagd nach dem, was er ›Inspiration‹ nannte, doch Beth bezeichnete das als ›Kuriositäten‹. Wann immer Neil nach Hause kam, sagte er, wie schön es sei, wieder daheim zu sein. »London ist heutzutage einfach nur furchtbar, Beth. Jeder hat es eilig. Hier zu leben, ist ein Segen.« Neil hatte sich förmlich über Nacht in ein richtiges Landei verwandelt.
»Aber gut ist das nicht«, murmelte Beth. »Er … Wir gehören einfach nicht hierher.«
Beth sehnte sich nach dem Chaos des Großstadtlebens, nach dem Adrenalinrausch, den man nur im Herzen einer Stadt wie London bekommen konnte. Und seien wir doch ehrlich: Hätte Beth nicht ihren Job verloren, sie würden noch immer dort leben. Es war einfach nicht gesund, sagte sie sich selbst, an einem Ort zu leben, wo nie etwas geschah und wo selbst der Lärm der Lastwagen wochentags eine willkommene Abwechslung darstellte. In Neils Büchern fand sich der Held (oder manchmal auch die Heldin) stets in einem fremden Land wieder, in dem unvertraute Sitten und Gesetze herrschten. Und so, dachte Beth jetzt, erging es auch ihr und Neil. Sie waren in einem fremden Habitat gestrandet.
Beth streckte noch immer ihre Fühler nach Leuten aus, die ihr einen neuen Job besorgen könnten, vorzugsweise einen, der es ihr ermöglichte, von zu Hause aus zu arbeiten und vielleicht ein-, zweimal die Woche nach London zu fahren. In dem gegenwärtigen Klima war das jedoch nicht leicht, wie ihr jeder erklärte. Der Arbeitsmarkt für Leute mit ihren Fähigkeiten war so gut wie leergefegt, und Beth stand nun schon seit zwei Jahren im Regal und sammelte den Staub, der sich ansammelte, wie sie sich selbst immer wieder mit einem wehmütigen Lächeln beschrieb.
Überdies wurden die monatlichen Kontoauszüge, die ihnen die Bank schickte, immer deprimierender. Beth und Neil hatten vollkommen unterschätzt, was es kosten würde, dieses Haus ins 21. Jahrhundert zu überführen. Der Vorbesitzer, ein älterer Mann, hatte hier jahrelang nichts mehr gemacht, frei nach dem Motto: ›In meinem Alter lohnt sich das nicht mehr.‹
Und für den alten Mr. Martin hatte es sich tatsächlich nicht mehr gelohnt. Nach seinem Tod war es so lange auf dem Markt gewesen, dass der Immobilienmakler den Preis bereits zweimal gesenkt hatte, bevor die Stewarts aufgetaucht waren. Inzwischen hatte Beth erkannt, dass sie und Neil für den Makler und die Nachlassverwalter des Vorbesitzers die Antwort auf ihre Gebete gewesen waren. »Frisch aus London und mit richtig Geld in der Tasche!«, hatte der Makler sich vermutlich ins Fäustchen gelacht.
Aber wie auch immer, mittlerweile hatte sich der Erlös aus dem Verkauf der Londoner Wohnung aufgelöst wie der Raureif auf dem Rasen im Licht der frühmorgendlichen Sonne. Gleiches galt für die erkleckliche Abfindung, die Beth von ihrem ehemaligen Arbeitgeber erhalten hatte. Neil überließ ihr ›die Finanzen‹, und sie teilte das Geld für ihren Lebensunterhalt sorgfältig ein. Doch Neil hatte das entweder nicht bemerkt, oder es kümmerte ihn in seiner privaten Welt voller starker Helden, mystischer Kreaturen, schwertschwingender Amazonen und Zauberer beiderlei Geschlechts einfach nicht. Seine Bücher waren zwar keine Megaseller, aber sie verkauften sich ordentlich. Dennoch hatten sie ihre Ausgaben kürzen müssen, da nun nur noch einer von ihnen Geld verdiente. Dieser Besitz, Glebe House, war wie ein Monster, das stets Hunger hatte und auch aus einer von Neils Geschichten hätte stammen können, nur dass es keine Menschen, sondern Bargeld verschlang. Beth hatte Neil noch nicht gesagt, wie angespannt ihre finanzielle Situation inzwischen war.
Sie hatte ihn nicht beunruhigen wollen, denn in letzter Zeit war Neil … nun ja, ›nervös‹ war wohl ein gutes Wort dafür. Eine Unheil verkündende Wolke war an Neils Horizont erschienen, und darauf stand in großen Lettern: Schreibblockade. Die Arbeit an dem neuen Buch lief nicht gut, und vielleicht war ihm inzwischen ja klar geworden, dass das Schreiben nun ihre einzige Einkommensquelle war. Er hatte nicht über den Besuch bei seinem Agenten am gestrigen Tag sprechen wollen, und als Beth nachgefragt hatte, da hatte er nur einsilbig geantwortet und den Blick gesenkt.
Aber wie auch immer, Tatsache war, dass Neil schon seit Wochen nicht mehr er selbst war, genauer gesagt seit dem letzten Kurs in Kreativem Schreiben, den er am College hier geleitet hatte. Das war sein zweiter Kurs dieser Art gewesen. Den ersten hatte er kurz nach ihrer Ankunft hier im letzten Winter geleitet. Die Veranstaltung war äußerst beliebt gewesen, sodass das College ihn gebeten hatte, dieses Jahr einen weiteren Kurs zu leiten. Geschmeichelt hatte Neil zugestimmt, und für den zweiten hatte es dann auch mehr Bewerbungen als freie Plätze gegeben.
Beth hatte sich gefreut, dass er das Angebot angenommen hatte, und das nicht nur wegen des kleinen zusätzlichen Gehalts, sondern auch weil Schriftsteller ein einsames Leben führen. Und sie hatte sich auch gefreut, dass er nach den Abendveranstaltungen noch mit seinen Studenten einen trinken gegangen war. Neil trank nie viel, und so hatte Beth sich auch keine Sorgen gemacht, wenn er anschließend noch mit dem Auto nach Hause gefahren war. Ein Glas Wein war für Neil das höchste der Gefühle. Diese Zurückhaltung bedeutete außerdem, dass die abendlichen Pubbesuche kein allzu großes Loch in ihre Haushaltskasse rissen. Beth glaubte, dass Neil die Kurse genoss.
Doch Schreiben erfordert auch Konzentration, und vielleicht hatte die Arbeit, die Neil in die Kurse stecken musste, ihn ja so sehr herausgerissen, dass nun sein neues Buch darunter litt.
Beth seufzte und verließ das Arbeitszimmer. Im Flur zog sie sich eine leichte Strickjacke über und ging nach draußen. Die Krähe, die hoch in der Eiche hockte, sah sie kommen und krächzte laut zur Warnung. Neil war noch immer damit beschäftigt, Laub zu kehren. Er hielt in seiner Arbeit inne, hob den Kopf und schob die Brille hoch.
»Hallo, Liebling. Ich werde das nicht verbrennen, sondern einfach so liegen lassen.«
»Warum?« Fast hätte Beth gefragt, ›Verbrennen?‹, denn der nasse Haufen Laub war nur sehr klein.
»Igel.«
»Ich habe schon seit Wochen keinen Igel mehr im Garten gesehen. Die sind alle im Winterschlaf.«
»Also mindestens einer ist noch unterwegs. Ich habe ihn nachts grunzen gehört, und er hat auch seine Visitenkarte hinterlassen. Schau. Da drüben. Und Igel sind gefährdet. Ihre Zahl nimmt rasant ab. Da dachte ich, es wäre doch ganz nett, ihm etwas zu bauen, wo er den Winter verbringen kann.«
Alles außer Arbeit, dachte Beth und seufzte innerlich. Ist das nur eine Ersatzbefriedigung oder der Versuch, die Schreibblockade zu überwinden? Oder liegt das daran, dass wir über Weihnachten Besuch bekommen? Neil mag kein volles Haus. All das Geplapper reißt ihn nur aus seiner Routine. Susies Kinder werden überall im Haus herumrennen, durch den Flur, die Treppe hoch und auf der anderen Seite die alte Dienstbotentreppe wieder herunter und das ununterbrochen. Aber ich freue mich auf den Lärm und die Gesellschaft. Die Kinder sind über Weihnachten immer so aufgeregt. Es macht mir noch nicht einmal etwas aus, wenn sie sich dauernd Cartoons ansehen.
Beth beschloss, die Situation direkt anzugehen. Neil mochte keine Konfrontation. Er tat fast alles, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen, doch manchmal musste er sich ihr auch stellen.
»Ich dachte«, sagte Beth in forschem Ton, »vielleicht würdest du mir ja gerne dabei helfen, Flur und Esszimmer zu schmücken. Offenbar machst du ja gerade Pause.«
Neil wandte sich von ihr ab und stocherte mit dem Besen im Laubhaufen herum. »Ich wollte das nur schnell erledigen und dann … wieder ins Arbeitszimmer zurück.«
»Nein, das wirst du nicht. Ich brauche dich nur fünfzehn Minuten, und fünfzehn Minuten kannst du ja wohl für mich entbehren.«
Neil wusste, dass sie das ernst meinte, und er wurde trotzig. »Ich weiß gar nicht, warum wir all den Schmuck brauchen. Der Mob kommt doch erst an Heiligabend, und am zweiten Weihnachtstag sind sie schon wieder weg. Das ist den Aufwand doch nicht wert.«
»Die Kinder erwarten aber Schmuck und auch unsere Eltern und meine Schwester.«
»Warum kommen die überhaupt alle zu uns?« Jetzt wurde Neil stur, doch sie hatten das alles bereits ausdiskutiert.
»Weil wir alle das so beschlossen haben. Wir sind die Einzigen, die genug Schlafzimmer haben.« Beth deutete aufs Haus. »Wir haben vier Gästezimmer … eigentlich fünf, wenn man das alte Dienstbotenzimmer unter dem Dach mitrechnet, Neil. Und das einzige Mal im Jahr, dass jemand hier übernachtet, ist an Weihnachten!«
»Deine Eltern waren auch an Ostern hier«, protestierte Neil, »und Susie und ihre verdammten Blagen haben sich hier im Sommer eine ganze Woche lang ausgetobt!«
»Und deine Eltern waren das letzte Mal hier, als sie aus Spanien zurückgekommen sind.«
»Die rennen aber nicht ständig die Treppe rauf und runter«, knurrte ihr Mann.
»Jetzt hör mal zu, Neil«, erklärte Beth mit fester Stimme. »Wir werden ein richtig schönes, altmodisches Familienweihnachten feiern, und das heißt Schmuck, Weihnachtsbaum, Mistelzweige und alles, was so dazugehört. Ich freue mich wirklich drauf, und du wirst es auch genießen. Das weiß ich.«
»Ich weigere mich aber, dass wir irgendwelche blinkenden Lichter im oder am Haus anbringen«, versuchte Neil, das letzte Wort zu haben. »Und das schließt Lichterketten mit ein.«
»Die brauchen wir auch nicht. Ich habe letztes Jahr einen Plastikbaum gekauft, weißt du noch?«
»Das ist doch schäbig«, murmelte Beths Mann. »Baum – schäbig, Schmuck – schäbig … und Mistelzweige sind ein heidnisches Symbol. Okay. Aber das ist das letzte Mal. Nächstes Jahr ist damit Schluss!«
»Kein Problem«, erwiderte Beth süßlich. »Nächstes Jahr können wir ja über Weihnachten auf Kreuzfahrt gehen.« Wenn wir uns das dann leisten können, ha!
Neil war so entsetzt, dass es ihm die Sprache verschlug. Doch als sie das Haus erreichten, wurde das Schweigen vom Rattern und Klappern eines Fahrzeugs durchbrochen, das sich lärmend die Einfahrt hinaufkämpfte. Die Krähe floh aus der Eiche und verkündete das Erscheinen des Neuankömmlings.
»Oh nein. Wayne Garley«, stöhnte Neil.
»Oh, gut«, konterte Beth. »Er bringt das Holz für den Kamin.«
»Warum brauchen wir eigentlich noch Feuerholz, wo doch endlich die Zentralheizung funktioniert? Unseren Wäldern geht es nämlich auch nicht gerade gut, weißt du?«
»Wir heizen ja nicht den ganzen Winter damit, sondern nur über die Feiertage.« Der Laster kam mit einem Knirschen auf dem Kies zum Stehen, und eine Gestalt in einem ausgeblichenen blauen Overall und einer zerschlissenen Lederjacke stieg aus und stapfte auf sie zu.
»Ich hab Ihr Holz!«, verkündete der Besucher. »Sie haben Glück. Zu dieser Jahreszeit will jeder welches. All die alten Pubs hier in der Gegend haben noch einen Kamin. Das Geschäft läuft gut.«
»Was heißt, dass er uns einen Aufschlag abknöpfen wird«, knurrte Neil.
»Wo soll ich das Holz hinbringen?«, fragte Garley. Sollte er Neils Bemerkung gehört haben, dann kümmerte ihn das zumindest nicht. Wayne Garley kümmerte überhaupt kaum etwas. ›Bei Nichtgefallen gibt’s auch kein Geld zurück!‹, lautete sein Motto.
Als Neil und Beth in das Haus gezogen waren, hatten sie sich im Ort nach jemandem erkundigt, der die ein oder andere Arbeit für sie erledigen konnte, ohne gleich ein Vermögen dafür zu verlangen. Die Einheimischen hatten sie sofort auf Wayne Garley verwiesen. »Das ist Ihr Mann.«
Garley war hier in der Gegend der Mann für alle Lebenslagen. Egal was man wollte, er konnte es besorgen oder erledigen. Entweder machte er den Job selbst, oder er fand jemanden, der das konnte (für gewöhnlich ein Mitglied seines umfangreichen Clans). Brauchte man eine Hochzeitskutsche? War der Ausguss verstopft? Musste die Gartenmauer repariert werden? Egal. Wayne Garley hatte für alles eine Lösung. Die Garleys sahen alle gleich aus. Egal ob Männlein oder Weiblein, sie waren klein und drahtig, und sie hatten nussbraune, leuchtende Augen und Stupsnasen.
Lettie Stone hatte Beth erzählt, dass die Garleys dafür bekannt waren, nur ›in der Familie‹ zu heiraten. »Du weißt schon … Vettern und Cousinen und so«, hatte Lettie gesagt, die einmal die Woche vorbeikam, um die Treppe zu saugen und die Küchenfliesen abzuwaschen. »Aber die Auswahl in der Familie ist ja auch nicht gerade klein.«
»Schon komisch«, hatte Neil erklärt, als Beth ihm davon berichtet hatte. Er hatte nachdenklich geklungen. Vielleicht würde in seinem nächsten Buch ja ein tätowierter, mit Dudelsäcken bewaffneter Clan von Garleys auftauchen.
»Aber Lettie hat auch gesagt, dass Wayne Garley uns nie im Stich lassen würde. Er ist nicht nur zuverlässig, sondern hat auch ein gutes Herz«, hatte Beth ihn verteidigt.
»Ich zeige Ihnen, wo das Holz hinsoll, Wayne«, sagte Beth nun laut. »Hinter dem Haus, neben ein paar Büschen ist ein kleiner Schuppen.«
»Den kenne ich«, erwiderte Garley. »Den müssen Sie mir nicht zeigen. Ist es okay, wenn ich mit dem Laster nach hinten fahre?«
»Sie werden den Boden aufreißen«, protestierte Neil. »Es ist sehr nass.«
»Ich kann das Holz ja wohl kaum tragen, oder?«, entgegnete Garley. »Bei der Menge würde das ewig dauern … Es sei denn natürlich, Sie gehen mir zur Hand. Wie wär’s?«
»Ach, dann fahren Sie eben mit dem Laster nach hinten!«, schnappte Neil und ging ins Haus.
Beth glaubte, ein schwaches Grinsen auf Waynes Gesicht zu sehen. »Danke«, sagte sie. »Haben Sie die Rechnung dabei?«
»Jep.« Wayne suchte in den Taschen seiner ledernen Bomberjacke und holte schließlich ein zerknülltes Stück Papier hervor.
»Ich nehme an, Sie wollen Bargeld. Wie immer?«, fragte Beth.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann ja. Das spart mir die Fahrt zur Bank, um den Scheck einzulösen.«
»Okay, dann kommen Sie kurz zum Haus, nachdem Sie das Holz gestapelt haben. Das Geld liegt bereit.«
Garley nickte und stieg wieder ins Führerhaus seines Lasters. Als Beth ins Haus ging, hörte sie ihn um das Gebäude rumpeln.
Trotz seiner anfänglichen Proteste schmückte Neil eifrig mit, und sie kamen gut voran. Beth wollte gerade eine Tasse Kaffee kochen, als sie Garley aus Richtung Küche rufen hörte.
»Er will wohl auch einen Kaffee«, sagte Neil.
Aber er irrte sich. Kaffee war das Letzte, was Wayne im Sinn hatte. Als Neil und Beth in die Küche kamen, stand Wayne in seinen Arbeitsstiefeln auf den Fliesen, die Lettie erst am Tag zuvor geputzt hatte. Eine Spur aus schlammigen Fußabdrücken führte von der Hintertür hinein. Diese Art von Gedankenlosigkeit war ganz und gar nicht typisch für Wayne, und Beth fiel auf, dass er überrascht, ja sogar schockiert die Augen aufgerissen hatte.
»Waren Sie heute Morgen schon mal am Ufer?«, fragte er mit heiserer Stimme. »Da wo der Fluss an Ihren Garten grenzt?«
Kein Wunder, dass Wayne so viel Schlamm hereingebracht hatte. Nach all dem Regen in letzter Zeit und dem damit verbundenen Anstieg des Flusspegels war der untere Teil des Gartens so gut wie unzugänglich. Na ja, dachte Beth, für die meisten Leute vielleicht, aber nicht für Wayne Garley.
»Warum sind Sie denn da runtergegangen, Wayne?«, fragte sie. »Das ist doch der reinste Sumpf. Wir waren schon ein paar Tage nicht mehr unten. Würden wir nicht auf einer kleinen Anhöhe wohnen, wäre der Garten schon halb überflutet.«
»Deshalb bin ich ja runtergegangen. Ich wollte wissen, wie hoch die Flut hier ist«, antwortete Garley. »Der Fluss ist überall aus seinem Bett getreten, und Ihre kleine Anlegestelle steht jetzt unter Wasser. Wenn es noch mehr regnet, dann wird der Fluss noch bis auf fünfzehn Fuß an Ihre Hintertür rankommen. Haben Sie Sandsäcke? Ich schätze nämlich, die werden Sie brauchen. Ich kann Ihnen welche besorgen.«
Die Anlegestelle, von der Wayne sprach, war eine wackelige Holzplattform, die in den Fluss hineinragte. Selbst im besten Fall war sie nicht sicher, und nun lag sie bereits zwei Fuß unter der Wasseroberfläche und sog sich voll.
»Jetzt, wo Sie es erwähnen, Wayne«, sagte Beth. »Ich wollte Sie ohnehin bitten, die Anlegestelle im Frühling abzureißen, wenn der Pegel wieder gesunken ist.«
Wayne atmete tief durch. »Da ist etwas eingeklemmt, größtenteils unter Wasser. Ich denke, Sie …« An diesem Punkt wandte Wayne sich demonstrativ von Beth ab und an Neil.
Neil wirkte verwirrt. »Was?«
»Sie sollten besser mitkommen und sich das selbst ansehen«, erwiderte Wayne geheimnisvoll und ging auf demselben Weg wieder hinaus, auf dem er gekommen war.
»Wir werden beide gehen«, flüsterte Beth. »Ich weiß ja nicht, was los ist, aber Wayne scheint fest entschlossen zu sein, es uns zu zeigen.«
Garley hatte gute Ohren. Er hielt kurz inne und schaute zurück. »Nein, Sie nicht, Mrs. Stewart, nur Ihr Mann. Es ist besser, wenn Sie nicht mitkommen.« Er zögerte. »Da ist was … was Totes.«
Neil beschloss, das Kommando über das Gespräch zu übernehmen. »Das ist doch Müll!«, erklärte er, fügte aber rasch hinzu: »Ich meine, das ist sicher Müll und kein totes Tier. Die Woche über ist alles Mögliche den Fluss heruntergekommen. Bleib hier, Liebling. Ich hol nur schnell meine Stiefel und seh mir das an.«
Neil folgte Garley. Beth blieb allein zurück, zögerte und murmelte dann: »Ach, verdammt …« Sie zog sich die Gummistiefel an, die immer neben der Küchentür standen. Als sie hinausging, hörte sie Neil laut rufen. Er klang entsetzt.
Damit war es entschieden. Was auch immer dort unten war, Beth musste hin und es sich ansehen. Wie schlimm konnte es schon sein?
Neil und Garley standen dem gegenüber, was von der alten Anlegestelle noch zu sehen war. Sie deuteten ins Wasser und diskutierten aufgeregt. Beth ging näher heran und bewegte sich dabei schräg den Hang hinunter, damit die beiden Männer nicht zwischen sie und dem geraten konnten, was auch immer dort im Wasser lag. Der Untergrund machte ihr das ganze Unterfangen auch nicht gerade leicht. Der Schlamm saugte an ihren Stiefeln, und Beth geriet gefährlich ins Wanken, sodass sie mit den Armen rudern musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Ja, da steckte definitiv etwas Großes unter der Plattform fest. Es trieb in der Strömung hin und her und war halb unter Wasser getaucht. Doch was es war, das konnte Beth nicht so recht erkennen.
»Was ist das?«, rief sie.
Neil drehte sich um, und als er sie sah, wedelte er wild mit den Armen, um sie zu vertreiben. »Geh wieder rein!«, schrie er. »Sofort!«
»Stell dich doch nicht so an, Neil!« Entschlossen stapfte Beth weiter, obwohl sie das Gefühl hatte, durch Leim zu waten. Kurz brach das festhängende Objekt durch die Wasseroberfläche, und Beth konnte es besser sehen. Das war kein Tier. Da waren Kleider und noch etwas anderes … Haare! Lange Haare, die sich wie ein Fächer auf dem Wasser ausgebreitet hatten. Das ›Ding‹ hatte Schultern und einen Oberkörper.
Beth kam die Galle hoch, und sie begann zu würgen. Sie schluckte. »Das … Das ist eine Leiche«, keuchte sie.
Neil stolperte auf sie zu. »Wir haben dir doch gesagt, du sollst nicht hier runter …«
Er hielt inne, als er mehrere Fahrzeuge näher kommen hörte. Sie fuhren durchs Tor. »Was ist denn jetzt schon wieder?«, knurrte er. »Geh rein, Beth!« Er machte sich auf den Weg, um die Neuankömmlinge zu begutachten.
Doch Beth hätte seinen Befehl noch nicht einmal befolgen können, wenn sie gewollt hätte. Die Beine gehorchten ihr nicht mehr. Nur mit Mühe gelang es ihr, sich umzudrehen und Neil hinterherzuschauen. Dann bemerkte sie Garley neben sich.
Nun, da Beth hier war, schien Wayne ihre Gegenwart zu akzeptieren. »Ich habe mir schon gedacht, dass das eine Leiche ist«, sagte er zu ihr. »Ich erkenne Müll, wenn ich welchen sehe.«
Neil kehrte wieder zurück, und er war nicht allein. Eine adrette junge Frau mit kurzem roten Haar und zwei Männer begleiteten ihn. Einer der Männer war noch ziemlich jung, groß, aber kompakt. Der andere war deutlich älter und fülliger, und er trug einen zottigen schwarz-weißen Schnurrbart, den nur der Träger selbst als schmeichelhaft empfinden konnte. Neil versuchte, den dreien die Situation zu erklären, und gestikulierte in Richtung Fluss. Hinter sich hörte Beth das Tuckern eines näher kommenden Motorboots.
Mit geübtem Auge musterte Wayne Garley die Neuankömmlinge. »Bullen«, sagte er.
KAPITEL DREI
Ein paar Minuten früher war Dave Nugent mit Schwung in die Einfahrt von Glebe House eingebogen und hätte dabei fast den Mann über den Haufen gefahren, der ihnen entgegengelaufen kam.
Der Anblick war nicht nur unerwartet gewesen, sondern auch grotesk. Der Mann war groß und dünn – ein Klappergestell hätte Nugents Oma ihn genannt. Die dürre Gestalt war sichtlich außer sich. Sie wedelte wild mit den Armen und gestikulierte wie verrückt, doch sie vermittelte keine klare Botschaft außer Verzweiflung und Entsetzen. Jess Campbell rief eine Warnung. Fast wäre es zum Zusammenprall gekommen. Nugent trat voll auf die Bremse, und der Wagen kam in einem Kiesregen zum Stehen. Dann steckte er den Kopf aus dem Fenster.
Der Mann blieb stehen, schnappte erschöpft nach Luft und schaute Nugent mit wilden Augen an. »Wer … Wer zum Teufel sind Sie?«, verlangte er zu wissen.
»Polizei, Sir«, antwortete Jess vom Beifahrersitz.
Der Mann riss die Augen auf und rief: »Gott sei Dank! Wir haben gerade etwas Furchtbares entdeckt … Es ist im Fluss.«
Er drehte sich um, ging voraus und winkte den Beamten wild, ihm zu folgen. Neben Jess murmelte Corcoran, der inzwischen aus seinem SUV gestiegen und neben sie getreten war: »Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die Strömung die Leiche flussabwärts tragen würde.«
Die Leiche war unter einem der Stützbalken eines kurzen Stegs gefangen, der in den Fluss ragte, im Augenblick aber vom Hochwasser überflutet war. Er war groß genug, um als Anlegestelle durchzugehen, und vermutlich hatte hier einst ein kleines Boot gelegen. Die heutigen Besitzer schienen ihn jedoch nicht zu nutzen. Zumindest war kein Boot zu sehen, und Jess nahm an, dass der Steg längst verrottet war. Auf gar keinen Fall sollte jemand versuchen, sich auf ihn zu stellen, um die Leiche aus dem Wasser zu bergen.
Doch verrottet hin oder her, er war stabil genug, um die Leiche aufzufangen. Ohne Zweifel handelte es sich um eine Frau. Hier war das Wasser flacher als dort, wo Lacey sie gesehen hatte. Die Strömung hatte die Tote gedreht, sodass ihre nackten Füße zum Ufer zeigten. Immer wieder durchbrach sie die Wasseroberfläche. Die Schuhe waren ihr vermutlich im Fluss von den Füßen gerutscht und auf den Grund gesunken.
Corcorans Männer waren bereits im Wasser und hoben die Tote heraus. Sie drehten sie um, und ihr Kopf fiel nach hinten, als die Taucher mit ihrer Last an Land kamen. Ihr langes Haar hing wie Seetang herab, und Tropfen regneten aus ihm heraus. Anfangs hatten die Taucher im Fluss Jess an Wassergeister erinnert. Jetzt wirkte es so, als hätten sie solch eine Kreatur gefangen und trugen sie aus ihrem Wasserreich an Land. Die Tote war noch sehr jung. Jess erinnerte sich an die Hausbesitzer, die direkt hinter ihr standen. Sie drehte sich um und sah die entsetzten Gesichter. Der Mann sah aus, als würde er sich gleich übergeben. Die Frau hatte den Mund geöffnet, als wolle sie schreien, doch kein Ton kam über ihre Lippen.
Der Mann in dem Overall, der die Ertrunkene offensichtlich entdeckt hatte, stand ein gutes Stück hinter den Hauseigentümern. Jess hatte den Eindruck, dass ihn nicht die Tote störte, sondern die Polizei. Das hieß jedoch nicht zwangsläufig, dass er etwas auf dem Kerbholz hatte. Wahrscheinlich mochte er einfach keine Leute, die private Fragen stellten. Soweit Jess bis jetzt wusste, war er so eine Art Handwerker und hatte Kaminholz angeliefert.
»Mr. Stewart, wollen Sie mit Ihrer Frau nicht lieber reingehen?«, wandte Jess sich an die Hausbesitzer. »Ich komme dann gleich nach und unterhalte mich kurz mit Ihnen.«
Die beiden nickten und drehten sich gehorsam um. Der Mann legte seiner Frau den Arm um die Schultern, und sie schlang ihren um seine Hüfte, als müssten sie sich gegenseitig stützen.
»Sergeant Nugent wird jetzt Ihre Personalien und Ihre Aussage aufnehmen, Mr. Garley«, sagte Jess zu dem Handwerker. »Dann können Sie gehen.«
Garley verzog das Gesicht, nickte aber. Er folgte Nugent zu den Fahrzeugen. Während sie nach oben gingen, begann es wieder zu regnen.
Sanft hatten Corcorans Männer das Mädchen flach auf den Rücken in den festgetrampelten Schlamm gelegt. Jetzt traten sie zurück, um den anderen den Blick freizugeben. Dabei waren ihre Gesichter vollkommen ausdruckslos wie die von professionellen Bestattern. Die Tote war kreidebleich. Sie besaß jene ›Leichenblässe‹, die Dichter in der Romantik so sehr geliebt hatten. Ihr Mund war leicht geöffnet, und ihre Augen starrten blind gen Himmel. Im bleichen Licht der Wintersonne glitzerte ihre nasse Haut wie polierter Marmor. Sie sah aus, als würde sie gleich sprechen und den Beamten sagen, was mit ihr geschehen war. Sie trug einen einzelnen großen Goldohrring. Sein Gegenstück lag vermutlich zusammen mit den Schuhen irgendwo auf dem Grund des Flusses.
Jess schaute sich das tote Mädchen genauer an.
Wie alt mag sie wohl sein, überlegte sie. Neunzehn? Zwanzig? Die nackten Füße des Mädchens hätten genauso gut zu einer Statue gehören können. Dünne Algenfäden bildeten ein Muster auf ihren Knöcheln und Zehen und verstärkten noch den Eindruck von Marmor. Ihre Zehennägel waren silbern lackiert, genau wie ihre Fingernägel.
Es gab da ein viktorianisches Gemälde – von Millais, glaubte Jess –, das Shakespeares ertrunkene Ophelia umgeben von Pflanzen im Wasser zeigte. Jess erinnerte sich daran, in der Schule gelernt zu haben, dass Millais’ Modell tatsächlich stundenlang in einer Badewanne liegen musste, und als Folge davon hatte sie sich eine schwere Erkältung zugezogen. Doch diese Ophelia hier war nicht nur mit einem Schnupfen davongekommen.
Das Mädchen trug ein dünnes, mit Pailletten besetztes Top. Das reichte natürlich nicht als Schutz gegen die Winterkälte. Also hatte sie vermutlich irgendwann und irgendwo auch eine Jacke oder einen Mantel getragen. Ihre schwarze Hose schien aus Samtcord zu bestehen. Es war elegante Kleidung, wie man sie anzog, wenn man abends ausgehen wollte, dachte Jess.
Jess stand auf, griff wieder nach ihrem Handy und rief erneut Carter an, um ihm von der Entdeckung zu berichten. »Gibt es irgendwelche sichtbaren Verletzungen an Kopf oder Gesicht?«, fragte er.
»Nicht, soweit ich erkennen kann. Da sind nur ein paar Kratzer, doch die könnten ebenso gut von den Büschen stammen, in denen sie sich verfangen hatte, als der Tierarzt sie gesehen hat. Sie kann jedoch noch nicht allzu lang im Wasser liegen. Corcoran schätzt, dass sie spät in der Nacht oder am frühen Morgen im Fluss gelandet ist, vermutlich irgendwo zwischen hier und Weston St. Ambrose. Wenn das stimmt, könnten Drogen, die sie vielleicht eingenommen hat, noch immer in ihrem Körper sein. Tom Palmer wird uns mehr sagen können. Aber für mich sieht es so aus, als ob …« Jess hielt inne.
»Was?«
»Ich würde sagen, sie wollte abends ausgehen. Dunkle Samthose, Glitzertop, große Ohrringe, einer fehlt. Das Wasser hat die Kleidung vollkommen durchtränkt, aber das Cordmuster ist noch gut zu erkennen. Ihre Nägel sind perfekt manikürt und lackiert, Finger und Zehen. Tom muss so schnell wie möglich eine Autopsie machen. Ich hoffe nur, das Wasser hat nicht alle Beweise von ihrem Körper gewaschen.«
»Ich bin nicht gerade ein Experte in Frauenmode«, erklärte Ian trocken. »Aber wenn sie zu einer Verabredung wollte, dann müssen wir herausfinden, wer der Kerl war. Aber natürlich erst, wenn wir wissen, wer sie ist! Okay. Ich veranlasse alles Notwendige.«
Jess steckte das Handy wieder in die Jackentasche und ließ ihren Blick über den Garten schweifen. Schon bald würde es hier nur so von Menschen wimmeln, einschließlich eines Arztes, um den Tod zu bescheinigen. Immer mehr Fahrzeuge würden sich einen Weg über das bahnen, was vom Rasen der Stewarts übrig geblieben war. Jess’ Ankunft mit Nugent und Corcoran und die folgenden Aktivitäten hatten schon genug Schaden angerichtet. Jess taten die Stewarts leid.
Jess überließ Nugent das Kommando und machte sich auf den Weg zum Haus. In Gedanken legte sie sich schon einmal eine Entschuldigung zurecht, mit der sie die Befragung beginnen wollte. Schließlich rechnete niemand damit, dass das eigene Haus plötzlich im Mittelpunkt einer polizeilichen Ermittlung stand. Die Hintertür stand offen. Das musste die Küche sein. Jess hielt darauf zu.
Die Stewarts befanden sich in der Tat in der Küche. Sie saßen nebeneinander und schauten zu der offenen Tür und dem dahinterliegenden Garten, obwohl sie von hier aus dank der großen, alten Lorbeerbüsche und des Gartenschuppens den Fluss gar nicht sehen konnten. Sie waren wie erstarrt. Warme Luft strömte aus der Küche heraus, doch beide zitterten vor Schock. Jess fühlte sich verpflichtet, an der offenen Tür zu klopfen, obwohl die beiden sie mit Sicherheit gesehen hatten. Sie war erleichtert, dass bereits Schlammspuren auf den Fliesen waren. Wenigstens dafür würde sie sich nicht mehr entschuldigen müssen. Trotzdem zog sie die Gummistiefel aus und stellte sie neben die Tür unter einen kleinen Sims. Würde ich hier wohnen, dachte sie, hätte ich mir schon längst eine überdachte Terrasse bauen lassen.
Jess stapfte auf feuchten Socken hinein und sagte: »Das Ganze tut mir sehr leid, Mr. und Mrs. Stewart.«
»Es ist ja nicht Ihre Schuld«, erwiderte die Frau kaum hörbar.
Irgendjemand hatte Kaffee gemacht, der nun unberührt und dampfend vor den beiden stand.
Mrs. Stewart sah, wohin Jess schaute. Steif stand sie auf, wie eine alte Frau, obwohl Jess sie auf höchstens Ende dreißig, Anfang vierzig schätzte. »Möchten Sie auch eine Tasse?«, bot die Frau an. Die automatische Höflichkeit war wie ein Rettungsanker für sie.
»Ja, danke.« Jess nickte. Wenn die Frau etwas zu tun hatte, würde sie das vielleicht ein wenig entspannen. Der Mann würde jedoch weit mehr brauchen, bis die Spannung von ihm wich. Er war weiterhin wie erstarrt, die Hände auf dem Tisch. Seine Haut hatte eine grünliche Farbe angenommen, und Schweißtropfen liefen ihm über die Schläfen. Unter normalen Umständen wäre er eigentlich ein gutaussehender Mann gewesen und das trotz seiner eher schmächtigen Gestalt und der Brille. Auch kam Jess sein Gesicht irgendwie vertraut vor.
Die Frau kehrte wieder zurück und stellte Jess einen Becher hin. »Ich heiße Beth«, stellte sie sich vor, »und das ist mein Mann Neil.« Auch sie war attraktiv, obwohl sie gerade unter erheblichem Stress stand. Ihr langes strohblondes Haar hatte sie sich mit einem Seidentuch zurückgebunden, sodass ihre ebenmäßigen Gesichtszüge gut zur Geltung kamen. Make-up hatte sie nur wenig aufgelegt, und sie trug noch immer ihre Strickjacke. Ihr Mann hatte seine verdreckte Steppweste ebenfalls noch nicht abgelegt, und im Gegensatz zu seiner Frau wirkte er auf den ersten Blick wie ein typischer Landbewohner, aber eben nicht ganz. Tatsächlich passten beide nicht in die Umgebung. Wie waren sie wohl hier gelandet?
Neil Stewart. Jess hatte den Namen schon einmal gehört. Dann fiel es ihr plötzlich wieder ein. Sie hatte sein Foto sowohl in der Lokalzeitung als auch auf den Umschlägen seiner Bücher gesehen.
»Sie sind der Autor«, sagte Jess zu ihm.
Neil Stewart hob den Blick von dem unberührten Kaffee vor ihm und starrte sie an. »Ja«, bestätigte er. Er kaute auf der Unterlippe und fügte unter Mühen hinzu: »Tut mir leid. Ich … Dieses Mädchen … Sie zu finden, hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen.«
»Wayne hat sie gefunden«, korrigierte Beth ihn.
Ein Hauch von Verärgerung huschte über Neils Gesicht. »Ja, ich weiß. Wayne hat sie gefunden. Was ich damit sagen wollte, ist: Als ich sie gesehen habe … Bis dahin habe ich nicht geglaubt, dass er wirklich jemanden gefunden hatte. Immerhin passiert sowas nicht jeden Tag!« Sein Ärger schien die Starre aufzubrechen, die ihn gefangen hielt.
»Erzählen Sie mir davon«, lud Jess ihn in der Hoffnung ein, dass ihm reden helfen würde.
Sie schauten einander an. »Da gibt es nichts zu erzählen. Wayne Garley hat uns eine Ladung Feuerholz gebracht, und Beth hat ihm gesagt, er solle es in den Schuppen bringen.« Neil griff nach seinem Kaffeebecher, stellte ihn aber sofort wieder ab. Kaffee schwappte auf den Tisch. »Wir konnten doch nicht wissen, dass er eine Leiche finden würde, verdammt!«
»Was haben Sie gerade getan, als Garley gekommen ist?«, fragte Jess.
»Nichts … na ja, zumindest nicht viel. Ich war im Garten und habe Laub gekehrt.« Neil hielt kurz inne und fügte dann hinzu: »Früher am Morgen habe ich an einem Buch gearbeitet, aber ich brauchte mal eine Pause. Also bin ich rausgegangen und habe mich aufs Laub gestürzt, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen.« Er blinzelte. Vielleicht sah er wieder das ertrunkene Mädchen vor sich und versuchte nun, das Bild aus seinem Kopf zu vertreiben. Es würde jedoch noch lange dauern, bis er und seine Frau dazu in der Lage sein würden.
»Sie sind nicht zum Fluss runter? Konnten Sie ihn denn von der Stelle aus sehen, wo Sie gearbeitet haben?«
Neil schüttelte den Kopf. »Ich bin noch nicht einmal in die Nähe des Ufers gegangen – oder zu der Stelle, wo das Ufer eigentlich sein sollte, wäre da nicht die Überschwemmung wegen dem vielen Regen. Aber ich hätte ohnehin nichts sehen können. Da gibt es viel zu viel Gestrüpp … wie das da draußen.« Er deutete zu dem Schuppen und den Lorbeersträuchern. »Viktorianische Pflanzungen, die jetzt alle verwildert sind. Aber selbst wenn ich runtergegangen wäre, hätte ich nichts gesehen, es sei denn, ich wäre direkt ans Wasser gegangen. Da unten ist es wie in Dartmoor. Das haben Sie doch gerade selbst gesehen! Dann ist Beth herausgekommen und hat mich gebeten, ihr mit dem Weihnachtsschmuck zu helfen.«
»Über Weihnachten haben wir Gäste«, erklärte Beth. »Die Familie. Wir haben gerade darüber gesprochen, als Wayne mit dem Holz gekommen ist. Ich habe ihm gesagt, er solle es in den Schuppen bringen, und er ist mit dem Laster ums Haus gefahren. Neil und ich sind reingegangen. Wir haben mit dem Schmücken angefangen und wollten gerade eine Kaffeepause einlegen, als wir Wayne aus der Küche haben rufen hören. Er wollte uns sagen, dass da etwas im Fluss ist, unter der alten Anlegestelle. Und er wollte, dass nur Neil ihn begleitet, um mir den Anblick zu ersparen.« Beth verzog das Gesicht. »Aber ich bin ihnen gefolgt. Natürlich hätten wir die Polizei rufen sollen, aber bevor wir Gelegenheit dazu hatten, waren Sie schon da.«
»Wir wussten nicht, dass Sie schon in der Nähe waren«, fügte Neil hinzu, »und so schnell kommen würden, auch ohne dass wir Sie angerufen haben. Ich habe gehört, wie Ihre Wagen durch das Tor gefahren sind, und mich gefragt, wer zum Teufel das sein könnte.«
»Ein Zeuge hat früher am Morgen eine Leiche im Fluss gemeldet.« Jess nippte an ihrem Kaffee, doch die Stewarts rührten ihren nicht an. »Gut eine halbe Meile flussaufwärts. Deshalb haben wir danach gesucht.«
»Sie … Sie ist sicher reingefallen und ertrunken, nicht wahr?«, fragte Beth.
»Das wissen wir nicht. Wir müssen erst das Ergebnis der Autopsie abwarten. Haben Sie Mr. Garley gebeten, zum Steg zu gehen?«