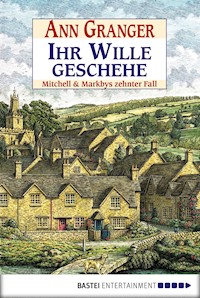9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Viktorianische Krimis
- Sprache: Deutsch
Deptford: Hier liegen die Werften und Häfen Londons - und die Leiche einer unbekannten Frau. Inspector Ben Ross hat zunächst kaum Hinweise auf ihre Identität, bis ein Dienstmädchen bei der Polizei auftaucht und seine Herrin Mrs Clifford als vermisst meldet. Es stellt sich rasch heraus: Sie ist die Tote von Deptford.
Eine neue Spur ergibt sich, als Bens Ehefrau Lizzie von einer Freundin um Rat gefragt wird. Deren Bruder Edgar hat Spielschulden - bei niemand anderem als Mrs Clifford. Nun gerät Edgar in Verdacht, und Lizzie soll ihm helfen.
Bald sind Lizzie und Ben wieder auf der Jagd nach einem rücksichtslosen Mörder ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
ÜBER DIE AUTORIN
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Kriminalromanen »Wer sich in Gefahr begibt« und »Neugier ist ein schneller Tod« knüpft sie mit »Stadt,Land, Mord«, dem ersten Band der Reihe um Inspector Jessica Campbell, wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
Die Tote von Deptford
EIN FALL FÜR LIZZIE MARTIN UNDBENJAMIN ROSS
KriminalromanÜbersetzung aus dem Englischenvon Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Dead Woman Of Deptford«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Lektorat: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenan
Einband-/Umschlagmotiv: © David Hopkins/Phosphorat
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2948-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die bloße Existenz Londons ist abhängig von der Schiffbarkeit der Themse, denn wäre dieser Fluss nicht befahrbar, die Stadt würde sich in kürzester Zeit in einen Ruinenhaufen verwandeln, genau wie Ninive oder Babylon …
The Picture of London for
KAPITEL EINS
Inspector Ben Ross
Sein Name war Harry Parker. Er war eine kleine, hagere Gestalt in abgerissener Kleidung. Im gelben Licht der Polizeilaterne spähte er zu uns hoch mit dem gehetzten Blick eines streunenden Hundes, der in die Ecke gedrängt worden war und keinen Ausweg mehr hatte. Er hielt eine Stoffmütze in den Händen, an die Brust gepresst, und seine kleinen Äuglein huschten ständig zwischen uns hin und her. Ich konnte nicht sagen, welchen Eindruck er als Zeuge vor einem Richter oder einer Jury machen würde. Ich wusste nur, dass er einen sehr bescheidenen Eindruck auf mich machte.
Eine knappe Stunde zuvor hatte ich noch geglaubt, mit meiner Arbeit für den Tag fertig zu sein. »Ich schätze, Morris, wir können endlich auch Feierabend machen«, hatte ich sogar in einem Anflug von Verwegenheit geäußert.
Ich war zusammen mit dem Sergeant außerhalb von London gewesen, in Cambridge, um eine Angelegenheit zu klären, bei der man um unsere Hilfe gebeten hatte. Abgesehen von den polizeilichen Aufgaben war es eine willkommene Abwechslung gewesen. Cambridge war mir ruhiger erschienen als London, und wir hatten die viel sauberere Luft genossen, die Atmosphäre der alten Universitätsstadt, die hübschen Gebäude im gotischen Stil sowie die offenen Weiden, auf denen Kühe friedlich grasten. Es war uns vorgekommen wie eine andere Welt.
Auf dem Rückweg nach Hause hatten wir vom Zug aus die graubraune Dunstwolke sehen können, die über unserer großen Hauptstadt hing. Es hätte schlimmer sein können. Um diese Jahreszeit, im November, stieg normalerweise zusätzlich Nebel aus den Niederungen der Themse auf. Zusammen mit dem Qualm aus den zahllosen Kohleöfen bildete er häufig eine undurchdringliche, stinkende, gelbliche Masse, die jeden Winkel und jede Ritze eroberte, bis hinunter zum Pflaster der Bürgersteige, und die Gebäude in einen dreckigen Schleier hüllte. Man konnte nicht an ihnen entlangstreifen, ohne seine Kleidung mit schwarzen Rußschlieren zu beschmutzen. Gott sei Dank war uns diese Londoner Eigenart trotz des kalten Wetters in diesem Herbst bisher erspart geblieben.
Morris und ich stiegen aus dem Zug und wurden sofort von den hin und her eilenden Massen verschluckt, während wir uns unseren Weg durch die vollen Straßen bahnten. Unsere Ohren waren voll vom Rattern von Rädern und dem Geklapper von Hufen, den Rufen der Straßenhändler und dem Geklimper von Drehorgeln. Alles Leben war hier versammelt. Unter die respektablen Bürger gemischt waren Bettler – die offen ihrem Gewerbe nachgingen – sowie Taschendiebe, die dies nicht taten. Die lebendige, doch gelehrte Atmosphäre in Cambridge erschien uns im Nachhinein wie aus einem anderen Land. Als wir die Türen von Scotland Yard passierten, erschien es uns, als hätten wir nach einem Sturm den sicheren Hafen erreicht. Ich meldete unsere Rückkehr an und versprach, gleich am nächsten Morgen meinen Bericht abzuliefern. Damit blieb uns für den Rest des Tages nur noch die angenehme Aussicht auf ein gemeinsames Abendessen im Kreis unserer Familien.
Das war der Augenblick, in dem das Schicksal einen Dämonen heraufbeschwor in Gestalt eines rotgesichtigen, atemlosen jungen Constables. Das Klappern seiner schweren Stiefel auf der Treppe kündete sein Eintreffen an, und Sekunden später stand er in der Tür, einen Brief in den verkrampften Händen. Er schwitzte stark.
»Wer sind Sie und was wollen Sie?«, bellte Morris den jungen Burschen an. Er kannte ihn nicht, doch er erkannte instinktiv ein Hindernis zwischen sich und seinem eigenen Kamin zu Hause.
»Evans, Sir, aus Deptford, Sir!«, krächzte der Neuankömmling und knallte die Hacken zusammen. Er spähte unsicher von einem zum anderen. »Man hat mir unten gesagt, ich soll mich an Inspector Ross wenden, Sir!«
»Hat man das tatsächlich?«, brummte ich und trat vor. »Ich bin Ross.« Ich trat vor und nahm den Brief an mich, den er mir entgegenhielt. »Nun, junger Mann, was hat Sie so dringlich hierher geführt?«
»Wir haben einen Mordfall, Sir!«, deklarierte der junge Mann aufgeregt. »Man hat die Leiche soeben erst gefunden. Sie liegt in Skinner’s Yard. Oh, und Sir, Inspector Phipps lässt Ihnen seine Grüße ausrichten und bittet um Entschuldigung«, fügte er ein wenig verspätet hinzu.
»Gut von ihm«, murmelte Morris hinter mir.
Wir wussten in diesem Moment beide, dass wir erst spät in der Nacht nach Hause kommen würden. Die meisten Beamten hatten das Gebäude längst verlassen, und die wenigen verbliebenen waren beschäftigt – oder zumindest hatten sie so viel zu tun, dass sie Constable Evans zu mir geschickt hatten. Ich las den Brief langsam. »Eine ermordete Frau, wie?«
»Die Leiche liegt noch genau dort, wo man sie gefunden hat«, drängte Evans. »Ich soll Sie hinbringen, Sir.« Der junge Kerl hüpfte vor Aufregung von einem Bein aufs andere.
Es war erforderlich, etwas zu unternehmen, bevor dieser eifrige junge Merkur von seiner Erregung so übermannt wurde, dass ich ihm einen Eimer Wasser über den Kopf schütten musste. Ich schickte ihn nach draußen, um eine Kutsche zu suchen, die uns alle drei zum Tatort bringen konnte.
»Tut mir leid, Morris«, sagte ich, als wir ihm langsam aus dem Gebäude folgten.
Morris murmelte eine Erwiderung, doch ich konnte ihn nicht verstehen. Es war auch nicht nötig.
Auf dem Weg nach Süden und über den Fluss las ich erneut den Brief von Phipps. Ich saß neben dem jungen Evans, denn er war von schmalerer Statur als Morris, dessen großzügige Körpermasse die Bank uns gegenüber beinahe ausfüllte. Um lesen zu können, musste ich mich gehörig verrenken und den Brief so halten, dass das schauerliche Licht der Gaslaternen darauffiel. Es ließ das Dokument aussehen wie ein mittelalterliches Pergament. Das Ruckeln und Schaukeln der Kutsche auf der unebenen Straße ließ die Worte vor meinen Augen auf und ab tanzen, doch es gelang mir, sie zu erkennen.
Der Mord wies einige ungewöhnliche Umstände auf, schrieb Phipps, ohne sich indes darin zu ergehen, welcher Natur diese Umstände wohl sein mochten. Er war jedoch der festen Überzeugung, dass die Ermittlungen in den Händen von Scotland Yard besser aufgehoben seien. In Deptford verfügten sie einfach nicht über die erforderlichen Ressourcen. Die jüngste Zunahme an Schlägereien unter Betrunkenen und Seeleuten, viele darunter von ausländischen Schiffen und nicht des Englischen mächtig, beanspruchte ihre gesamte Arbeitskraft.
Ich kannte Inspector Phipps nicht persönlich, doch ich hatte von ihm gehört, und er besaß den Ruf eines fähigen Beamten. Ich hatte jedoch meine Not, zu begreifen, dass in Deptford derartige Anarchie herrschte, dass die dortigen Beamten sich außerstande sahen, einer Mordermittlung Priorität zu geben, zumindest anfänglich. Falls sich tatsächlich herausstellte, dass es Komplikationen gab, hätte man Scotland Yard zu einem späteren Zeitpunkt immer noch hinzuziehen können. Dass man uns sofort herbeigerufen hatte, brachte mir den Begriff »heiße Kartoffel« zu Bewusstsein.
Ich spähte aus dem Fenster. Deptford stand schon lange in dem Ruf, die ungesundeste Gegend von London zu sein, und das trotz starker Konkurrenz durch andere Stadtteile. Doch die Gegend, die wir durchfuhren, erweckte den Eindruck eines lebhaften Viertels. Entlang dem Fluss lagen auf einer Seite Schiffe vor Anker, deren hohe Masten einen richtigen Wald vor dem nächtlichen Himmel bildeten. Gelegentlich wurde die Dunkelheit des winterlichen Nachthimmels durchbrochen von einem Schauer aus roten und goldenen Funken, als hätte jemand ein spektakuläres Feuerwerk gezündet. Die spontane Szenerie markierte Stellen, wo Männer in einer der zahllosen Werften den Rumpf eines Stahlschiffs bearbeiteten.
Wir rumpelten und polterten an den dunklen Silhouetten der großen Lagerhäuser vorbei, die ausnahmslos Großhändlern gehörten. Der Hafen von London war Ziel von Frachtschiffen aus aller Welt, und zwischen all den anderen Gerüchen, die ihren Weg in die Kutsche fanden, entdeckte meine Nase auch den Duft von Gewürzen und Tabak. Zahlreiche Geschäfte waren von den Docks abhängig: Kerzenmacher, Schmiede, Wagner, Stellmacher. Wir klapperten durch die Hauptstraße mit der üblichen Ansammlung von Krämern, Obsthändlern und Weinverkäufern. Viele von ihnen hatten selbst um diese späte Stunde noch alle Hände voll zu tun. Nach den flüchtigen Blicken, die mir möglich waren, schienen viele der Läden klein und vollgestopft zu sein, mit niedrigen Decken und frei liegenden Balken. Schon jetzt war jedes Lokal, das wir passierten, voll mit Gästen. Wir fingen Fetzen von rauen Gesängen und das Kratzen einer Fiedel auf. Über uns versperrten die oberen Stockwerke der Gebäude den Blick zum Himmel, menschliche Ameisenhügel, in denen Familien unter den beengtesten Umständen lebten, oftmals nur in einem einzigen Zimmer.
Ich hatte bisher noch keine Hinweise auf aufrührerische Mobs gesehen und auch keine gebrüllten Flüche in einer Vielzahl von Sprachen hören können, wie es Phipps in seiner Bitte um Hilfe durch Scotland Yard geschildert hatte.
Natürlich konnte ich das nicht laut vor dem Constable aus Deptford aussprechen, doch ich hatte eine böse Vorahnung wegen dieser ganzen Angelegenheit. Ich reichte Morris den Brief des Inspectors, der ihn überflog, so gut es im spärlichen Licht ging, bevor wir in noch schlechter beleuchtete Straßen einbogen. Laut und gedacht als schwacher Trost sagte ich zu ihm: »Vielleicht stellt sich ja heraus, dass Deptford ganz gut alleine mit diesem Fall zurechtkommt.«
»Und warum hat man uns dann überhaupt gerufen?«, murmelte Morris. Vielleicht hatte er nicht beabsichtigt, dass ich ihn hören konnte. Vielleicht war er aber auch müde und hungrig, und es war ihm egal.
Doch der junge Constable hatte ihn gehört, und ich sah, wie er zusammenzuckte. Als die Kutsche kurz darauf zum Halten kam, ertönte seine Stimme nervös im Dämmerlicht. »Wir sind da, Sir. Es ist hier.«
Wir stiegen aus, und ich bezahlte den Kutscher. Ich ließ mir von ihm eine Quittung geben auf einem Fetzen Papier, den ich aus meiner Tasche kramte, in der Hoffnung, dass man mir diese Auslage ersetzen würde. Der Yard hatte bereits unsere Rückfahrkarten nach Cambridge an diesem Tag erstattet, und es schien durchaus möglich, dass man die zusätzlichen Spesen als über dem erlaubten Maß deklarierte.
Die Kutsche ratterte davon, und wir blieben in einer Gegend irgendwo zwischen dem Fluss und dem kommerziellen Zentrum des Viertels zurück. Augenpaare beobachteten uns aus sämtlichen Häusern ringsum, doch so, dass wir sie nicht sehen konnten. Wir folgten dem jungen Evans, der uns durch eine Lücke zwischen zwei Gebäuden in einen dunklen, stinkenden Innenhof führte, nur unzureichend erleuchtet durch das Licht aus den Fenstern darüber und den tanzenden Scheinwerferkegeln der Blendlaternen, die verschiedene Beamte in Uniform bei sich trugen. Der Besitzer einer solchen Laterne, ein stämmiger Bursche mit einem Cape und einem Helm, erblickte uns und hob sie so hoch, dass der Strahl in mein Gesicht fiel.
»Barrett, Sir!«, meldete er sich schneidig, als ich meine Augen vor dem plötzlichen grellen Lichtschein abschirmte. »Wir haben ihn hier, Sir, den Kameraden, der die Leiche gefunden hat.«
Meine Augen gewöhnten sich an das schlechte Licht. Die Umgebung, in der wir uns befanden, war weniger ein richtiger Hof als vielmehr eine weite Lücke zwischen zwei hohen Gebäuden aus Ziegelwerk. Die Lücke erstreckte sich sechs Meter weit nach hinten und war vielleicht fünf oder sechs Meter breit. Überall lag Schutt herum, was nahelegte, dass hier ein Haus abgerissen worden war, vielleicht ein alter Lagerschuppen, und niemand hatte einen Sinn darin gesehen, etwas Neues aufzubauen. Zusammen mit den verbliebenen Häusern rechts und links war der Effekt der einer Reihe alter Zähne, die langsam zerbröckelten und ausfielen.
Die Straße hinter uns war von Gaslaternen erhellt, doch sie warfen kaum Licht in diesen trostlosen Winkel. Allein die ölbetriebenen Laternen reichten bis zum anderen Ende, wo baufällige Holzhäuschen an der Wand Aborte vermuten ließen. Früher waren sie von jedermann benutzt worden, der hier gelebt hatte, und nach dem Gestank zu urteilen taten zumindest einige dies noch heute. Das von Bazalgette entworfene Kanalsystem für London war noch nicht hier angekommen. Die Aborte mündeten vermutlich in eine nur selten geleerte Jauchegrube oder schlimmer noch, direkt in den Fluss. Andernorts hatte die neue Kanalisation viel dazu beigetragen, die gefürchtete Cholera einzudämmen. Sollte sie nach London zurückkehren, war dieser Hof eine geradezu ideale Brutstätte für ihre Schrecken. Abfälle und Unrat aller Art lagen in verrottenden Haufen verstreut. Ratten huschten unerschrocken hin und her, hervorgelockt von der Aussicht auf leichte Beute und in dieser Nacht vom Geruch von Blut.
Wie sein Kollege Evans war auch Constable Barrett jung und eifrig. Er zerrte seine Prise schwungvoll aus den Schatten und in das Licht wie ein Zauberer, der ein Kaninchen aus dem Hut zieht.
»Hier ist er, Sir!«, deklarierte er triumphierend.
Ich klatschte in die kalten Hände, zum einen, um die Taubheit zu vertreiben, und zum anderen, um zu demonstrieren, wer hier das Sagen hatte, während ich meinem Missvergnügen angesichts des elenden Exemplars der menschlichen Rasse, von denen es hier bei den Docks mehr als genug gab, stirnrunzelnd Ausdruck verlieh.
Als Reaktion auf meinen finsteren Blick und das Echo meines Klatschens, das von den Ziegelwänden zurückgeworfen wurde, duckte er sich erschrocken und blickte noch verängstigter drein. Gut so. Es mochte an dieser Stelle unfair sein, ihm die Schuld zu geben für meinen verspäteten Feierabend und mein hinausgezögertes warmes Abendessen, doch ich war auch nur ein Mensch, und in Abwesenheit von Inspector Phipps musste ich meinen Missmut auf irgendein anderes Ziel richten.
»Wie heißen Sie?«, herrschte ich den unansehnlichen Kerl an, der mir unter die Nase geschoben worden war. Ich hatte schon einmal einen Rattenzirkus gesehen, angestachelt und aufgeputscht von einem menschlichen Ringmeister, und es schien mir, als wäre eines der Exemplare aus dem Käfig entflohen und stünde nun, mit Jacke und Hose am dürren Leib, auf den Hinterpfoten vor mir.
Meine Nase bestätigte indessen meinen ersten Eindruck von ihm. Der »Zeuge« hatte die letzten Stunden offensichtlich in einer Spelunke verbracht. Er stank nach Bier, Schweiß, Sägemehl und Tabakqualm.
»Parker«, murmelte der Angesprochene kleinlaut. »Harry Parker, Sir. Das habe ich dem Bullen da auch schon gesagt«, fügte er in einem Anfall von Mut, befeuert von Verbitterung, hinzu. »Oder vielleicht nicht?«
»Welchem Beruf gehen Sie nach, Mr. Parker?«
»Ich arbeite auf den Docks«, murmelte er. »Ich warte jeden Morgen in der Frühe am Tor, wenn Männer für den Tag eingestellt werden. Wenn ich genommen werde, mache ich alles, was man mir aufträgt. Ausladen, einladen, tragen, schleppen …«
Und ein wenig klauen, wenn sich die Gelegenheit bietet, dachte ich bei mir. Alle Tagelöhner, die des Morgens an den Toren eingestellt wurden, mussten sich am Abend beim Verlassen des Geländes einer Leibesvisitation unterziehen, doch angesichts der Massen von müden, schlecht gelaunten Kerlen, die sich an den wenigen Wachleuten vorbeischoben, war es unmöglich, jeden zu überprüfen, und damit war der Diebstahl auch nicht einzudämmen.
»Wie haben Sie sie gefunden, Mr. Parker?«, wollte ich von ihm wissen.
»Ich bin über sie gefallen!« Seine Stimme hob sich zu einem indignierten Kreischen. »Das hab ich dem Polypen da auch schon gesagt! Es ist nicht meine Schuld, oder? Ich hab nicht nach ihr gesucht, wissen Sie? Ich bin hier reingekommen.« Er deutete mit der Hand auf den Hof. »Ich bin hier reingekommen, weil ich ein natürliches Bedürfnis hatte!« Er betonte den Euphemismus mit einer geradezu lächerlichen Würde und deutete in Richtung der Holzschuppen auf der Rückseite des Hofs. Ich bezweifelte stark, dass er tatsächlich dorthin gewollt hatte. Niemand, der bei klarem Verstand war, würde freiwillig nach Einbruch der Dunkelheit in einen dieser Schuppen gehen und riskieren, kopfüber in eine stinkende Grube zu stürzen.
»Ich hab sie in der Dunkelheit überhaupt nicht sehen können!«, fuhr Parker fort. »Es gibt kein Licht hier außer den Laternen auf der Straße oder von den Fenstern oben, wenn jemand einen Vorhang zurückzieht.« Er stieß einen Finger himmelwärts. »Ich hab mich furchtbar erschrocken. Ich bin nach draußen auf die Straße zurückgerannt, und da war dieser –« Er unterbrach sich, vielleicht, weil ihm angesichts von Barretts finsterer Miene bewusst wurde, dass dieser es nicht wohlwollend aufnehmen würde, wenn er ein drittes Mal als Bulle oder Polyp beschimpft wurde. Er formulierte das Ende seines Satzes neu. »… da war dieser Constable hier. Fragen Sie doch ihn!«
»Das ist korrekt, Sir«, sagte Barrett. »Ich war auf meiner normalen Streife. Der Zeuge kam aus dem Hof auf die Straße und hätte mich beinahe umgerannt. Er stammelte wirr vor Angst, und ich konnte kein Wort verstehen. ›Da drin!‹, rief er immer wieder. Also schob ich ihn vor mir her in diesen Hof, die Hand an seinem Kragen, damit er mir nicht entwischen konnte. Und tatsächlich, dort fanden wir die arme tote Frau.«
Ich fragte mich, wohin Parker gelaufen wäre auf der Suche nach Hilfe, wenn der Constable nicht zufällig vor Ort gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre er auf geradem Weg nach Hause gerannt und hätte die grausige Entdeckung jemand anderem überlassen.
Parker schniefte in seine Kappe. »Ich bin ein ehrbarer arbeitender Mann«, sagte er in einem Ton, der so voller Selbstmitleid war, als glaubte er selbst daran.
Ich sah nach oben. Es war nicht zu erkennen, wie viel Licht vorher im Hof gewesen war. Jetzt, nachdem die Nachricht sich wie ein Lauffeuer verbreitet hatte, dass sich ein Mord ereignet hatte, war jedes Fenster zum Hof weit geöffnet, und eine oder mehrere Gestalten lehnten sich neugierig hinaus, um das Spektakel unten zu verfolgen. Wie bei einer Theateraufführung eines Shakespeare-Stückes, dachte ich. Und wir sind die Spieler. Aufgeregte Stimmen hallten zu uns herunter.
»Kann jemand die Leiche sehen?«, fragte eine schrille Frauenstimme.
»Nein … sie ham sie zugedeckt. Da drüben bei der Wand, siehste? Da is was.«
»Ich kann nix sehn«, grummelte die erste Stimme.
»Wir müssen Beamte in die Häuser schicken«, sagte ich zu Sergeant Morris. »Herumfragen, ob jemand etwas gesehen oder gehört hat. So eine neugierige Bande. Ich wünschte, Phipps hätte das bereits getan!«
Barrett, darauf bedacht, seine Kollegen und seinen Vorgesetzten zu verteidigen, meldete sich zu Wort. »Es gibt niemanden, den wir in die Häuser schicken könnten, Sir! Ein russisches Frachtschiff ist in den Hafen eingelaufen, und die Nacht war sehr wild.«
»Das habe ich dem Brief des Inspectors entnehmen können«, erwiderte ich. »Obwohl die Dinge im Moment einigermaßen ruhig scheinen. Abgesehen von dieser unglückseligen toten Frau, heißt das.«
»Wir haben jeden verfügbaren Mann draußen auf der Straße, Sir«, sagte Barrett. »Um dafür zu sorgen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Sie hätten gestern hier sein müssen! Es war wie die verdammte Schlacht von Waterloo.«
»Ich trommle gleich morgen früh als Erstes eine Reihe von Constables zusammen, die an den Türen klopfen, Sir«, sagte Morris. »Es ist zu spät, um jetzt noch jemanden zu finden. Die Verzögerung macht sicher keinen Unterschied; ich schätze, niemand will etwas gehört haben. Außerdem ist es zu dunkel, als dass man etwas hätte sehen können. Und selbst wenn, niemand wird es zugeben. Sehen wir den Tatsachen ins Auge, wer würde schon Notiz nehmen von ein paar Schreien oder einer Rauferei? Irgendwo in der Gegend ist doch immer Trara, nach den Worten des jungen Evans zu urteilen.«
Damit hatte Morris durchaus recht, obwohl ich insgeheim immer noch vermutete, dass Phipps übertrieben hatte mit seiner Schilderung der jüngsten Zunahme von Schlägereien und dergleichen. Wir mochten im Moment viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen, aber die Einschätzung von Morris war meiner Meinung nach durchaus zutreffend. Niemand würde zugeben, etwas gesehen zu haben, geschweige denn, eine Frau, die um Hilfe gerufen oder geschrien hatte.
Was Verdächtige anging, so würden wir mehr haben, als uns lieb sein konnte. Ringsum gab es zahllose Spelunken und Bordelle, und verkommene Pensionen boten billige Zimmer feil für Seeleute aller Nationen. Ja, es gab häufig Gewalt, und in dieser Nacht hatte sich ein Mord ereignet.
Die Leiche lag ein Stück abseits, geziemend bedeckt mit einer Plane. Ich gab Evans ein Zeichen, die Abdeckung zurückzuziehen, so dass ich sie im spärlichen Licht der Laterne so gut wie möglich in Augenschein nehmen konnte. Er kam meiner Aufforderung schluckend nach und huschte zu der Toten. Ich hoffte, dass er sich nicht übergeben musste.
Selbst im schwachen Lichtschein und trotz ihrer grässlichen Verletzungen war mir sofort klar, dass es sich bei der Ermordeten nicht um eine der zahllosen Straßendirnen Londons handeln konnte. Vielleicht war das die Ursache für die Nervosität von Phipps gewesen. Sie war stämmig gebaut und respektabel gekleidet, auch wenn ich keinen Hut und keine Haube entdecken konnte, auch kein Umhängetuch und keinen Mantel. Sie sah aus, als wäre sie aus einem der umgebenden Häuser in die kalte Nachtluft herausgetreten, nur für einen kurzen Augenblick, um irgendeine triviale Besorgung zu erledigen. Selbst um diese späte Nachtzeit hatten noch viele der kleinen Läden geöffnet, wie mir bereits auf der Fahrt hierher aufgefallen war. Nicht nur Halsabschneider und Raufbolde waren in der Gegend unterwegs, sondern auch Bürger von der anständigeren Sorte waren zu sehen: Arbeiter auf dem Heimweg von ihrer Schicht oder Hausfrauen, die noch schnell etwas einkaufen wollten, um das Abendessen zuzubereiten, oder sogar ein Kind, das mit ein paar Pennys losgeschickt worden war, um etwas Tee zu kaufen. Wenn man arm war, kaufte man Tee nicht in Dosen, sondern gerade so viel, wie man benötigte, um eine Kanne aufzusetzen. Eine winzige Portion in ein Stück Papier eingeschlagen. War die tote Frau zu einer solchen Besorgung unterwegs gewesen? Wartete ihre Familie vielleicht sogar jetzt noch, in diesem Moment, auf ihre Rückkehr?
Ich beugte mich vor und betastete den Saum ihres Rocks. Im unzureichenden Licht erschien er von dunkler Farbe. Der Stoff war von guter Qualität, der Saum mit einer Borte besetzt, doch ansonsten ohne Verzierungen. Sie war keine sehr arme Frau gewesen, und mein erster Gedanke, dass sie einen Einkauf in letzter Minute hatte erledigen wollen, schien nun weniger vorstellbar. Sie gehörte zu der Sorte, die eine gut gefüllte Speisekammer im Haus hatte. Eine respektable Frau, auf den ersten Blick, und das konnte ausreichend gewesen sein, um Phipps in Besorgnis zu versetzen.
Es war nicht leicht, ihr Alter einzuschätzen, denn eine Seite ihres Kopfes war übel zugerichtet worden. Ich schätzte sie auf Mitte fünfzig. Sie trug keine Ohrringe und keinen Ehering. Vielleicht hatte der Mörder ihren Schmuck mitgenommen. Oder der elende Harry Parker hatte die Leiche ausgeraubt, bevor er Alarm geschlagen hatte. Ich hielt es nicht für ausgeschlossen.
Ich zog Barrett beiseite. Parker, unübersehbar erleichtert, aus der Obhut des Constables entlassen zu werden, beobachtete uns gespannt.
»Hat der Mann Blut an sich?«, fragte ich Barrett.
»Ja, Sir«, antwortete der Constable mit leiser Stimme. »Am rechten Ärmel, Sir, und an den Händen. Er sagt, er hätte sich gebückt und sie an der Schulter gerüttelt, nachdem er über sie gestolpert war. Er dachte, sie wäre betrunken. Doch dann hat er ein Streichholz angezündet und ihre Verletzungen und das viele Blut gesehen, und ihm wurde klar, dass sie tot sein musste.«
»Wir dürfen ihn nicht gehen lassen«, warnte ich. »Bringen Sie ihn zur Wache und durchsuchen Sie seine Taschen. Anschließend nehmen Sie seine Aussage zu Protokoll und seine Personalien auf. Überzeugen Sie sich, dass er die richtige Adresse angibt. Entweder überprüfen Sie sie selbst oder, falls nötig, schicken Sie einen Kollegen mit ihm nach Hause. Sorgen Sie dafür, dass er sich umzieht, und nehmen Sie die blutbefleckte Kleidung an sich. Bringen Sie sie zu weiteren Untersuchungen mit zurück. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Mr. Parker bedingungslos glauben dürfen.«
Von der Straße erklang das Rattern von Rädern. Ein geschlossener Wagen war eingetroffen, um das Opfer zur Leichenschau abzutransportieren. Das Geschnatter der Stimmen von den Fenstern über uns verstummte für einen respektvollen Moment.
»Sie bleiben hier, Morris«, sagte ich. »Überwachen Sie die Vorgänge. Sichern Sie den Bereich, so dass wir morgen in aller Frühe zurückkehren und den Tatort bei Tageslicht in Augenschein nehmen können. Melden Sie sich morgen früh bei mir zum Rapport.«
»Ja, Inspector Ross«, antwortete Morris resigniert.
Es tat mir leid, ihn zurücklassen zu müssen, doch ich konnte für den Moment nicht mehr tun. Ich machte mich auf den Weg nach Hause zu meiner Frau.
KAPITEL ZWEI
Mein kleines Haus stand in der Nähe des großen Bahnhofs von Waterloo. Ich befand mich zwar bereits am Südufer, doch es war immer noch ein gutes Stück entfernt, und es war wenig wahrscheinlich, hier eine Droschke zu finden, die mich nach Hause bringen würde. Also lenkte ich meine Schritte in Richtung Themse in der Hoffnung, dort eine Fähre zu finden, die mich ein Stück weit flussaufwärts bis in die Nähe der Waterloo Bridge bringen würde.
Den Fluss zu finden war nicht besonders schwer. Ich musste nur meiner Nase folgen. Die Docks und Werften lagen nur ein paar Straßen entfernt. In Deptford wurden schon seit den guten (oder schlechten, je nach Standpunkt) alten Zeiten von König Heinrich VIII. Schiffe für die Royal Navy gebaut. Angesichts derartiger Protektion war es zwangsläufig, dass eine Gegend aufblühte. So auch Deptford, zumindest eine Zeit lang. Damals hatte offenes Land zwischen der Gemeinde und den seuchengeplagten armseligen Hütten von London gelegen, und so hatten vornehme Bürger ihre Häuser hier erbaut. Königin Elizabeth hatte Deptford persönlich besucht, um Francis Drake bei der Rückkehr von seinen Kaperfahrten zu begrüßen. Hier in Deptford hatte sie ihn zum Ritter geschlagen, auf seinem eigenen Schiff, das vor Anker gelegen hatte. Und es war eine Pfütze in Deptford gewesen, so behaupteten die Einheimischen, wo Sir Walter Raleigh seinen Mantel ausgebreitet hatte, um seiner Monarchin zu ersparen, dass sie sich die Schuhe schmutzig machte. Selbst ein so exotischer Besucher wie der russische Zar Peter war nach Deptford gekommen, um den Schiffsbauern bei der Arbeit zuzusehen inmitten all des Hämmerns und Sägens und des überwältigenden Gestanks von kochendem Teer.
Seit damals hatte der immer weiter wachsende, unersättliche Moloch London die Felder und kleinen Gehöfte aufgefressen und alles unter Ziegeln begraben. Seither war Deptford nahezu ständig unter dem Leichentuch des Londoner Nebels begraben und hatte seine Beliebtheit bei den Gutbetuchten verloren. Schlimmer noch, die große Werft war kürzlich bei der Royal Navy in Ungnade gefallen. Moderne Schiffe hatten Rümpfe aus Eisen. Die Aufträge gingen an andere Werften.
Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig war ebenfalls verschwunden, nachdem die berüchtigten Gefangenentransporte nach Australien endlich eingestellt worden waren. »Eine wahre Schande«, lamentierten die Schiffseigner und Seekapitäne von Deptford. »Es war eine regelmäßige Fracht.«
Ich bog in eine schmale und verlassene Gasse ein. An beiden Enden standen Gaslaternen, doch ihr Lichtschein erhellte nur die umliegenden Mauern und reichte nicht bis zur Mitte, wo ein unheilvolles Loch aus unsicherer Schwärze auf mich wartete. Ich fragte mich unbehaglich, ob es klug gewesen war, das geschäftige Treiben und die Menschenmengen hinter mir zu lassen, und ob ich tatsächlich allein in der Gasse war. Das lauteste Geräusch war das meiner eigenen Schritte, doch da war noch etwas. Meine Ohren erfassten das Knarren ungeölter Räder hinter mir, und ein Rumpeln und Rattern verriet, wo sie über das unebene Pflaster rumpelten. Ich blieb stehen und fuhr herum.
Ein Handkarren war in die Gasse eingebogen und wurde mühsam in meine Richtung geschoben. Er war hoch beladen und die Fracht nur zum Teil durch eine Plane verdeckt. Das Gefährt wurde von einer seltsamen Kreatur bewegt. Ich sage Kreatur, weil die Gestalt im ersten Moment keinerlei Ähnlichkeit mit einem menschlichen Wesen aufwies. Mit der Gaslaterne an der Straßenecke im Rücken konnte ich zuerst kaum mehr erkennen als eine breite, unförmige Silhouette, vollkommen schwarz und mit flatternden Schößen zu beiden Seiten wie eine riesige Fledermaus. Sie war vornübergebeugt von der Anstrengung, den Karren zu schieben. Dann kam das Gefährt in den Lichtkegel einer flackernden Öllampe über einem Hauseingang, und ich konnte besser erkennen, wer die Kreatur dahinter war: ein Lumpensammler.
Es war ein weit verbreitetes Gewerbe und nichts Überraschendes. Unter der Plane konnte ich einen Haufen alter Kleidungsstücke erkennen sowie anderen Plunder. Eine Woge der Erleichterung erfasste mich, und ich schalt mich einen Toren, weil ich Augenblicke zuvor meiner Phantasie zum Opfer gefallen war. Was um alles in der Welt hatte ich erwartet? In diesem Moment kam mir der Mond zu Hilfe und warf sein bleiches Licht über den Mann.
Der Lumpensammler trug eine Auswahl der abgerissenen Kleidungsstücke, die er im Verlauf der Jahre gesammelt hatte: weite Hosen, eine Art Mantel mit Karomuster und ein schmuddeliges Halstuch. Über all dem einen schweren schwarzen Opernumhang, der früher einmal einem Theatergänger gehört haben musste, der aus einer reicheren Gegend der Stadt stammte. Ich konnte erkennen, dass er einen Samtkragen besaß. Es war dieser Umhang, der den Mann hatte aussehen lassen, als besäße er Flügel. Seine Haare, lang, grau und ungekämmt, fielen unter einem abgetragenen Zylinder herunter bis auf die Schultern – auch der Zylinder sah aus, als hätte ein Dandy ihn getragen, allerdings vor vierzig, fünfzig Jahren. Das Gesicht des Lumpensammlers war ausgemergelt und von tiefen Falten durchzogen. Er sah unglaublich alt aus, und ich wunderte mich, dass er überhaupt die Kraft aufbrachte, den schweren Karren über das Pflaster zu schieben. Als er meinen Blick bemerkte, teilten sich seine welken Lippen zu einer grotesken Karikatur von einem Grinsen und gaben den Blick frei auf zwei Reihen verfaulter Zähne, die mich an die Gebäude erinnerten, welche ich kurze Zeit zuvor hinter mir gelassen hatte. Sogar Lücken waren zu sehen, genau wie jene, die in den Hof führte, wo die ermordete Frau gefunden worden war.
»Guten Abend, Sir«, krächzte er und neigte zur gleichen Zeit den Kopf zur Seite. Die Falten der runzligen Haut auf seinen Wangen vertieften sich noch. Sein Blick schien nicht nur mich anzusehen, sondern auch meine Umgebung, sogar durch mich hindurchzugehen, alles auf einmal. Ich fühlte mich, als würde mich ein wildes Tier anstarren. Er war zweifellos älter, jedoch noch nicht so alt, wie ich im ersten Moment angenommen hatte.
»Guten Abend«, erwiderte ich seinen Gruß.
Er machte Anstalten, seinen Karren weiterzuschieben, doch ich hielt eine Hand vor, um ihn zu stoppen. Er tat wie gewünscht und stellte den Karren auf eine Holzstütze an einem Ende, bevor er die Hände von den Griffen löste. Allerdings richtete er sich nicht auf, sondern verharrte in der gebeugten Haltung. Vielleicht war seine Wirbelsäule deformiert oder vielleicht hatte er so viele Jahre damit verbracht, den Karren zu schieben, dass er einfach vergessen hatte, wie man gerade stand. Sein ausweichender Blick huschte immer noch über mich. Ich fühlte mich unbehaglich.
»Sie arbeiten regelmäßig in dieser Gegend?«, fragte ich ihn, und um ihn zu einer Antwort zu ermutigen, nahm ich einen Shilling aus der Tasche und streckte ihm die Münze entgegen.
Eine Hand, mehr eine Klaue als etwas Menschliches, schoss hervor und griff danach. Kalte, schuppige Finger streiften meine eigenen, und ich zuckte unwillkürlich zusammen.
»Polizei …«, krächzte er rau. »Von der zivilen Sorte, stimmt’s?«
Ich war nicht überrascht, dass er mich so leicht erkannte. Die Armen, ob sie einer rechtmäßigen Tätigkeit nachgingen oder nicht, hatten ein untrügliches Gespür für das Gesetz.
»Das ist richtig«, antwortete ich.
»Ich sammle Lumpen«, antwortete er. »Überall, nicht nur hier in der Gegend. Wo Leute wohnen, werfen sie Sachen weg. Ich gehe sogar über den Fluss, nach Westen rauf. Da gibt es gute Sachen.«
Dort musste er den Opernmantel und den Zylinder gefunden haben. Ich wunderte mich, dass er überhaupt die Kraft hatte, den Karren so weit zu schieben.
»Waren Sie am frühen Abend in dieser Gegend hier?«
Er sah mich blinzelnd an. »Ich war hier. Ich war vorher in Greenwich. Ich war beim Seaman’s Hospital.«
Ich rief mir ins Gedächtnis, wo das Seaman’s Hospital lag. Es war kein Gebäude, sondern ein Schiff, und zwar eines mit einer berühmten Historie als Linienschiff. Die Navy hatte keine Verwendung mehr dafür gehabt und es an eine philanthropische Gesellschaft verkauft, die ihrerseits ein schwimmendes Krankenhaus für Seeleute daraus gemacht hatte. Der Fluss bildete eine natürliche Sperre zwischen ihren Krankheiten und der Stadt.
»Was haben Sie dort gefunden?«, fragte ich ihn. Das Hospital war kein Ort, den viele freiwillig besuchten.
Er bedachte mich mit einem listigen Blick aus den Augenwinkeln und beugte sich in meine Richtung, als wollte er mir etwas Vertrauliches mitteilen. Ich war nicht sicher, ob ich es hören wollte.
»Sie haben oft Fetzen von Stoff für mich. Die Fieberkranken und so. Das Hospital verbrennt die meisten Sachen, die sie anhaben, wenn sie dorthin gebracht werden. Was übrig bleibt, wenn sie gestorben sind, das braucht niemand mehr, und keiner meldet sich, und ich kann es kriegen.«
Ich wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Er bemerkte es und bedachte mich mit einem scheußlichen Grinsen.
Ich konnte nicht anders; mein Blick ging voller Horror auf den Stapel Lumpen auf seinem Karren. Ich versuchte, nicht daran zu denken, welche unaussprechlichen Krankheiten sich darin eingenistet hatten, zusammen mit den unzähligen Läusen und Flöhen. Ich hoffte, dass er recht hatte und das Hospital die abgelegten Sachen der Fieberkranken tatsächlich verbrannte. Es war nicht selten, dass pockenkranke ausländische Seeleute ins Hospital eingeliefert wurden.
»Sie haben nicht vielleicht …« Meine Stimme klang in meinen eigenen Ohren angespannt. »Sie haben nicht vielleicht früher am Abend eine respektabel gekleidete Frau im mittleren Alter bemerkt, von stämmiger Statur? Vor vielleicht drei Stunden? Allein oder in Begleitung eines Mannes?«
»Eine Hure?«, krächzte er.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, eine respektable Person, dem Aussehen nach.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ich hab nichts gesehen. Ich sehe nur hin, wenn ich denke, sie haben vielleicht was für mich.« Dann fügte er unvermittelt hinzu: »Es hat einen Mord gegeben heute Abend, nicht wahr? Dort hinten?« Er deutete in Richtung der Gegend, aus der ich gekommen war.
»Das ist richtig. Woher wissen Sie davon?«, fragte ich in scharfem Ton.
Er schnaubte und rieb sich mit der dreckigen Klauenhand über das Gesicht. »Mord? Jeder hört es, und sie reden tagelang von nichts anderem. Ich war im Clipper, um meine trockene Kehle zu schmieren, und dort hab ich es gehört.«
»Wie heißen Sie?«, wollte ich von ihm wissen.
»Lumpen-Jeb. So werde ich gerufen. Sie können jeden hier in der Gegend nach mir fragen. Die Leute kennen mich.«
»Und Ihr Familienname?«
»Fisher«, antwortete er. »Den Namen haben sie mir im Arbeitshaus gegeben, weil sie mich aus dem Fluss gefischt haben, als ich ein kleines Baby war. Irgendjemand hat mich hineingeworfen wie einen Sack voll Müll. Meine Windeln hatten sich in einem Stück Holz verfangen, und deswegen war ich lange genug über Wasser, bis mich ein Leichtmatrose herausfischen konnte. Meine Familie war das Arbeitshaus. Ich kenne sonst niemanden.«
Eine Kindheit in einer so unerbittlichen Einrichtung war keine Kindheit. Er hatte trotzdem irgendwie überlebt.
»Nun, Jeb Fisher, wenn Sie etwas hören in Bezug auf diesen Mord, von dem Sie glauben, es könnte mich interessieren, oder wenn Sie jemanden sagen hören, er glaubt, er hätte diese Frau gesehen, dann kommen Sie zu mir in den Scotland Yard und erzählen es mir. Inspector Ross ist mein Name.«
»Und was springt für mich dabei heraus?«, versuchte er zu handeln.
»Sie erhalten eine Belohnung, wenn sich das, was Sie erzählen, als wahr erweist. Kommen Sie nicht mit erfundenen Geschichten.«
Er nickte, und ohne ein weiteres Wort wandte er sich um und packte die Griffe seines Karrens, um mitsamt der Ladung schwärender Lumpen weiterzuziehen. In diesem Moment durchfuhr mich, obwohl ich durch meine Erfahrungen während langer Dienstjahre abgehärtet war, ein solcher Schock, dass ich einen erschrockenen Laut von mir gab.
Die Plane über den Lumpen bewegte sich. Mein erster Gedanke war, dass sich eine Ratte auf den Karren geschlichen hatte. Doch es war viel schlimmer. Eine kleine, sehr kleine menschliche Hand kam unter der Plane hervor. Winzige Finger packten den Rand, um sie wieder an ihren Platz zu ziehen. Ich trat vor und schlug sie vollends zurück. Dort vor mir, inmitten all der Lumpen, saß zusammengekauert ein kleines Kind.
Es war ein Mädchen, nicht älter als vier oder fünf Jahre, mit langen, zerzausten blonden Haaren und den hellen Augen von etwas Wildem, Ungezähmtem. Sie trug ein zerknittertes, schmuddeliges Samtkleid, viel zu groß für ihre zarte Gestalt, und einen gehäkelten Umhang darüber, gehalten von einer Nadel. Sie starrte mit einem Gesichtsausdruck zu mir hoch, der berechnend und vollkommen unkindlich war.
Entsetzt wandte ich mich an Fisher. »Wer ist das?«, wollte ich von ihm wissen.
Er antwortete mit einem heiseren Kichern. »Sie ist meine Enkeltochter, Herr. Sie kommt oft mit, wenn ich meine Runden mache. Sag dem Herrn Guten Abend, Sukey.«
Das Kind, das keinerlei Angst vor mir zu haben schien, gehorchte artig. »Guten Abend, mein Herr«, sagte es.
»Wie kommen Sie dazu, ein Kind auf diesen Karren voller Dreck und Läuse zu setzen?«, herrschte ich ihn ungehalten an.
»Sie lernt das Geschäft«, antwortete er selbstzufrieden.
»In ihrem Alter? Sie ist noch ein Kind!«
»Man ist nie zu jung zum Lernen«, entgegnete er. »Sie ist gut fürs Geschäft, meine Sukey. Wenn wir in respektablen Gegenden sind, auf Straßen, wo die Leute ein wenig Geld haben und gute Sachen, schicke ich sie zur Tür und warte bei meinem Karren. Sie würden mich wegschicken, verstehen Sie, auf der Stelle. Aber sie schicken Sukey nicht weg. Sie sagen ihr, dass sie warten soll, und dann kramen sie etwas für sie hervor, in hübschen Farben, und geben es ihr. Ich habe auf diese Weise ein paar hübsche Stücke gekriegt.«
»Aber was macht sie unter dieser verdreckten Plane, zwischen all den dreckigen Lumpen?«
»Es ist warm und gemütlich. Nicht wahr, Sukey? Es ist eine kalte, ungemütliche Nacht. Unter der Plane hat sie es warm.«
»Und was ist mit all den Krankheiten in den Lumpen?«, herrschte ich ihn an.
»Sie wurde zwischen Lumpen geboren, Herr. Sie lebt zwischen den Lumpen, genau wie die Mutter und meine ganze Familie. Wir werden nicht krank. Wir haben, was man natürlichen Schutz nennt. Es gibt keine gesünderen Leute als uns Lumpensammler. Sag dem Inspector Gute Nacht, Sukey.«
»Gute Nacht, Inspector«, piepste das Mädchen und krabbelte unter die Plane zurück.
»Wir sind bald zu Hause, Sir«, sagte ihr Großvater (falls er das wirklich war). »Sie ist nicht mehr lang auf dem Karren.«
Mit diesen Worten schob er den Karren an, und das schwere Gefährt setzte sich knarrend und rumpelnd in Bewegung.
Ich sah ihm hinterher. Eine Tür wurde aufgerissen, als er vorbeikam, und für einen Moment waren er und der Karren in das helle Licht aus dem Hauseingang getaucht. Dann war er verschwunden, um die Ecke und auf dem Weg zu dem elenden Quartier, in dem er und seine unglückselige Familie hausten. In diesem Moment entdeckte, wer auch immer neugierig genug gewesen war, um die Tür zu öffnen, meine Person, und die Tür wurde hastig wieder zugeschlagen. Ich blieb allein in der Dunkelheit zurück.
Ich hatte den Lumpensammler oder seine unappetitliche Ladung nicht angerührt, doch mich juckte es am ganzen Körper.
KAPITEL DREI
Elizabeth Martin Ross
Wenn man mit einem Beamten des Gesetzes verheiratet ist, kann man niemals vorhersagen, um welche Zeit er des Abends nach Hause kommt. Aus diesem Grund gab es in unserem kleinen Haus bei der Waterloo Station eine ganze Reihe von verkochten Abendmahlzeiten, zusammen mit kalten Platten, die auf Bens Heimkehr warteten. Auch an diesem Tag würde Ben später als üblich nach Hause kommen, denn er war außerhalb der Stadt unterwegs gewesen, in Cambridge. Was mir unerwartet freie Zeit verschafft hatte, und diese hatte ich genutzt, um meiner Tante Parry auf der anderen Seite des Flusses einen überfälligen Pflichtbesuch abzustatten. Sie war eine wohlhabende Witwe und wohnte im schicken Stadtteil Marylebone, am Dorset Square.
Aus genau diesem Grund war auch ich erst spät nach Hause gekommen. Ich hatte ziemlich fest damit gerechnet, Ben bereits dort anzutreffen, selbst unter Berücksichtigung der Zeit für die Rückfahrt von Cambridge nach London. Doch sowohl unser Wohnzimmer als auch die obere Etage lagen dunkel und verlassen. Ich hatte unser Hausmädchen Bessie zu Tante Parry mitgenommen, und so war das Haus kalt. Ich gab Bessie den Auftrag, das Feuer im Wohnzimmer anzumachen, bevor sie in die Küche ging, um Kartoffeln zu schälen. Anschließend ging ich nach oben, um meinen Sonntagshut abzunehmen und mir eine Schürze umzubinden, bevor ich Bessie in der Küche Gesellschaft leistete. Ich war auf dem Heimweg in eine Fleischerei gegangen und hatte dort eine große Portion Steaks und Nieren mit gut gebräunter Kruste erstanden. Wenn das nach einem hastig zusammengestellten Mahl klingt, dann zu Recht.
Ich sollte erklären, dass Tante Parry nicht wirklich meine Tante war, sondern die Witwe meines Patenonkels Josiah Parry. Sie war so freundlich gewesen, mir ein Heim und eine Anstellung als ihre Gesellschafterin anzubieten, als ich nach London gekommen war. Dass ich sie verlassen hatte, um zu heiraten, und zu ihrer weiteren Bestürzung ausgerechnet einen Polizisten, war etwas, das sie mir nur schwer vergeben konnte. Nicht, dass ich als Gesellschafterin ein großer Erfolg gewesen wäre mit meiner Neigung, in Angelegenheiten verwickelt zu werden, mit denen sich keine wirkliche Dame abgeben sollte (Mord zum Beispiel). Doch Tante Parry fühlte sich schnell vernachlässigt und liebte es, mich daran zu erinnern, dass ich sie im Stich gelassen hatte. Bessie hatte ebenfalls am Dorset Square gearbeitet, als Küchenmädchen, und war mit mir gegangen, als ich meinen eigenen Haushalt gegründet hatte. Auch darüber pflegte sich Tante Parry gelegentlich zu beschweren, wenngleich ein Küchenmädchen leicht zu ersetzen war. Es hätte mich nicht überrascht, wenn Tante Parry die arme Bessie vorher niemals im Untergeschoss hatte schuften sehen; nichtsdestotrotz war es ein Punkt auf ihrer langen Liste von Missständen.
Mein Besuch an diesem Tag war schwieriger gewesen als für gewöhnlich, weil ich zu meinem Erstaunen Tante Parry in noch größerer Not vorgefunden hatte als normal. Ihr Hausarzt hatte ihr eine strenge Behandlung verordnet.
»Eine strenge Behandlung?«, hatte ich erstaunt gefragt.
»Eine strenge Behandlung!« Ihre Stimme zitterte vor Empörung. Das Zittern pflanzte sich von ihrem Mund aus fort wie die Ringe, die ein in einen Teich geworfener Stein verursacht, bis ihre gesamte substantielle Gestalt ein einziges Beben war.
Als ich noch ihre Gesellschafterin gewesen war, hatte ich oft Tante Parrys Levers beigewohnt. Während Nugent, ihre Zofe, sorgfältig ihr Haar in lange Locken onduliert hatte, um hernach alles in einen Hochzeitskuchen von einem Arrangement hochzustecken, hatte ich den ermüdenden Plänen lauschen müssen, wen sie alles mit mir zusammen an diesem Tag besuchen wollte. Meine Augen hatten oft Ablenkung gesucht im Studium eines Porträts an der Wand. Ich wusste, dass die Frau auf dem Porträt die junge Tante Parry gewesen war, unmittelbar vor ihrer Heirat mit meinem Patenonkel Josiah. Sie war seine zweite Frau gewesen, und es hatte einen beträchtlichen Altersunterschied gegeben. Das Gemälde zeigte eine junge Frau in einem rosafarbenen seidenen Ballkleid im Stil von etwa 1830, mit den tief sitzenden Ballonärmeln jener Epoche, angenäht an ein Oberteil, das gerade über ihrem Busen verlief. Die Frau hatte einen frischen Strauß wilder Blumen im Schoß, als wäre Blumenpflücken auf dem Land in einem rosafarbenen Seidenkleid das Natürlichste von der Welt. Ihr Haar trug sie in dicken Ringellocken, und es rahmte ein rundliches, wenngleich attraktives Gesicht mit einem kleinen Mund und großen blauen Augen ein. Um die Lippen spielte ein rätselhaftes Lächeln. Das Haar – echt oder falsch – war mit Hilfe einer Art Rahmen um den Kopf zu einem Apolloknoten gewickelt. Das ganze Porträt erinnerte mich an einen Cherubim, den man in ein Korsett gezwungen hatte. Nichtsdestotrotz konnte ich erkennen, was Onkel Josiah an ihr anziehend gefunden hatte.
Seit damals war aus dem Cherubim leider eine sehr übergewichtige Frau in mittlerem Alter mit einem verdrießlichen Gesichtsausdruck geworden. Die blauen Augen verrieten Enttäuschung über die Welt und den Lauf der Dinge, und sie hellten sich nur noch auf beim Anblick einer überladenen Essenstafel. Aus diesem Grund war ich nicht überrascht, dass ihr Arzt endlich den Mut gefunden hatte, ihr eine Diät zu verordnen. Dazu war zweifellos ein tapferer Mann nötig gewesen …
»Ist das die Verordnung Ihres üblichen Hausarztes?«, fragte ich.
Tante Parrys türkisfarbene Ohrringe tanzten aufgeregt, als sie den Kopf schüttelte. »Dr. Bretton ist ein so lieber Mann. Ich glaube nicht, dass er je so streng zu mir gewesen wäre. Aber er konnte meine Atemlosigkeit, meine Müdigkeit und das schlimme Herzbrennen nicht mehr erklären, unter dem ich leide. Er verwies mich an einen Spezialisten, einen Dr. Bruch.«
Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Er ist Deutscher und allem Anschein nach sehr angesehen.« Ihre Miene hellte sich auf. »Er wird von den besten und wichtigsten Persönlichkeiten zu Rate gezogen.«
»Ich bin sicher, Dr. Bretton hätte Sie nicht zu einem weniger gut beleumundeten Kollegen geschickt, Tante Parry«, sagte ich. Also hatte Dr. Bretton bei dem Gedanken daran, ihr die Diät selbst verordnen zu müssen, gekniffen und den Kelch an die nächstbeste Person weitergereicht, so schnell er nur konnte.
»Ganz bestimmt nicht!«, empörte sich Tante Parry. »Dr. Bretton war immer sehr besorgt um meine Gesundheit. Nun ja, wie dem auch sei, Elizabeth«, fuhr sie munter fort. »Ich habe die Behandlungsräume von Dr. Bruch in der Harley Street mit vollstem Vertrauen aufgesucht. Ich habe meine Symptome detailliert geschildert, einschließlich …« Sie senkte erneut die Stimme, »… einschließlich der wiederholten Unpässlichkeiten bei der Verdauung.«
Sie warf die dicken Hände in die Luft. »Und das war seine Antwort! Dass ich mich bewegen soll! Eine Frau in meinem angegriffenen Gesundheitszustand! Wie könnte ich? Und dass ich Gewicht verlieren soll! Selbst wenn so etwas wünschenswert und möglich wäre, diese schreckliche Diät bedeutet, dass man mich des unschuldigen Vergnügens meines Nachmittagstees beraubt hat! Zweifellos hast du dich bereits gefragt, wieso Simms an diesem Nachmittag so ein dürftiges Tablett hereingebracht hat!«
Tante Parrys Blick ging trübselig zu den Krümeln, die alles waren, was von einem Mohnkuchen übrig geblieben war, und dem inzwischen leeren Teller, auf dem dünne Scheiben Brot mit einem mageren Aufstrich von Erdbeermarmelade gelegen hatten. Es stimmte in der Tat, ich hatte mich bereits gefragt, was die ungewohnte Frugalität bedeutete.
»Keine Hörnchen!« Tante Parrys Stimme klang geradezu grabesschwer. »Keine Muffins, kein Teegebäck, keine Rosinenküchlein, keine Kekse, nichts. Nicht einmal die einfachsten. Ganz zu schweigen von den leckeren Sachen wie Liebesknochen oder Baisers …« Sie seufzte erneut. »Ich habe schon fast vergessen, wie sie aussehen.«
»Und die Bewegung?«, erkühnte ich mich zu fragen, während ich gespannt wartete, ob die bloße Erwähnung weitere Empörung in den Schichten aus Seide und Spitzen mir gegenüber auslösen würde.
Die Reaktion war unerwartet heftig. Tante Parry packte die Armlehnen ihres Sessels. Ihr Teint, auch zu normalen Zeiten schon sehr gerötet, verdunkelte sich zu einer alarmierenden Schattierung von Violett, passend zu ihrem Morgenrock. Ihre Augen blitzten.
»Wie du weißt, Elizabeth, würde ich normalerweise meine Korrespondenz vom Bett aus erledigen und mich nur erheben, wenn sie beantwortet wurde. Dann pflegt Nugent mir beim Ankleiden zu helfen und mein Haar zu richten. In glücklicheren Zeiten war das der Augenblick für ein leichtes Mittagessen.«
Ich hatte an Tante Parrys Mittagstisch gesessen, als ich noch hier gelebt hatte, und die Mengen, die von der unermüdlichen Mrs. Simms hereingebracht worden waren, waren immer mehr als genug gewesen, um für den Rest des Tages auszureichen. Unnötig zu erwähnen, dass sie im Fall von Tante Parry nur bis zum Nachmittag, höchstenfalls bis zum Tee gereicht hatten, gefolgt von einem üppigen Dinner am Abend.
»Allerdings muss ich mich nun – dank der Verordnung von Dr. Bruch – bereits um zehn Uhr morgens erheben und ankleiden. Um zehn Uhr morgens, Elizabeth!«
»Unser Haushalt ist bereits um halb sieben auf, Tante Parry«, antwortete ich unklugerweise.
»Mit ›unser Haushalt‹ meinst du vermutlich die eine Magd, die in deinen Diensten steht. Sie sollte in der Tat um halb sieben bei der Arbeit sein! Aber um welche Zeit stehst du auf, mein Kind?«
»Nicht lange danach«, gestand ich. »Mein Ehemann muss um Punkt acht Uhr seinen Dienst beim Scotland Yard antreten, verstehen Sie?«
Tante Parry musterte mich mehr sorgenvoll als streng. »Du warst es, die unbedingt diesen Polizeibeamten heiraten wollte!«, sagte sie. »Du hättest hier bei mir bleiben können, in einem gemütlichen, komfortablen Heim!«
»Ich werde Ihnen immer dankbar sein für die Freundlichkeit, die Sie mir erwiesen haben, Tante Parry.« Ich fragte nicht, wo ihre derzeitige Gesellschafterin an diesem Nachmittag war. Hatte sie, wie all meine Nachfolgerinnen, die Flucht ergriffen?
Tante Parry war bereits zu ihrer wichtigsten Sorge zurückgekehrt: ihrer eigenen Person. »Und nun muss ich mich morgens anziehen und mich mit einem geradezu lächerlichen Frühstück aus einem einzigen gekochten Ei und zwei Scheiben Toast begnügen. Dr. Bruch hat mich informiert, dass ich stattdessen auch eine Schale Porridge zu mir nehmen darf, wenn ich dies wünsche. Stell dir vor, Elizabeth! Porridge! Das wird aus Hafer gemacht! Bin ich vielleicht ein Pferd? Nach dem Frühstück muss ich meine Korrespondenz ignorieren und mich von James zum Regent’s Park fahren lassen. Dort muss ich in Begleitung von Nugent eine halbe Stunde umhergehen. Und das in dieser grausigen, kalten Jahreszeit! Ich habe Dr. Bruch gesagt, wenn ich mir eine Lungenentzündung von der schlimmsten Sorte zuziehe, dann nur, weil ich seinem Rat gefolgt bin!« Tante Parrys fest in ein Korsett geschnürter Oberkörper beugte sich in meine Richtung. »Er hat nur gelacht, Elizabeth! Er hat nur gelacht!«, vertraute sie mir in einem erstickten Flüstern an.
»Gelacht, Tante Parry? Das kann ich nicht glauben … Ein Arzt?«
»Nun ja, gekichert vielleicht«, räumte Tante Parry ein. »Er hat meine protestierenden Worte zumindest mit ungebührlichem Gleichmut aufgenommen. Er sagte, ich müsse mich halt warm genug anziehen, und dann würde es mir schon an nichts fehlen. Wie dem auch sei, nach dem Spaziergang soll James mich hierher ins Haus bringen, wo mich ein frugales Mittagessen aus kaltem Fleisch und Reispudding erwartet. Und nicht einmal ein ordentlicher Nachmittagstee, um dieses Mahl zu kompensieren!« Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort: »Aber sobald Patience da ist, lasse ich uns mehr Tee bringen, und ich bin sicher, Mrs. Simms findet etwas Passendes zum Essen dazu.«
»Wir erhalten Gesellschaft von Franks Verlobter, Miss Wellings?«, fragte ich überrascht.
Frank Carterton war der Neffe von Tante Parry. Er war kürzlich ins Parlament gewählt worden – und hatte sich kurz darauf verlobt, um in nächster Zeit zu heiraten. Tante Parry sorgte sich wegen beider Vorkommnisse. Ich hatte Patience flüchtig kennen gelernt, als sie kurz nach der Verlobung zusammen mit ihren Eltern nach London gekommen war. Mr. und Mrs. Wellings hatten unübersehbar großen Respekt vor Tante Parry gehabt. Patience hingegen war gelassener gewesen. Sie war mir als fröhlicher, praktischer Mensch erschienen, mit hübschen dunklen Locken. Ich hatte sie gleich gemocht. Das war auch gut so, denn Frank hatte mich zur Seite gezogen und mich in vollem Ernst gefragt, was ich von Patience hielt. Ich hatte ihm versichert, dass er meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Wahl getroffen hatte. Er war offensichtlich erleichtert gewesen über meine Antwort.
»Ich freue mich, Miss Wellings wiederzusehen«, sagte ich. »Sind ihre Eltern ebenfalls in London?«
Tante Parry schüttelte den Kopf. »Nein, geschäftliche Angelegenheiten verlangen, dass ihr Vater zu Hause bleibt, und ihre Mutter hat anderweitige Verpflichtungen. Patience wohnt bei Verwandten in Goodge Place. Sie heißen Pickford.«
Sie zögerte kurz, bevor sie ihren massigen Oberkörper erneut vorbeugte, was eine weitere Vertraulichkeit signalisierte.
»Elizabeth, ich fürchte, der arme Frank stürzt sich voreilig in diesen Ehebund! Die Verlobung kam so plötzlich. Ich bin sicher, sie kam durch die Insistenz dieses Mr. Gladstone zustande. Ich habe keine Bedenken gegen Patience. Sie ist ein wohlerzogenes, höfliches und freundliches Mädchen, und es fällt leicht, sie gernzuhaben. In einem Jahr oder zwei, mit dem richtigen Einfluss und den nötigen Aufmunterungen, könnte sie richtig erstrahlen. Doch ihre Familie ist provinziell, und ihr fehlt es an Erfahrung mit der eleganten Gesellschaft. Patience ist noch sehr jung und könnte leicht den einen oder anderen schrecklichen Fauxpas begehen. Sie ist kaum mehr als ein Kind, gerade erst neunzehn. Oh, Elizabeth! Sie ist eine richtige kleine Wilde, so sehr mangelt es ihr an Kenntnis über die Welt! Jedes Mal, wenn sie die Lippen öffnet, fürchte ich mich vor dem, was sie sagen könnte! Der gute Frank findet das natürlich bezaubernd, was sonst?«
»Sie wird lernen«, versuchte ich Tante Parry zu trösten.
»Aber von wem?«, entgegnete Tante Parry scharf. »Habe ich nicht gerade erst gesagt, dass ihr engster Kreis nicht sonderlich niveauvoll ist?« Vielleicht wurde ihr bewusst, dass sie überkritisch erschien. Wie dem auch sei, als sie fortfuhr, war ihr Tonfall deutlich gnädiger. »Ich nehme an, sie sind eine der vornehmeren Familien in Franks Wahlkreis, durchaus angesehen, und sie haben ein wichtiges Wort in lokalen Angelegenheiten mitzureden. Im Park dort gibt es eine Statue von ihrem Großvater. Ich glaube, der Grund ist, dass er die Eisenbahn in die Stadt gebracht und in großem Maß zum Wohlstand dort beigetragen hat. Frank hat mir erzählt, ihr Vater hätte ein schönes großes Haus im gotischen Stil erbaut. Nichtsdestotrotz, die Stadt ist und bleibt ein alltäglicher Ort voll Schmutz und Industrie. Frank hat mir verraten, dass sie beständig unter einer dichten schwarzen Rauchwolke aus den Brennöfen liegt.« Sie seufzte. »Ich fürchte, dass der gute Frank selbst ein unschuldiger Naivling bleiben könnte, trotz seiner exzellenten Ausbildung und der Tatsache, dass er so viel Zeit hier am Dorset Square verbracht hat.«
Es war gut, dass ich meine Teetasse abgesetzt hatte, sonst wäre sie mir wahrscheinlich aus der Hand gefallen. Frank ein Naivling? Unschuldig? Wohl kaum. Freundlich, ja, und gutmütig. Aber als ich ihm zum ersten Mal begegnet war, war er sehr damit beschäftigt gewesen, sich die Hörner abzustoßen. Er hatte dies sehr geschickt vor seiner in einer Affenliebe zu ihm verfangenen Tante versteckt. Mehr noch, nach einer kurzen Karriere im diplomatischen Dienst saß er inzwischen in Westminster als Repräsentant eines Wahlkreises in den Potteries, mit all den Problemen, die die Industrialisierung mit sich brachte. Ich bezweifelte stark, dass Frank in irgendeiner Hinsicht naiv war.
»Ähm …«, war alles, was mir als Erwiderung einfiel.
Glücklicherweise ging genau in diesem Moment die Türglocke.
Tante Parry richtete sich kerzengerade auf. »Oh, gut«, sagte sie strahlend. »Das wird die liebe Patience sein. Es gibt neuen Kuchen! Mrs. Simms hat sicher noch Kuchen irgendwo unten in der Küche.« Und in leisem, vertraulichem Tonfall fügte sie hinzu: »Wir setzen unsere Unterhaltung ein andermal fort, Elizabeth.«
Was immer Tante Parry in Sorge versetzte, ich würde es nicht erfahren, zumindest jetzt noch nicht.