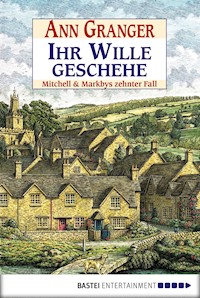9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jessica Campbell ermittelt
- Sprache: Deutsch
Das Key House ist ein leerstehendes Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert und ein wenig heruntergekommen. Gervase Crown, der vermögende Besitzer, lebt inzwischen in Portugal. Niemand interessiert sich für das alte Haus, bis eines Tages ein Feuer darin ausbricht und man in der Asche die Leiche eines Mannes findet.
Zuerst fürchtet man, dass es Gervase sein könnte, doch dieser lebt. Eine tödliche Verwechslung? Jessica Campbell beginnt zu ermitteln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
Ann Granger
ASCHEAUF SEINHAUPT
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonVerena und Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »Bricks and Mortality«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhardt Arth
Titelillustration: © David Hopkins/Phosphor Art
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2470-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für John und Diane Boland –die Neuseeland-Connection
»Fange beim Anfang an«, sagte der König ernst,»und lies, bis du ans Ende kommst, dann halte an.«
Lewis Carroll: Alice im Wunderland
KAPITEL 1
Früher, als es der Brandstifter beabsichtigt haben mochte, durchzog ein blutroter Dunstschleier den nächtlichen Himmel und warnte vor den darunterliegenden Flammen. Die glühende Asche sandte golden funkelnde Punkte in die rötlich gefärbten Wolken, sodass es aussah wie ein kleines Feuerwerk. Vom Sirenengeheul der Einsatzwagen geweckt, hingen im Umkreis von einer Meile Leute an den Fenstern der oberen Stockwerke. »Das muss Key House sein.«
»Merk dir meine Worte«, sagte Roger Trenton zu seiner Frau. »Das setzt dem Treiben der Hausbesetzer ein Ende. Habe ich es nicht wieder und immer wieder gesagt? So, wie das Haus dastand, war es ein Pulverfass. Leer stehend und nicht ausreichend gesichert – als hätte es nur darauf gewartet, dass so etwas passiert. Die Gemeinde hat Schuld.«
»Es ist nicht der Fehler der Gemeinde«, murmelte seine Frau, während sie ins Bett zurückkroch. »Sie sind schließlich nicht hinaufgegangen und haben ein Streichholz drangehalten.«
Ihr Ehemann wandte ihr das Gesicht zu. »Was sie getan haben, ist genauso schlimm!« Sein schütterer Haarkranz um die ausgeprägte Glatze herum hob sich von dem rötlichen Lichtschein des Feuers ab wie ein Halo. »Eine hohe Stirn, das ist es, was ich habe«, pflegte er zu sagen. »Ich habe immer noch jede Menge Haare, aber ich habe die hohe Stirn meines Vaters geerbt.«
Der war genauso kahl, dachte Poppy Trenton und vergrub den Kopf in den Kissen. Hohe Stirn, dass ich nicht lache! Soweit ich mich erinnere, war sein Vater schon kahl, als er mich das erste Mal mit nach Hause nahm und seiner Familie vorstellte. Ich hätte mir meinen zukünftigen Schwiegervater besser genauer angesehen. Wenn ich geahnt hätte, dass Roger genauso wird wie dieser alte Kerl, hätte ich die Verlobung vielleicht auf der Stelle gelöst. Sieh ihn nur an! Er trägt sogar die gleichen Schlafanzüge wie sein Vater, gestreifter Flanell mit einem Tunnelzug in der Taille, und Kordpantoffeln dazu.
»He, he, he!«, rief Roger. Er hob eine Hand und wedelte triumphierend mit einem Finger in Richtung des fernen Feuers. »Ich hab’s dir gesagt!«
Die Frau spähte über die Bettdecke in Richtung des Fensters, wo ihr Ehemann unverändert die Stellung hielt. Es war ein Wunder, dass er nicht vor Schadenfreude hüpfte. »Auch wenn Hausbesetzer für das Feuer verantwortlich sind, so hoffe ich, dass keiner dort in den Flammen eingeschlossen ist«, sagte sie.
»Es gibt genügend Fenster, durch die sie rauskönnen, falls nötig«, entgegnete Roger. »Sie nehmen den Weg, auf dem sie auch reingekommen sind. Keines der Fenster ist vernagelt. Das Türschloss könnte jedes Kind knacken. Du weißt, dass ich immer wieder die Gemeinde wegen Key House angeschrieben habe. Du kannst die Briefe gerne lesen. Sie befinden sich alle im Ordner mit dem Schriftwechsel, den ich mit der Gemeinde geführt habe. Es hat die Landschaft verschandelt, das ist es. Es ist überflüssig, absolut überflüssig. Ein schönes altes Haus, das man dem Verfall preisgegeben hat. Ich habe diesem jungen Mann bei der Gemeinde gesagt, er soll sich mit dem Eigentümer in Verbindung setzen, damit er etwas dagegen unternimmt.«
»Gervase Crown …«, murmelte seine Frau. »Er ist nach Portugal ausgewandert.«
»Das weiß ich selbst!«, fuhr Roger ihr ins Wort. »Ein richtiger Playboy. Es war wohl zu viel verlangt, von ihm zu erwarten, dass er etwas tut.«
»Er hatte einen recht attraktiven Vater«, murmelte Poppy unbedacht.
Roger fühlte sich veranlasst, sich von seinem Beobachtungsposten umzudrehen. »›Attraktiven Vater‹?«
»Gervase’ Vater, Sebastian Crown.«
»Stimmt doch gar nicht. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen. An Sebastian war überhaupt nichts attraktiv. Du redest Blödsinn, Poppy. Er war ein guter Kerl, sehr solide, wenngleich er auch kein Glück hatte, weder mit seiner Ehe noch mit diesem nutzlosen Taugenichts von einem Jungen. Gut, dass der junge Crown von hier abgehauen ist.«
»Es ist eigenartig, aber vor ein paar Tagen habe –«, setzte Poppy an, doch Roger hatte sich bereits wieder zum Fenster umgedreht. Sie ließ den Satz unbeendet. In Rogers Augen war es wahrscheinlich ohnehin Unfug. Sie hatte es im ersten Moment wirklich geglaubt. Und jetzt dieses Feuer … Es war beunruhigend. Vielleicht sollte ich Serena anrufen, dachte sie.
»Aha!«, frohlockte Roger von seinem Fensterplatz. Mit seinem feuerrot schimmernden Haarkranz sah er aus wie ein verrückter übergroßer Gockel. »Weißt du, was mich nicht im Geringsten überraschen würde? Wenn sie eine Leiche in der Asche finden, sobald das Feuer heruntergebrannt ist.«
»Oh nein!«, rief Poppy erschrocken. Plötzlich war sie hellwach und setzte sich im Bett auf. »So etwas darfst du nicht sagen, Roger!«
»Ach Herrgott, Poppy, leg dich wieder hin«, erwiderte ihr Ehemann.
Das Feuer hatte nach Kräften gewütet, doch Key House war nicht so einfach zu vernichten. Es war ein massives Steingebäude aus dem frühen achtzehnten Jahrhundert. Seine ersten Bewohner waren bereits zu Queen Annes Zeiten eingezogen. Nach Queen Annes Tod hatten die Mitglieder des Hauses Hannover die Herrschaft übernommen, und die ins Exil verbannten Stuarts hatten sich gegen sie verschworen. Key House hatte sie und die folgenden Generationen kommen und gehen sehen und allen Stürmen bis heute getrotzt. Seine Wände waren an der Basis annähernd einen Meter dick und verjüngten sich nach oben hin. Unter dem Dach maßen sie weniger als dreißig Zentimeter. Das Dach war mit den traditionellen Cotswold-Schieferplatten in sechsundzwanzig verschiedenen Größen gedeckt, von denen jede ihre eigene Bezeichnung und feste Position auf dem Dach hatte. Jetzt nicht mehr – die Platten waren in den darunterliegenden Innenbereich gestürzt, und dort lagen sie nun kreuz und quer durcheinander: lange und kurze Bachelors, Becks und Wivutts und wie sie alle hießen. Sie würden irgendwann geborgen werden, schon wegen ihres Wertes, und wenn sie nicht zum Wiederaufbau von Key House benutzt wurden, dann eben für ein anderes Dach.
Der Rest, die Eichentreppe mit dem gedrechselten Geländer und den von Schnitzereien überladenen Pfosten, das Parkett, das Gebälk und die vom Alter dunklen Holzvertäfelungen in Eingangshalle, Studierzimmer und Speisesaal – alles war fort. Die Überreste des aus alten Baumstämmen gezimmerten Gebälks waren noch zu sehen. Sie schwelten vor sich hin, vom Feuer geschwärzt und verkohlt und in unregelmäßige Stücke geborsten. Sogar die Astlöcher waren noch zu erkennen sowie die gelegentlichen Narben, wo die Zimmerleute einst mit der Axt zu tief gezielt hatten.
Es war bereits Nachmittag, als man die Leiche unter den Trümmern der ehemaligen Küche entdeckte, wo Reste der modernen Einbaumöbel geschwärzt an den Wänden hingen. Roger Trenton sollte bald erfahren, dass er recht gehabt hatte.
Inspector Jessica Campbell traf erst spät am Tatort ein, als Folge des grausigen Fundes. Sie betrachtete den dampfenden Qualm, der immer noch aus der Ruine waberte. Auf ihren Wangen spürte sie die Hitze, die von den einst glatt behauenen Cotswoldsteinen herrührte. Auch die Steine hatten das Feuer überlebt, wenngleich rußgeschwärzt und immer noch zu heiß zum Anfassen. Jessica legte sich die kalten Finger auf das Gesicht und spürte, wie die Spitzen die Wärme aufnahmen und zu kribbeln anfingen.
Bis jetzt war es ein milder Monat gewesen, doch in den letzten beiden Tagen hatte sich der Winter auf unnachgiebige Weise mit zunehmenden Winden und erstem Frost angekündigt. Die Büsche, Sträucher und Straßenbäume wurden in dieser verlassenen Straße anscheinend von niemandem zurückgeschnitten und gaben ein beinahe unwirkliches Bild ab mit ihren zu langen, kahlen Zweigen. Totes Laub häufte sich in windstillen Ecken und füllte die Gräben. Nur einige wenige Bäume wuchsen voller Trotz weiter, als wüssten sie, dass die wenigen übriggebliebenen Blätter das Rot und Gelb ihrer herbstlichen Pracht nicht zu ersetzen vermochten, geschweige denn das üppige frische Grün des nächsten Frühlings, wenn er denn endlich kam.
Trockenes Laub war über die vernachlässigten Rasenflächen von Key House geweht und hatte sich zwischen den dichten Ranken der Brombeersträucher gesammelt, wo es zu Mulch zerfallen war. Die Brombeeren hatten den Garten im Lauf der Jahre regelrecht überwuchert und reichten inzwischen fast bis zum Gebäude. Die Feuerwehrmänner hatten bei ihrer Arbeit viele der dornigen Tentakel niedergetrampelt, und das Löschwasser aus den Schläuchen ließ die Laubdecke vor Nässe glänzen. Wenn die Menschen diesen Ort erst wieder verlassen hatten, würden sich die Brombeeren von ihrer vorübergehenden Niederlage erholen und unerbittlich ihren Weg über den ehemaligen Rasen in Richtung Haus fortsetzen. Falls sich niemand fand, der Key House wieder aufbaute, würden sich Ranken und Gestrüpp einen Weg durch die im Mauerwerk klaffenden Löcher der zerbrochenen Fenster und ausgebrannten Türen suchen.
Gegenwärtig war das zerstörte Haus eins mit der verwelkenden Natur ringsum. Für einen kurzen Moment sah Jess vor ihrem geistigen Auge, wie das Haus unter einem Wust aus Ranken und Dornen verschwand wie ein Dornröschenschloss. Die Stimme des Doktors riss sie aus ihren Tagträumen.
»Junkies«, bemerkte er lakonisch. Sein Name war Layton, und er war ein großer, gebeugter Mann im fortgeschrittenen Alter, womöglich kurz vor dem Ruhestand. Sein grüner Tweed-Anzug war hochwertig gearbeitet, doch altmodisch geschnitten und hing ihm in einer Art und Weise am Leib, die vermuten ließ, dass er früher deutlich korpulenter gewesen war. Während er zu sprechen ansetzte, versuchte er ohne großen Erfolg eine Rußflocke von seinem Ärmel zu wischen. Als er feststellte, dass er aus der Flocke einen schwarzen verschmierten Fleck gemacht hatte, grunzte er frustriert. »Sie glauben ja nicht, wie oft sie sich bis zur Bewusstlosigkeit zudröhnen, und dann passiert so was. Das heißt, Sie natürlich schon, Inspector! Ich wage zu behaupten, dass Sie so etwas kennen.«
Layton bedachte sie mit einem entschuldigenden Nicken. Sein graues Haar, welches er ein wenig zu lang trug, geriet noch mehr in Unordnung.
Obwohl die Nebenstraße einsam gelegen war, waren sie nicht die einzigen Zuschauer. Es würde Jess stets ein Rätsel bleiben, wie die meisten Neugierigen es immer wieder schafften, rechtzeitig aufzutauchen, um einen Unfall oder dessen Folgen zu beobachten, sogar in einer Gegend wie dieser hier. Wahrscheinlich war das Publikum deshalb diesmal nicht besonders zahlreich. Ein groß gewachsener, hagerer älterer Mann in einer Öljacke mit einem schütteren grauen Haarkranz, der gleich einem Heiligenschein seinen ansonsten kahlen Schädel umrahmte. Wo um alles in der Welt war er bloß hergekommen? Ein Stück weiter entfernt standen zwei jüngere Männer mit wettergegerbter, gebräunter Haut und beobachteten das Treiben diskret aus sicherer Entfernung. Jess nahm an, dass es sich um Pavee handelte, fahrendes Volk. Vermutlich überlegten sie, ob es sich lohnte, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren, wenn alle anderen fort waren, und nachzusehen, ob sie irgendetwas an Metall ergattern konnten.
Ganz in Jess’ Nähe stand eine ältere Dame mit einer Brille und einer über die Ohren gezogenen Wollmütze. Sie trug eine hellgelbe Wachsjacke und dazu passende Hosen – vermutlich, damit sie gut zu erkennen war, wenn sie ihren Hund auf den Straßen ausführte, da neben den Straßen keine Fußwege angelegt waren. Was den Hund anging, so machte er einen missmutigen Eindruck. Sein Auslauf war unterbrochen worden. Er hatte keinerlei Interesse an dem Feuer. Er war ein Boxermischling mit stämmigem Körperbau und krummen Vorderbeinen, doch größer als für die Rasse üblich, was auf die Beimischung einer anderen Rasse unter seinen Ahnen hindeutete. Er besaß die üblichen zerknautschten Gesichtszüge, und Jess überlegte, dass seine vorstehenden Augen wohl ständig diesen leicht missmutigen Blick hatten. Vielleicht aber war es auch nur ein Beispiel dafür, dass Hundebesitzer ihren Tieren ähnelten. Die Hundebesitzerin jedenfalls blickte derart grimmig drein, als wäre das Feuer ein persönlicher Angriff auf ihre eigene Person gewesen.
Layton hob erneut an. »Sie werden vermutlich feststellen, dass der Typ sich irgendwas geschossen hat und weggetreten ist. Dann ist eine Kerze umgefallen, und das Feuer nahm seinen Lauf. Das Haus war nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen, soviel ich weiß. Das Gas war ebenfalls abgestellt. Das Haus stand seit dem Tod von Sebastian Crown leer. Vermutlich gehört das Anwesen noch seinem Sohn, doch der war noch nie hier. Eine Schande, wirklich, schließlich war es ein hübsches altes Haus.
Hey! Wahrscheinlich liegen überall Nadeln in der Asche. Seien Sie vorsichtig!«, rief er unvermittelt, indem er sich abwandte. Sein Rat galt den in der Nähe stehenden Brandermittlern und den mit Ruß beschmutzen und nach Rauch stinkenden Feuerwehrleuten, die noch immer mit Löscharbeiten beschäftigt waren. Sie würden noch einige Male im Verlauf der nächsten Tage zurückkommen und diese Arbeit wiederholen. Auch wenn ein Feuer gelöscht zu sein schien, konnte es jederzeit ohne Vorwarnung an einem heißen Punkt zu einem erneuten Brand kommen, wie Jess wusste.
»Diese verdammten Nadeln gehen mühelos durch die Stiefelsohle«, rief der am nächsten stehende Feuerwehrmann. Alle nickten.
Die verkohlte Leiche ruhte nach wie vor unbehelligt in ihrem Bett aus verkohlter Schlacke und Asche, zusammengekauert in einer fötalen Haltung, das Gesicht dem Boden zugewandt. Das herabgestürzte Gebälk hatte eine Art Dach über ihr gebildet, sodass sie nicht zerquetscht worden war. Die Arme waren abwehrend erhoben und verharrten in einer Haltung, die typisch war für Leichen, die man nach Bränden fand: die Fäuste geballt in einer absurden Parodie einer Boxerhaltung, als verspotteten sie die prasselnden Flammen, und als riefen sie ihnen zu: »Kommt schon, wenn ihr euch traut!«
Eine Gestalt in einem Schutzanzug erstellte aus angemessenem Sicherheitsabstand eine Videoaufnahme des Schauplatzes.
»Er ist tot, ohne Zweifel«, fasste Layton zusammen. »So weit, so gut. Es besteht kein Grund, jetzt dort herumzufummeln, um ihn zu untersuchen, selbst wenn es möglich wäre, an ihn heranzukommen. Nebenbei, die Überreste sind vermutlich spröde und zerbröseln wie Kekse unter den Händen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich gemacht werden, solange der Leichnam nicht obduziert wurde.«
Er schien darauf bedacht, sich nicht noch schmutziger zu machen, indem er eine verkohlte Leiche hin und her wälzte. Womöglich verbrannte er sich dabei die Hände, und eventuell trat er in eine der erwähnten weggeworfenen Nadeln. Jess fühlte mit ihm. Layton war kein Polizeiarzt, den man üblicherweise in Fällen wie diesem herbeirief, sondern unterhielt eine eigene Praxis. Doch er war am schnellsten erreichbar gewesen, und sie hatten ihn schon bei früheren Gelegenheiten hinzugezogen. Eins musste man ihm lassen: Er war ohne Murren gekommen und hatte seine Arbeit gemacht – den Tod des Opfers festgestellt.
Vielleicht lag es daran, dass es ein wenig anders als die ärztliche Tätigkeit war, die er normalerweise ausübte, doch er konnte der Versuchung nicht widerstehen, ein wenig zu spekulieren. »Natürlich ist es Sache Ihres Pathologen, die genaue Todesursache festzustellen und ob das Opfer unter Drogen stand, doch die Muskelkontraktion sagt mir, dass es noch am Leben war, als das Feuer ausbrach. Vermutlich war die Bewusstlosigkeit zu tief, als dass es sich selbst hätte helfen können. Außerdem finden sich Spuren von Rauch in seiner Lunge, wenn es noch am Leben gewesen ist. Wahrscheinlich hat es von alldem nichts mitbekommen. Ich schätze, es starb durch den Rauch, nicht durch das Feuer.«
Layton straffte sich. »Ich muss weiter. Ich habe noch eine Reihe von Hausbesuchen vor mir.« Er fuhr sich mit der Hand durch die wirren grauen Haare in dem Versuch, sie ein wenig zu glätten.
Jess begleitete ihn zu seinem Wagen. »Sie sagten, Sie kennen die Familie, der das Haus gehört?«
Die Frage schien ihn zu überraschen, und für einen Augenblick starrte er sie an, als hätte sie sich einen Fauxpas erlaubt. Doch dann schien ihm einzufallen, dass sie ja schließlich ein Police Officer war und am Anfang eines Ermittlungsverfahrens zu einem Brand mit tödlichem Ausgang stand, und er setzte zu einer vorsichtigen Antwort an.
»Ich kannte Sebastian – den früheren Besitzer. Er war ein Patient von mir. Oh, es ist Jahre her – er ist schon eine ganze Weile tot. Er war einer meiner ersten Patienten, als ich hier am Ort meine Praxis eröffnete, darum erinnere ich mich an ihn. Es gibt immer noch Leute, die den Nationalen Gesundheitsdienst ablehnen und Alternativen vorziehen. Ich war zwanzig Jahre lang sein Arzt. Ich kann nicht sagen, dass ich seinen Sohn Gervase kannte. Zumindest nicht als erwachsenen Mann, heißt das. Ich weiß, dass es ihn gibt. Er war die meiste Zeit im Internat und bereitete seinem Vater die üblichen Kopfschmerzen. Vermutlich hat ihn der Schularzt im Krankheitsfall behandelt. Soweit ich mich erinnern kann, ist er als Jugendlicher nicht mehr in meiner Praxis gewesen, und ganz sicher nicht als Erwachsener. Seine Mutter war ein paar Mal mit ihm da, als er noch ein Kind war. Die üblichen Impfungen und Kinderkrankheiten. Ich kann nicht sagen, wo er in den Jahren danach ärztlich versorgt wurde. Vielleicht war er als Kassenpatient bei einer anderen Praxis. Sein Vater hat stets über ihn gejammert, wie alle Eltern über ihre halbwüchsigen Kinder schimpfen.«
Erneut warf Jess einen Blick auf die verkohlten Überreste des Hauses. »Dann war Sebastian Crown ein reicher Mann?«
»Recht wohlhabend, würde ich sagen. Hier in der Gegend wohnen einige reiche Leute. Wenn ich mich recht entsinne, hat er sein Geld mit Hundeshampoo gemacht.«
»Wie bitte?«, staunte Jess.
»Kein gewöhnliches Shampoo, eher Pflegeprodukte und Anwendungen für Hunde«, erläuterte Layton. »Die Leute geben eine Menge Geld für ihre Haustiere aus. Glauben Sie mir, als Arzt kenne ich Fälle, wo Patienten sich mehr um ihre Tiere gekümmert haben als um ihre Kinder.«
»Hat Sebastian Crown sich um sein Kind gekümmert?«, fragte Jess vorsichtig.
Layton zögerte, bevor er umständlich fortfuhr. »Was ich jetzt sage, gilt mehr im Allgemeinen und nicht speziell für die Familie Crown, wenn Sie verstehen. Jedermann weiß, wie schwer es ist, eine Familie durchzubringen, wenn man arm ist. Kaum jemand hingegen weiß um die Probleme, eine Familie zusammenzuhalten, wenn Geld da ist. Natürlich keine finanziellen Probleme. Doch besonders ein Sohn kann das Gefühl haben, im Schatten eines sehr erfolgreichen Vaters zu stehen. Wenn der Vater ein Selfmademan ist, führt er seinem Sohn unter Umständen immer wieder ungewollt vor Augen, dass es seine harte Arbeit war, die der Familie den großzügigen Lebensstil ermöglicht. Womöglich ist er unerwartet geizig, wenn es darum geht, dem Sohn Geld zu geben, weil er möchte, dass sein Sohn erkennt, dass Geld verdient werden muss. Ich sage damit nicht, dass dies bei Sebastian und Gervase Crown der Fall war.«
»Nein, selbstverständlich nicht«, versicherte ihm Jess.
»In der Beziehung zwischen einem heranreifenden jungen Mann und seinem Vater ist eine gewisse Rivalität nur natürlich. In der Tierwelt könnte man es etwa mit einer Herausforderung an den etablierten Rudelführer vergleichen. Vielleicht schauen Sie ja die ein oder andere Tiersendung im Fernsehen? Der jüngere Mann hat das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Manchmal findet er Gefallen an der Herausforderung, und manchmal, nun, manchmal hat er keine Lust dazu. Verstehen Sie? Er bricht einfach aus und weigert sich, es überhaupt zu probieren – was für sich genommen der Versuch ist, sich auf andere Art zu beweisen. Eben nicht zu tun, was von ihm erwartet wird. Nach der Schule verschwand Gervase für etwa ein Jahr. Er trampte durch die Welt, mit dem Rucksack, wie man das halt so macht. Soweit ich weiß, ist er bis nach Australien gekommen und hat das Surfen für sich entdeckt. Als er wieder nach Hause kam … nun ja. Ich nehme an, er hatte sich angewöhnt, das zu tun, wozu er Lust hatte. Er geriet in Schwierigkeiten, doch es ist nicht an mir, Ihnen das zu erzählen. Es war keine gute Zeit. Sebastian hörte auf, von ihm zu erzählen.« Layton runzelte die Stirn.
»Was ist mit Mrs Crown?«, hakte Jess nach, bemüht, den Strom der Informationen nicht abreißen zu lassen.
»Mrs Crown? Ach, Sie meinen Sebastians Frau. Sie verließ die beiden – den Mann und das Kind –, als der Junge noch sehr klein war, vielleicht zehn oder elf Jahre alt. Einige Leute sagen, sie ist mit einem anderen Kerl durchgebrannt …« Womöglich wollte Layton nicht länger darüber reden. »Ich setze mich nächstes Jahr zur Ruhe«, wechselte er das Thema. »Die Zeit rast dahin.«
Jess dachte über das Gehörte nach. »Wie alt ist Gervase Crown heute?«
Der Doktor überlegte. »Mitte dreißig? Er lebt im Ausland. Ich verstehe nicht, warum er den Besitz nicht einfach verkauft hat, wenn er nicht vorhatte, darin zu wohnen. Es war eine unübersehbare Aufforderung für jegliche Art von Abschaum, sich hier niederzulassen.«
»War es denn noch eingerichtet?« Jess lächelte aufmunternd. »Momentan kann man das nämlich nicht so genau erkennen.«
Layton wand sich. Die allgemeine Richtung des Gesprächs schien ihn nervös zu machen. Er hatte nicht vorgehabt, länger hierzubleiben und ein Schwätzchen zu halten, ganz sicher nicht über Sebastian Crown, einen ehemaligen Patienten. Er hatte klargestellt, dass Gervase Crown nicht zu seinen Patienten gehörte, doch die Grenze zwischen beruflicher Diskretion und »der Polizei behilflich sein«, auf der er sich bewegte, war äußerst schmal. Dort in den Trümmern lag eine Leiche, darüber konnte man nicht hinwegsehen. Wie sie dort hingekommen war, würde Inhalt einer umfangreichen Ermittlung sein. Er war lediglich hier, um den Tod festzustellen, weiter nichts. Er wurde tiefer in die Geschichte hineingezogen, als ihm recht war.
»Oh, keine Ahnung! Ich denke nicht. Falls überhaupt noch Mobiliar vorhanden war, hat es in der Zwischenzeit bestimmt irgendjemand gestohlen! Ich glaube, der junge Gervase hat das Mobiliar entweder abholen lassen oder verkauft. Wahrscheinlich hat er die Antiquitäten bei einer Auktion angeboten. Ich erinnere mich dunkel an eine Versteigerung, die hier im Haus abgehalten wurde. Doch ich wüsste nicht, dass er auch sein Elternhaus verkauft hat. Ich denke, dass ich es erfahren hätte. Derartige Neuigkeiten sprechen sich schnell herum. Die Leute hier in der Gegend wollen wissen, wenn sie neue Nachbarn bekommen.«
Demonstrativ öffnete er die Autotür. Jess’ Informationsquelle war versiegt. Sie dankte ihm für sein Erscheinen.
»Alles Teil meiner Arbeit«, antwortete der Doktor gut gelaunt darüber, dass er sich endlich verabschieden konnte. »Schade, dass es kein Mord war, dann könnte ich ein höheres Honorar fordern.«
Jess blickte ihm nach, als er davonfuhr. Genau wie Layton wäre sie normalerweise nicht hier gewesen, nicht zu diesem frühen Zeitpunkt und ganz gewiss nicht in Abwesenheit jeglicher Hinweise auf eine Gewalttat. Doch die Polizeibeamten, die von der Einsatzzentrale ursprünglich hergeschickt worden waren, hatten unterwegs wegen eines Verkehrsunfalls auf der Hauptstraße anhalten müssen.
Jess war zufällig frei gewesen, als die Information hereinkam, dass man eine Leiche gefunden hatte. Sie hatte sich in ihr Auto gesetzt und war losgefahren.
Jetzt drehte sie sich zu den Schaulustigen um. Die beiden Pavee hatten ihre Aktionen vorausgeahnt und sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Jess war allein mit dem großen Mann und der Frau mit dem Boxer.
Sie wandte sich zuerst an den Mann, da er ohnehin darauf zu warten schien, und stellte sich vor. Er musterte sie abschätzend von oben bis unten, bevor er sie informierte, dass er Roger Trenton hieß. Er wohnte etwas weniger als einen Kilometer entfernt in Ivy Lodge und hatte vom Fenster seines Schlafzimmers aus das rote Leuchten des Nachthimmels gesehen, etwa um Mitternacht. »Es hat direkt ins Zimmer geleuchtet, wie eine Kerze.« Er hatte gleich gewusst, dass es sich um Key House handeln musste.
»Warum?«, fragte Jess.
Trenton reagierte ungehalten. »Weil man das Haus dem Verfall preisgegeben hat und es nur eine Frage der Zeit war, bis Hausbesetzer dort einzogen! Entweder die oder irgendein Taugenichts oder Landstreicher! Ich habe die Gemeinde schon mehrere Male wegen dieses Missstands angeschrieben, und zweimal den Eigentümer direkt, Mr Gervase Crown.«
»Sie haben die Adresse von Mr Crown?«, fragte Jess hoffnungsvoll.
»Nein. Ich habe die Adresse seiner Anwälte, die kann ich Ihnen gerne geben. Ich habe Crown über seine Anwälte kontaktiert. Ich nahm an, dass sie die Briefe weiterleiten würden. Ich erhielt keine Antwort. Jedenfalls, in meinen Briefen fragte ich Crown, ob und wann er etwas zu unternehmen gedächte. Das war ein großartiges Anwesen in gepflegtem Zustand, als er es geerbt hat. Er hat weniger als sechs Monate darin gewohnt, dann hat er Mobiliar und Hausrat in einer Auktion vor Ort verkauft. Das halbe County ist deswegen hier aufgelaufen! Crown hat das Geld eingesackt und sich davongemacht. Das Haus blieb leer und verlassen zurück. Der Mann ist ein Irrer.«
»Sie erwähnten Hausbesetzer«, sagte Jess. »Haben Sie in der letzten Zeit jemanden hier gesehen?«
»Nein«, gestand Trenton widerwillig. »Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, nach Key House zu sehen, wenn Crown keine Zeit dafür hat – oder keine Lust.«
Diese Aussage stand im Widerspruch zu seiner vorher geäußerten Behauptung, er habe zweimal den Eigentümer wegen des Hauses angeschrieben und die Gemeinde mit Beschwerdebriefen bombardiert.
»Denken Sie nur nicht …«, setzte Trenton an und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, ich wäre hier, weil ich einer von diesen abartigen Gaffern bin! Ich mache jeden Morgen einen Ertüchtigungsspaziergang. Ich komme oft hier lang.«
Bei diesem Satz drehte sich die Frau mit dem Hund zu ihnen und bedachte den Sprecher mit einem spöttischen Grinsen.
»Es wird später noch mal jemand bei Ihnen vorbeischauen, um Ihre Aussage zu protokollieren, Mr Trenton, falls Sie keine Einwände haben«, sagte Jess. »Ivy Lodge, ist das richtig?«
»Dort entlang, immer geradeaus …« Trenton deutete die Straße hinunter, vorbei an der Ruine. »Sie können es nicht verfehlen. Direkt dahinter steht eine prachtvolle uralte Eiche.«
Trenton ging davon, und Jess wandte sich der Frau mit dem Hund zu.
»So ein Schwätzer!«, sagte diese wenig zurückhaltend in Trentons Richtung. Der so titulierte große Mann entfernte sich mit schnellen Schritten und war längst außer Hörweite.
»Sie sind …?«
»Muriel Pickering – und ich gehe tatsächlich jeden Tag hier entlang, zusammen mit Hamlet.« Sie zeigte auf den Boxer, der Jess mit einem unheilvollen Blick bedachte.
»Dann wohnen Sie in der Nähe? Oder sind Sie mit dem Auto hier?«
»Ich bin selbstverständlich zu Fuß!«, wiederholte Ms Pickering. »Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Ich scheue mich nicht, meine Beine zu gebrauchen. Ich wohne in Mullions, das liegt dort den Weg hinunter.«
Sie deutete auf eine schmale, gerade noch erkennbare Nebenstraße ein paar Meter hinter ihnen. Dann warf sie einen weiteren finsteren Blick in die Richtung, in die Mr Trenton entschwunden war. »Ich habe Roger noch nie diesen Weg nehmen sehen! So ein dummes Zeug. Der einzige Ort, wo er sich je ›ertüchtigt‹, ist der Golfplatz. Nein, er war zum Gaffen hier. Und nein, ich habe keine verdächtige Person hier herumschleichen sehen. Ja, gelegentlich gab es Landstreicher, die sich im Haus aufgehalten haben. Nicht in der letzten Zeit. Es war wohl nicht besonders schwer, reinzukommen. Ich denke mir, wenn man sich die Mühe gemacht hätte, ums Haus herumzugehen, so hätte man vermutlich ein eingeschlagenes Fenster oder eine aufgebrochene Tür gefunden. Nur macht es jetzt wohl keinen Sinn mehr, nachzusehen. Jetzt ist sicher jedes Fenster und jede Tür zerbrochen.«
Da hatte sie recht. Jess notierte ihre Adresse und informierte sie, wie sie es bereits bei Trenton getan hatte, dass ein Beamter zur weiteren Befragung bei ihr vorbeischauen würde.
Was die Pavee anging, das fahrende Volk, war es unwahrscheinlich, dass sie für das Feuer verantwortlich waren. Ansonsten hätten sie die Gegend fluchtartig verlassen. Vermutlich waren sie jetzt in diesem Moment, nachdem sie Jess gesehen hatten, dabei ihre Sachen zu packen und sich davonzumachen. Falls sie entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch aufgegriffen und vernommen wurden, würden sie zu Protokoll geben, nichts gesehen und nichts gehört zu haben.
Es gibt Leute, die wollen unbedingt mit der Polizei reden, obwohl sie überhaupt nichts wissen. Vermutlich gehörte Roger Trenton zu der Sorte. Dann gibt es wiederum diejenigen, die selbst dann, wenn sie etwas wissen, aus reiner Ablehnung nicht mit der Polizei reden – Muriel Pickering gehörte möglicherweise in diese Kategorie. Und die dritte Gruppe von Leuten will überhaupt nichts mit der Polizei zu tun haben, unabhängig davon, ob sie etwas wissen oder nicht – beispielsweise die beiden Pavee. Gelegentlich – selten wie eine Perle in einem Meer voller Austern – findet sich jemand, der sowohl etwas weiß als auch bereit ist, darüber zu reden. Jess kreuzte die Finger und hoffte, dass sie bald einen solchen Zeugen fanden.
Eine weitere Person war zugegen gewesen, unbemerkt, und hatte den Schauplatz kurz vor Jess Campbells Erscheinen verlassen. Alfie Darrow war bei Tagesanbruch losgezogen, um seine Fallen zu kontrollieren. Alfie war kein Landmensch, obwohl er die meiste Zeit seines Lebens in Weston St. Ambrose gewohnt hatte. Doch sein Großvater war sehr bewandert gewesen in diesen Dingen, und er hatte seinem Enkel auch gezeigt, wie man eine einfache Schlinge anfertigte. Alfies Großvater war die männliche Bezugsperson in Alfies Kindheit gewesen. Sein Vater hatte sich davongemacht, als Alfie noch in der Wiege gelegen hatte. Es gab einen ausgedehnten alten Kaninchenbau am Rand eines verwilderten Waldstücks entlang der Long Lane genannten Straße und dem »Rabbit Field« – der Name, unter dem der Acker gemeinhin bekannt war. Im Verlauf der Jahre hatten die Kaninchen kleine Wildwechsel im Unterholz geschaffen, die ausnahmslos alle zu ihrem Bau führten. Sie waren Gewohnheitstiere. Wenn sie auf den engen Pfaden in ihren Bau flüchteten, mussten sie unter einem Drahtzaun hindurch, der halb verborgen zwischen Nesseln, Disteln und Ampfer lag. Genau an diesem Zaun hatte Alfie seine größten Erfolge, genau da, wo die Kaninchen herauskamen.
Als er an diesem Morgen aufgebrochen war, hatte er sehr bald den rund um Key House herrschenden Betrieb bemerkt. Ein schwerer Geruch nach Feuer hing in der Luft. Von Zeit zu Zeit schoss eine Flamme gen Himmel, wenn einer der verbliebenen Balken oder eines der Dielenbretter des Hauses dem erbarmungslosen Fortschreiten der Flammen zum Opfer fiel. Alfie versteckte sich hinter der verwilderten Hecke an der Straße und beobachtete alles. Es waren die unterhaltsamsten und aufregendsten Stunden, soweit er sich zurückerinnern konnte. Die Feuerwehrmänner waren zum Leben erweckte Helden aus den Computerspielen, die Alfies liebste Freizeitbeschäftigung darstellten. In Uniform und Schutzhelm brüllten sie sich Befehle und Warnrufe zu, während sie Schläuche hielten und dicke Wasserstrahlen über das Feuer schwenkten. Als die brennenden Überreste des ersten Stocks in das Erdgeschoss krachten und die Luft sich mit einem Schauer goldener Funken füllte, presste Alfie die Hände vor den Mund, um seine Begeisterung nicht laut herauszubrüllen. Das Wasser prasselte auf das darunterliegende Gebälk, und das Holz krachte und knisterte und spie Funken gleich wilden, in die Enge getriebenen Bestien. Mit lautem Zischen platschte es auf die heißen Steine, und dichte Dampfschwaden stiegen in die Luft, um sich mit dem Rauch zu vermischen. Alfies Mund stand offen vor Staunen. Glühende Asche schoss raketengleich über die Straße. Es roch wie am Martinsfeuer. Alfie beobachtete alles hingerissen, völlig ungeachtet seines beengten Verstecks und der unbehaglichen Position, in der seine verbogenen Gliedmaßen sich befanden.
Dann war der erste Streifenwagen eingetroffen, mit zwei uniformierten Beamten, und hatte Alfies Spaß ein Ende bereitet. Mit dem Erscheinen des Gesetzes auf der Bildfläche war es Zeit für ihn zu gehen. Er war kein Unbekannter bei der örtlichen Polizei, und er meinte einen der Polizisten zu kennen. Der Bulle würde ihn erkennen, sobald er ihn bemerkte, und bevor er sich’s versah, würden sie Alfie der Brandstiftung bezichtigen. So waren die Bullen nach Alfies Erfahrung. Sie griffen sich das erste bekannte Gesicht und dichteten seinem Träger an, was immer gerade nötig war. Nein, er würde am nächsten Tag wiederkommen, um nach seinen Fallen zu sehen. Er kroch aus seinem Versteck, streckte die steif gewordenen Glieder und machte sich querfeldein auf den Weg nach Hause. Was für eine Geschichte er zu erzählen hatte!
Hätte er noch ein wenig länger gewartet, so lange, bis man die Leiche fand, seine Geschichte wäre noch viel dramatischer gewesen.
KAPITEL 2
Ian Carter dachte an ein altes Zitat. »Auch der beste Schlachtplan übersteht selten den ersten Schuss.« Hätte er heute gelebt, der schottische Schriftsteller hätte beim Verfassen seiner Zeilen vermutlich Carter vor Augen gehabt.
Er saß mit einem Becher Löskaffee in der Hand in seinem einzigen Lehnsessel und spürte, wie ihn ein Moment der Einkehr überkam. Es war noch früh und gerade hell genug, um schon ohne elektrisches Licht sehen zu können. Im Haus war alles still – es war die Zeit des Tages, in der die Dinge ihn nicht überrollten, während er krampfhaft versuchte mitzuhalten. Er hatte Gelegenheit zum Nachdenken.
Er schlürfte seinen Kaffee, der heiß, bitter und geschmacklos war, alles zugleich, und sann über sein bisheriges Leben nach. Um von vorne anzufangen, der wirklich große Plan, sein Leben an Sophies Seite zu verbringen und mit ihr zusammen in Frieden alt zu werden, war grandios gescheitert. Arm in Arm mitzuerleben, wie ihre Tochter erwachsen wurde und zu einer selbstbewussten, anmutigen und charmanten jungen Frau heranwuchs, die Sorte Frau, als die er auch Sophie empfunden hatte, als zu Beginn ihrer Beziehung noch alles gut gewesen war, daraus war nichts geworden.
Der Plan hatte sich in dem Moment in Luft aufgelöst, als Sophie Rodney Marsham kennengelernt hatte. Rodney! Ausgerechnet! Carter fragte sich nicht zum ersten Mal, wie seine damalige Frau derart von einem Kerl angetan sein konnte, der so farblos, teigig und absolut geistlos war wie Marsham und dessen permanent joviales Auftreten Carter ungemein irritierend fand. Einem Kerl, dessen berufliche Interessen, wenngleich profitabel, einen zweifelhaften Eindruck bei Carter hinterließen, um nicht zu sagen zwielichtig.
»Das ist der Polizist in dir, Ian«, hatte Sophies Antwort gelautet, als er diesen letzten Einwand vorgebracht hatte, zum Zeitpunkt ihrer Trennung. »Für dich ist einfach jeder verdächtig!«
Um fair zu sein, sie hatte ihm diesen Vorwurf im Verlauf ihrer Ehe häufiger gemacht, nicht nur am Ende ihrer Beziehung. Vermutlich lag sie damit sogar richtig. Er war Sophie kein guter Ehemann gewesen. Irgendwann hatten sich die Dinge zwischen ihnen falsch entwickelt, lange bevor Rodney auf der Bildfläche erschienen war mit seinem ewigen Lächeln, offensichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Wer hing schon an einem übellaunigen Bullen, der seine Arbeitstage mit allem verbrachte, was es Schlechtes an den Menschen gab, und der abends müde nach Hause kam und keine Lust mehr hatte zu feiern? Wer hätte ihn nicht gegen einen fröhlichen, geselligen Burschen eingetauscht, mit einem untrüglichen Riecher fürs Geldverdienen?
Rodney und Sophie waren vermutlich füreinander geschaffen. Er sollte sie nicht um ihre Zufriedenheit beneiden. Doch Millie … Das war ein ganz anderes Thema.
Er hörte ein leises Klappern und dann das Geräusch kleiner Füße, die in Richtung Wohnzimmer tapsten. Die Tür öffnete sich knarrend, und Millies Gesicht lugte durch den Spalt. Als sie ihren Vater mit seinem Kaffee erblickte, drückte sie die Tür ganz auf und kam herein. Sie hüpfte mit nackten Füßen über den Boden und kuschelte sich in den Sitzsack ihm gegenüber. Über den Schlafanzug hatte sie sich ihren Morgenmantel gezogen, die Pantoffeln jedoch vergessen, und sie hielt MacTavish fest an sich gedrückt.
MacTavish war ein verblüffend menschenähnlicher Teddybär, den sie aus einem Urlaub in Schottland mitgebracht hatten, als sie noch eine Familie gewesen waren. Er trug ein Barett in Schottenkaro, das zwischen den Ohren auf seinen Kopf genäht war, und um seinen pelzigen Leib hing ein locker geschlungenes Schottentuch. Ursprünglich hatte er noch einen Plastikschild und ein Plastik-Zweihandschwert getragen, doch Sophie hatte die Waffen in einer ihrer pazifistischen Phasen entfernt und weggeworfen. Typisch für Sophie, überlegte Carter, dass ihr Beitrag zum Weltfrieden größtenteils aus symbolischen Gesten wie dieser bestand. Andererseits organisierte sie von Zeit zu Zeit morgendliche Tees und sammelte Spenden für eine wohltätige Einrichtung, die sich um jene kümmerte, deren Leben durch Kriege und ähnliche Konflikte aus der Bahn geworfen worden war, und er musste anerkennen, dass das vermutlich mehr bewirkte, als mit selbst gemalten Plakaten zu winken und Puppen von Politikern aufzuhängen. MacTavishs Lächeln, eingestickt in sein Plüschgesicht, war jedenfalls alles andere als kriegerisch. Sein Grinsen erinnerte Carter eher an Rodney Marsham.
Carters Tochter hatte ihn mit einem ebenso direkten wie vorwurfsvollen Blick fixiert, der ihn stark an Sophie erinnerte. Was war bloß aus diesem Traum von einer reizenden, charmanten …
»Warum bist du so früh aufgestanden?«, fragte Millie streng.
»Ich wollte dich nicht stören«, entschuldigte sich Carter. »Ich habe versucht, leise zu sein.«
»Ich habe den Wasserhahn in der Küche gehört. Er macht dieses stöhnende Geräusch, wenn man ihn zudreht. Du musst ihn reparieren lassen.«
Kein Zweifel, das war Sophies Stimme.
»Ich nehme mir irgendwann dafür Zeit«, versprach er ausweichend. In ihm regte sich das schreckliche Gefühl, dass er diese Unterhaltung in der Vergangenheit bereits viele Male mit ihrer Mutter geführt hatte.
»MacTavish hat es auch gehört.«
Er öffnete den Mund, um zu erwidern, dass MacTavishs Ohren aus Stoff waren, doch irgendetwas war an ihrer Beziehung zu diesem Spielzeug, das ihn zu gleichen Teilen rührte und Schuldgefühle in ihm weckte. MacTavish hatte Millie noch nie im Stich gelassen.
»Entschuldige, MacTavish«, sagte er. »Habt ihr denn beide gut geschlafen, bis ich diesen Lärm in der Küche veranstaltet habe?«
»Hm …«, murmelte Millie, während sie kritisch den Blick durch den Raum schweifen ließ. »Mami und Rodney haben sich einen Innenarchitekten geholt.« Die letzten Worte sprach sie beinahe ehrfürchtig. »Ein Innenarchitekt sucht die Möbel für dich aus«, erklärte sie ihrem Vater netterweise.
Das saß. »Ich kann mir meine Möbel selber aussuchen«, konterte Carter.
»Und warum hast du das hier ausgesucht?«, fragte Millie mit jener treuherzigen Offenheit, die keine richtige Antwort zuließ.
»Ich war in Eile. Ich brauchte dringend ein paar Möbel. Wenn du das nächste Mal kommst, habe ich die Wohnung hoffentlich in Ordnung gebracht.«
Millies Besuch war nicht geplant gewesen. Sophie hatte ihn angerufen und gesagt, es wäre ein Notfall.
»In meiner Schule gibt es Asbest im Dach«, sagte Millie nun. Offensichtlich war sie Expertin, wenn es darum ging, seine Gedanken zu lesen.
»Ja, deine Mama hat es mir erzählt. Ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, man hätte den Asbest längst aus allen Gebäuden entfernt.«
»Man wusste nichts davon«, erklärte Millie. »Sie hatten eine falsche Decke in der Halle, und als die Maler kamen, um sie zu streichen, haben sie sie entdeckt. Man muss bestimmte Dinge tun, wenn man Asbest entfernt. Deshalb können wir die Schule in der Zwischenzeit nicht benutzen, wir würden womöglich krank werden. Sie wollen den Asbest diese Woche wegmachen. Dann können wir wieder zur Schule.«
»So hatte ich es verstanden.«
»Mami und Rodney konnten die Reise nach New York nicht absagen …«
»Millie«, unterbrach Carter sie. »Ich bin sehr froh darüber, dass du hier bist. Ich würde dich gerne öfters sehen. Es ist ein glücklicher Zufall, dass in deiner Schule Asbest gefunden wurde und Rodney diese Geschäftsreise nach New York hat und … alles andere. Dadurch hat sich die Möglichkeit ergeben, dass du mich hier besuchen kannst.«
MacTavishs schwarze, glänzende Augen starrten ihn an. Sein gesticktes Grinsen glich plötzlich mehr einem Zähnefletschen. Fällt dir nichts Besseres ein?, schien er zu fragen.
»Muss ich heute wieder zu Tante Monica?«, peilte Millie die Schwachstelle in seiner Argumentation an.
»Ja. Ich muss zur Arbeit, tut mir leid. Wir haben Ermittlungen am Laufen. Wenn ich früher Bescheid bekommen hätte, hätte ich mir ein paar Tage freinehmen können …« Er brach ab. »Du bist doch gerne bei Tante Monica, oder nicht?«
»Oh ja, sie hat zwei Katzen. Du solltest dir auch eine holen.«
»Ich wäre zu wenig zu Hause, um mich um sie zu kümmern.«
»Tante Monicas Hintertür hat eine Klappe. Die Katzen können alleine rein und raus. Wenn die Sonne scheint und sie im Garten sitzen möchten, so können sie das tun. Und wenn es regnet und sie reinmöchten, dann können sie das auch. Tante Monica ist meine Großtante, wie du weißt. Sie ist Mamis Tante, also ist sie meine Großtante. Sie mag nicht so genannt werden, weil sie sich dann alt fühlt. Aber sie ist doch alt, oder?«
»So alt auch wieder nicht … Ich gehe und mache uns Haferflocken, es ist fast Zeit fürs Frühstück. Warum decken du und MacTavish nicht den Tisch?«
»Was ermittelst du?«, fragte Millie kurz darauf, während sie klappernd das Besteck aus seiner unaufgeräumten Schublade kramte. Wenn das Interesse einer Zehnjährigen erst einmal geweckt war, ließ sie so schnell nicht wieder davon ab, so ungeeignet das Thema auch sein mochte. Carter stand im Begriff, das herauszufinden.
»Gestern hat es ein großes Feuer gegeben, in einem alten Haus auf dem Land. Einem leer stehenden Haus«, fügte Carter von seinem Platz an der Haferbreischlüssel hinzu. Es gab keinen Grund, ihr junges Gemüt mit dem Gedanken an eine Leiche zu belasten.
MacTavish war auf dem Abtropffeld neben dem Herd platziert worden und beobachtete ihn auf eine Art und Weise, wie man es von einem schottischen Bären erwarten würde, der einem Engländer beim Zubereiten von Porridge zusah. Hör zu, MacTavish, ich werde bestimmt kein Salz hineinschütten, nur damit du zufrieden bist!
»Hat jemand das Feuer absichtlich gelegt? Werdet ihr herausfinden, wer es war?«
»Ich hoffe, dass es uns gelingt.«
»Wie?«
»Das weiß ich noch nicht.«
MacTavish grinste ihn spöttisch an. Pass auf, MacTavish, oder ich kippe dir Haferbrei auf den schottischen Pfannkuchen, den du auf deinem Kopf hast … Und dann landest du wieder in der Waschmaschine!
»Vielleicht haben sie mit Streichhölzern gespielt«, sagte Millie altklug. »Das soll man nicht. Man sollte nicht mit Feuer spielen.«
»Da hast du vollkommen recht«, stimmte Carter seiner Tochter zu.
Nach dem Frühstück fuhr er Millie und MacTavish nach Weston St. Ambrose, wo Tante Monica lebte – die Tante seiner früheren Frau. Monica war eine pensionierte Grundschullehrerin und erfreut, wieder ein Kind um sich herum zu haben, wenn auch nur für ein paar Stunden.
»Mach dir um uns keine Sorgen, Ian«, versicherte sie ihm. »Ich habe jede Menge für uns geplant. Ich mache ihr was zu Mittag und zum Tee, und du kannst sie heute Abend holen kommen, wann immer es dir passt.«
Carter sah zu Millie, die MacTavish soeben zwei sehr misstrauischen Katzen vorstellte. Millie trug eine Weste aus weißem Kunstpelz. Ihm dämmerte, dass die Katzen den Pelz vielleicht auch ein wenig verdächtig fanden.
»Ich weiß das wirklich zu schätzen, Monica. Ich hätte mir ein paar Tage freigenommen, wenn ich es vorher gewusst hätte …«
»Ist schon gut, Ian, wirklich. Nun geh schon.«
Also gab er Millie einen Kuss und ging. MacTavish winkte ihm unter dem Einfluss seiner Besitzerin hinterher.
Ich schaffe es nicht, mit meinem Kind zu reden, dachte er traurig. Vermutlich fällt es Millie genauso schwer, sich mir mitzuteilen. Deshalb hat sie MacTavish mitgebracht. Er ist unser Mittelsmann.
Tom Palmer, der Pathologe, war der Grund, weshalb Carter an diesem Tag zur Arbeit musste. Er hatte die Untersuchungen an der Leiche von Key House abgeschlossen und wartete darauf, Carter die gewonnenen Erkenntnisse darzulegen. Der glücklose Phil Morton hatte der Obduktion beiwohnen müssen, doch es waren Ian Carter und Jess Campbell, die sich später in Toms winzigem Büro im Leichenschauhaus einfanden.
Der Pathologe raschelte mit Papieren, gab seine Suche schließlich auf und fuhr sich durch die dichten schwarzen Haare. »Das war eine echte Herausforderung.«
»Zu stark verbrannt?«, fragte Carter.
»Stark verbrannt, allerdings. Aber ich mag Herausforderungen. Schauen wir mal … Der Tote war männlich und ungefähr dreißig Jahre alt. Ich habe alles auf Band diktiert, aber es ist noch nicht im Computer. Sie kriegen selbstverständlich noch einen ordentlichen Ausdruck. Wir sind etwas knapp mit Personal hier.« Palmer starrte sie an, als wären sie irgendwie dafür verantwortlich.
»Wir sind alle knapp mit Personal!«, entgegnete Carter verärgert.
»Tom, erzählen Sie uns doch einfach, was die Todesursache war und ob sie Ihnen irgendwie verdächtig vorkommt«, warf Jess hastig ein.
»Ja, richtig«, sagte Palmer. »Die Todesursache war Ersticken durch Rauchvergiftung. Das war ziemlich eindeutig. Die Lungen waren verklebt von Ruß.«
»War er zu dem Zeitpunkt bewusstlos? Hat er geschlafen? Stand er vielleicht unter Drogen?«, fragte Carter.
Palmers Verhalten änderte sich schlagartig. Der Pathologe wurde vorsichtig. »Die Tests haben keine Drogen in seinem Körper nachweisen können – also nein, keine Drogen. Die Arme waren in einer Abwehrhaltung erhoben. Ich nehme an, das war eine normale Reaktion auf das Feuer. Nichts deutet auf einen Kampf hin. Vielleicht klingt das jetzt ein wenig konfus, aber meiner Meinung nach wurde er kurz vor dem Ausbruch des Feuers angegriffen. Sein Hinterkopf weist eine Fraktur auf, und das ist verdächtig. Ich denke nicht, dass es im Feuer passiert ist. Ich denke vielmehr, irgendjemand hat ihn verprügelt, ihn bewusstlos geschlagen. Er wurde mindestens zweimal schwer getroffen. Der erste Schlag hat ihn zu Boden gestreckt und vielleicht bewegungsunfähig gemacht. Der zweite hat ihn definitiv bewusstlos gemacht.«
»Doch er hat ihn nicht getötet«, murmelte Carter mehr zu sich selbst als zu den anderen. »Dachte der Angreifer, er hätte ihn getötet? Hat er vielleicht deshalb das Feuer gelegt?«
Jess antwortete dennoch. »Das Feuer wurde in der Nacht gelegt. Der Strom war abgeschaltet, wie man mir gesagt hat. Falls der Angreifer nur eine Taschenlampe hatte, könnte er durchaus zu dem Schluss gekommen sein, dass sein Opfer tot war.«
»Oder er hat sein Opfer einfach liegen lassen und darauf vertraut, dass der Rauch und das Feuer sein Werk vollenden«, sagte Carter.
Für einen Moment herrschte Stille. Alle drei besaßen Erfahrung, was Nachwirkungen von Gewaltverbrechen anging. Trotzdem war es immer wieder erschreckend, zu welch berechnender Grausamkeit selbst die zivilisiertesten Menschen imstande waren.
»Sonstige Verletzungen?«, fragte Jess schnell und beendete damit das lastende Schweigen.
Tom stürzte sich förmlich auf die Frage und begann zu reden. »Mit Ausnahme der Kopfwunden konnte ich keine weiteren Anzeichen für Verletzungen finden, die ihm vor dem Feuer zugefügt worden sein könnten. Die Leiche …«
Der Tote war nicht länger »das Opfer« – er war zur »Leiche« geworden, einem Objekt. Palmer stockte, als würde ihm das soeben bewusst, bevor er weiterredete.
»Wenn ich richtig verstanden habe, war er geschützt durch die Balken, die zwar auf der Außenseite brannten, aber nicht zu Asche zerfielen. Als sie herunterstürzten, brachen sie auseinander, aber in große Stücke, und einige davon landeten so, dass sie ein schützendes Dach über ihm bildeten. Die Frakturen am Kopf wurden meiner Meinung nach nicht durch das herunterfallende Gebälk verursacht. Die Schädelfrakturen sind einfach nicht konsistent mit dieser Art von Unfall. Beide Wunden sind wie aus dem Lehrbuch. Paradebeispiele für Verletzungen, die durch einen kraftvollen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand herbeigeführt wurden. Deswegen die lokale Fraktur des Schädelknochens.
Die anderen Verletzungen lassen sich mit dem Feuer erklären. Beispielsweise ist an manchen Stellen die Haut aufgeplatzt, eine typische Folge des Feuers. Keinerlei Hinweise auf legale oder illegale Substanzen, die eine Bewusstlosigkeit herbeigeführt haben könnten. Er wurde vorsätzlich niedergeschlagen.
Möglicherweise hilft eine andere Sache bei der Ermittlung seiner Identität. Wie ich schon sagte, haben sich seine Armmuskeln infolge der Hitze zusammengezogen. Dadurch haben sich die Hände zu Fäusten geballt und gewissermaßen die Innenseiten geschützt. Die Außenseiten der Hände sind stark zerstört. Die Handinnenflächen sind, auch wenn sie aufgrund der heißen Asche versengt sind, nicht ganz so stark zerstört. Von den tiefer liegenden Hautschichten lassen sich möglicherweise noch ein paar Abdrücke gewinnen.« Er hob den Blick und sah Jess und Carter fragend an. »Liegt der Bericht der Brandermittler bereits vor?«
Jess schüttelte den Kopf. »Aus dem, was Sie sagen und was wir beide denken …« Sie warf Carter einen kurzen Blick zu. Der Superintendent nickte zustimmend. »Das Feuer wurde mit großer Wahrscheinlichkeit absichtlich gelegt in dem Versuch, die Leiche und eventuell auch noch weitere Beweise verschwinden zu lassen. Wenn die Brandermittler Hinweise finden, dass ein Beschleuniger benutzt wurde, würde das unsere These bekräftigen. Doch auch so haben wir es definitiv mit einem Tötungsdelikt zu tun.« Sie drehte sich zu Carter um, der schweigend neben ihr saß. »Stimmen Sie mir zu, Sir?«
Carter war ihrer Meinung. »Ja, das ist mehr oder weniger das, was der Coroner feststellen wird. Danach ist es an uns, das Wie und Warum herauszufinden. Wir danken Ihnen, Tom. Wir lassen Sie jetzt in Ruhe, damit Sie Ihren Bericht schreiben können. Nochmals danke, dass Sie einen so schnellen und effizienten Job gemacht haben.«
Palmer öffnete den Mund zu einer Erwiderung, als sein Mobiltelefon klingelte. Er bedachte seine beiden Besucher mit einem entschuldigenden Blick und nahm das Telefon aus seiner Tasche. Jess und Carter bedeuteten ihm mit einem Wink, dass sie fortgingen.
Auf dem Weg zur Tür hörten sie Palmers Stimme. »Oh, hi Madison! Entschuldige, dass ich dich nicht früher angerufen habe … Ich hatte es versprochen, ich weiß, aber ich war sehr beschäftigt …«
»Tut mir leid, dass das mit Ihnen und Palmer vorbei ist«, sagte Carter außerhalb des Gebäudes verlegen.
Sie hielt in ihren Bewegungen inne und fuhr zu Carter herum, während sie ihn aus blitzenden Augen anstarrte – eine kleine, rothaarige, kampflustige Gestalt. »Das mit mir und Palmer? Das ist nicht vorbei, weil nie etwas zwischen uns war! Tom und ich waren – sind immer noch – Freunde! Nur Freunde, okay?«
»Oh. Noch mal sorry dann – dafür, dass ich meine Nase in Ihre Angelegenheiten gesteckt habe!«, beeilte sich Carter, seinen Patzer auszubügeln.
Ihr Zorn verrauchte wie bei einem Wasserkessel, den man vom Herd genommen hatte. »Nein, nein, ich bin diejenige, die sich entschuldigen sollte, Sir. Ich wollte nicht aus der Haut fahren. Es ist nur so, dass Tom und ich … Wir sind gelegentlich zum Essen gegangen, als wir beide solo waren. Nur, dass Tom jetzt nicht mehr solo ist, nachdem er Madison kennengelernt hat.«
»Ist das ihr Vorname?«, fragte Carter.
»So ist es. Tom ist ein begeisterter Wanderer, und Madison ist sogar in seinen Verein oder Club, oder wie auch immer man das nennt, eingetreten. Ich weiß, dass einige Leute den Eindruck hatten, dass zwischen uns was lief, aber da war nichts, zu keiner Zeit, und wir hatten nie etwas Derartiges im Sinn.« Jess grinste unsicher. »Das war mein Albtraum – dass meine Mutter es erfahren und womöglich die falschen Schlüsse daraus ziehen könnte. Meine Mutter … nun ja.« Sie zuckte die Schultern. »Familie. Sie wissen ja, wie das ist.«
»Meine Tochter Millie ist für ein paar Tage bei mir zu Besuch«, hörte er sich sagen.
Jess’ anfängliche Überraschung wandelte sich in Interesse. »Das ist sicher schön für Sie, Sir.«
»Es wäre noch viel schöner, wenn wir nicht gerade festgestellt hätten, dass wir es mit einem Mordfall zu tun haben. Ich hatte gehofft, ein paar Tage freinehmen zu können … In Millies Schule wurde Asbest unterm Dach gefunden. Mir ist unbegreiflich, wie das bis heute unentdeckt bleiben konnte. Jedenfalls, die Schule bleibt geschlossen, bis der ganze Mist raus ist. Millies Mutter und …« Er stockte, dann begann er von Neuem. »Sophie und Rodney, ihr derzeitiger Ehemann, hatten dringende Verpflichtungen und mussten nach New York. Sie konnten die Reise nicht verschieben. Sicher, es ist schön, dass Millie hier ist, doch ich habe nicht das Gefühl, als würde ich das Beste aus der Gelegenheit machen.«
»Vielleicht könnten Sie ja trotzdem freinehmen? Wir könnten ohne Sie …«
»Nein, nein, schon gut. Millie verbringt den Tag bei Monica Farrell. Sie erinnern sich an Monica?«
»Ja, natürlich erinnere ich mich.«
»Ich fände es schön, wenn Sie Millie kennenlernen würden«, hörte Carter sich sagen. »Ich weiß außerdem, dass Monica sich auch freuen würde, Sie wiederzusehen. Vielleicht könnten Sie ja mitkommen, wenn ich Millie abhole, entweder heute oder morgen Abend.«
Jess verbarg das Gefühl von nackter Panik, das sie für einen Moment zu übermannen drohte. Sie mochte Kinder, zugegeben, doch sie hatte wenig mit ihnen zu tun. Außerdem war Millie nicht irgendein Kind, sondern Carters Tochter. Sie hatte immer noch Mühe mit der Vorstellung von Carter als einem hingebungsvollen Vater. Abgesehen davon, ihr Auftauchen zusammen mit Carter konnte durchaus von Monica falsch interpretiert werden, oder noch schlimmer, von Carters kleiner Tochter. Trotzdem durfte sie nicht ablehnen. Sie spürte seine Verwundbarkeit, was dieses Thema anging. Sie sagte sich, dass es nicht ihr Problem wäre, sondern seines! Sie sollte ihm freundlich, aber bestimmt sagen, dass das keine gute Idee war. Doch sich zu weigern wäre unzivilisiert und gemein gewesen.
Also antwortete sie: »Ja, ich würde Millie gerne kennenlernen und dabei Monica wiedersehen. Morgen dann, damit Sie Gelegenheit haben, Monica zu warnen, dass ich mit Ihnen zusammen auftauche.« Sie versuchte ein gesundes Maß an Begeisterung in ihre Stimme zu legen.
»Großartig!«, erwiderte Carter.
Sie hatten sein Auto erreicht und stiegen ein. »Schön, legen wir los mit unserem Mordfall!«, sagte Carter, indem er den Zündschlüssel drehte. Er klang heiterer, als der Anlass es rechtfertigte. Doch er fühlte sich mit einem Mal beschwingt, Mord hin oder her.
Früher am Morgen, ungefähr zu der Zeit, als Ian Carter unter MacTavishs missbilligenden Blicken den Frühstücksporridge zubereitet hatte, war Alfie Darrow zurückgekehrt, um seine Fallen zu kontrollieren. Zuerst jedoch begutachtete er jenen Ort der Verwüstung, der alles war, was von Key House noch existierte. Blauweißes Flatterband riegelte alles ab. Hinweisschilder warnten Passanten davor, die Ruine zu betreten, weil sie ein Tatort war. Gleichzeitig wurde dazu angehalten, jegliche Informationen bezüglich des Feuers an die Polizei weiterzuleiten.
Alfie hätte zu gerne zwischen den verrußten Mauern nach Souvenirs gewühlt, doch selbst jetzt noch strahlten die Grundmauern eine Hitze ab, die jeden Versuch vereitelte, hineinzugehen und nach vergessenen Schätzen zu suchen. Außerdem knackte und raschelte es überall unheimlich, als die Trümmer sich setzten. Es klang wie geisterhafte Wesenheiten, die Furcht erregende Dinge flüsterten. Alfie hatte – wie jeder in Weston St. Ambrose – von der Leiche gehört, die man aus den Trümmern geborgen hatte. Eine primitive Angst vor Geistern überkam ihn, welche genährt wurde aus seiner anderen großen Leidenschaft: Gruselfilme mit verwunschenen Gebäuden und schwankenden Mumien, die aus ihren Gräbern stiegen. Er hastete über das Feld in Richtung Kaninchenbau, draußen im Freien, wo man keine geisterhafte Erscheinung zu erwarten hatte und keine knöcherne Hand auf der Schulter.
Überall waren Kaninchen. Sie knabberten an den spärlichen winterharten Gräsern und wild wachsenden Pflanzen. Als Alfie eintraf, hoppelten die meisten in alle Richtungen davon, doch einige Tiere ignorierten ihn. Anscheinend dachten sie, er wäre zu weit weg, um eine Gefahr darzustellen.
Er hatte kein Glück. Schlimmer noch, eine der Fallen fehlte. Das passierte gelegentlich. Irgendein größeres Tier, vielleicht ein Fuchs, war vorbeigekommen und hatte sie mitgeschleppt. Sie konnte nicht weit weg sein. Alfie kletterte über die Einzäunung ins Unterholz, was nicht so schwierig war, da der Zaun an einigen Stellen in sich zusammengefallen war, und fing im Unterholz an zu suchen.
Er fand die Falle nicht, doch er entdeckte etwas anderes. Im ersten Moment nahm er an, dass er nicht allein war im Gehölz. Er blickte sich suchend um, und als er nichts entdecken konnte, verharrte er lauschend. Er besaß ein feines Gehör für die leisen Geräusche des Waldes, die einem so viel erzählten, wenn man wusste, was sie bedeuteten. Die Zweige der Bäume knarrten leise im Wind, doch aus dem Unterholz war kein Knacken oder Rascheln zu hören. Sicherheitshalber rief er ein kurzes »Hallo?«, doch er erhielt keine Antwort. Alfie grinste in sich hinein. Immer noch vorsichtig näherte er sich der unerwarteten Entdeckung und umrundete sie begutachtend.
»Ich will verdammt sein«, murmelte er schließlich zu sich selbst. »Aber das lasse ich ganz sicher nicht hier zurück!«
Jess war soeben an ihren Schreibtisch zurückgekehrt und hatte Sergeant Phil Morton informiert: »Es war Mord.«
»Ich nehme an, sämtliche Beweise sind dem Feuer zum Opfer gefallen?«, hatte Morton erwidert, dann hatte auch schon das Telefon geklingelt. Jess nahm den Hörer auf.
»Ein Anruf für Sie, Ma’am«, sagte der Sergeant vom Dienst an ihrem Ohr. »Ein Mr Foscott, der sagt, er wäre Anwalt. Es geht um den Brand von Key House und den Toten dort. Soll ich den Anrufer durchstellen?«
»Ja, tun Sie das«, antwortete sie. Soso, Reggie Foscott. Wer hätte das gedacht?
Vor ihrem geistigen Auge entstand das Bild eines Mannes, hoch aufgeschossen, schlaksig, blass, steif und gerissen. Was um alles in der Welt hatte Reggie Foscott mit Key House zu tun? Doch Roger Trenton hatte erzählt, dass er Crowns Anwälte angeschrieben hatte. Morton hatte sowohl Roger Trenton als auch Muriel Pickering am späten Nachmittag des auf das Feuer und den Fund der Leiche folgenden Tages vernommen. Irgendwo in seinem Bericht musste auch Foscotts Name stehen.
»Inspector Campbell? Verzeihen Sie die Störung …« Foscotts Stimme hallte in ihrem Ohr.
»Sie stören nicht, Mr Foscott. Sie rufen also wegen des Feuers an, das vor einigen Tagen in Key House gewütet hat?«
»Äh …« Foscott legte seine Karten niemals offen auf den Tisch und machte auch jetzt keine Ausnahme, obwohl er derjenige war, der anrief. »Ja, in der Tat. Ein höchst bedauernswertes Ereignis. Ich habe gehört, das Gebäude wurde stark beschädigt?«
»Ja«, antwortete Jess knapp. Komm zur Sache, Reggie.
»Mir ist außerdem zu Ohren gekommen, dass man eine Leiche in den, äh, Trümmern gefunden hat – oder handelt es sich dabei nur um ein Gerücht?«
»Kein Gerücht.«
»Wissen Sie vielleicht …« Reggies Stimme klang noch vorsichtiger. »Kennen Sie vielleicht bereits die Identität des Opfers?« Eilig fügte er hinzu: »Sollte dies der Fall sein, habe ich natürlich Verständnis dafür, wenn Sie zuerst die nächsten Angehörigen informieren möchten, bevor Sie den Namen preisgeben.«
»Wir konnten die Leiche bisher nicht identifizieren, Mr Foscott.«
»Oje«, antwortete Foscott betrübt. »Haben Sie Grund zu der Annahme, es könnte sich bei dem – äh – Verstorbenen um den Eigentümer des Anwesens gehandelt haben, Mr Gervase Crown? Meine Firma vertritt hierzulande seine Interessen, daher meine Anfrage.«
»Bisher nicht. Man hat uns informiert, dass Mr Crown im Ausland lebt?«
»Das ist richtig. Mr Crown hat ein Haus in Portugal in der Nähe von Cascais. Es liegt an der Küste, etwa eine halbe Stunde von Lissabon entfernt. Er ist ein begeisterter Surfer und nutzt jede Gelegenheit, auf sein Brett zu steigen, wenn die Bedingungen stimmen. Ich muss betonen, dass mir von einem eventuellen Aufenthalt Mr Crowns hier in England nichts bekannt ist. Üblicherweise meldet er sich in unserem Büro, um uns Bescheid zu geben. Natürlich haben wir überlegt, dass wir mit ihm in Verbindung treten sollten, als wir von dem Feuer hörten. Sachschaden an seinem Eigentum, Versicherungsfall und so weiter.«
Dieses Mal wartete Jess und unterbrach ihn nicht. Foscott setzte seinen Bericht fort.
»Wir haben ihm eine E-Mail geschickt, doch bis heute kam keine Antwort. Ich sollte erwähnen, dass Mr Crown nicht immer sofort auf unsere E-Mail-Anfragen antwortet. Im Allgemeinen antwortet er aber irgendwann. Wir, äh, wir haben auch versucht, ihn telefonisch zu erreichen, doch in seinem Haus geht lediglich der Anrufbeantworter an, und sein Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Ich habe ihm eine Nachricht auf seiner Mailbox hinterlassen.«
»Ist es normal, dass Mr Crown nicht erreichbar ist?« Mit ihrer freien Hand schrieb Jess Anmerkungen auf einen Notizblock. Foscott klang besorgt, offensichtlich nicht ohne Grund. Morton kam um den Tisch herum und las, was sie notiert hatte. Er verzog das Gesicht.
»Nun, für gewöhnlich nicht. Doch dann und wann zieht er sich zurück«, sagte die Stimme des Anwalts an ihrem Ohr. »Beispielsweise wenn er surfen geht oder andere sportliche Aktivitäten verfolgt. Er spielt auch viel Golf … Es gibt nichts Schlimmeres auf einem Golfplatz, als wenn das Telefon klingelt, kurz bevor man mit seinem Abschlag an der Reihe ist …«
»Und? Ist der Tote Gervase Crown?«, fragte Sergeant Phil Morton später. Die Frage war rhetorisch. Es war das, was alle dachten.
Morton war zusammen mit Jess in Superintendent Carters Büro. Die Heizung war langsam wieder angegangen, doch bisher hatte es den Anschein, als würde sie lediglich den Staub des zurückliegenden Sommers aufwirbeln und nur wenig Wärme bringen. Morton stand am Fenster und blickte niedergeschlagen drein. Was nicht bedeutete, dass er es für hoffnungslos hielt, den Fall zu lösen. Es war nur so, dass er bei jeder Ermittlung mit plötzlichen Fallgruben rechnete. Seine Haltung beruhte auf Erfahrung. Im Moment brütete er darüber, welche Haken und Ösen sich diesmal wieder offenbaren würden. Eine mysteriöse Leiche und ein vom Feuer zerstörter Tatort waren jedenfalls ein guter Anfang, wie er zuvor bereits Jess gegenüber angemerkt hatte.