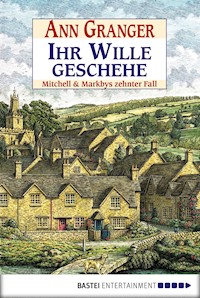9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Viktorianische Krimis
- Sprache: Deutsch
New Forest, England 1864: Die ländliche Idylle trügt. Ein Baby stirbt auf tragische Weise. Die junge Mutter ist verzweifelt. Verzweifelt genug, einen Mord zu begehen? Kurz darauf findet der Rattenfänger des Ortes ein grausames Ende.
Als Lizzie Martin aus London in New Forest eintrifft, stolpert sie wieder einmal über eine Leiche und muss erneut ganz auf ihre Intuition und die Hilfe ihres alten Freundes Benjamin Ross von Scotland Yard vertrauen, um das Verbrechen zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die AutorinTitelImpressumWidmungERSTER TEILKAPITEL EINSKAPITEL ZWEIKAPITEL DREIKAPITEL VIERKAPITEL FÜNFKAPITEL SECHSKAPITEL SIEBENKAPITEL ACHTZWEITER TEILKAPITEL NEUNKAPITEL ZEHNKAPITEL ELFKAPITEL ZWÖLFKAPITEL DREIZEHNKAPITEL VIERZEHNKAPITEL FÜNFZEHNKAPITEL SECHZEHNKAPITEL SIEBZEHNKAPITEL ACHTZEHNDRITTER TEILKAPITEL NEUNZEHNKAPITEL ZWANZIGKAPITEL EINUNDZWANZIGKAPITEL ZWEIUNDZWANZIGAnhangUnsere EmpfehlungenÜber die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
NEUGIER IST EIN SCHNELLER TOD
EIN FALL FÜR LIZZIE MARTINUND BENJAMIN ROSS
Kriminalroman Aus dem Englischen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »Mortal Curiosity«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2007 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2008 by Bastei Lübbe AG, Köln Titelillustration: © Dave Hopkins / phosporart Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen Textredaktion: Gerhard Arth, Bad Münstereifel Lektorat: Stefan Bauer E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-0142-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Danke allen, die mir bei den Nachforschungen zu diesem Buch geholfen haben, an Alan Shotter für eine Beschreibung der Lage und Situation der ursprünglichen Southampton Town Eisenbahnstation, an Graham Parkes für Informationen bezüglich der Landevorbereitungen für die Hythe (Hants) Fähre vor dem Bau des Piers von Hythe und wie stets meiner Schriftstellerkollegin Angela Arney, die mich in New Forest herumgefahren (und mir ihre großzügige Gastfreundschaft gewährt) hat. Danke auch an all diejenigen, die mich regelmäßig bei meiner Arbeit unterstützen: an meine Lektorin Clare Foss, meine Agentin Carole Blake und vor allem meinen Ehemann John.
ERSTER TEIL
KAPITEL EINS
Elizabeth Martin
Der Mann mir gegenüber im Erster-Klasse-Abteil trug einen glänzenden schwarzen Zylinderhut, der vom Deckel bis zum Rand mit einem glänzenden weißen Seidentuch drapiert war. Es bewegte sich anmutig fließend in der sanften Luftströmung und erweckte den Eindruck, die im Übrigen würdevolle Erscheinung des Fremden könnte von einem Augenblick zum anderen levitieren und über unsere Köpfe hinweg entlang der Gepäckablage schweben.
Die Vorstellung brachte mich zum Lächeln, denn der Träger dieses Hutes war in jeglicher anderer Hinsicht eine ordentliche, ja peinlich korrekt gekleidete Gestalt. In seinem rotbraunen Schnurrbart und dem üppigen Backenbart, der sich entlang seiner Wangen nach unten zog und unter dem Kinn zu einem Gabelbart vereinigte, zeigten sich erste graue Streifen. Dennoch schätzte ich sein Alter auf nicht mehr als fünfundvierzig oder sechsundvierzig Jahre. Seine schlanke Gestalt steckte in einem schwarzen Frack, und sein Leinenhemd – was davon zu sehen war – stellte einen schneeweißen Kontrast dazu her. Seine Hände ruhten übereinander auf dem geschnitzten Elfenbeingriff eines langen Malakkaspazierstocks. Die Haltung zog die Aufmerksamkeit auf seine erstklassigen, mit Litze besetzten Glacéhandschuhe. Meine aufgebauschten Röcke hinderten mich daran, sein Schuhwerk zu betrachten, doch ich war sicher, dass es gleichermaßen makellos war. Was den Zylinderhut anging, so war er sicherlich ein kostspieliger Kauf gewesen. Umherfliegende Asche von den Dampflokomotiven, die in die Waterloo Station einfuhren oder sie wieder verließen, hätten ihn beschädigen können, und so hatte er ihn auf dem Bahnsteig wohlweislich mit dem weißen Seidenschal umhüllt und entweder vergessen, den Schutz zu entfernen, nachdem wir unterwegs waren, oder er fürchtete noch immer, dass ein Wirbel feindseliger Funken trotz der fest geschlossenen verglasten Fenster den Weg in unser Abteil finden könnte.
Na, Lizzie!, schalt ich mich, als mir bewusst wurde, dass ich Gefahr lief, unhöflich zu erscheinen, weil ich ihn so kritisch anstarrte. Das reicht nun wirklich! Ich hoffte, dass es ihm nicht aufgefallen war, und richtete meinen Blick hastig durch das Fenster auf die Landschaft draußen, sofern man davon reden konnte. Wir schaukelten stetig aus der Endstation London and South Western Railway in Waterloo, und die Aussicht war eine eher wenig aufregende auf rußgeschwärzte, schmutzige Gebäude.
In meinen Adern breitete sich ein Gefühl von bevorstehendem Abenteuer aus, gepaart mit einer ganz leichten Spur von Nervosität. Die Südküste Englands war mir so unbekannt wie London zu Anfang des Jahres, als ich mit meinem bescheidenen Gepäck aus dem Norden hierhergekommen war. Und nun war ich erneut unterwegs. Unangenehme und unvorhergesehene Ereignisse hatten meinen Aufenthalt in der Hauptstadt plötzlich beendet. Wie sich herausgestellt hatte, waren sie es auch gewesen, die mir die Tür zu neuen Möglichkeiten geöffnet hatten. Und doch hätte ich mich auch in das dunkelste Afrika begeben können, so wenig wusste ich über mein gegenwärtiges Reiseziel. Zumindest in meiner Phantasie erschien es kein Stück weniger exotisch.
Wir ratterten durch Clapham und erreichten die Vororte. Die Häuser waren bereits kleiner und drängten sich in Reihen. Die sorgfältig gepflegten Gärten reichten bis an die Gleisböschung heran und boten Ausblicke auf bescheidene häusliche Verhältnisse. Wäsche flatterte auf Leinen, und Kinderspielzeug lag achtlos auf dem Rasen. Bäume und freie Flächen deuteten auf eine ländliche Gegend hin. Die überwältigende Gegenwart des hektischen London mit seinen verstopften Straßen, dem Staub, Qualm und niemals endenden Lärm blieb allmählich zurück.
Ich verließ das alles nicht ohne Bedauern. Ganz besonders eine Person war es, die mir den Abschied schwer machte.
»Dieser junge Mann, mit dem du dich triffst«, hatte mich Tante Parry eines Tages über dem reichhaltigen Mittagsmahl gefragt, das sie als Imbiss bezeichnete. »Beabsichtigt er, eine Heirat vorzuschlagen?«
Normalerweise bin ich um eine Antwort nicht verlegen, doch diese Frage, ohne jede Vorwarnung gestellt, ließ mich ins Schwimmen geraten. Tante Parry sah mich nicht an. Ihre Augen waren auf ihren Teller gerichtet, und sie konzentrierte sich anscheinend auf eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Essen. Ich beobachtete, wie der Löffel ihren Mund erreichte und wie sich ihre schmollenden Lippen teilten. Ich überlegte, wie klein ihr Mund war und dass sie mit ihrer Stupsnase und den rosigen Pausbacken aussah wie ein himmlischer Cherub in fortgeschrittenem Alter. Die kastanienbraunen Locken, die unter ihrer Spitzenhaube hervorlugten, verstärkten diesen Eindruck noch. Sehr kastanienbraun. Ich weiß noch, wie ich voller Staunen überlegte, ob sie angefangen hatte, Henna zu benutzen! Dann kehrte mein Verstand zögernd zu ihrer Frage zurück und wie ich darauf antworten sollte.
In den vorangegangenen drei Monaten war ich offiziell mit Ben Ross »ausgegangen«. In Wirklichkeit hatte ich nur sehr wenig von ihm gesehen. Ich hatte eine Rivalin, und ihr Name war Polizeiarbeit. Die Unterwelt machte keine Ferien, wie ich sehr bald herausgefunden hatte. Zu allen Tages- und Nachtzeiten und mit einem ausgesprochenen Mangel an Rücksicht auf Polizeibeamte und ihr Privatleben erleichterten Einbrecher unbescholtene Bürger ihrer Habseligkeiten, brüteten Betrüger ihre raffinierten Intrigen aus, während Mörder, jene skrupellosesten aller Raubtiere, die Gassen der Elendsviertel durchstreiften und ungesehen in die Behausungen der Besserverdienenden schlüpften.
Das unablässige Durchkreuzen jeglicher Pläne, die Ben und ich schmiedeten, fand seine Verkörperung in der beträchtlichen Leibesmasse von Superintendent Dunn. Er war ein netter Mann, rau, aber herzlich, doch ich merkte bald, dass er von seinen untergebenen Beamten erwartete, dass sie nach seiner Pfeife tanzten, »zuerst und zuoberst und mehr oder weniger ununterbrochen!«, wie ich Ben gegenüber mit heißer Inbrunst erklärte.
Was also um alles in der Welt sollte ich Tante Parry auf ihre Frage hin antworten? Ich hätte ihr erzählen können, dass ich glaubte, Ben würde mit einem Heiratsantrag herausrücken, doch auf der anderen Seite war kein diesbezügliches Wort gesagt worden. Mehr noch, wenn ich als Ehefrau so wenig von ihm sehen würde wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt als seine »junge Lady«, dann regten sich in mir ernste Zweifel, ob ich überhaupt mit einem Inspector der Plain Clothes Division* der Metropolitan Police verheiratet sein wollte.
Mein innerer Zwiespalt hatte sich noch verschlimmert wegen der Note, die mir erst an jenem Morgen von einem impertinent grinsenden Bengel zugestellt worden war. In ihr bat Ben mich um Verzeihung und teilte mir sein aufrichtiges Bedauern darüber mit, dass er nicht wie geplant frei und imstande sein würde, mich an jenem Nachmittag zum Freiluftkonzert im Hyde Park zu begleiten. Als wir unseren Ausflug geplant hatten, hatte Ben mir noch versichert, dass es angesichts der langen Stunden, die er in letzter Zeit gearbeitet hatte, und angesichts der nicht unbeträchtlichen Erfolge seiner Anstrengungen möglich sein müsste, einen freien Samstagnachmittag zu erhalten. Doch nein. Wieder einmal waren wir frustriert. Ich wusste, dass er genauso enttäuscht war wie ich, allein, es half nichts, und die Phrase in seiner sorgfältig formulierten Note, die mich am meisten verärgerte, war die, von der ich wusste, wie sehr der arme Ben über ihr geschwitzt hatte und in welcher er seiner innigen Hoffnung Ausdruck verlieh, ich würde »es verstehen«.
Oh ja, ich verstand sehr genau. Superintendent Dunn verlangte nach Bens Diensten, und das Konzert wurde beiseitegeschoben, um Platz zu schaffen für einen weiteren zweifellos grausigen Mord.
Und so antwortete ich auf Tante Parrys Frage mit einem forschen »Es tut mir leid, aber ich weiß es durchaus nicht!«.
Sie blickte verblüfft von ihrem Teller auf. »Aber ich bin verantwortlich für dich, Elizabeth, meine Liebe!«, sagte sie, wie um ihre Neugier zu rechtfertigen.
Sie glaubte wahrscheinlich, mein kurzes Stirnrunzeln sollte bedeuten, dass sie sich meiner Meinung nach in eine delikate private Angelegenheit einmischte. Die Frage nach Bens Absichten hatte mich jedoch nicht verärgert – vielmehr wurmte mich die Erklärung, dass sie »verantwortlich« für mich wäre.
Ich wollte erwidern, dass dies keineswegs der Fall wäre. Dass sie nur eine »angeheiratete« Tante wäre, die Witwe meines verstorbenen Patenonkels und überdies gegenwärtig meine Arbeitgeberin. Ich war die Haushälterin meines verwitweten Vaters gewesen und ganz allgemein sein Faktotum bis zu seinem Tod, und ich war daran gewöhnt, für mich selbst verantwortlich zu sein. Doch es wäre nicht nur unhöflich von mir gewesen, ihr das zu sagen, sondern darüber hinaus undankbar. Auf ihre eigene Weise war sie in der Tat sehr freundlich zu mir gewesen. Es war weder ihre noch meine Schuld, dass wir beide überhaupt nicht zueinander passten.
Als Kind war ich, wenn ich mich in einer schwierigen Situation wiedergefunden hatte, die Treppen unseres alten Hauses hinaufgerannt und hatte mich auf dem Dachboden versteckt, bis mir eine Antwort auf meine Probleme eingefallen war. Das konnte ich in dieser Situation nicht. Was ich dringender brauchte als alles andere war Abstand, Alleinsein und Zeit, um ungestört über meine missliche Lage nachzudenken. Stattdessen jedoch verbrachte ich den größten Teil meiner Zeit (dank Superintendent Dunn) damit, mir Tante Parrys Geschnatter anzuhören und mit ihr und ihren Freunden und Freundinnen Whist zu spielen.
»Liebste Tante Parry«, sagte ich zu ihr. »Ich bin sehr dankbar für alles, was du für mich getan hast. Ich weiß, dass du dich um meine Zukunft sorgst. Es würde mir ohne Frage sehr leidtun, dieses Haus zu verlassen und das Heim, das du mir zu geben die große Herzensgüte besessen hast, aber ich habe überlegt, dass ich London vielleicht für eine Weile ganz verlassen sollte.«
»Was hältst du von Hampshire?«, fragte Tante Parry sofort.
Ich riss verblüfft die Augen auf, dann nahm ich mich zusammen. »Ich kenne Hampshire nicht. Ich war bisher nur in meinem Heimatdorf und hier in London.«
»Oh, Hampshire würde dir gefallen!«, sagte Tante Parry zuversichtlich. »Ganz besonders die Gegend, die New Forest genannt wird. Es ist sehr hübsch dort, und es liegt am Meer. Die Seeluft würde dir guttun.«
Schlug sie etwa vor, dass ich Ferien machte? Ich konnte es nicht glauben. Und es war richtig, daran zu zweifeln. Ferien waren ganz und gar nicht das, was Tante Parry im Sinn hatte.
Sie schob ihren Teller mit Stachelbeercreme von sich – eine Geste, die mir verriet, wie ernst es ihr war.
»Ich habe mich mit einem alten Bekannten unterhalten, Mr. Charles Roche«, begann sie. »Mr. Roche ist ein ehemaliger Geschäftspartner meines armen Josiah. Seide, weißt du? Seit einigen Jahren hat er seine geschäftlichen Aktivitäten um den Import von Tee aus China erweitert. Wenn ich recht informiert bin, besitzt er zwei schnelle Teeklipper. Stell dir vor, von Kanton bis London in nur neun Wochen!«
Tante Parry hielt inne, um mit kurzen, dicken Fingern den Stoff ihres Ärmels glattzustreichen. »Wie ausgesprochen klug von Charles«, murmelte sie abschweifend vor sich hin. »Seide und Tee zu kombinieren – zwei Dinge, ohne die keine richtige Lady leben kann …!« Sie riss sich zusammen und kehrte zum Thema zurück. »Nun habe ich soeben erfahren, dass es in seiner Familie zu gewissen privaten Schwierigkeiten gekommen ist, und mir kam der Gedanke, dass du möglicherweise genau die richtige Person wärst, um ihm da herauszuhelfen.«
Ich musste tun, als wäre ich interessiert. »Ja?«, ermunterte ich sie.
Tante Parry strahlte mich anerkennend an. Es würde nicht schwierig werden.
»Nun, meine Liebe, Mr. Roche hat eine junge verheiratete Nichte, Mrs. Craven. Lucy wird sie gerufen. Mrs. Craven hat erst vor kurzem ihr erstes Kind zur Welt gebracht, doch leider starb es nach gerade einmal zwei Tagen!«
»Das tut mir leid zu hören«, sagte ich aufrichtig.
»Seit diesem Zeitpunkt ist ihre Stimmung sehr gedrückt«, fuhr Tante Parry fort. »Ihr Ehemann …« An dieser Stelle stockte sie und blickte ein wenig verlegen drein.
»Mr. Craven?«, schlug ich in sanftem Tonfall vor.
Tante Parry war keine Närrin. Sie blinzelte und sagte in scharfem Ton: »Ganz recht. Mr. Craven ist geschäftlich im Ausland. Er und seine junge Frau sind im Übrigen Cousin und Cousine – zweiten oder dritten Grades, sollte ich meinen. Wie dem auch sei, Mr. Roche möchte, dass Mr. Craven in seiner Firma vorankommt, daher hat er ihn nach China geschickt, damit er den Seehandel lernt.«
»Geschäft ist Geschäft, nehme ich an«, sagte ich. »Doch es erscheint mir sehr unfreundlich, den jungen Mann nach China zu senden, während seine Frau sich vom Kindbett erholt und beide noch um ihr verstorbenes Neugeborenes trauern.«
»Ich meine gehört zu haben, dass er bereits zu seiner Reise aufgebrochen ist, bevor das Kind geboren wurde«, räumte Tante Parry ein und hob die Hand. »Abgesehen davon gehen uns die Umstände nichts an, Elizabeth. Die gegenwärtige Situation ist folgende: Die junge Mrs. Craven wohnt zusammen mit den Schwestern von Mr. Roche, zwei unverheirateten Damen, in ihrem Haus in Hampshire. Ich habe gehört, dass es wunderbar liegt, dort, wo New Forest auf den Solent hinauszeigt. Man kann bis zur Isle of Wight sehen, wo unsere geliebte Königin ihr wunderschönes Osborne House besitzt.«
Tante Parry hielt inne und stieß einen Seufzer aus. Um ihrem Mitgefühl mit Ihrer Majestät der Königin in ihrer Witwenschaft Ausdruck zu verleihen, wie ich annahm – doch ich hätte es besser wissen müssen.
»Ich habe oft zu deinem Patenonkel gesagt, dass er ein Haus auf dem Land kaufen soll, doch das hat er nie getan. ›Meine Liebe‹, pflegte er stets zu antworten, ›hier in Marylebone bin ich so dicht am Land, wie ich zu sein wünsche.‹ Er war nur höchst ungern weiter weg von seinem Büro.
Wie dem auch sei, ich sprach von Shore House draußen in New Forest, wo die Ladys Roche leben. Es ist ein wunderbarer Fleck, doch es ist zugleich sehr still. Es gibt keine jüngere Gesellschaft, die Ladys sind ältlich und leben zurückgezogen. Wie ich bereits sagte, Mrs. Cravens Stimmung ist sehr gedrückt. Charles Roche ist der Meinung, eine Gesellschafterin in ihrem eigenen Alter würde seine Nichte aufmuntern. Außerdem würde es seinen Schwestern einen Teil der Bürde nehmen, die die Sorge um Mrs. Craven mit sich bringt. Er möchte selbstverständlich niemanden, der zu jung ist und eine Klatschbase. Er sucht eine Person, die in einem etwas reiferen Alter ist und zugleich noch beträchtlich jünger als seine Schwestern. Ich dachte sofort an dich.«
»Ich werde erst Ende des Jahres dreißig, Tante Parry!«, protestierte ich.
Tante Parry machte eine Handbewegung, die diesen unbedeutenden Einwand abtat.
»Du bist die Tochter eines Arztes, Elizabeth, und mir will scheinen, dass du genau die richtige Person bist, um Mrs. Craven für eine Weile als Gesellschafterin zu dienen, bis sich ihr Zustand gebessert hat. Es wäre nur für ein paar Monate. Danach könntest du nach London zurückkehren und in dieses Haus … oder vielleicht in ein anderes.«
Es war offensichtlich, welche der beiden Optionen Tante Parry bevorzugte.
»Ich könnte mich nach einer anderen Stelle für dich umhören, während du in Hampshire bist«, fügte sie hinzu und bestätigte damit meine Vermutung. »Nicht, dass du denkst, ich hätte den Wunsch, dich gehen zu lassen, meine liebe Elizabeth.«
So ist das mit der Konvention. Sie zwingt uns alle zu lügen. Ich konnte nicht schnell genug aus diesem Haus verschwinden, und meine Arbeitgeberin konnte mich nicht schnell genug loswerden. Ich sagte ihr, dass ich das sehr gut verstünde, und überließ es ihr, sich zu denken, was immer sie wollte.
Ich verstummte alsdann, um über den Vorschlag von Tante Parry nachzudenken, und Tante Parry machte sich über den Rest ihrer Stachelbeercreme her. Sie wirkte erleichtert, sich die Angelegenheit von der Seele geredet zu haben.
Ich musste zugeben, dass es zwar ein gewisses Geheimnis bezüglich des Verbleibs von Mr. Craven gab, doch der Vorschlag Tante Parrys hatte eine Menge, die für ihn sprach. Mein verstorbener Vater hatte eine Vielzahl von Frauen behandelt, die nach der Geburt eines Kindes in niedergedrückter Stimmung gewesen waren. Ich wusste, ohne selbst Mutter zu sein, dass es nicht ungewöhnlich war, selbst dann, wenn man ein gesundes, putzmunteres Kind zur Welt gebracht hatte. Die arme Lucy Craven jedoch hatte ihr Kind beerdigen müssen. Wenn ich zu ihr fuhr und ihr Gesellschaft leistete, würde ich etwas Nützliches tun, und der kurze Aufenthalt in Hampshire würde mir Gelegenheit verschaffen, über meine Zukunft nachzudenken.
Das alles war in jeder Hinsicht schön und gut – mit einer Ausnahme: Ben Ross’ wahrscheinlicher Reaktion. Doch das konnte ich gegenüber Tante Parry nicht zugeben. Außerdem sagte ich mir, dass es töricht wäre, Ben davon zu erzählen, bevor ich selbst mit Mr. Roche gesprochen hatte. Schließlich war es durchaus möglich, dass bei der Sache nichts herauskam.
»Vielleicht sollte ich mich mit Mr. Roche treffen und mit ihm darüber sprechen«, schlug ich vor.
»Selbstverständlich, meine Liebe. Ich dachte mir bereits, dass du so etwas sagen würdest. Mr. Roche würde sich freuen, dich am Montagmorgen um elf Uhr dreißig in seinem Haus in Chelsea zu empfangen.« Sie betupfte sich das Kinn mit einer Serviette, nahm die kleine Messingglocke, die auf dem Tisch stand, und läutete. »Ich denke, ich könnte noch ein wenig Käse vertragen. Wie steht es mit dir, Elizabeth?«
Ich war angenehm beeindruckt von Charles Roche. Das Haus in Chelsea, ein elegantes Reihenhaus, war kostspielig möbliert. Der Butler, der mir öffnete, war bereits in fortgeschrittenem Alter, sicher über sechzig, und ich schätzte seinen Arbeitgeber ungefähr genauso alt. Charles Roche war ein großer, breiter Mann, ein wenig gebeugt vom Alter. In jüngeren Jahren war er sicher über einsachtzig groß gewesen. Er erwies sich als Gentleman vom alten Schlag, sehr höflich und sehr besorgt, dass ich mich auch ja in keiner Weise unannehmlich fühlte. Ich würde das gleiche Salär beziehen wie das, was Tante Parry mir gegenwärtig zahlte. Da ich auf dem Land lebte, würde ich nicht die gleichen Ausgaben haben wie in London. Die Ladys Roche gaben keine Gesellschaften – nicht nur aufgrund der gegenwärtigen Situation, sondern weil sie ein ruhiges Leben bevorzugten. Was bedeutete, dass ich mich in finanzieller Hinsicht beträchtlich besser stellen würde als bei Tante Parry.
Mr. Roche würde mir einen Fahrschein erster Klasse nach Southampton bezahlen. (Luxus, in der Tat!) Miss Christina Roche, die ältere der beiden Schwestern, würde mir vor meiner Abfahrt schriftliche Instruktionen schicken, wie ich von Southampton aus weiterreisen musste.
Mr. Roches Sorge um seine junge Nichte schien so aufrichtig, seine Bedenken wegen der schwierigen Situation, in der sich seine Schwestern befanden, so unumwunden an den Tag gelegt, dass ich, bevor ich’s wusste, zustimmte.
Tante Parry war entzückt. Nun blieb nur noch, Ben Ross die Neuigkeit beizubringen.
»Hast du etwa den Verstand verloren, Lizzie? Wer um alles in der Welt ist diese Miss Roche von Shore House?«
Ben feuerte diese Breitseite auf mich ab, nachdem ich ihn in freundlichem, bestimmtem Ton von meinen Absichten in Kenntnis gesetzt hatte.
»Das glaube ich nicht, Ben«, widersprach ich. »Ich habe im Gegenteil sehr gründlich darüber nachgedacht.«
Ich gab meine Antwort mit so viel Würde, wie ich aufzubringen imstande war. Ich räume bereitwillig ein, dass ich von Zeit zu Zeit unbesonnen agiere, ganz besonders, was meine Zunge angeht, die bisweilen schneller ist als mein Verstand. Doch ich war bisher immer in der Lage gewesen, eigene Entschlüsse zu fassen.
Ben stand mit gerötetem Gesicht vor mir, den Hut in der Hand, der Schopf schwarzer Haare wirr von der Hand, mit der er sie gerade gerauft hatte, und starrte mich entschieden aufgebracht an. Wir befanden uns in Tante Parrys Haus, in dem Zimmer, das als Bibliothek diente. Es gab selbstverständlich ein paar Bücher darin, doch sie waren von der eher trockenen Sorte, und niemand rührte sie je an.
»Josiah hat sie gebraucht erstanden, bei einem privaten Räumungsverkauf«, hatte Tante Parry mir vor einiger Zeit einmal anvertraut. »Partieware sozusagen.«
»Weißt du was, Lizzie?« Ben hob die Hand und zeigte auf mich, dann wurde ihm bewusst, wie unhöflich es aussah, und er ließ sie hastig wieder sinken. »Hör mal«, fuhr er fort in einem erbärmlichen Versuch, ruhig zu bleiben. »Ich war felsenfest überzeugt, dass du die vernünftigste Frau bist, die ich je gekannt habe. Du von allen hast den Kopf richtig herum auf den Schultern sitzen, hätte ich geglaubt. Und dann plötzlich willst du nach Hampshire gehen, wo du noch nie im Leben warst, und eine Stelle als Gesellschafterin bei jemandem antreten, von dem du bis vor einer Woche noch nie gehört hast.«
Sein Tonfall und sein Verhalten wurden erneut zunehmend aufgeregt, und sein Derbyshire-Dialekt klang durch. »Die ganze Geschichte klingt meiner Meinung nach eigenartig. Erzähl mir nicht, dass ich Polizist und deswegen misstrauisch bin. Schön, zugegeben, wenn du so willst, ich bin Polizist und ich bin misstrauisch, allerdings habe ich auch meine Erfahrungen! An dieser Geschichte ist etwas ganz entschieden faul, Lizzie, merk dir meine Worte!«
Er vollführte eine theatralische Geste in Richtung des Porträts meines verstorbenen Patenonkels Josiah, das über dem Kamin hing.
»Ben«, sagte ich laut und entschieden, da ich keine andere Möglichkeit sah, seine Tirade zu durchbrechen. »Würdest du mich die Sache vielleicht erklären lassen?«
»Schieß los!«
»Aber lass mich bitte ausreden, und anschließend höre ich mir an, was immer du mir zu sagen hast.«
Ein Schnauben war die Antwort.
»Erstens, ich lebe nur deswegen weiter in diesem Haus, weil ich Tante Parrys Gesellschafterin bin, auch wenn wir beide dieses Arrangement gerne beenden würden. Du und ich wissen beide sehr genau, warum. Solange ich hier bin, kann sie den Mord an meiner Vorgängerin nicht vergessen. Du erinnerst sie ebenfalls daran; du hast in der Sache ermittelt. Und ich kann ihn auch nicht vergessen.«
Ich atmete tief durch. »Josiah Parry war mein Patenonkel, und sie kann mich nicht mit Sack und Pack vor die Tür setzen, doch sie hat einige Mühe auf sich genommen, um eine andere Anstellung für mich zu finden. So ist das nun einmal. Sie schert sich einen Kehricht um die Familie Roche oder die junge Mrs. Craven, aber sie will mich loswerden. Ich muss das Arrangement akzeptieren, das sie so mühevoll eingerichtet hat.«
»Hmmmph!«, war die gemurmelte Antwort darauf.
»Die Anstellung ist nur für sechs Monate, bis Mrs. Craven sich vollends von ihrer niedergedrückten Stimmungslage erholt hat oder bis Mr. Craven nach Britannien zurückgekehrt ist.«
»Falls es überhaupt einen Mr. Craven gibt!«, schnaubte Ben.
»Der Gedanke kam mir in der Tat ebenfalls«, gestand ich. »Doch nun, da ich mit Mr. Roche gesprochen habe, sind diese Zweifel ausgeräumt. Mr. Roche ist ein sehr respektabler älterer Gentleman. Er hat erklärt, er hofft, dass der junge Craven eines Tages das Teegeschäft der Familie übernimmt. Deswegen wurde er ins Ausland geschickt. Er soll lernen, wie Tee angebaut und geerntet und verschifft wird. Er ist zurzeit irgendwo in China.«
»Ganz bestimmt!«, lautete der kühle Kommentar. »Warum nicht auf dem Mond?«
»Das ist deiner unwürdig, Ben!«
Er reckte den Unterkiefer halsstarrig vor. »Hör zu, Lizzie, ich weiß, dass du aufgebracht bist, weil ich in den letzten Wochen nicht viel Zeit für uns erübrigen konnte, aber ich hoffe sehr, dass du nicht nach Hampshire gehst, um dich für die Vernachlässigung zu rächen, die du durch mich erlitten hast. Ich bin der Erste, der dies eingesteht, und ich weiß …«
»Ich stürze mich nicht überhastet in ein Abenteuer!«, unterbrach ich ihn. »Bitte, denk das nicht, Ben. Ich bestreite nicht, dass ich Superintendent Dunns ständiges Verlangen nach dir höchst ärgerlich finde. Ich weiß auch, dass es nicht deine Schuld ist und dass, welche Zukunft wir auch immer gemeinsam hätten, Superintendent Dunn notwendigerweise ein Teil davon wäre.« Ich brachte ein ironisches Grinsen zu Stande. »Mein Vater war Hausarzt und wusste nie im Vorhinein, wann er zu einem Kranken gerufen werden würde. Ich verstehe die Situation sehr gut.«
Schweigen breitete sich aus. Ben setzte sich auf den Ohrensessel mir gegenüber. Er räusperte sich, und sein Gesicht lief erschreckend rot an.
»Lizzie«, begann er. »Du sollst wissen, dass meine Hoffnungen …«
Die Ernsthaftigkeit seines Gesichtsausdrucks und die Schweißperlen auf seiner Stirn erfüllten mich mit plötzlicher Panik.
»Bitte, Ben!«, platzte ich heraus. »Verzeih, wenn ich mir zu viel herausnehme, doch wenn du vorhast zu fragen, was ich denke, dann kann ich dir im Augenblick wirklich keine Antwort darauf geben! Ich bin mir der Ehre durchaus bewusst«, fuhr ich fort und klang Stück für Stück genauso gestelzt wie er noch wenige Sekunden zuvor, doch ich wusste mir nicht anders zu helfen. »Es ist nicht, dass ich nicht … dass es mir nicht …« An diesem Punkt geriet ich ins Stocken, und mein Gesicht war ganz ohne Zweifel noch röter als das von Ben.
»In diesem Fall …«, begann er eifrig, doch ich unterbrach ihn erneut.
»So viel ist passiert in den letzten Monaten, dass meine ganze Welt auf dem Kopf zu stehen scheint! An manchen Morgen wache ich auf und frage mich, was um alles in der Welt als Nächstes geschehen wird. Ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu ordnen. Bitte, versuch das zu verstehen, Ben.«
»Selbstverständlich«, sagte Ben und sah mich so untröstlich an, dass ich mich wie ein Monster fühlte. »Ich hätte wissen müssen, dass dies nicht der geeignete Moment ist. Nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Doch es wäre leichter für mich, geduldig zu sein, wenn ich das Gefühl hätte, dass du mich nicht rundweg ablehnst. Nicht«, fügte er hastig hinzu, »nicht, dass ich ein Recht hätte zu mutmaßen, dass du akzeptieren würdest. Ganz bestimmt jedoch musst du nicht aus London weggehen. Ich werde dich nicht um eine Antwort bedrängen.«
Das war schlimmer, als beschuldigt zu werden, im Zorn zu fliehen. Ich versicherte ihm aufrichtig, dass ich niemals auch nur für eine Sekunde geglaubt hätte, dass er sich anders als in absolut jeder Hinsicht korrekt verhalten würde. Dies schien ihn zuerst ein wenig aufzumuntern, doch dann bedrückte es ihn noch mehr.
»Das freut mich zu hören, Lizzie, das freut mich sehr«, sagte er betrübt.
»Ich werde dir eine Antwort geben, Ben, aber nicht jetzt. Ich spüre das dringende Bedürfnis, eine Zeitlang aus London wegzugehen. Es wird nur für eine kurze Weile sein, bestimmt.«
Ben blickte noch trübseliger drein. »Es gefällt mir nicht, Lizzie. Ich bin nicht selbstsüchtig, bestimmt nicht. Es ist nur, diese ganze Geschichte ist wie eine gesprungene Tasse. Sie klingt einfach nicht richtig.«
»Oh, Ben!«, sagte ich und ergriff seine Hand. »Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich bin sehr wohl imstande, auf mich aufzupassen.«
»Perfekt imstande, dich in eine missliche Lage zu bringen, meinst du wohl!« Er umklammerte meine Hand mit seinen Händen und bettelte: »Ich weiß, dass nichts dich von deinem Entschluss abzubringen vermag, wenn du dir erst etwas in den Kopf gesetzt hast. Aber versprich mir, dass du mir jeden Tag schreiben wirst, Lizzie, und mir alles berichten. Alles, einverstanden? Ich will keine ellenlangen Landschaftsbeschreibungen. Ich will wissen, was vorgeht.«
Das wollte ich ebenfalls, und es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden – ich musste nach Hampshire reisen. Ich versprach Ben, dass ich ihm regelmäßig schreiben und nicht mehr als einen Absatz pro Brief auf die Landschaft verschwenden würde.
Ich wusste, dass seine Sorge um mich aufrichtig war. Doch die Reise nach Hampshire war nichtsdestotrotz notwendig für mich, dessen war ich mir über alle Zweifel sicher.
»Nicht mehr als sechs Monate«, wiederholte ich.
Das Schicksal spielt uns eigenartige Streiche. Ben unternahm alles in seiner Macht Stehende, um mich zur Waterloo Station zu begleiten und persönlich in einem Damenabteil der ersten Klasse unterzubringen. Doch wie üblich hatte die kriminelle Unterwelt ihre eigenen Vorstellungen, wie er an diesem Morgen seine Zeit verbringen sollte. Und so brachte mich letztendlich Simms, der Butler, zum Bahnhof, während Ben sich um »polizeiliche Angelegenheiten« kümmerte.
Unsere Droschke wurde zum einen vom Verkehr aufgehalten, zum anderen von Simms, der den Fahrpreis in Frage stellte. Am Bahnhof hatten wir zunächst Mühe, den richtigen Bahnsteig zu finden wegen der unübersichtlichen Art und Weise, wie sie ausgeschildert und nummeriert waren. Der Bahnhof war scheibchenweise gebaut worden und Bahnsteige je nach Bedarf angefügt, ohne jeden Versuch, Ordnung in das Chaos zu bringen. Simms und ich waren nicht die Einzigen, die in zunehmender Frustration hin und her rannten. Als wir den Zug endlich gefunden hatten, waren sämtliche Plätze im Damenabteil bereits besetzt. So kam es, dass ich in Gesellschaft des Mannes mit dem verschleierten Zylinderhut reiste sowie zwei weiteren Personen: einem geistlichen Gentleman, der gänzlich in ein frommes Buch vertieft saß, und einer älteren Lady, deren geschickte Finger ein ständig länger werdendes Band aus Tüllspitze produzierten. Es war gut, dass niemand sonst das Abteil zu betreten wünschte, denn mein von Reifröcken gestütztes Kleid und das der älteren Lady nahmen jeden verfügbaren freien Raum ein.
Ich nahm auf der komfortablen Polsterbank Platz, verdrängte all die Unbill der letzten Wochen aus meinen Gedanken und konzentrierte mich auf die Möglichkeiten, welche die Zukunft bereithielt. Um mich einzustimmen öffnete ich meine Börse und nahm den Brief hervor, der mir den Weg nach Shore House, meinem endgültigen Reiseziel, genauestens beschrieb. Ich hatte ihn gerade entfaltet und darin zu lesen angefangen, als der Gentleman in dem verschleierten Hut seine Kopfbedeckung abnahm und – immer noch mit Schleier – auf die Knie stellte. Sodann beugte er sich vor und gab ein diskretes Hüsteln von sich, um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen.
»Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie anspreche, ohne dass wir einander vorgestellt wurden«, sagte er. Er besaß eine kultivierte, beruhigende Stimme. Zusammen mit einem nüchternen, wenngleich nicht unsympathischen Gebaren brachte mich dies zu der Annahme, es müsse sich bei ihm entweder um einen Doktor oder einen Anwalt handeln. Darüber hinaus schien er, nach seiner Garderobe zu urteilen, jemand zu sein, der geschäftlich erfolgreich war. »Aber kann es sein, dass ich die Ehre habe, mit Miss Elizabeth Martin zu reisen?«
* zivile Kriminalpolizei
KAPITEL ZWEI
Elizabeth Martin
Ich musste ihn höchst erstaunt angestarrt haben. Ich war es zumindest, und ich saß offenen Mundes da, bis ich mich fasste und zu einer Antwort imstande war. »Die haben Sie in der Tat. Doch ich würde wirklich sehr gerne erfahren, woher Sie meinen Namen kennen.«
»Ich sollte mich erklären«, beeilte er sich zu antworten. Er deutete auf den Brief in meiner Hand. »Das sollte helfen.« Er kramte in der Seitentasche seines Fracks und zückte einen ganz ähnlichen Brief, der allem Anschein nach von der gleichen Hand geschrieben war. »Ihr Brief kommt, genau wie der meine, von Miss Roche aus Shore House. Wir reisen beide zum gleichen Ziel. Miss Roche hat mir von Ihnen erzählt. Wenn ich recht informiert bin, treten Sie die Stelle einer Gesellschafterin bei Miss Roches Nichte an. An Ihrem Gesichtsausdruck vermag ich zu erkennen, dass Sie nicht über mich informiert wurden. Bitte erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Lefebre, Dr. Marius Lefebre.«
»Dann sind Sie also Arzt!«, rief ich unbedacht aus und beeilte mich hinzuzufügen: »Mein Vater war ebenfalls Arzt in unserem Dorf.«
»Tatsächlich?« Dr. Lefebre hob die Augenbrauen.
»Und Polizeichirurg«, ergänzte ich.
»Nein, was Sie nicht sagen!« Dr. Lefebre sah mich für einen Moment gedankenvoll an. »Ich bin froh, dass wir uns vor unserer Ankunft in Shore House begegnet sind«, sagte er zu guter Letzt. »Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, ein oder zwei Dinge zu besprechen, bevor wir dort eintreffen, wenngleich jetzt offensichtlich nicht der passende Augenblick ist.«
Sein vielsagender Blick streifte den Geistlichen und die Lady mit der Spitzenarbeit.
Ich fand seine Worte ein wenig seltsam. Was wollte er mit mir besprechen? Ich konnte kaum verlangen, dass er seine Worte unverzüglich klarstellte. Vielleicht sollte es mich nicht überraschen, dass er vom Zweck meiner Reise nach New Forest wusste. Wenn Miss Roche sich die Mühe gemacht hatte, ihm von mir zu erzählen, dann würde sie ihm auch den Grund verraten haben, warum ich auf dem Weg nach Hampshire war. Doch warum hatte sie mir nichts von ihm erzählt? Das war ärgerlich, andererseits vielleicht doch nicht so merkwürdig. Eine Gesellschafterin, wie ich es war, besaß einen nebulösen Status, ein wenig über einer Gouvernante, aber nicht zur Familie zugehörig. Es war ein merkwürdiges Dazwischen. Miss Roche hatte es einfach nicht für erforderlich gehalten, mich zu informieren, dass ich nicht die einzige Person war, die nach Shore House reiste. Es ging mich nichts an.
Lefebre schwieg für sicherlich fünf Minuten. Dann, gerade als ich mir gestatten wollte, mich wieder zu entspannen, sprach er erneut.
»Haben Sie diese Reise schon einmal gemacht, Miss Martin? Kennen Sie die Gegend von Hampshire?« Er blickte unverwandt durch das Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft, während er sprach.
»Überhaupt nicht, Dr. Lefebre. Ich stamme ursprünglich aus Derbyshire und war noch niemals südlich von London.«
»Ich denke, es wird Ihnen gefallen. Die Luft ist sehr mild und das Klima zuträglich. Der Bahnhof von Waterloo hat die Reise in den Süden auf der Londoner Seite beträchtlich vereinfacht. Das heißt, wenn man dort endlich einmal mit der Nummerierung seiner Bahnsteige durch wäre! Dennoch, der frühere Bahnhof in Nine Elms war viel beschwerlicher. So weit draußen! Waterloo ist dagegen der reinste Segen. Allerdings fürchte ich, in Southampton sehen die Dinge ein wenig anders aus. Miss Roche hat Ihnen ohne Zweifel geschrieben, was sie Ihnen für die Ankunft empfiehlt?«
»Sie hat von Problemen mit dem Fuhrwerk geschrieben«, sagte ich. »Sie kann es nicht aussenden, um mich abzuholen, wie ursprünglich erhofft. Doch es gibt ein Fährschiff, schreibt sie, vom Stadthafen nach Hythe auf der anderen Seite von Southampton Water. Auf der anderen Seite wartet eine Transportgelegenheit auf mich – vielleicht sollte ich sagen, auf uns. Irgendein Ersatz für das Fuhrwerk jedenfalls. Ich weiß nicht, was oder wie lange es dauert, bis wir Shore House erreichen.«
»Glauben Sie mir, lange genug, um ernstlich durchgebeutelt zu werden auf einer Landstraße, ganz gleich, welches Vehikel sie nach uns schickt«, sagte Dr. Lefebre mit einem gehörigen Maß an Missbilligung. Er sah mich überraschend direkt an. »Derbyshire, wie? Dann sind Sie ziemlich weit weg von zu Hause.«
»Nun«, sagte ich ein wenig verlegen. »Mein Vater starb, und ich musste andere Arrangements treffen.«
Er hielt eine glacŽbehandschuhte Hand hoch. »Ich wollte nicht unverschämt klingen, Miss Martin. Ich wollte lediglich bemerken, dass wir heutzutage dank dem ganz ausgezeichneten Eisenbahnsystem mit einer Leichtigkeit und Schnelligkeit durch das Land reisen, die sich unsere Vorfahren nicht im Traum hätten vorstellen können. Nehmen Sie beispielsweise meinen eigenen Großvater. Wenn er seine jährliche Reise nach Bath unternahm, um seine Kuren zu machen, fuhr er in seinem eigenen Fuhrwerk los und benötigte drei Tage, um dort anzukommen! Heute reisen wir, ausgerüstet mit Bradshaws Kursbuch, in der gleichen Zeit durch das halbe Land! Zugegeben, mein Großvater legte unterwegs häufige Pausen ein, um Bekannte zu besuchen beispielsweise, um zu essen, die Pferde ausruhen zu lassen und so weiter. Auch reiste er langsam, weil er seine eigene Bettwäsche dabeihatte, um von den Wanzen in den Landgasthöfen verschont zu bleiben. Er hatte auch sein eigenes Tischgeschirr dabei, weil er dem Abwasch nicht traute – ah, und einen Vorrat an gutem Tee, zusammen mit einer Flasche Liniment und einer Flasche Single Malt Whisky, um die äußerlichen und innerlichen Unbequemlichkeiten des Reisens zu lindern. Sie lächeln, Miss Martin.«
Sein scharfer Blick wurde sanft und amüsiert.
»Ich bitte um Verzeihung«, antwortete ich.
»Aber warum denn? Es war meine Absicht, Sie zu unterhalten. Sie sind recht aufgeregt, stelle ich mir vor. Ich wollte Ihre Bürde lediglich ein wenig erleichtern. Schließlich bin ich ein Doktor, und es ist meine Aufgabe, Ihr Wohlbefinden zu steigern.«
Die Worte wurden ernst gesprochen, doch in den Augen glitzerte es immer noch.
Mir kam der Gedanke, dass er sich vielleicht die Langeweile der Reise vertrieb, indem er unschuldig mit mir flirtete. Ich schätze, die Dame mit der Spitze dachte das Gleiche. Sie warf ein paar interessierte Blicke in unsere Richtung. Der Gentleman mit dem frommen Buch schwebte über derartig profanen Dingen.
Doch vielleicht hatte mein neuer Bekannter auch nur einen schrägen Sinn für Humor. Ich war nicht sicher, ob mir eine der beiden Erklärungen gefiel.
Ich schätze, er erriet meine Gedanken. Er lächelte vornehm und nickte der Lady in der Ecke des Abteils höflich zu, worauf diese so heftig zu klöppeln begann, dass die kleinen Spulen nur so flogen. Lefebre richtete den Blick wieder aus dem Fenster.
Er hat sich an mir gerächt, dachte ich. Ich habe ihn unverblümt angestarrt, als wir aus Waterloo gedampft sind, und nun zahlt er es mir heim. Ich nehme an, es amüsiert ihn.
Ich würde allem Anschein nach eine Zeitlang unter dem gleichen Dach verbringen wie mein verwirrender Reisebegleiter. Ich hoffte sehr, dass sein Besuch in Shore House von kurzer Dauer war. Er musste Praxisräume in London haben und reiche Patienten, um die er sich zu kümmern hatte.
Lizzie!, schalt ich mich streng, als unser Zug Fahrt aufnahm. Du musst auf deine Manieren achten und deine Zunge im Zaum halten!
Im Geiste vernahm ich das ungläubige Schnauben von Ben Ross.
Je näher wir unserem Zielort kamen, desto voller wurde der Zug. Viele der zusteigenden Reisenden hatten Unmengen an Gepäck dabei. Dr. Lefebre begann nachdenklich dreinzublicken und mit den Fingern auf dem Seidenschal über seinem Hut zu trommeln. Schließlich richtete er seine Aufmerksamkeit einmal mehr auf mich. »Southampton ist ein geschäftiger Hafen, Miss Martin«, sagte er. »Viele von diesen Leuten reisen bis zur Endstation und von dort aus weiter zu den Docks, um an Bord der Postboote zu steigen. Das Gedränge wird unerträglich sein. Ich schlage vor, dass Sie auf dem Bahnsteig warten. Ich suche uns einen Gepäckträger und eine Droschke, die uns zum Liegeplatz der Fähre nach Hythe bringt.«
Dies klang in meinen Ohren nach einer guten Idee. Der Doktor erwies sich als ein praktisch veranlagter Reisebegleiter. Er hatte zweifellos Recht mit seiner Vorhersage. In der Endstation herrschte das gleiche Gedränge wie in jedem x-beliebigen Londoner Bahnhof. Dass viele Reisende in Southampton auf ein Schiff gehen wollten, zeigten die Berge von Gepäck jeglicher Art, die sich rasch rings um uns auftürmten. Gepäckträger erschienen auf dem Bahnsteig und wurden augenblicklich in Beschlag genommen. »Bleiben Sie, wo Sie sind, Miss Martin!«, rief Lefebre, dann verschwand er in der Menge. Ich war es zufrieden, als ich ihn kurze Zeit darauf im Qualm und Rauch und dem Getümmel ringsum wieder auftauchen sah, einen stämmigen Gepäckträger im Schlepptau. Wir wurden zügig durch den Mob geführt und fanden uns bald draußen vor dem Bahnhof wieder, wo unser Gepäckträger bereits eine Droschke für uns reserviert hatte. Es dauerte nicht lange, und wir ratterten davon.
»Es wird eine kurze Fahrt werden!« Lefebre war geziemend außer Atem von der Anstrengung. »Wir werden ein paar alte Stadtmauern sehen, aber nicht das große Bar Gate, wie ich fürchte. Das ist zu schade. Vielleicht finden Sie ja eine Gelegenheit, die Stadt zu besichtigen, bevor Sie Hampshire wieder verlassen.«
»Das wäre schön, ja«, stimmte ich zu.
Lefebre beugte sich in meine Richtung vor. Ich erwartete, dass er seine Rolle als Führer fortsetzen würde, doch er hatte etwas anderes im Sinn. Er räusperte sich und sagte: »Ich bin froh, dass sich diese Gelegenheit zu einer privaten, wenngleich kurzen Unterhaltung ergeben hat, bevor wir in Shore House eintreffen. Bezüglich Mrs. Craven, meine ich.«
Ich war nicht sicher, ob mir sein Ton gefiel. »Mr. Charles Roche, Mrs. Cravens Onkel, der mich zur Gesellschafterin seiner Nichte bestellt hat, hat mir berichtet, dass sie seit ihrer kürzlichen Niederkunft sehr bedrückt ist«, sagte ich vorsichtig. »Deswegen ist er der Meinung, dass sie jemanden braucht, der ihr Gesellschaft leistet. Ihr Ehemann ist im Ausland, wenn ich richtig informiert bin.«
Dr. Lefebre winkte irritiert ab. Ich nehme an, er war es nicht gewöhnt, unterbrochen zu werden. »Mrs. Craven leidet an Melancholie. Die Ursache ist der Verlust ihres Kindes wenige Tage nach der Geburt.«
Einige Sekunden lang herrschte Stille. Ich wollte nicht, dass er mich erneut mit einem ungeduldigen Abwinken unterbrach. Diesmal jedoch schien er auf einen Kommentar meinerseits zu warten, und so fragte ich schließlich: »Sind Sie gekommen, um sie zu behandeln, Doktor?«
Er zögerte. »Nein, nein«, räumte er schließlich ein. »Ich bin im Auftrag von Mr. Roche dort, um eine Einschätzung der Situation vorzunehmen. Er ist zurzeit außerstande, selbst nach Hampshire zu fahren. Ich kenne Roche seit einer Reihe von Jahren.« Er lächelte flüchtig. »Wir französischen Exilanten halten zusammen.«
Ich muss ihn verwirrt angesehen haben, denn er fügte hinzu: »Unser beider Familien sind hugenottischer Abstammung.«
Ich verdaute diese Information und fragte mich, ob er versuchte, mir auf diesem Weg zu beweisen, dass er tatsächlich ein enger Freund des Mannes war, der mich eingestellt hatte. Warum? Damit ich unbekümmerter drauflosplapperte?
Er räusperte sich erneut auf jene Weise, mit der er, wie ich inzwischen wusste, meine Aufmerksamkeit zu erwecken trachtete.
»Sie sollten wissen, dass Mrs. Cravens Melancholie eine besondere Form von Wahnvorstellung beinhaltet.«
Er wartete erneut auf einen Kommentar meinerseits, doch ich lernte rasch, dieser Art von Spiel auszuweichen. Er mochte Arzt sein, doch ich war nicht seine Patientin. Ich war nicht hier, um ihm meine Gedanken und Ängste zu beichten – ganz im Gegenteil!
Mein Schweigen brachte ihn schließlich dazu weiterzureden.
»Sie kann den Tod ihres Kindes nicht akzeptieren.«
Ich hatte vorgehabt, meine Meinung für mich zu behalten, doch die Unverblümtheit dieser schockierenden Feststellung entlockte mir einen lauten Ausruf. Sie sandte außerdem einen alarmierten Schauer über meinen Rücken. Die Tragödie war offensichtlich weit größer, als mir gegenüber angedeutet worden war. Zum ersten Mal fragte ich mich ernsthaft, warum ich wirklich nach Shore House geschickt worden war. Sollte ich eine Freundin und Vertraute der jungen Frau sein, um sie zu unterstützen? Oder sollte ich sie dazu bringen, die traurige Wirklichkeit vom Tod ihres Kindes zu akzeptieren? Das wäre eine schwierige und delikate Aufgabe, und eine Fremde wie ich wohl kaum die richtige Person dafür. Und wie war ihr Geisteszustand zu bezeichnen? Diese letzte Frage stellte ich meinem Reisebegleiter unverblümt.
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß genauso wenig wie Sie, Miss Martin. Ich bin Mrs. Craven noch nie begegnet. Ich weiß nur das, was man mir erzählt hat.«
»Ich habe keine Erfahrung in der Pflege von Kranken«, sagte ich entschieden.
»Das ist, soweit ich informiert bin, wohl auch nicht erforderlich«, lautete seine kühle Antwort. »Ah, wir sind bei den Docks.«
Die kurze Unterhaltung hatte mich nervös gemacht, doch als wir am Kai aus unserer Droschke stiegen, hatte ich sie schon wieder vergessen. Hinter uns ragten die hohen, antiken Stadtmauern auf, und darunter verlief eine Promenade am Ufer entlang ins Landesinnere. Überall ringsum bemerkten wir die Spuren kürzlicher Bauaktivitäten, eine Erweiterung der Docks und vor uns – das Meer! Oder zumindest jener tiefe Einschnitt, der Southampton Water genannt wurde. Eine steife Brise wehte uns in die Gesichter und brachte den Geruch von Salz mit sich. Über uns schwebten kreisende Möwen, bereit, sich in die Tiefe zu stürzen und jeden Krümel Nahrung zu erbeuten, der aus den Händen jener fiel, die am Kai warteten. Sonnenlicht glitzerte auf den tanzenden Wellen. Auf der anderen Seite des Einschnitts und in blauen Dunst gehüllt erkannte ich eine von Bäumen gesäumte Küstenlinie und ein Gewirr von weiß gekalkten Gebäuden, mit großer Wahrscheinlichkeit die kleine Stadt Hythe. Ich war genauso aufgeregt wie eines der zahlreichen kleinen Kinder, die kreischend durch die Menge rannten und die verzweifelten Rufe ihrer Eltern ignorierten.
Und was für eine bunt gewürfelte Menge das war, die uns umgab! Wollten etwa all diese Leute an Bord der Fähre gehen? Noah musste vor einem ganz ähnlichen Problem gestanden haben, als ein tobender Mob von Tieren an Bord seiner Arche gedrängt hatte. Es waren Landbewohner mit wettergegerbten Gesichtern, die Frauen mit Sonnenhauben aus Baumwolle, alle beladen mit Körben und Gepäck in der Form geheimnisvoller Kisten. Hunde aller Rassen (und Mischungen) haschten nach den Hacken der Kinder und bellten voll wilder Begeisterung angesichts der aufregenden Jagd. Hier und da standen vereinzelt ernst gekleidete, würdige Gestalten, darunter ein Geistlicher. Vervollständigt wurde die Mischung von Gepäckträgern, Matrosen von den Postschiffen, die in der Bucht ankerten, und Müßiggängern, die mit den Händen in den Taschen das Geschehen beobachteten. Einige gehörten zu jener zerlumpten Bevölkerungsschicht, die sämtliche stark bevölkerten Flecken aufsucht in der Hoffnung, von der Naivität der Fremden zu profitieren. Wir waren offensichtlich beide Stadtbewohner und Neuankömmlinge. Demzufolge zeigten bereits einige dieser Leute Interesse an uns.
»Passen Sie auf Ihre Taschen auf, Sir!«, empfahl uns unser Kutscher, als Dr. Lefebre ihn bezahlte. »Dort ist die Fähre, direkt vor Ihnen, und dort ist Albert. Hey, holla!«, brüllte er unvermittelt. »Albert! Hier sind zwei Herrschaften für dich, die auf die Fähre möchten!«
Ich war noch nie im Leben als »Herrschaft« bezeichnet worden, doch ich nahm an, Dr. Lefebres distinguiertes Erscheinungsbild und sein gebieterisches Verhalten waren der Grund.
Eine schlaksige Gestalt näherte sich durch die Menge und entpuppte sich als ein junger Mann mit von der Sonne tief gebräuntem Gesicht. Er trug eine Schirmmütze im seemännischen Stil, dazu einen Strickpullover, dessen Ärmel ein gutes Stück zu kurz waren für seine sehnigen, gebräunten Unterarme, dazu stabile Baumwollhosen und Arbeitsstiefel. Sein charakteristischstes Merkmal war jedoch, dass er nur ein gutes Auge hatte. Das andere schien einen furchtbaren Unfall erlitten zu haben. Der Augapfel war von einem hellen, rauchigen Blau und rollte auf erschreckende Art und Weise nach oben in den Kopf, doch das verbliebene gesunde Auge blinzelte gut gelaunt.
»Albert«, stellte unser Kutscher den Neuankömmling vor. »Er ist ein Besatzungsmitglied der Fähre. Ich lasse Sie bei ihm zurück. Eine gute Reise wünsche ich, Sir und Ma’am.« Mit diesen Worten stieg er wieder auf seinen Kutschbock, schnalzte mit der Zunge und zockelte davon.
»Fahrscheine?«, erkundigte sich Albert, augenscheinlich ein Mann weniger Worte.
»Wo kaufe ich Fahrscheine?«, erkundigte sich Dr. Lefebre.
Albert deutete auf eine kleine Holzhütte mit einem Fenster darin, hinter dem eine stämmige weibliche Gestalt gegen Bezahlung Fahrscheine an eine wartende Menschenschlange ausgab.
»Wenn Sie vielleicht hier warten wollen, Miss Martin …?«, begann Dr. Lefebre.
»Nicht nötig!«, unterbrach ihn Albert. »Ich nehme die Koffer und bringe die Lady an Bord. Bitte folgen Sie mir, Ma’am.«
Noch während er sprach, hatte er mit großer Effizienz unser Gepäck aufgesammelt und es irgendwie fertiggebracht, alles an seiner Person zu verstauen. Er setzte sich mit ausholenden Schritten in Bewegung, und ich hastete hinter ihm her.
Wir erreichten den Landesteg. Am Seetang entlang der Mole konnte ich erkennen, dass Ebbe herrschte und der Wasserspiegel meterweit unter dem Hochwasserstand lag. Die Fähre schwamm mehrere Meter unter uns, mit Tauen vorn und hinten an einer schlüpfrig aussehenden Plattform im Schatten des Landestegs hoch oben festgemacht. Es war ein kleiner eiserner Raddampfer mit einem hohen Schornstein. Hoch oben neben dem Schornstein, mit einer Hand am Ruder und auf gleicher Höhe mit uns, weil das Schiff wegen der Ebbe so tief lag, stand eine maritime Gestalt. Ihre Haut war gegerbt von den Einwirkungen der Elemente und so braun wie Teakholz. Unser Kapitän, wie ich annahm. Er beobachtete das Durcheinander an Land und den über eine Holzrampe nach unten an Bord strömenden Mob mit wohlwollendem Blick. Direkt unter seinem Ruderstand befand sich ein überdachter Bereich, anscheinend eine Art Salon für die betuchteren Passagiere. Andere verteilten sich in geübter Manier überall auf dem Deck.
Die Stützbalken des Piers waren genau wie die Molenmauer übersät von schwarzem Seetang und Muscheln. Der Geruch hier unten war sehr viel stärker und keineswegs angenehm. Das an die Balken schwappende Wasser roch stark nach Kanalisation. Alle Arten von Kehricht schwammen auf seiner Oberfläche und sammelten sich um die Piers.
Inzwischen waren bereits so viele an Bord gegangen, dass ich befürchtete, es wäre nicht mehr genügend Platz für uns, und so beeilte ich mich, der Menge zu folgen. Unser Gepäck war jedenfalls schon an Bord. Ich konnte Albert sehen, der es ordentlich auf dem der Mole zugewandten Vordeck stapelte. Die Rampe wackelte und zitterte, und ich hielt mich am Geländer fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Eilige Passagiere hinter mir schoben mich immer weiter vorwärts. Unten am Fuß der Rampe war es kaum besser. Ein schmaler Laufsteg überbrückte die Lücke zwischen der Steinplattform am Fuß der Rampe und der schwankenden Fähre. Ein kleiner Junge stand vor dem Laufsteg und nahm die Fahrscheine der Passagiere in Empfang. Von dort aus überbrückten sie kreischend und kichernd und quiekend den Abgrund, um in einem kunterbunten Durcheinander auf Deck anzukommen. Ich raffte meine Röcke und landete mit einem athletischen Sprung unsicher auf dem ersten Schiff, das ich in meinem ganzen Leben jemals betreten hatte.
»Setzen Sie sich hierher, Ma’am«, empfahl mir Albert, indem er mich am Arm fasste und mit der freien Hand auf eine Holzbank neben unserem Gepäck deutete. »Der Salon ist bereits voll.«
Rasch setzte ich mich auf den freien Platz, bevor jemand anders unsere Bank in Beschlag nehmen konnte, und blickte, besorgt nach meinem Reisebegleiter Ausschau haltend, zurück an Land. Dr. Lefebre kam bereits die Rampe hinunter. Mit einer Hand sicherte er seinen Zylinderhut auf dem Kopf; in der anderen erblickte ich die kleinen, weißen Fahrscheine. Bei seinem Eintreffen vor dem Laufsteg hielt er dem Knaben die Fahrscheine hin. Der Bursche war so beeindruckt von der stattlichen Erscheinung seines gut gekleideten Fahrgastes, dass er ihn volle zwei Sekunden lang anstarrte, bevor er nach den Tickets schnappte. Ein wenig außer Atem, doch ansonsten unerschütterlich wie zuvor, traf Dr. Lefebre Augenblicke später bei uns ein und nahm auf der Holzbank neben mir Platz.
»Da wären wir, Miss Martin. Ich frage mich, welche Abenteuer uns sonst noch erwarten, bevor wir in Shore House ankommen.«
Eine Glocke wurde geläutet. Albert zog den Laufsteg ein und schloss das Gatter in der Reling. Die Dampfmaschine brüllte, und aus dem Schornstein quoll dichter, weißer Rauch. Die Schaufelräder fingen an sich zu drehen und wirbelten das Wasser auf. Wir entfernten uns vom Ufer – rückwärts.
Fast zur gleichen Zeit beschrieb unser Schiff einen Halbkreis, bis wir in die richtige Richtung zeigten und die Küste von New Forest auf der anderen Seite vor uns lag. Der Doktor und ich wandten uns dem Wind und der Sonne zu. Ich überlegte, ob ich meinen Regenschirm von meinem Reisekoffer losschnallen sollte, um ihn als Schattenspender zu benutzen. Doch angesichts so vieler Menschen, die so dicht gedrängt um uns herumstanden, hätte ich ihn wohl kaum öffnen können.
Die Schaufelräder verursachten einen gewaltigen Radau und machten jegliche Unterhaltung unmöglich. Der Wind war stärker hier draußen, je weiter wir in die Mitte des Wassers kamen. Dr. Lefebre zückte einmal mehr sein weißes Seidentuch, faltete es in Form einer Bandage und band es über seinen Zylinder und unter seinem Kinn zusammen. An jedem anderen hätte es lächerlich ausgesehen – an ihm wirkte es einfach nur praktisch. Oder jedenfalls erschien es mir so. Andere sahen es wohl anders. Uns gegenüber saßen zwei Landfrauen und beobachteten ihn mit etwas, das Entsetzen ziemlich nahekam. Eine der beiden beugte sich zu ihrer Freundin vor, strich mit einem dicken Zeigefinger über ihr Kinn und formte mit den Lippen die Worte: »Das Kinn hochgebunden wie bei einem Toten!«
Es dauerte eine gute halbe Stunde bis zur anderen Seite, und ich genoss meine erste Seereise sehr. Im Kanal herrschte reger Verkehr; zahlreiche kleine Fahrzeuge waren unterwegs. Die größeren, Postschiffe und Passagierfähren und Handelsklipper, lagen vor Anker und warteten auf Hochwasser. Schließlich wurden die Schaufelräder langsamer, und eine weitere Glocke läutete, die das Ende unserer Überfahrt ankündigte. Ich bedauerte, dass die Schiffsreise zu Ende ging. Noch mehr bedauerte ich unsere Ankunft, als ich diese Anlegestelle erblickte. Auf der Seite von Southampton hatte es wenigstens einen Pier und eine Landebrücke gegeben. Auf der Seite von Hythe sah ich lediglich eine weit in das streng riechende Gewässer hinausragende aufgeschüttete Landzunge mit einem Pfad darauf. Am Kopfende der Landzunge war das Wasser auch bei Ebbe tief genug für unser Fährschiff zum Anlegen. Ein Seemann stand dort und wartete auf uns.
Es half alles nichts, wir mussten irgendwie auf den unsicheren Pfad hinunter und, beladen mit unserem Gepäck, einen Weg auf Terra firme finden. Es sah gefährlich aus, und man muss mir meine Bestürzung angesehen haben, denn ein älterer, rotgesichtiger Landbewohner, der neben mir stand und wartete, unternahm einen Versuch, mich aufzumuntern.
»’s ist nicht so schlimm, wie’s aussieht, Ma’am«, sagte er. »Ich hab noch nie jemanden reinfallen sehn, bis auf zwei Mal, und einer davon war bis zum Kragen voll mit Alkohol. Hier, mein Junge wird Ihnen mit Ihrem Gepäck helfen. Obadiah, nimm den Koffer der Lady!«
»Wir sind Ihnen sehr verbunden«, sagte Dr. Lefebre.
Unser Informant beugte sich vor und sagte in vertraulichem Ton: »Wir brauchen einen Beschluss vom Parlament, Sir.« Er sprach jede einzelne Silbe überdeutlich aus.
Selbst Lefebre sah ihn erstaunt an. »Tatsächlich?«
»Ja, Sir. Wir brauchen einen richtigen Pier, wie sie ihn auf der Seite von Southampton haben. Dann könnte die Fähre hübsch ordentlich festmachen, und wir bräuchten die Landzunge nicht mehr. Wir warten schon seit Jahren darauf, dass wir einen kriegen, aber wir brauchen einen Beschluss vom Parlament, damit er gebaut wird. Man hat uns versprochen, dass wir ihn kriegen, sobald die Gentlemen im Parlament genügend Zeit finden, um über unser Problem nachzudenken. Wir haben große Hoffnung, Sir.«
Unser Kapitän manövrierte den tapferen kleinen Dampfer längsseits neben die Landzunge. Albert erschien und mühte sich ab, den Laufsteg loszubinden, um ihn sodann durch das geöffnete Tor in der Reling zu schieben, bis er von dem Seemann an Land in Empfang genommen und in den Schotter gerammt wurde. Die ersten, erfahreneren Passagiere stiegen wenige Sekunden später über den Laufsteg nach unten. Wir folgten ihnen, einer nach dem anderen, während Albert uns über die Planke in die Arme des am Ufer wartenden Mannes schob. Er fing uns auf und versetzte uns einen weiteren entschlossenen Schubs in Richtung des Ufers. Irgendwie kamen wir alle heil unten auf dem Schotter an. Ich hielt meine wehenden Röcke mit beiden Händen. Nasser Schotter knirschte unter meinen Füßen. Vor mir wankte eine kräftige Frau mit einem Weidenkorb im Arm, hinter mir kam Dr. Lefebre, der mich mit aufmunternden Worten zu ermutigen trachtete. So stolperte ich wenig elegant über den Schotterpfad und verspürte größte Erleichterung, als ich endlich den gemauerten Kai erreicht hatte.
Reisende von New Forest nach Southampton hatten sich dort versammelt und warteten, dass die Aussteigenden an Land gingen. Sobald die schmale Landzunge frei geworden war, strömten sie geschäftig nach unten in der Absicht, unser Fährschiff zu besteigen. Bald schon würde es ablegen und zu einem immer kleineren schwarzen Fleck werden, bis es sich ganz der Sicht entzog. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass ich zwar von vielen Menschen umgeben war, mich nichtsdestotrotz aber fühlte wie Robinson Crusoe an einem fremden Ufer. Ich kannte niemanden hier mit Ausnahme meines merkwürdigen Reisebegleiters.
Unser Gepäck wurde an Land gebracht, und Dr. Lefebre bedankte sich mit einem Sixpence bei Obadiah. Dessen Vater protestierte, dass dies nicht erforderlich wäre, doch Obadiah hatte offensichtlich eine andere Vorstellung: Er nahm die Münze und trollte sich davon.
Dr. Lefebre löste den Seidenschal unter dem Kinn, der seinen Hut gesichert hatte, faltete ihn säuberlich zusammen und steckte ihn ein.
»Haben Sie die Überfahrt gut überstanden, Miss Martin?«
»Oh ja!«, antwortete ich atemlos, indem ich die in mir aufgestiegenen Zweifel beiseiteschob.
»Sehr schön. Nun dann, wo ist das Transportmittel, das uns hier abholen sollte?«
Von jetzt an gab es kein Zurück mehr.
KAPITEL DREI
Inspector Benjamin Ross
Natürlich wollte ich Lizzie selbst zur Waterloo Station im Süden begleiten, nicht zuletzt, weil ich hoffte, ein Appell in letzter Minute und in Gegenwart der zischenden Dampflokomotiven könnte ihren Entschluss, nach Hampshire zu fahren, doch noch umstoßen. Obwohl mir klar war, dass schon etwas Außergewöhnliches passieren musste, damit Lizzie, wenn sie einmal einen Entschluss gefasst hatte, diesen noch einmal überdachte.
Wie die Dinge standen, saß ich genau um die Zeit ihrer geplanten Abfahrt nicht weit von einem anderen großen Londoner Bahnhof im Revier von King’s Cross gegenüber einem wenig sympathischen Subjekt namens Jonas Watkins. Dieser Watkins war ein teiggesichtiger Bursche mit hervorquellenden Augen und einem kleinen, gemeinen Mund. Er trug einen schicken Anzug in klein kariertem schrillem Hahnentrittmuster. Ich fand, es zog unnötig Aufmerksamkeit auf seine dürre Gestalt. Er war offensichtlich anderer Meinung. Trotz eines, soweit ich es beurteilen konnte, Mangels an jeglichem Charme war er ein eitler kleiner Pfau, der sich wiederholt über den Kopf strich, wo sein dünner werdendes Haar mit irgendeiner durchdringend riechenden Tinktur angeklebt war.
»Also schön!«, sagte ich zu ihm. »Verschwenden Sie nicht meine Zeit! Ich warne Sie, ich bin heute nicht besonders gut gelaunt, und es wäre ein Fehler, wenn Sie mich in Versuchung führen.«
»Ich will bestimmt niemandes Zeit verschwenden!«, protestierte Mr. Watkins. »Ich will nicht mal meine eigene verschwenden, wissen Sie? Was mache ich überhaupt hier? Das würde ich gerne erfahren!«
Was mache ich hier?, dachte ich und stöhnte innerlich. Ich sollte auf dem Bahnhof von Waterloo sein und Lizzie notfalls mit Gewalt aus diesem Zugabteil ziehen, falls sie nicht freiwillig ausstieg.
Ich tändelte kurz mit dem Bild, das vor meinem geistigen Auge hing, und schob es dann als undurchführbar beiseite. Lizzie war durchaus in der Lage, entschiedenen Widerstand zu leisten, und ein derartiges Unterfangen würde möglicherweise mit meiner eigenen Verhaftung enden.
Warum um alles in der Welt muss sie zu einem Ort reisen, von dem sie überhaupt nichts weiß? Zu Leuten, von denen sie nur das weiß, was sie aus – meiner Meinung nach – höchst unzuverlässigen Quellen erfahren hat? Als sie aus Derbyshire wegging, um nach London zu fahren, da war sie in gewisser Hinsicht wenigstens zu Verwandtschaft gereist. Sie hatte gewusst, wer Mrs. Parry war. Und selbst das war schiefgegangen.
»Nun?«, begehrte Watkins trotzig auf, indem er aus meiner momentanen Unaufmerksamkeit fälschlicherweise schloss, ich wäre nicht imstande, seine Frage zu beantworten.
»Sie sind hier«, beschied ich ihm, »weil eine junge Frau namens Mary Harris bei der Polizei Anzeige erstattet hat. Sie sagt, sie hätte ihr damals sechzehn Monate altes Kind in die Obhut von Ihnen und Ihrer Frau gegeben.«
»Ich kenne keine Mary Harris«, antwortete er prompt. »Das habe ich bereits einem Ihrer Kollegen gesagt! Er kam zu mir nach Hause und hat Fragen gestellt. Meine Frau war außer sich vor Empörung. Wir sind ehrbare Leute. Wir können keine uniformierten Constabler brauchen, die an unsere Tür klopfen! Die Nachbarn fangen an zu reden. Ich kenne eine Mary Fletcher, wenn Ihnen das weiterhilft. Sie führt das King’s Head Pub. Sie hat allerdings kein achtzehn Monate altes Kind. Sie ist bestimmt schon sechzig – an einem guten Tag!«
»Jonas«, sagte ich freundlich zu ihm. »Ich bin ein viel beschäftigter Mann und habe überhaupt keine Zeit, mir Unsinn anzuhören.«
Beim ruhigen Ton meiner Stimme blickte er alarmiert auf. Er hätte es vorgezogen, von mir angebrüllt zu werden, darauf war er vorbereitet.
»Ich kenne sie nicht«, wiederholte er mürrisch.
»Ganz wie Sie meinen. Lassen Sie mich Ihr Gedächtnis auffrischen. Mary Harris ist in Anstellung. Sie ist ein Stubenmädchen. Vor achtzehn Monaten, als sie in Chelsea gearbeitet hat, brachte sie ein uneheliches männliches Kind zur Welt.«
»Da haben Sie’s!«, sagte Watkins rechtschaffen. »Sie werden doch wohl kein Wort von dem glauben, was diese Person Ihnen erzählt!«