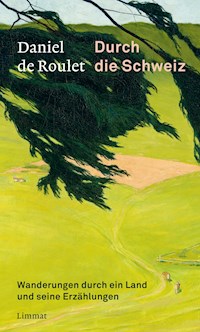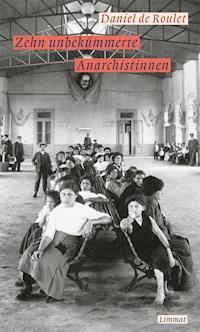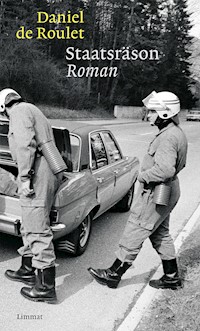19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1975. Auf einem eingeschneiten Berg hoch über Gstaad geht in der Nacht ein Chalet in Flammen auf, die Helikopter kommen zu spät. Die Schweizer Polizei geht von einer ausländischen Täterschaft aus und veröffentlicht das Phantombild nicht in der Schweiz. Das Chalet hat dem Pressemagnaten Axel Springer gehört, die Brandstifter werden im Umfeld der RAF vermutet. Der Urheber dieses Anschlags war der Schweizer Autor Daniel de Roulet, der in diesem Buch berichtet, wie er seine Tat geplant und quasi auf einem Sonntagsausflug in die Berge ausgeführt hat. Er erzählt von Irrtümern aus der Befangenheit des Kalten Kriegs heraus und von seiner Verblüffung, als er die posthume Nachricht entdeckte, die Springer für ihn am Tatort hinterlassen hat. Mit der Veröffentlichung löst er ein Versprechen ein, das er seiner Komplizin und damaligen Liebe kurz vor ihrem Tod gegeben hat. Im Nachwort zur Neuauflage erzählt de Roulet, wie er mit seinem Geständnis die Gemeinde Rougemont von einem Fluch erlöst hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1975. Auf einem eingeschneiten Berg hoch über Gstaad geht in der Nacht ein Chalet in Flammen auf, die Helikopter kommen zu spät. Die Schweizer Polizei geht von einer ausländischen Täterschaft aus und veröffentlicht das Phantombild nicht in der Schweiz. Das Chalet hat dem Pressemagnaten Axel Springer gehört, die Brandstifter werden im Umfeld der RAF vermutet.
Der Urheber dieses Anschlags war der Schweizer Autor Daniel de Roulet, der in diesem Buch berichtet, wie er seine Tat geplant und quasi auf einem Sonntagsausflug in die Berge ausgeführt hat. Er erzählt von Irrtümern aus der Befangenheit des Kalten Kriegs heraus und von seiner Verblüffung, als er die posthume Nachricht entdeckte, die Springer für ihn am Tatort hinterlassen hat. Mit der Veröffentlichung löst er ein Versprechen ein, das er seiner Komplizin und damaligen Liebe kurz vor ihrem Tod gegeben hat.
Im Nachwort zur Neuauflage erzählt de Roulet, wie er mit seinem Geständnis die Gemeinde Rougemont von einem Fluch erlöst hat.
Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt, arbeitete als Informatiker und lebt heute als freier Schriftsteller in Genf. Autor zahlreicher Bücher, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde, etwa «Die rote Mütze», «Zehn unbekümmerte Anarchistinnen» und «Staatsräson». Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi).
Daniel de Roulet
Ein Sonntag in den Bergen Ein Bericht
Aus dem Französischen
von Maria Hoffmann-Dartevelle
Limmat Verlag
Zürich
Im Gedenken an eine Jugendliebe (1948–2005)
01
An einem schönen Sonntag im Kalten Krieg habe ich oben auf einem Schweizer Berg Axel Caesar Springers Chalet in Brand gesteckt. Wie und warum, das will ich hier erzählen.
Zuvor aber möchte ich schildern, was mich dazu getrieben hat, diese Tat zu gestehen. Auslöser war nur eine Bemerkung, die mich im Innersten berührt hat:
Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir,
Tag für Tag bekämpfe ich das,
wofür ich mich als junger Mensch engagiert habe.
Der Mann, der diese Bemerkung macht, ist kein Geringerer als der amtierende deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, jetzt, im August 2003, achtundzwanzig Jahre nach meinem Anschlag. Wir sitzen unter einem großen, weißen Zelt im Park eines Schweizer Hotels. Am Ende eines glühendheißen Tages weht von den Bergen die Abendbrise herab nach Locarno und über den See. Rosenbeete von erlesener Schönheit prangen inmitten leuchtend grüner Rasenflächen. Hier werden Zierpalmen und Hecken mit der Nagelschere gestutzt und jeder Parkbaum einzeln begossen, damit sein Blattwerk die Gäste vor der sommerlichen Hitze schützt.
Die Damen sind, wie auf der Einladungskarte erbeten, sommerlich elegant gekleidet. Die Herren dürfen ihre Jacketts noch nicht ablegen. Unter der weißen Zeltplane nähert sich das von einem großzügigen Zeitungsverleger spendierte Bankett seinem Ende, gleich wird das Dessert serviert. Zeit für eine kurze Rede. Der Mann, der das Wort ergreift, ist genau so alt wie ich und sitzt mir gegenüber, neben unserem Bundespräsidenten. Und er sagt den Satz, der mich sofort aufhorchen lässt:
Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir,
Tag für Tag bekämpfe ich das,
wofür ich mich als junger Mensch engagiert habe.
Er blickt die Gäste an, schaut nach links, nach rechts, wägt seine Worte ab. Was er sagt, klingt aufrichtig und ehrlich. Ich mustere seine Leibwächter und seine Assistentin. Ob sie es gewohnt ist, ihren Chef frei sprechen zu hören? Kanzler Schröder ist aufgestanden, hat seine Fingerspitzen auf den Tisch gestützt und fühlt sich bei seiner Dankesrede sichtlich wohl.
Nur die bessere Gesellschaft ist hier vertreten. Mein rechter Nachbar hat sich mir als Vorstandsvorsitzender eines großen Zürcher Finanzinstituts vorgestellt, zu meiner Linken sitzt eine Berliner Psychiaterin. Ihrem verschwörerischen Lächeln fühle ich mich näher. Vorhin haben wir über ihre Praxis gesprochen, über die vielen Taschentücher, die ihre Patientinnen und Patienten verbrauchen, um sich während der Therapiestunden die Tränen zu trocknen. Da spricht auch Kanzler Schröder von Tränen: «Ich weine oft im Kino, besonders wenn der Film mich an eine Situation erinnert, die ich selbst erlebt habe.» Und er erzählt von einem Ereignis, das ihn, wie er sagt, besonders geprägt hat. Es war der Sieg der bundesrepublikanischen Elf beim Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954 in unserer Hauptstadt Bern. Zehn Jahre war er damals alt. Kürzlich, so berichtet er noch, als das alte Berner Stadion abgerissen werden sollte, habe die Schweizer Regierung ihm daraus eine fußballgroße Grassode geschenkt. Die habe er in Berlin im Garten des Kanzleramtes wieder einpflanzen lassen. «Manchmal gieße ich dieses Stückchen Rasen», sagt er.
Es gibt also zwei Schröder. Der eine bekämpft heute das, wofür er sich früher einmal engagiert hat, der andere träumt beim Anblick eines Grasbüschels von der schönen, verflogenen Jugend. Kein Wunder, dass er manchmal im Kino weint, wenn diese beiden Schröder nicht mehr recht zueinander finden.
Als er sich die Freiheit nimmt, sein Jackett abzulegen, tun wir übrigen Männer es ihm nach. Ein willkommener Windhauch entspannt die Atmosphäre. Ich frage mich, ob dieser eine Satz «Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht wie mir …» nicht der Geisteshaltung derer entspringt, die sich an die schmale Gratwanderung zwischen Ironie und Zynismus gewöhnt haben. Sie vermeiden es, Fragen voll ins Gesicht zu bekommen, indem sie einfach den Kopf einziehen.
Ich nehme Reden viel zu persönlich. Dabei müsste ich wissen, wie man Worten ausweicht, selbst denen eines Schröder. Aber genau diese Worte haben mich getroffen, weil ich sie mir dummerweise zu Herzen genommen habe. Während ich die zum Dessert gereichten tropischen Früchte genieße, denke ich darüber nach, ob auch ich um ein besonders grünes Grasbüschel trauern würde, das ich in meiner eigenen Jugend betrachtet habe. Weinen die anderen Männer hier auch im Kino, wie ich es tue? Hat besagter Satz auch sie berührt? Bei mir löst er etwas Unerwartetes aus.
Plötzlich habe ich wieder den Anschlag vor Augen, das Chalet oben auf dem verschneiten Berggipfel. Aber vor allem sie sehe ich vor mir, meine damalige Freundin, die mir auf einmal entsetzlich fehlt. Keine der Frauen in diesem Zelt hat ihre grünen, von einer blonden Haarsträhne überschatteten Augen. Und vor allem nicht ihre unbekümmerte Art, laut aufzulachen. Sie hatte zarte Hände, die sich nie an mich geklammert haben. Im Bett hielten ihre Arme mich fest umschlungen und ließen mich nicht eher entkommen, bis ich ihre vielen Fragen beantwortet hatte. Warum sind die Flugpassagiere der ersten Klasse so ungehobelt? Warum sind die Leute gerade dort so arm, wo die Strände so schön sind? Wann wirst du über frischen Schnee laufen können, ohne Spuren zu hinterlassen? Sie fand mich zu zögerlich, warf mir vor, ich hielte Sonntagsreden und trüge nichts dazu bei, unsere prachtvollen Berge von den Mistkerlen zu säubern, die sich dort verkrochen. Ich wollte ihr beweisen, dass sie sich irrte, wollte wenigstens dieses eine Mal zu meinen Überzeugungen stehen. Sie würde schon erleben, wie gut ich in verschneiten Berggegenden zurechtkam. Ich würde ihr zeigen, dass ich zur Abwechslung auch mal ein Held sein konnte. Ja, ich würde zur Tat schreiten.
Wenn sich ein sommerliches Essen in einem luftigen Zelt in die Länge zieht, kann es zu allerlei persönlichen Gesprächen kommen. Meinem rechten Nachbarn mache ich klar, dass die Einkünfte aus meinen Romanen nicht an die Sitzungsgelder seiner Verwaltungsräte herankommen. Mit der Nachbarin zu meiner Linken, der Berliner Psychiaterin, beginne ich eine ernste, fast zu ernste Unterhaltung. Ich versichere ihr, hierzulande würde ein Politiker sich niemals damit brüsten, dass er im Kino weint. Unsere Volkstribunen seien starke Männer, zutiefst vom Konsens geprägte Charaktere. Dann reden wir über die Beziehungen zwischen Presse und Macht, und ich erzähle ihr von den Turbulenzen, die der französische Journalismus derzeit durchlebt. Aus unerfindlichen Gründen kommt sie auf eine der großen Verlagsfiguren zu sprechen, auf Axel Springer, den mittlerweile verstorbenen Chef des riesigen deutschen Presseimperiums. Eine seiner Zeitungen, die Bild, erreicht täglich eine Auflage von über vier Millionen, eine Zahl, die nur noch von der japanischen Tagespresse übertroffen wird.
Weil sie eine Frau ist oder weil mir die Erinnerung an Springer keine Ruhe lässt, gestehe ich ihr, dieser Typ sei für mich das Symbol des Kalten Krieges schlechthin. Und wage erstaunlicherweise hinzuzufügen: «Dieser Springer war ein mieses Schwein.» Sie wundert sich nicht besonders über die Vehemenz meiner Worte. Und wie so oft, wenn im Verlauf eines Essens persönliche Nähe entsteht, erfahre ich auch diesmal ein paar Dinge, von denen ich noch nichts wusste.
Axel Caesar Springer war fünfmal verheiratet. Seine erste Ehe, aus der eine Tochter stammt, schloss er 1933 mit einer Jüdin namens Meyer.1938 ließ er sich scheiden, heiratete ein Model und bekam einen Sohn. 1948 gelang es ihm, den Engländern durch geschicktes Verhandeln die Erlaubnis abzuringen, eine große Tageszeitung herauszugeben. Auf die Frage, ob er Nazi gewesen sei, soll er geantwortet haben: «Die Nazis hatten nicht genug Stil für mich.» Seine dritte Frau lenkte seine Aufmerksamkeit auf das Schicksal Israels. Aus seiner vierten Ehe stammt sein zweiter Sohn, dessen junge Kinderfrau einige Jahre später seine fünfte und letzte Ehefrau wurde. Der andere aber, sein älterer Sohn, der unter dem Pseudonym Sven Simon als Fotograf tätig war, hat sich das Leben genommen, ein Schicksalsschlag, von dem sich der Vater nie erholt hat. Meine Tischnachbarin beteuert nochmals:
– Auf jeden Fall war er kein Nazi.
– Und ich hatte geglaubt …
– Alles Mögliche, aber kein Nazi.
– Verdammt.
Beim Kaffee äußert Schröder vertraulich, seinen Italienurlaub müsse er dieses Jahr schweren Herzens ausfallen lassen, weil Berlusconi die Deutschen beleidigt habe. Außerdem ist er der Meinung, der Irak dürfe nicht zu einem zweiten Vietnam werden.
Ich höre nur mit halbem Ohr zu; meine Gedanken kreisen um das, was ich soeben erfahren habe. Nicht nur Schröders Bemerkung hat mich getroffen, sondern auch die Eröffnung, dass Springer gar nicht der war, für den ich ihn gehalten habe. Was, wenn er hier unter den Gästen wäre? Würde ich mich bei ihm entschuldigen? Zum Beispiel mit den Worten: «Ich habe Sie mal für ein mieses Schwein gehalten. Aber ein Nazi waren Sie anscheinend gar nicht. Und Ihr Chalet oben auf dem Berg, hat es Ihnen nicht zu sehr gefehlt?»
Als ich nachts in meinem Hotelbett liege und nicht schlafen kann, schalte ich das Nachttischlämpchen wieder an und lese Schröders Bemerkung, die ich mir notiert habe. Ich nehme mir vor, den Kanzler beim Frühstück darum zu bitten, mir seine Gedanken näher zu erläutern: «Sie, Herr Bundeskanzler, bekämpfen also tagtäglich …? Tatsächlich? Haben Sie überhaupt noch Zeit für andere Dinge?»
Am nächsten Morgen sitzen wir zu etwa dreißig Leuten, vor allem Männer reiferen Alters, im Park desselben Hotels zusammen. Schröder trägt keine Krawatte mehr. Begleitet wird er nur noch von einer Assistentin, einer bildhübschen Deutschen mit rastlos umherwanderndem Blick, unter dem Gürtel offenbar ein besonders flaches Kleinkaliber. Zwei Stunden lang erläutert der Staatsmann Schröder die Politik, die ihm vorschwebt, auf nationaler Ebene, für Europa. Seine Stringenz beeindruckt mich. Ihm meine Frage zu stellen, getraue ich mich nicht mehr. Doch ich höre ihm aufmerksam zu und habe das Gefühl, hinter sein Geheimnis gekommen zu sein. Schröder wäre nicht der Machtmensch, der er heute ist, wären nicht die beiden anderen Facetten seiner früheren Persönlichkeit in ihm lebendig geblieben: der junge, leidenschaftliche Sozialist und der melancholische Fußballspieler.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht wie mir … Ich wie er? Nein, auf Machtergreifung war ich nie erpicht, ebensowenig zog es mich in die Parteipolitik, selbst damals nicht, als es galt, Parteien aufzubauen, um die Massen zur Revolution zu führen. Ich war kein passionierter Sozialist, und auch Fußball lässt mich eher kalt. Anders der Langstreckenlauf. Und ab und zu die Rolle des Untergrundpatrioten.
Noch lange nach dem Brand des Alpenchalets, lange nach dem Ende des Kalten Krieges habe ich felsenfest geglaubt, Springer sei Nazi gewesen. Sollte ich mich tatsächlich geirrt haben, werde ich mich jetzt beeilen müssen, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Allmählich wird es Zeit, dass ich all das zu begreifen versuche, was ich damals zwischen den starren Fronten nicht wahrgenommen habe. Und so beschließe ich in jenem Schweizer Hotel, während der deutsche Kanzler seine Zukunftsvisionen ausbreitet, noch einmal den Tatort in den Bergen aufzusuchen. Und wenn nötig, fahre ich auch bis nach Hamburg. Jetzt, da der nächste Krieg begonnen hat, will ich den Kalten Krieg durchschauen, jene Zeiten, als wir noch Sonntagsterroristen waren. Das schulde ich denen, die wir einst mit dem großspurigen Satz bedacht haben: «Wir müssen später einmal unseren Kindern in die Augen blicken können.»
Hier ist also mein Geständnis. Wer aber in seinem geheimen Garten noch nie ein besonders grünes Grasbüschel begossen hat, sollte dieses Buch wieder schließen.
02
Eines Morgens im Januar 1975 stieg ich in Gstaad aus dem Zug, um einen Anschlag zu verüben. Der Boxer Mohammed Ali hatte sich soeben seinen Weltmeistertitel zurückgeholt. Ich war dreißig und sah aus wie ein Einheimischer, der das Wochenende auf der Skipiste verbringen wollte. In meinem Rucksack steckten neben meiner Waschtasche ein Brecheisen, eine Axt und ein Fernglas. Die Mütze saß mir tief im Gesicht, und auf der Schulter trug ich ein Paar Ski. Ich liebte rasende Abfahrten durchs winterliche Weiß, seit ich den Pariserinnen beibrachte, wie man über unsere verschneiten Hänge glitt. Gekommen war ich mit der kleinen, blauen Schmalspurbahn, die vom See hinaufklettert ins Oberland und dabei einige Dörfer, darunter auch Rougemont, und mehrere Tunnel durchquert und die Sprachgrenze passiert.
Gegen zehn Uhr morgens hielt die Bahn, nachdem sie die Schlucht Les Allamans verlassen hatte, in der deutschen Schweiz. Wann genau sie in dem vornehmen Bahnhof eintraf, kann ich heute nicht mehr sagen. Inzwischen bin ich sechzig und mir bleiben nur noch meine eigenen Erinnerungen, um von jenem Abenteuer zu erzählen. Es gibt niemanden mehr, der mir sagen könnte, mit welchem der kleinen, blauen Züge ich damals gekommen bin.
Doch eines weiß ich noch, es war ein schöner Tag. Ich hatte die Vorhersagen studiert, um sicherzugehen, dass wir nicht in einen Schneesturm geraten würden. In jenen längst vergangenen Zeiten gab es kaum Satelliten. Heraufziehende Wolken kündigte das Radio erst ein, zwei Tage vorher an, und an Neujahr wusste noch niemand, wie hoch an Dreikönigen der Schnee auf den Pisten liegen würde. Gerade gingen die Weihnachtsferien zu Ende. Wie jedes Jahr hatte ich einige Tage bei meinen Eltern verbracht, unter einem Baum voll glitzernder Girlanden und funkelnder Engel, die meine Mutter aus Silberpapier gebastelt hatte. Und im Vertrauen auf den Wetterbericht für den nächsten Tag hatte ich die große Entscheidung getroffen: Ich würde zur Tat schreiten.
Meine Handschuhe waren der wichtigste Teil meiner Ausrüstung. Ich trug zwei Paar übereinander, Lederfäustlinge über Seidenhandschuhen, die so dünn waren, dass man damit problemlos alles anfassen konnte, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Über einer Wollstrumpfhose trug ich ein Paar Jeans und sah aus wie einer aus der Gegend, dem die Kälte nichts anhaben kann. Im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, haben wir uns immer lustig gemacht über die Touristen in ihren wattierten Schneeanzügen. Ich hatte außerdem einen dieser dicken, marineblauen Wollpullover mit Schulterknöpfen an, die man in den Läden für US-Armeebestände kaufen konnte. Meine wendbare Windjacke zeigte sich vorerst von ihrer dunklen Seite. Zu gegebener Zeit wollte ich sie umdrehen, denn will man sich im Winter tarnen, so kommt man, wie die Schneehühner wissen, an der weißen Farbe nicht vorbei.