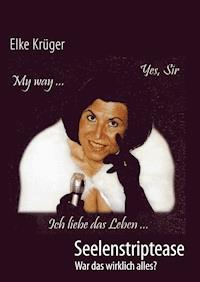4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1911, auf dem Höhepunkt der deutschen Kolonialzeit, unternahm die Familie Duderstadt aus Lübeck eine Reise rund um Afrika. Größere Etappen bewältigten sie mit den Postdampfern der Deutschen Ost-Afrika-Linie. Dort genossen sie alle Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt. Auch an Land reisten sie, stets adrett gekleidet, mal mit den neuesten Autos und Eisenbahnlinien, mal im Einbaum oder auf dem Rücken eines Esels zu Zielen wie den Slums von Windhuk, den Victoriafällen, nach Sansibar oder zu den Pyramiden von Gizeh. Von ihrer Reise brachten sie 100 Objekte und 833 Fotografien mit nach Lübeck, die sie 1960 der Völkerkundesammlung vermachten. Dieser noch nie gezeigte Bilderschatz eröffnet amüsante bis bizarre Einblicke in die luxuriöse Lebenswelt früher Tourist:innen. Die Fotos zeigen die Naturschönheit und die kulturelle Vielfalt Afrikas ebenso, wie die vermeintlichen Errungenschaften der Kolonialherren. Aber auch der beginnende Raubbau an der Natur und die Unterdrückung der Einheimischen deuten sich in einigen Bildern an. Unübersehbar sind die Ähnlichkeiten zwischen diesen alten Aufnahmen und den Bildern heutiger Reiseblogs. So soll diese Publikation dazu anregen, über das Verhältnis von Tourismus und Kolonialismus nachzudenken und die heutigen Afrikabilder in unseren Köpfen auf "koloniale Filterblasen" hin kritisch zu hinterfragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Route der Afrikareise von Familie Duderstadt 1911
Inhalt
Einleitung
Biografisches
Reiseroute
Sammlung
Waffen
Kleidung und Schmuck
Gebrauchsgegenstände
Naturalien
Kunsthandwerk
Die koloniale Filterblase
Katalog der Fotografien und Postkarten
Belgien, England und Kanaren
Namibia
Südafrika und Simbabwe
Mosambik, Tansania und Sansibar
Kenia und Uganda
Ägypten
Italien und Frankreich
Index
Personen
Orte, Bauten und Denkmäler, Unternehmen und Verkehrsmittel
Quellen und Literatur
Einleitung
Im Jahr 1911, auf dem Höhepunkt der europäischen Kolonialzeit, unternahmen der in Lübeck wohnhafte Eugen Duderstadt, seine Frau Johanna und ihr Sohn Walter eine mehrmonatige Reise rund um Afrika. Neben 100 Objekten brachte die Familie mehr als 800 Fotografien mit nach Hause. Teilweise handelt es sich um vor Ort erworbene Abzüge und Postkarten, um Studiofotografien und Aufnahmen anderer Mitreisender.1 Die Mehrzahl der Aufnahmen wurde jedoch von den Duderstadts selbst gemacht.
1960 gelangten die Bilder und Objekte als Schenkung in die Völkerkundesammlung der Hansestadt Lübeck. Es handelt sich um insgesamt 823 heute noch erhaltene Fotografien, teils einzeln, teils in Gruppen auf Pappen aufgeklebt und beschriftet, wodurch die z. T. gedruckten und handschriftlichen Texte auf den Rückseiten verdeckt wurden. Einige Fotografien und Postkarten sind beschnitten und daher nicht mehr vollständig erhalten. Die Pappen waren offenbar niemals zu einem Album gebunden, sind aber fortlaufend von 2 bis 355 nummeriert, was darauf hindeutet, dass ein ursprünglich vorhandenes Deckblatt fehlt. Anhand dieser Seitenzahlen lässt sich feststellen, dass nicht nur einzelne Fotos auf einigen Seiten, sondern auch komplette Pappen fehlen. Auf eine bewusste Entfernung allzu persönlicher oder inzwischen als anstößig empfundener Bilder vor der Übergabe an das Museum deutet in den vorhandenen Bildunterschriften allerdings nichts hin.
Die Aufnahmen eröffnen uns teils amüsante, teils verstörende Einblicke in die luxuriöse Lebenswelt europäischer Reisender jener Epoche, die in einem scharfen Kontrast zu dem ausbeuterischen System des Kolonialismus steht. In erster Linie zeigen die Bilder die Schönheit der Natur und die kulturelle Vielfalt Afrikas, wie sie auch in den Alben heutiger Reisender zu erwarten wäre. Auffällig häufig werden aber auch europäische Bauten, Denkmäler und moderne Transportmittel, wie Automobile und Eisenbahnen, gezeigt. Diese Aufnahmen sollten zweifellos die vermeintlichen Errungenschaften der Kolonialherren in ihrem Bemühen um eine „Zivilisierung“ Afrikas zeigen und sind somit als ein Teil der kolonialen Herrschaftslegitimation zu verstehen. Für heutige kritische Betrachter:innen sind auf einigen Bildern aber auch der beginnende Raubbau an der Natur und die Unterdrückung der Einheimischen deutlich erkennbar. Indizien, wie z.B. Schattenwürfe und Spiegelungen, auf einigen Fotografien weisen darauf hin, dass neben den Männern auch Johanna Duderstadt bisweilen die Kamera bediente. Die Bilder repräsentieren also anteilig einen selten dokumentierten, weiblichen kolonialen Blick.
Nicht minder bemerkenswert sind die z. T. sorgfältig arrangierten Selbstinszenierungen der Reisenden, die den „Selfies“ heutiger Reiseblogger:innen im Internet in Nichts nachstehen. So mag diese historische Bildersammlung auch dazu anregen, über die Kontinuität von eurozentristischen Sichtreisen und kolonialen Afrikabildern in unserer heutigen Wahrnehmung nachzudenken.
Nachdem bisher nur einzelne Abbildungen dieser Fotodokumentation in Ausstellungen der Völkerkundesammlung zu sehen waren, bieten wir in diesem Band mit 216 Fotografien erstmalig einen umfassenderen Einblick in diesen Bestand. Ausschlaggebend für die Auswahl war der historische und ethnographische Wert der Bilder sowie deren Schärfe und Erhaltungszustand.
Der Schwerpunkt wurde auf Darstellungen von ethnologischem und kolonialhistorischem Interesse gelegt sowie wenig bekannte Orte und Personen, die für zukünftige Forschungsprojekte von Interesse sind. Entbehrlicher erschienen uns Tier- und Naturaufnahmen, etwa direkt aus der Ugandabahn, oder den Victoriafällen sowie Postkarten und andere Ansichten vielfach fotografierter Metropolen wie Kapstadt oder Kairo. Generell wurde der umfangreiche Bestand an Postkarten und eigenen Aufnahmen aus Ägypten angesichts zahlreicher bereits publizierter Vergleichsbilder aus derselben Zeit nur sehr zurückhaltend verwendet, um lediglich die Stationen und Interessensgebiete der Reisenden wiederzugeben. Wir haben uns bei der Auswahl jedoch stets auf die Weglassung von Bildern mehrfach fotografierte Orte beschränkt, so dass das visuelle Narrativ der chronologischen Abfolge der Reiseroute erkennbar bleibt. Nichtsdestotrotz erhebt dieser Band keinesfalls den Anspruch, die Sammlung Duderstadt umfassend zu analysieren, sondern stellt lediglich einen ersten Schritt dar, um diesen Bestand einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen und als Quellenmaterial für zukünftige Forschungsprojekte zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte anzubieten.
Nicht unerwähnt bleiben darf dabei die ethische Problematik, die unausweichlich mit der Veröffentlichung kolonialer Fotografien einhergeht. Denn ungeachtet ihres enormen Wertes für eine kritische Aufarbeitung des Kolonialismus besteht in unserem Zeitalter digitaler Medien immer die Gefahr, dass solche Bilder aus ihrem Zusammenhang gerissen, ideologisch missbraucht oder sexualisiert werden. So gibt es in der Museumswelt und in aktivistischen Kreisen einige Stimmen, die sich grundsätzlich gegen die Veröffentlichung kolonialzeitlicher Fotos aussprechen, da mit jeder Präsentation des historisch belasteten Bildmaterials immer auch die Gefahr einhergeht, überkommene rassistische Stereotype im öffentlichen Bewusstsein zu verfestigen oder Gefühle heutiger Nachkommen zu verletzen. Da die meisten Afrikaner:innen wohl ohne ihre Zustimmung fotografiert wurden, könnte die Veröffentlichung sogar als Fortführung dieses Unrechts empfunden werden. Vor diesem Hintergrund haben wir mit Angehörigen der migrantischen Communities in Lübeck diskutiert, wobei wir stets Zustimmung fanden und der Wert dieser Bilder für eine öffentliche Aufklärung der deutschen Bevölkerung über das historische Unrecht des Kolonialismus höher eingestuft wurde, als die Gefahr, mit einer Veröffentlichung Gefühle von Nachfahren zu verletzen.