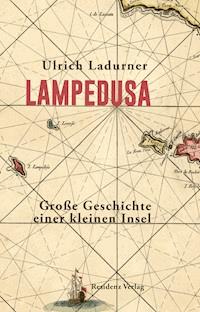Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was haben wir in Afghanistan verloren? Mit einem Vorwort von Helmut Schmidt Die Afghanen haben im Laufe ihrer Geschichte die kalte Klinge der Geopolitik immer wieder zu spüren bekommen. Ihr Land war das Schachbrett, auf dem die Großmächte ihre Kräfte maßen, Russland und England im 19. Jahrhundert, die Sowjetunion und die USA im 20. Jahrhundert. Das große Spiel wurde auf dem Rücken der Afghanen ausgetragen. Die Attentate vom 11. September 2001 machten Afghanistan zum Gegenstand eines Experiments der Beglückung durch den Westen: Bomber plus Menschenrechte plus Rechtsstaat plus Demokratie ist gleich das Paradies auf Erden. Auch Ulrich Ladurner kam im Gefolge einer Armee, die interveniert hat und mehr und mehr Soldaten schickt. Er beobachtete, wie das neue gegen das alte Afghanistan kämpft, das Afghanistan, das keinen Krieg mehr will, gegen das Afghanistan, das ohne Krieg nicht leben kann. Seine Reisen führten ihn in ein Land voller Gegensätze, auf den Spuren von Eroberungen und Niederlagen. Er berichtet von den Schauplätzen in diesem Krieg, in dem die zentralen Werte des Westens beschädigt werden. Und er blickt zurück in die lebendige Vergangenheit eines alten Schlachtfeldes, das Europäern und Amerikanern zur Obsession wurde. Ein Geschichts- und Geschichtenbuch über Feindbilder und die Macht der Erinnerung, als Antwort auf die provokante Frage, was wir in Afghanistan eigentlich verloren haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich LadurnerEine Nacht in Kabul
Ulrich Ladurner
Eine Nachtin Kabul
Unterwegs in einefremde Vergangenheit
Mit einem Vorwortvon Helmut Schmidt
Für alle, die den Krieg nicht hinnehmen
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2010 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4246-2
ISBN Printausgabe:978-3-7017-3205-0
Inhalt
Vorwortvon Helmut Schmidt
Eine Nacht in Kabul
Anmerkungen
Literatur
Dank
Register
Vorwort
Vor neun Jahren begann die Intervention der NATO in Afghanistan. Der Einsatz dauert damit länger als der Zweite Weltkrieg, länger als der Vietnamkrieg, länger als der Koreakrieg. Noch immer ist kein Ende abzusehen. Niemand kann heute sagen, wann die NATO sich aus Afghanistan zurückziehen wird. Ganz egal, ob man für den Rückzug ist oder für den weiteren Verbleib der NATO, Afghanistan wird uns weiterhin als eine der zentralen außenpolitischen Herausforderungen begleiten. Wir müssen uns mit diesem Land auseinandersetzen, allein schon deshalb, weil deutsche Soldaten dort täglich ihr Leben aufs Spiel setzen. Das vorliegende Buch leistet dazu einen hilfreichen Beitrag.
Ulrich Ladurner hat in den vergangenen neun Jahren im Auftrag der ZEIT das Land immer wieder bereist. Dabei hat er sich nicht auf die Hauptstadt Kabul beschränkt, sondern ist auch in den Süden gefahren, wo es eine starke Präsenz der Taliban gibt. Er hat sich ebenso nach Kundus und Mazar-e-Sharif aufgemacht, wo die deutsche Bundeswehr Verantwortung trägt. Er ist in entlegene Dörfer gereist und kann über die harten Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen berichten.
Gleichzeitig unternimmt er eine Expedition in die komplexe, aufregende Geschichte dieses Landes, das mehrfach im Zentrum geopolitischer Interessen verschiedener Großmächte stand. Aus dieser Geschichte fördert er erstaunliche und erhellende Episoden hervor, die einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der gegenwärtigen Lage leisten. Ladurner weiß dabei spannend zu erzählen und das Gegenwärtige mit dem Vergangenen auf eine höchst wirksame Weise zu verbinden. Ladurners Buch ist kein kühl analysierendes Sachbuch, wohl aber getragen von einem glasklaren analytischen Blick. Es handelt sich auch nicht um die Reportagensammlung eines vorzüglichen Journalisten, sondern um ein geschlossenes erzählerisches Werk, das uns wesentliche politische Einsichten in die Gegenwart vermittelt.
Afghanistan ist ein bitterarmes Land. Es ist seit dreißig Jahren zerrissen von Krieg, Bürgerkrieg und ausländischer militärischer Intervention. Wir wissen nicht, ob dieses Land eine bessere Zukunft haben kann. Jedoch wissen wir, dass es in der Geschichte immer wieder als Schachbrett diente, auf dem mächtige Spieler ihre Kräfte messen. Im 19. Jahrhundert waren es das britische Empire und das zaristische Russland, im 20. Jahrhundert die USA und die Sowjetunion. Heute ist eine ganze Reihe von konkurrierenden und auch feindlichen Staaten in Afghanistan präsent. Die USA, China, Indien, Pakistan, Iran, Europa – sie alle treffen in diesem Land aufeinander. Darum ist Afghanistan ein Spiegel für die internationale Politik des 21. Jahrhunderts. Wer wie der Autor des vorliegenden Buches dieses Land eingehend studiert, der lernt nicht nur viel über Afghanistan, sondern auch über die Welt, in der wir heute leben. Ich kann durchaus empfehlen, dieses Buch zu lesen.
Helmut SchmidtHamburg, im Juli 2010
1
Es ist kurz vor Mitternacht, als das Licht in meinem Zimmer erlischt. Ich bleibe am Schreibtisch sitzen und warte, den Stift in der Hand, über die Karte von Afghanistan gebeugt, die ich mir gekauft habe, als ich zum ersten Mal in dieses Land kam. Sie ist übersät mit Kreisen und Strichen, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, um Städte, Dörfer und Weiler hervorzuheben: Tarin Kowt, Musa Qala, Spin Boldak, Shindand, Salang, Sang-e-Talkh, Kundus, Kandahar, Herat, Ghazni, Khost. An manchen dieser Orte bin ich mehrmals gewesen, an anderen nur einmal, an den meisten aber nie, weil es zu gefährlich war oder weil mir der Mut fehlte, sie zu besuchen. Wenn das Licht wieder zurückkommt, denke ich, werde ich die Orte, an denen ich nie war, mit einem roten Stift markieren, dann werde ich sehen können, wie vieles in Afghanistan mir noch unbekannt ist, was mir alles noch fehlt, um behaupten zu können, ich kennte das Land. Die roten Stellen markieren ein Scheitern.
Im Dunkeln betaste ich die Karte. Das Papier ist inzwischen an verschiedenen Stellen eingerissen, an anderen ist es knittrig und abgenutzt. Es fühlt sich an wie ein matschiges Stück feuchten Kartons, der sich jeden Augenblick auflösen kann. Alles in allem ein unbrauchbarer Gegenstand. Trotzdem habe ich diese Karte nicht gegen eine neue eingetauscht, sondern immer bei mir getragen, eng an meinem Körper, in einer Seitentasche meiner Jacke, oder in meiner Tragetasche, sicher verstaut und doch so, dass ich schnell auf sie zugreifen konnte wie auf eine lebensrettende Medizin. Manchmal, wenn ich gerade wieder einmal nicht recht wusste, wo ich war und wohin ich wollte, nahm ich sie mit den leise gesprochenen Worten hervor: »Schauen wir mal, was du sagst!«, so vertraut war sie mir, so selbstverständlich war mir ihre Anwesenheit, dass ich sie behandelte wie einen Menschen, der sprechen und denken kann. Und tatsächlich, wenn ich mich auf sie einließ, wenn ich sie betrachtete wie jemanden, der trotz seiner Stummheit etwas zu sagen hat, sprach sie zu mir: Shindand, Shindand, Shindand. Sie wiederholte ihre Worte so lange, bis ich einen Klang vernahm, der mich auf etwas verwies, das hinter diesem Wort liegt, ein Afghanistan, das weniger ein fest umrissenes Gebiet war, sondern ein unbekannter Raum, der erst Ende des 19. Jahrhunderts den Namen »Afghanistan« bekam – und selbst danach blieb umstritten, wo denn die Grenzen dieses Gebildes lagen und was das denn für Menschen waren, die darin lebten.
In der Dunkelheit meines Zimmers lasse ich mich treiben von der Karte und den auf ihrer rissigen Haut aufgedruckten Namen. Shindand, Shindand, Shindand, murmele ich vor mich hin. Die Worte spannen sich wie das Fell einer Trommel und antworten auf jeden Schlag meiner Zunge mit einem dunklen Dröhnen, das mich immer weiter hinein lockt in diesen namenlosen Raum, in dem ich hoffe, Afghanistan zu finden, denn das ist es ja, was auf der Karte steht: Afghanistan.
Schließlich, gefangen in einem Wachtraum, sehe ich eine Karawane über den Fluss Indus setzen. Sie zieht sich über fast drei Kilometer dahin und schiebt sich langsam und beharrlich auf Peshawar zu, die Sommerresidenz des afghanischen Königs Shah Shuja. Sie besteht aus einem Dutzend Offizieren, Hunderten Fußsoldaten, mehr als hundert Kavalleristen, dreizehn Elefanten und zweihundert Kamelen. Es ist der 13. Oktober 1808, Herbst, doch die Erde ist noch trocken vom heißen Sommer. Staub umhüllt die Karawane und verwischt ihre Konturen. Wer sie von Weitem sieht, kann den Eindruck bekommen, dass sich hier ein riesiger Wurm durch die fruchtbare Ebene Punjabs frisst. Tatsächlich ist es der Zweck dieser Karawane, alles in sich aufzusaugen, was man nur aufsaugen kann über dieses Reich jenseits des Indus, das Reich Durrani des Shah Shuja. Sie bildet die erste offizielle diplomatische Mission, die die Briten in das Land der Afghanen entsenden. Angeführt wird sie von Mountstuart Elphinstone, neunundzwanzig Jahre alt, Spross eines schottischen Adelshauses, weltgewandt, gebildet, von großem Fleiß und unbändiger Neugier, alles in allem ein prächtiger Sohn des machtvollen britischen Empires. Er hat sich in Indien bereits eine Reihe von Meriten erworben, und nun steht er vor einem weiteren Karrieresprung. Elphinstone kommt im Auftrag der Ostindischen Kompanie, die sich in den vergangenen Jahrzehnten den indischen Subkontinent nach und nach unterworfen hat und nun ihre Fühler ausstreckt, um die Gegend jenseits des Indus zu erfassen. Fast zeitgleich mit dem Aufstieg der Kompanie war das Reich der Durrani in Hader und Streit versunken. Nichts mehr erinnert an die furchterregende Kraft, die noch ihr Gründer, Ahmed Shah Abdali, ausgestrahlt hatte. Der Leibwächter des persischen Herrschers Nadir Shah war nach dem gewaltsamen Tod seines Herrn 1747 in seine Heimat Kandahar zurückgekehrt. Dort riefen ihn Tausende Männer in aller Öffentlichkeit zum ersten König der Afghanen aus, woraufhin Shah Abdali daran ging, sich Stücke aus dem riesigen Körper des Subkontinents zu reißen und sein eigenes Reich zu gründen, das Reich der Durrani. Die Moguln – die Herrscher Indiens – konnten dem wenig entgegensetzen. Sie waren zu schwach geworden. Abdali konnte in Nordindien einfallen, ungestraft Delhi ausrauben und Tributzahlungen verlangen. Sein Reich nährte sich von Plünderungen. Als Abdali starb, kam es zu einem Streit unter seinen Söhnen, der das Königreich lähmte und zerriss. Nach seinem Tod öffnete sich jenseits des Indus buchstäblich eine Lücke. Die Briten wussten nichts Genaueres darüber, was dort, in dieser Leere, vor sich ging. Die Ostindische Kompanie war besorgt. Ihre Männer waren darin geschult, in großen Zusammenhängen zu denken und ihr Handeln in einen geostrategischen Kontext zu stellen. Indien wurde gerade zur Perle des britischen Empires. Sie galt es zu bewahren und zu schützen. Die Männer der Kompanie studierten die Landkarten und fragten sich: Woher droht uns Gefahr?
Im Norden des Subkontinents steht der unüberwindliche Himalaya, im Osten befindet sich die undurchdringliche grüne Mauer des südostasiatischen Dschungels, das Meer, das Indien auf drei Seiten umspült und über das Eroberer jederzeit kommen könnten, ängstigt die Männer der Kompanie nicht. Denn auf den Meeren herrscht unumstritten die Flotte Seiner Majestät. Gefahr kann demnach nur aus dem Westen kommen, aus der Landmasse, die man Afghanistan zu nennen begonnen hat. Sind nicht all die Eroberer, von Alexander dem Großen über die Timuriden bis zu Shah Abdali, über den Khyberpass gekommen und in Indien eingefallen?
Je weniger die Kompanie über Afghanistan wusste, desto größer war ihre Sorge. Sie galt allerdings nicht so sehr den Afghanen, sondern konkurrierenden europäischen Mächten, die Afghanistan nutzen könnten, um dem britischen Empire zu schaden. Als Elphinstone 1808 zu seiner Erkundungsreise aufbrach, befand sich England im tödlichen Kampf mit dem französischen Kaiser Napoleon. Es erschien den Briten daher nur natürlich zu glauben, dass Frankreich versuchte, in Afghanistan Einfluss zu gewinnen. Die Tatsache, dass der Arm des napoleonischen Frankreichs gar nicht nach Kabul oder Peshawar reichen konnte, weil er nicht stark genug war, änderte nichts an der Gefahrenanalyse. Das Vakuum Afghanistan empfanden die Briten per se als Bedrohung. Es könnte, wenn man nicht wachsam war, immer von Feinden genutzt werden, um von dort aus einen Schlag zu führen. Afghanistan wurde zur Obsession der Briten. Jedes Gerücht, dass in Herat, in Kabul oder gar in Peshawar Franzosen gesichtet worden seien, löste im Tausende Kilometer entfernten Verwaltungsgebäude der Kompanie größte Unruhe aus. In Kalkutta notierten die Beamten des Empires die Nachrichten aus dem Westen, trugen sie weiter, von Büro zu Büro, wo sie zusammengefasst und ausgewertet wurden, bis sie schließlich auf dem Tisch des Gouverneurs landeten, der sie mit größter Aufmerksamkeit las. Nichts sollte ihm entgehen. So empfindlich und ängstlich war das Imperium. Es war wie ein riesiges, mächtiges Tier, das sich vor dem Dunklen fürchtete und nicht mehr unterscheiden konnte zwischen einer echten Gefahr und den Gespenstern, die nichts weiter waren als das Produkt der eigenen Furcht. Aus diesem Dunkel heraus blickten die entstellten Gesichter all jener, die das Imperium im Zug der Eroberung unterworfen, gedemütigt, ums Leben gebracht hatte. Jenseits des Indus hatten sie Asyl gefunden. Sie streckten die Zungen heraus, fletschten die Zähne, rollten die Augen, schimpften, spuckten und höhnten, sodass es den Männern der Ostindischen Kompanie kalte Schauer über den Rücken jagte. Afghanistan war wir eine Leinwand, auf der die Ängste der britischen Herrscherseele sich abbildeten und lebendig wurden.
Im fernen Westen trieben auch Deserteure der Kompanie ihr Unwesen. Sie waren nicht auf Rache aus oder Wiedergutmachung, sie suchten nach Gelegenheiten, Geld zu verdienen. Je erfolgreicher die Kompanie war, je mehr Schlachten sie auf dem militärischen Feld gewann, desto mehr wuchs unter den von den Briten noch unabhängigen Herrschern des Subkontinents der Bedarf nach militärischen Kenntnissen der Europäer. Ranjit Singh, König der Sikh, suchte gezielt nach Offizieren, die seinen Soldaten beibringen konnten, wie man moderne Kriege führte. Europäische Söldner kamen zahlreich in seine Hauptstadt Lahore und halfen ihm, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Ranjit Singh erwarb sich den Titel »Löwe von Punjab«. Er entriss den Afghanen Punjab, nahm 1818 Peshawar ein und eroberte Kaschmir. Die Briten fürchteten Ranjit Singh. Sie schlossen mit ihm Abkommen und versuchten seine Expansionsenergie Richtung Westen zu dirigieren, nach Afghanistan, was ihnen lange Zeit gelang. Singh lag mit den Afghanen im Dauerkrieg. Den Engländern gefiel das, doch nie verließ sie der Argwohn gegenüber dem mächtigen Löwen von Punjab.
Die Kompanie tat, was sie konnte, um den Transfer von militärischem Wissen zu stoppen, doch in den Griff bekam sie das Problem nicht; keine noch so schlimme Strafe hielt Deserteure davon ab, den Verlockungen des Geldes zu widerstehen. Die Kunde, dass hier auf dem Subkontinent reich werden konnte, wer vom Kriegshandwerk etwas verstand, sprach sich schnell bis nach Europa herum. Als Napoleon 1815 endgültig besiegt wurde und damit ein fast zwei Jahrzehnte dauernder ständiger Krieg auf dem europäischen Festland zu Ende ging, wurde ein ganzes Heer von Offizieren arbeitslos. Da sie in vielen Fällen nichts anderes konnten, als Krieg zu führen, suchten sie Beschäftigung in diesem Metier und fanden sie auf dem Subkontinent, wo es an Kriegen nicht mangelte.
Aus der Sicht der Briten musste etwas geschehen. Mountstuart Elphinstone sollte mit einer Fackel das Dunkel jenseits des Indus ausleuchten und die Gespenster verjagen. Seine Mission war die eines Exorzisten – eine Teufelsaustreibung.
Als Elphinstone über den Indus setzt und die Ebene von Peshawar erreicht, überwältigt ihn der Blick der Berge des Hindukusch: »Wir sahen sie schon auf einer Entfernung von hundert Meilen (…). Die unglaubliche Höhe dieser Berge (…), die fürchterliche und völlige Einsamkeit, die inmitten dieses ewigen Schnees regiert, füllen den Geist mit Bewunderung und Staunen, das keine Sprache der Welt beschreiben kann.«1 Elphinstone nähert sich seinem Studienobjekt Afghanistan mit Respekt und spürbarer Ehrfurcht. Ihm wird bald klar, dass die ihm gestellte Aufgabe, nämlich die Afghanen und ihr Land zu erfassen und für das Empire lesbar zu machen, kaum lösbar ist, denn er hat es mit einem äußerst heterogenen Volk zu tun. »Ich finde, dass es sehr schwer ist, die Kennzeichen herauszuarbeiten, die allen gemeinsam sind und die den Afghanen einen klaren nationalen Charakter geben könnten.« Er versucht, die Afghanen von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten, um ihre Konturen schärfer fassen zu können, doch auch um klarzumachen, dass der Gegenstand der Beobachtung sich verändert, je nachdem, von welchem Blickwinkel aus man beobachtet. Elphinstone weiß offensichtlich darum, dass die Wahrheit sich in unterschiedlichen Formen zeigt, je nachdem, von welcher Seite man sich ihr nähert. »Wenn ein Reisender aus England hierherkäme, würde er sofort das Fehlen jeden Gerichts und jeder Form eines organisierten Polizeiwesens bemerken. Er würde sich wundern über die Fluktuation und Instabilität der zivilen Einrichtungen. Es würde ihm schwerfallen zu verstehen, wie eine Nation in solcher Unordnung überleben kann; und er würde jeden bemitleiden, der dazu gezwungen wird, seine Tage in solcher Umgebung zu verbringen.« Nachdem er auf diese Weise versucht hat, das Verwirrende Afghanistans in den Augen eines Engländers aus England zu beschreiben, geht er dazu über, den Standpunkt eines Engländers aus Indien einzunehmen: »In Indien hat dieser Reisende ein Land zurückgelassen, in dem jede Bewegung ihren Ursprung in der Regierung oder ihren Beamten hat und wo die Leute selbst kaum Initiative haben; er würde sich (in Afghanistan – U. L.) in einem Land wiederfinden, in dem die Kontrolle der Regierung kaum spürbar ist und wo jeder Mann scheinbar seinen eigenen Neigungen nachgehen kann, ohne Anleitung und ohne Hindernisse!«
Bei der Lektüre dieser Zeilen möchte man gerne wissen, ob Elphinstone die Freiheit, die eine gewisse Unordnung mit sich bringt, höher schätzte oder ob er einen starken Staat vorzog, der seinen Bürgern Sicherheit gibt, sie aber auch mit Einschränkungen belegt. Doch verbietet es ihm sein Forschergeist offensichtlich, eindeutige Antworten zu geben. Er stellt die Möglichkeit dar, wie man eine Sache betrachten kann, im ehrlichen Bemühen zu begreifen. Elphinstone war ein Kind der Aufklärung, für ihn war das Sammeln von Informationen ein Wert an sich. Seine Porträtisten zeichnen ihn mit großen Augen, einer langen aristokratischen Nase, schmalem Gesicht, einer hohen Stirn und leicht gewelltem Haar. Die Darstellung entspricht dem Selbstbild eines englischen Adligen jener Zeit: empfindsam, mit einem leichten Hang zu romantischer Übertreibung, fest auf dem Boden der europäischen Zivilisation verankert, bewandert in der griechischen und lateinischen Klassik, ausgestattet mit einem Sinn für das Schöne, getrieben vom Willen, die Welt zu verstehen. Bei der Betrachtung seines Porträts vergisst man leicht, dass Elphinstone ein Gesandter des Empires war, der Wissen sammeln wollte, um Englands Macht zu mehren.
Als er am Hofe von Shah Shuja ankommt, trifft er auf einen in etwa Gleichaltrigen, von dessen angenehmer Erscheinung er offensichtlich überrascht und beeindruckt ist. »Er war ein Mann von etwa dreißig Jahren mit olivenfarbener Haut und einem dicken schwarzen Bart. Seine Zurückhaltung war würdevoll und angenehm, seine Stimme klar und seine Rede einem König gemäß. Er trug, so schien es uns zunächst, eine Panzerung aus Juwelen. Doch als wir näher kamen, da sahen wir, dass seine Kleidung aus mit Blumenmustern besticktem Stoff bestand, in den wertvolle Steine eingenäht waren. Darüber trug er eine eiserne, mit Diamanten besetzte Platte. Oberhalb des Ellenbogens trug er Smaragdringe, und viele andere Juwelen an verschiedenen Stellen des Körpers. In einem seiner Armreifen befand sich der Koh-e-Noor, der größte Diamant der Welt.«
Sosehr Elphinstone auch erstaunt ist, so wenig lässt er sich blenden. Er weiß, dass das Reich der Durrani seit dem Tode seines Gründers Shah Abdali von inneren Kämpfen zerrissen wird und dass auch Shah Shuja mit einer Revolte konfrontiert ist, die von seinem Bruder Mahmud angeführt wird. Elphinstone notiert: »Obwohl ich von manchen Dingen überrascht wurde, besonders von der Erscheinung des Königs, hatte ich insgesamt den Eindruck, dass es sich hier nicht um eine blühenden Staat handelte, sondern um eine Monarchie im Niedergang.« Er schließt zwar ein Freundschaftsabkommen mit Shah Shuja, in dem England Beistand zusichert für den Fall, dass die Franzosen und Perser »auf Kabul zumarschieren sollten«, doch wird dieses Abkommen schnell hinfällig. Shah Shuja stürzt 1810, zwei Jahre nach Elphinstons Mission. Die Briten gewähren dem afghanischen König Exil im nordindischen Ludhiana. Sie halten ihn in Reserve. Der Tag, an dem sie ihn brauchen, wird kommen.
Elphinstone und seine Männer bleiben sechs Monate in Peshawar. Sie notieren alles ausführlich und detailreich. Die Beschaffenheit der Landschaft, Flora, Fauna, die Menschen – nichts entgeht dem enzyklopädischen Eifer dieses schottischen Adligen. Die Aufzeichnungen von Elphinstones Mission werden am Ende insgesamt neun Bände umfassen. 1815 veröffentlichte er für ein breiteres Publikum ein zweibändiges Werk: »An Account of the Kingdom of Caubul, and Its Dependencies in Persia, Tartary, and India: Comprising a View of the Afghaun Nation, and a History of the Dooraunee Monarchy.« Dieses Buch war seinerzeit sehr erfolgreich. Es sollte das Bild Afghanistans im Westen grundlegend formen, bis heute.
Bei allem um Objektivität bemühten Forschergeist ist Elphinstone doch auch ein Gefangener seiner Vorstellungen. Als er sieht, dass die afghanische Gesellschaft nach Stämmen und Clans organisiert ist, vergleicht er sie mit dem, was er bestens kennt: den Highländern seiner schottischen Heimat. »Die Situation Afghanistans scheint mir sehr ähnlich mit dem Schottland alter Zeiten zu sein«, notiert er und fährt fort, den Charakter der Menschen zu beschreiben: »Freiheitsliebend, treu zu Freunden, freundlich zu ihren Schutzbefohlenen, gastfreundlich, tapfer, arbeitsam, vorsichtig; im Gegensatz zu den benachbarten Nationen haben sie eine geringere Neigung zur Intrige und Verrat.«2
Das klingt, als wäre es die Beschreibung des schottischen Nationalcharakters durch einen schottischen Patrioten. Elphinstone sucht nach Analogien, um zu begreifen, und er findet sie zuhauf. Der paschtunische Krieger und Poet Kushal Khan Khattak, der im 17. Jahrhundert gegen die indischen Moguln Widerstand leistete, wird unter der Feder Elphinstones zum schottischen Helden William Wallace, der im 13. Jahrhundert gegen die Engländer gekämpft hat. Es ist zu sehen, wie dieser gebildete Mann krampfhaft das Unbegriffene mittels Vergleichen zu verstehen sucht. Elphinstone will für ein größeres Publikum schreiben. Dabei nutzt er die romantische Sehnsucht nach dem »edlen Wilden« Rousseauscher Prägung, die damals noch eine gewisse Unschuld besitzt, weil sie noch nicht als Grundlage kolonialer Eroberungszüge missbraucht worden ist. Das wird erst in den folgenden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geschehen, als der Kolonialismus seinem Höhepunkt entgegenstrebt. Elphinstone führt in seinem Reisegepäck die Germania des Tacitus mit. Der römische Schriftsteller hatte die Germanen in mancher Hinsicht als äußerst edel und sittsam dargestellt. Er wollte mit dem Bild des edlen Barbaren die Zustände in seinem heimatlichen Rom kritisieren, die er als dekadent empfand. Elphinstone liest während seines Aufenthaltes in Peshawar immer wieder in der Germania. An freien Abenden greift er zu Tacitus’ Werk, um nach Inspiration zu suchen, nach Möglichkeiten, wie man ein fremdes Volk begreifen und beschreiben könnte, nach Wegen der Erkenntnis, die viele hundert Jahre vor ihm Tacitus gegangen ist. Manchmal glaubt er, fündig geworden zu sein.
»Also leben sie in wohl behüteter Keuschheit und sind von keinen Verlockungen des Schauspiels oder der Festmähler verdorben. Geheime Liebesbriefe sind dem Mann wie der Frau ganz unbekannt. Trotz der großen Zahl des Volkes kommt Ehebruch nur selten vor, der dann augenblicklich vom Ehemann bestraft wird. Nachdem er ihr die Haare abgeschnitten hat, treibt der Mann die entblößte Frau vor den Augen der Verwandten aus dem Haus und schlägt sie durch alle Dörfer mit der Rute; preisgegebene Schande bringt nämlich nie wieder Vergebung: weder durch ihr Aussehen, noch durch ihr Alter, noch durch gute Werke wird man ihr verzeihen. Denn hier lacht niemand über das Laster und der Zeitgeist verlangt nicht nach Verführung. So nehmen sie einen Ehemann, wie sie auch nur einen Körper und ein Leben haben, damit nicht die Überlegung über die Ehe hinausgeht, damit die Begierde nicht weiterreicht, damit sie nicht so sehr den Mann als vielmehr die Ehe lieben. Die Zahl der Kinder zu begrenzen oder einen nachgeborenen Sohn zu töten, bringt Schande, und hier sind gute Sitten mehr wert als anderswo die guten Gesetze.«3
In den Straßen Peshawars und am Hofe des Königs kann Elphinstone eine Keuschheit, wie sie Tacitus beschrieben hat, beobachten. Den Afghanen attestiert er Talent zur Liebe: »Ich bin mir nicht sicher, ob es im Osten irgendein Volk gibt, bei dem ich nur eine Spur von Liebe gesehen habe, so wie sie unseren Ideen darüber entspricht. Bei den Afghanen ist dieses Gefühl aber von überragender Bedeutung.« Und doch geht es wie bei Tacitus’ Germanen äußerst gesittet zu, auch in Peshawar bemerkt Elphinstone, dass keiner »lacht über das Laster und der Zeitgeist nicht nach Verführung verlangt«. Elphinstone freilich nutzt diese gesitteten Verhältnisse eines fremden Volkes nicht, um die Zustände in London oder Kalkutta zu kritisieren, dazu hat er keinen Anlass. Das britische Imperium vibriert vor Energie und platzt vor Selbstbewusstsein. Es geht entschlossen daran, die Geschicke der damals bekannten Welt in die Hände zu nehmen. Elphinstone ist ein Teil dieser imperialen Macht. In ihrem Apparat strebt er eine Karriere an und wird sie auch machen. Nein, er hat keinen Grund, den edlen, wilden Afghanen als Schablone zu nehmen, um der eigenen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Er ist eins mit sich und den Seinen.
Seine Mission hat allem absichtslosen Forscherdrang zum Trotz auch den Zweck, Informationen in Herrschaftswissen umzuformen. Wie könnte das, was er da kennenlernt, beherrscht werden? Wie könnte man es für England nutzen? Elphinstones Erkenntnisse dienen der britischen Afghanistanpolitik als Grundlage. Jeder Fehler in der Analyse hat daher weitreichende Konsequenzen. Elphinstone macht Fehler. Er vergleicht die afghanischen Stammesgesellschaften mit der schottischen Clanstruktur älterer Zeiten. Zwischen den beiden gibt es jedoch fundamentale Unterschiede. Die Schotten kannten eine zentrale Machtstruktur und sie verfügten über eine relativ einheitliche politische Kultur, die Afghanen haben beides nicht. Vor allem aber war die Macht der schottischen Clans an ihre Fähigkeit gebunden, das Land zu kontrollieren und zu vererben, die Bindung an ein Territorium war entscheidend.
Elphinstones Kartenzeichner, Leutnant Macartney, fertigte eine Karte an, in der den verschiedenen Stämmen verschiedene Territorien »zugesprochen« wurden – doch nicht das Territorium war für die afghanischen Stämme die erste Machtquelle, sondern der Verwandtschaftsgrad und die Fähigkeit, seine eigenen Leute zu schützen und ihnen so weit wie möglich ein Leben in Wohlstand und Sicherheit zu garantieren. Macartney aber fixierte die Stämme auf seiner Karte, als wären sie ein Teil der Landschaft, wie ein Berg, der in alle Ewigkeit an seinem Ort stehen, oder ein Fluss, der auch noch in Hunderten Jahren durch dasselbe Tal fließen würde. Dabei übersah er, dass die afghanischen Stämme eben nicht nur an die Erde gebunden waren, sondern viel mehr an ihre Verwandtschaft – dass sie einen flüssigen, netzartigen Charakter hatten. Das entging den Kundschaftern des Imperiums, dessen Logik auf hierarchische Kontrolle des Territoriums aufgebaut war.
Als die Karawane nach sechs Monaten Peshawar verließ, führte sie einen detaillierten Wissensschatz über Afghanistan im Gepäck mit sich. Als Entscheidungsgrundlage für die Ostindische Kompanie war er allerdings nur beschränkt von Nutzen. Doch das sollte sich erst mehr als dreißig Jahre später herausstellen, als die Briten Krieg gegen Afghanistan führten und verloren.
Die Karawane Elphinstones war nie über Peshawar hinausgekommen. Die gesammelten Informationen stammten nicht aus erster Hand oder eigener Anschauung. Elphinstone verließ sich auf Informanten, zumeist Afghanen, und diese hatten ein sehr feines Gespür für die Bedürfnisse des Mannes, der ihre Dienste in Anspruch nahm. Es war ihnen ein Leichtes, dem Engländer das zu erzählen, was er gerne hören wollte, und wenn es nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprach, so war es doch passgenau für den Blick ihres Auftraggebers. Auch wenn er mit einer Karte nach Hause kam, für die er viel Lob erhielt, war er doch ein Verlorener in diesem Land geblieben, denn sie verbarg mehr, als sie zeigte.
So sehe ich diesen Gesandten vor mir, und ich spüre, wie mir ein leiser Schrecken durch die Glieder fährt, ein Zittern, wie wenn man von einem hohen Sprungturm ins Wasser tauchen muss und es sich nicht traut, obwohl man doch weiß, dass die Schande, es nicht zu tun, viel schlimmer wäre als das Schlimme, was einem durch den Sprung auch widerfahren könnte. Ich sehe Elphinstone nach Kalkutta zurückkehren, schwer und satt von allem, was er gesehen hat, begierig darauf, seine Informationen weiterzugeben, zu erzählen, zu schreiben, das Unbekannte in eine Form zu gießen, die es möglich machte, Afghanistan mit anderen zu teilen. Ich halte mich an der Kante meines Schreibtisches fest, weil ich nicht springen will in diesen unermesslichen Raum namens Afghanistan. Dabei füge ich meiner Karte versehentlich eine Verletzung zu, denn sie ragt über den Tisch hinaus, und nun zeichnet sich die Kante auf ihrem papierenen Rücken ab, klar und tief wie der Schnitt eines Rasiermessers. Ich kann sie nicht erkennen, weil es immer noch dunkel ist, doch sehe ich eine gerade Linie vor mir, die nun Berge, Flüsse, Hügel entzweischneidet und ihre Namen in unlesbare Stücke teilt. Vielleicht, denke ich für einen kurzen Augenblick, gibt sie ihr Geheimnis auf diese Weise preis, unter Schmerzen gewissermaßen beginnt sie, ihre wahre Geschichte zu erzählen, als könnte man ihr unter der Folter ein Geständnis abringen. Doch fehlen mir Entschlossenheit und Glaube, denn die Karte, das weiß ich, wird ihr Geheimnis niemals preisgeben. Sie öffnet die Tür nur einen Spalt breit, sodass mir der Hauch einer anderen Welt über die Wangen streicht.
Ich hebe meine Hand von der Tischkante und taste mit den Fingern nach der frischen Falte in der Karte. Sie ist nicht so tief, wie ich dachte. Mit wenigen Strichen meiner flachen Hand kann ich sie ausmerzen, wie man einen bösen Traum mit einer einzigen, schnellen Geste verjagen kann. Gäbe ich diese Karte weg, wäre es so, als würde ich mich von einer zwar etwas zerzausten, doch treuen und lieben Freundin trennen. Dieses Schicksal hat sie nicht verdient. Darum versuchte ich, wenn sie auf Reisen wieder einen Schaden in Form eines Risses oder eines allzu starken Knickes davontrug, sie notdürftig zusammenzuflicken. Je öfter das nötig war, desto wertvoller erschien mir die Karte. Mit jeder erlittenen Verletzung wurden wir uns vertrauter. Jetzt, da ich im Dunkeln über sie gebeugt sitze, ist mir, als seien wir zusammengewachsen. Ich rettete sie vor dem sicheren Untergang, sie wies mir den Weg durch ein Land, das vom Tod gezeichnet ist, und deutet tausend Geheimnisse an, ohne sie zu verraten. Wir sind ein seltsamer siamesischer Zwilling aus Fleisch und Papier geworden. Den einen gäbe es nicht ohne den anderen, nicht hier in Afghanistan.
2
Irgendwo in der Stadt ertönt das Brummen eines Generators, dann folgt ein zweiter, ein dritter, ein vierter; erst als der Lärm der Motoren sich über die Dächer ausgebreitet hat, heult auch in unserem Innenhof der Generator auf. Die Fensterscheiben in meinem Zimmer klirren. Das Licht kommt zurück. Die Karte taucht mit einem Schlag aus dem Dunkel auf. Wie oft habe ich mir überlegt, mit welchem Gegenstand man die Konturen Afghanistans vergleichen könnte. Bei manchen Ländern ist diese Übung einfach: Italien ist ein Stiefel, Sri Lanka eine Träne, Frankreich ein Hexagon, Österreich ein Schnitzel. Andere Länder entziehen sich jeden Vergleiches, die USA zum Beispiel oder Kanada. Afghanistan ist irgendetwas dazwischen, vergleichbar mit einem Ding und doch wieder nicht. Manchmal dachte ich, es sei eine Keule mit einem kurzen, schmalen Griff, doch erschien er mir wieder zu zerbrechlich; andere Male dachte ich, es sei ein Trümmerstück einer versunkenen Welt; meistens aber glaubte ich bei der Betrachtung Afghanistans den Teil eines Puzzlespiels vor mir zu haben, das verloren gegangen ist. Nicht einmal Gott, der es erfunden haben muss, kann es wieder zusammensetzen. Das erscheint mir am überzeugendsten, denke ich, und schicke mich an, die Karte zusammenzufalten.
Da huscht draußen, vor meinem Fenster, ein Schatten vorbei, läuft über meine Karte wie ein dunkler, alles verwischender Pinsel. Es ist wahrscheinlich der Techniker des Hauses, der nach dem Rechten sieht, vielleicht ist es auch Herr Wu, der auf dem Balkon eine Zigarette geraucht hat und nun, da der Strom wieder da ist, in sein Zimmer zurückkehrt, um fernzusehen. Herr Wu ist mein Nachbar, ein freundlicher Chinese, der eine altmodische Hornbrille trägt, die ihm immer wieder von der Nase rutscht. Sobald er am Abend sein Zimmer betritt, schaltet er den Fernseher ein. Dann höre ich bis tief in die Nacht Schüsse, Schläge und Schreie. Herr Wu liebt Actionfilme, und er ist etwas schwerhörig. Die Sender, die hier empfangen werden können, bieten genügend Stoff für Herrn Wus Leidenschaft.
Als ich das letzte Mal in diesem Hotel war, hatte ich Karen zur Nachbarin, eine holländische Journalistin. Sie war sehr jung, rothaarig und morgens hörte ich sie lange und ausgiebig duschen. Sie hatte sich für ihre Zeitung, bevor sie nach Afghanistan geschickt wurde, vor allem mit sogenannten Problemvierteln in ihrer Heimatstadt Rotterdam beschäftigt. Ihre Erfahrungen dort, sagte sie mir, seien ihr hier nützlich, immerhin gehe es auch in Rotterdam um Gewalt und Konflikte zwischen den Religionen. Immerhin habe ihre Heimat Männer wie den Politiker Pim Fortuyn hervorgebracht, der mit seinem Populismus gegen muslimische Einwanderer wie eine Rakete in den politischen Himmel Hollands aufstieg und dort verglühte beziehungsweise von einem offensichtlich verwirrten Tierschützer ermordet wurde. Fortuyn war ein bekennender Schwuler, der, wie Karen mir erzählte, in einer Fernsehsendung gesagt habe: »Ich habe nichts gegen Muslime. Ich gehe mit ihnen sogar ins Bett!« Und dann, berichtete sie weiter, haben wir ja auch unseren Regisseur Theo van Gogh verloren, auf der Straße erstochen von einem niederländischen Muslim marokkanischer Abstammung, er hat ihn abgestochen wie ein Tier. Das alles wollte sie nicht als Qualifikationsausweis für ihre Aufgaben in Afghanistan verstanden wissen, dafür war sie zu bescheiden, doch glaubte sie in den Niederlanden an den Ausläufern eines Erdbebens gestanden zu haben, dessen Epizentrum in Afghanistan liegt. Sie war vom Rande in das Zentrum vorgedrungen. Ich konnte dem nichts entgegensetzen, doch schien mir das Bild nicht zu stimmen. Wo war außen? Und wo war innen? Wo sprudelte die schwarze Quelle der Gefahr? Gab es sie denn überhaupt? Oder waren es nicht vielmehr zahlreiche unterirdische Quellen, die, ohne dass wir es merkten, den Boden unterspülten, auf dem wir sicher zu stehen glaubten? Lag die Gefahr vielleicht in uns selbst? Wie war es mit unserer Angst bestellt? Unsere Angst vor dem Dunkel, das uns aus Afghanistan entgegenleuchtete?
Die Briten des 19. Jahrhunderts, die über Jahrzehnte gebannt in die afghanische »Leere« starrten, waren nicht etwa von einer Krankheit gezeichnet. Sie folgten der Logik des Imperiums, das immerzu damit beschäftigt ist, seine Grenze zu bewachen, zu sichern, zu verteidigen, und darüber ganz vergisst, dass Grenzen nicht nur eine Angelegenheit der Geographie sind. Die Briten fürchteten sich nicht vor den Afghanen, sondern davor, dass ihre europäischen Gegner Afghanistan als Sprungbrett nutzen könnten – die Annahme war völlig unrealistisch, und doch formte sie ihre Politik. Sie sicherten ihre Grenze nach außen aber vor allem deshalb, weil sie sich in ihrem Inneren vor den unterworfenen Indern fürchteten, denen gegenüber sie glaubten, sich keine Blöße geben zu können, ansonsten würde ihre Macht zusammenbrechen, die sich ja ganz wesentlich auf den Glauben der Unterworfenen stützte, dass es aussichtslos sei, aufzubegehren. Die Macht der Briten war geliehen, und sie wollten diesen Umstand verbergen, indem sie bewiesen, dass sie Afghanistan kontrollieren konnten. Was müssen Europäer und Amerikaner in Afghanistan beweisen? Wo liegen die Grenzen dieses Afghanistans, wenn Karen glaubte, sie sei gut vorbereitet, weil sie aus einem Land kam, in dem der Konflikt mit den Muslimen mitunter hässliche Züge annahm? Wer jagte uns Furcht ein? Die Afghanen oder der tödliche Schlag, der mitten aus unseren Gesellschaften kam und uns unserer Sicherheiten beraubte?
Im Gegensatz zu Herrn Wu schaute Karen nicht fern, dafür hatte sie keine Zeit, denn sie musste jeden Abend für ihre Zeitung einen Blog schreiben.
»Was die Leute alles wissen wollen?!«, sagte sie eines Abends mit einem Ausdruck des Erstaunens in der Stimme zu mir. Es war ein angenehmer, warmer Abend, wir saßen im Garten und tranken Tee. Die Hitze des Tages hatte sich verflüchtigt. Viele Gäste des Hauses genossen diese Stunden, saßen auf Plastikstühlen, plauderten oder schwiegen und atmeten tief durch wie Menschen, die gerade etwas überstanden hatten.
»Was wollen die Leser denn alles wissen?«
»Zum Beispiel, was ich einpacke, wenn ich nach Afghanistan fahre. Ob ich Lippenstift mitnehme und wenn ja, wozu.« Sie lachte auf. »Lippenstift! Ausgerechnet!«
»Und was wollen sie noch alles wissen?«
Ihr Gesicht wurde ernster. »Ob ich Angst habe«, antwortete sie, »das fragen viele: Ob ich Angst habe.«
»Und?«
»Ja, natürlich habe ich Angst. Das ist doch normal. Die Leute freilich fragen mich dann, warum ich das eigentlich alles mache, wenn ich doch Angst hätte?«
»Was antwortest du ihnen?«
»Ach«, sagte sie nur, zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck Tee. Wir schwiegen, schauten in den klaren Sternenhimmel und versuchten uns einzureden, dass Afghanistan schön sei und wir uns trotz allem glücklich schätzen konnten, hier zu sein. Es gibt Menschen, die von sich sagen, sie seien von der »maladie afghane« befallen, der afghanischen Krankheit: Man konnte kaum erwarten, wegzukommen, und wenn man weg war, sehnte man sich danach, wieder zurückzukommen, ganz gleich, wie unerträglich man es auch finden mochte, während man hier war. Wir redeten uns an diesem Abend ein, unter dieser »maladie afghane« zu leiden. Wir blieben noch lange sitzen, sprachen über Afghanistan und über unser Zuhause. Mir wurde erst später klar, dass wir versuchten, Kraft zu schöpfen, indem wir uns gegenseitig berichteten. Wir warfen die Worte aus wie Anglerhaken in den See dieser sich eindunkelnden Nacht und hofften, etwas an Land zu ziehen, das uns stärken konnte. Doch nichts dergleichen geschah. Mit unseren Haken zogen wir nur Tang an, schweigenden, dumpfen, übel riechenden Tang. Alles war still. Der Verkehrslärm, der am Tag über die Mauer unseres Hotels brandete und im Garten verebbte, war längst verstummt. Im Geviert hallten Schritte wider. Eine schrille Stimme stieß schnell hintereinander Sätze aus. Sie knallten gegen die Mauern des Hotels. Die Lichter der Zimmer starrten mit trüben Augen in den Innenhof. Als wir auseinandergingen, waren wir kraftloser als vorher.
Mit Herrn Wu habe ich solche Gespräche nie geführt. Ich spreche kein Chinesisch und er kaum Englisch. Doch sind wir uns durchaus zugeneigt. Wenn wir uns begegnen, lächeln wir ausgiebig. Ich bin mir sicher, dass auch er vom Heimweh geplagt wird, vor allem an Tagen wie dem heutigen, da es regnet, ein kalter Wind von den Bergen durch Kabul fegt und die Straßen im Schlamm versinken. An solchen Tagen könnte man glauben, dass Kabul am Grund eines Moores liegt, schwarz, dunkel und nass, wie es ist. Es ist dann nicht mehr vorstellbar, dass die Sonne hier je wieder strahlen wird, dass Kabul überhaupt noch erfüllt werden könnte vom Licht dieser Welt. Es ist an solchen Tagen ein dunkler Ort ohne Ausgang. Die Berge rücken der Stadt auf den Leib, pressen sie zusammen, bis sie ein konturloser Ziegelhaufen ist, aus dem unaufhörlich brauner Schlick fließt wie Blut aus einem geschundenen Körper. Der Himmel senkt sich bleiern herab und erstickt jeden Hilfeschrei, der dieses Gebilde durchdringen könnte.
Herr Wu, das habe ich beobachtet, wehrt sich gegen den Druck solcher Tage, indem er mehr raucht als gewöhnlich und zum Frühstück Kuchenstücke isst, die so groß und farbenprächtig gestaltet sind wie ein aufgeschlagenes Zirkuszelt. Mir fallen schon beim Anblick dieser Meisterwerke afghanischer Konditorenkunst die Zähne aus, doch Herr Wu beißt mit Freude hinein, als handle es sich um einen vitaminreichen Apfel. Seine Essgewohnheiten bleiben mir ein Rätsel. Ich würde gerne damit aufhören, mir darüber Gedanken zu machen, doch kann ich kaum anders, denn im Restaurant des Hotels bin ich fast ausschließlich von Chinesen umgeben, die mit großem Genuss die afghanischen Zuckerbomben verzehren, die ein livrierter Kellner schon ab sechs Uhr morgens auf den Büffettischen niedersinken lässt. Zwischen all den Chinesen habe ich bisher nur drei Männer aus dem Westen ausgemacht. Ich nenne sie zum Spaß meine Verbündeten, weil ich – ohne einen Beweis dafür zu haben – davon ausgehe, dass uns etwas Gemeinsames verbindet. Ein englischer Geologe namens Malcolm ist darunter. Jedes Mal, wenn ich in das Restaurant komme, begrüßt er mich mit seiner Donnerstimme.
»Na, wie war dein Tag?«
Eine Antwort wartet er gar nicht ab. Er gibt sie sich selbst: »Schlecht, da bin ich mir sicher, schlecht! So wie meiner. Ein Tag in Kabul kann nur schlecht sein. Ich kann es gar nicht erwarten, hier wegzukommen!«
»Was isst du denn heute?«, frage ich, um ihn von seiner schlechten Laune abzulenken, was mir in schöner Regelmäßigkeit misslingt.
»Essen? Nennst du das Essen, Buddy?«
»Nein, eigentlich … Ja, du hast recht.«
Dann hebt er die Arme zum Himmel und ruft: »Wer hat mir nur eingeredet, hierherzukommen? Ich bin ja schon in Rente! Wer bloß?«
Er verfällt in depressives Schweigen, das den ganzen Abend lang anhält. Vielleicht, denke ich manchmal, ist in dem defätistischen Verhalten dieses Geologen ein dumpfer Nachhall der Niederlage zu spüren, die seine Vorfahren in Kabul erlitten haben.
1839, einunddreißig Jahre nach Elphinstones Mission, marschiert eine englische Expeditionsarmee über den Bolanpass in Afghanistan ein. Die »Army of the Indus« besteht aus 15 000 Soldaten, 30 000 Menschen sind es samt Tross. Soldaten, Zivilisten, Pferde, Packtiere, Kamele, ganze Rinderherden ziehen über die Grenze. Ein endloser, langer Zug ergießt sich nach Afghanistan. Die Engländer kommen in all ihrer Pracht, siegesgewiss, zuversichtlich und sehr überheblich. Ein besonders eitler Oberst führt sechzig Kamele mit sich, die allein sein eigenes Gepäck transportieren. Zwei Kamele tragen den Zigarrenvorrat für die Offiziere. Nichts darf fehlen, auch nicht die Frauen, von denen viele mitkommen, verheiratete und unverheiratete. Die »Army of the Indus« erobert Kandahar, nimmt die Festungsstadt Ghazni im Sturm und marschiert schließlich nach Kabul, wo sie im August siegreich durch die Straßen paradiert. Die Engländer können zufrieden sein, es ist ein leichter Sieg gewesen.
Sie waren gekommen, um eine direktere Kontrolle über Afghanistan zu erringen. Der Auslöser für die Invasion war die Furcht gewesen, dass Afghanistan von Englands Konkurrenten um die Vorherrschaft auf dem Globus genutzt werden könnte, um dem Empire seine Perle Indien wegzuschnappen. Sie war so lebendig wie Anfang des 19. Jahrhunderts, als Mountstuart Elphinstone nach Peshawar gereist war. Nur der Feind war ein anderer geworden.
1808 fürchteten die Briten das napoleonische Frankreich, doch das war untergegangen, dreißig Jahre später trat das zaristische Russland an seine Stelle. Die Russophobie breitete sich in Kalkutta mit rasender Geschwindigkeit aus. Als die Perser versuchten, mit russischer Hilfe das afghanische Herat einzunehmen, als gleichzeitig die Afghanen den mit den Briten verbündeten Sikhs eine Niederlage zufügten und um ein Haar Peshawar einnahmen, da entschlossen sich die Briten zum Eingreifen – jetzt wollten sie die Sache selbst regeln.
Als sie Kabul einnahmen, glaubten die Engländer, nun einem möglichen Vormarsch der Russen einen Riegel vorgeschoben zu haben. Sie verhielten sich wie ein Schachspieler, der möglichst viele Züge des Gegners vorauszuberechnen versucht und sein eigenes Handeln darauf abstimmt. Dabei war die eigene Vorstellung vom Gegner, von seinen Absichten und seinen Möglichkeiten, entscheidend. Die Frage, ob denn die Russen überhaupt die Kraft hatten, ihre Pläne umzusetzen, interessierte die englischen Russophoben nicht. Die Imagination führte zum Handeln, weniger die tatsächliche Entwicklung. Selbst wenn es an Belegen fehlte, dass die Russen nach Indien marschieren könnten, so wurde jede Spur, die auch nur annähernd darauf hinzuweisen schien, dankbar aufgenommen und eingebaut in ein dramatisches Bedrohungsbild. Die Besetzung Kabuls war das Produkt einer Phobie.
So wie ich mit meinem englischen Geologen Malcolm jeden Tag frühstücke und ein wenig plaudere; so wie er mir erzählt, was er am Abend zuvor gemacht hat, dass er zum Beispiel zu Gast gewesen sei in einem schönen Garten, es sei schon kühl gewesen, erzählt er, aber doch irgendwie schön, denn die Sterne funkelten am Himmel Afghanistans wie Edelsteine, sie seien so nahe, dass man meinte, sie vom Firmament pflücken zu können; so wie er mir damit beweist, dass unter seiner zur Schau gestellten schlechten Laune ein Mann schlummert, der sich nicht verschließt gegenüber den Schönheiten dieser Welt, auch wenn sie ein so hartes Gesicht trägt wie Afghanistan – so sicher bin ich mir, dass es damals, 1839, unter den Briten in Kabul ähnliche Gespräche gegeben hat, nur dass sie noch viel entspannter waren, ja dass die Briten geradezu sprudelten vor Ausgelassenheit. »Da gab es Pfirsiche, Pflaumen, Aprikosen, Äpfel, Weintrauben, Walnüsse, Granatäpfel und Maulbeeren. All das wuchs in einem Garten. Es gab Nachtigallen, Amseln, Dohlen und zwitschernde Spatzen auf jedem Baum!«4 Diese Zeilen schrieb Alexander Burnes, nachdem er 1832 zum ersten Mal in Kabul gewesen war. Burnes ist zu diesem Zeitpunkt in England bereits eine Berühmtheit. Er war den Indus ab der Mündung im arabischen Golf entlanggefahren, um im Auftrag der Ostindischen Kompanie die Schiffbarkeit dieses Flusses zu erforschen. Burnes hatte dabei eine Reihe von Abenteuern zu bestehen, denn in vielen Gebieten, durch die er kam, waren die Engländer nicht willkommen. Nachdem Burnes den Indus befahren hatte, machte er sich auf nach Kabul, in die Stadt, die ein paar Jahre später sein Schicksal besiegeln sollte.
Er verlässt Kabul bald wieder, um weiterzufahren bis nach Buchara, in die Hauptstadt eines zentralasiatischen Khanats. Er beobachtet die politischen und militärischen Verhältnisse, studiert mit großer Aufmerksamkeit Märkte und Gesellschaft. Er verfasst geheime Berichte für die Ostindische Kompanie und die Regierung in London. Die Kompanie plant nämlich über den Indus eine Arterie zu öffnen, welche Fertiggüter des Imperiums bis nach Zentralasien transportieren und die dortigen Märkte überschwemmen soll. Aufmerksam registriert Burnes, welche russischen Waren zum Verkauf stehen, er recherchiert, auf welchen Routen, über welche Händler sie aus dem Reich des Zaren gekommen waren. Über Kabul versucht er sich ein Bild von Russland zu verschaffen. So ernst er den Gegner nimmt, so selbstbewusst und ironisch ist Burnes. »Der Markt von Kabul wird von den zwei großen europäischen Nationen versorgt; aber die Frauen Kabuls schätzen die britischen Güter höher ein: und der Einfluss der Frauen ist in keinem Land von geringer Bedeutung!«5
Burnes ist ein Pionier der britischen Expansion, der erste Engländer, der Zentralasien bereist und lebend zurückkommt. Er reist inkognito. Wenn er von seinen Gastgebern gefragt wird, was er denn in diesen Gegenden verloren habe, antwortet er, er sei auf dem Weg nach England, das sei, er gebe es gerne zu, eine ungewöhnliche Route, aber das Heimweh plage ihn, aber auch die Lust, Neues zu sehen. Das müsse doch jeder verstehen.
Burnes tischt diese Geschichte allen seinen Zuhörern auf, den misstrauischen Bewohnern des Königreiches Sind, dem vorsichtigen Sikh Ranjit Singh, den argwöhnischen Afghanen in Kabul, dem Khan von Buchara, der schon manche durchreisende Ausländer in das Verlies geworfen und dort verrotten hat lassen. Zeitgenössische Bilder von Burnes zeigen ihn in zentralasiatischer Tracht, mit Turban und Kaftanmantel, ein schwungvoller Oberlippenbart ziert sein Gesicht, in dem große, neugierige und etwas verschlagen dreinblickende Augen liegen. Burnes wusste sich zu helfen, kein Zweifel.
Nach seiner Rückkehr sandte ihn die Ostindische Kompanie nach London, damit er dort der Regierung persönlich Bericht erstattete. Selbst der König wollte hören, was Burnes alles erlebt hatte, und lud ihn zu einer Privataudienz. Er wurde zum Kapitän befördert, er bekam die Goldmedaille der Royal Geographical Society verliehen, und er wurde in das Atheneum aufgenommen, den heiligsten Schrein der englischen Wissenschaftselite. Er war über Nacht zum Helden geworden. Sein dreibändiges Werk Travels into Bokhara wurde ein Bestseller. Allein am ersten Tag sollen 900 Bücher verkauft worden sein. Der knapp Dreißigjährige war eine Attraktion in der feinen Londoner Gesellschaft. Frauen wie Männer hingen an seinen Lippen. Er bediente die Neugierigen bereitwillig mit seinen Geschichten aus dem wilden Osten. Burnes befriedigte die romantischen Sehnsüchte eines zu seiner vollen Blüte aufstrebenden Empires, das sich selbst als zivilisierende Macht verstand. Draußen, in den Weiten Asiens, herrschten Ungeheuer, und es war Englands Aufgabe, sie zum Wohle der Menschheit zu zähmen. Alexander Burnes war Zeuge für die Entschlossenheit Englands, die Welt zu regieren. Das war der politische Treibstoff für den kometenhaften Aufstieg dieses Mannes, der effektvoll Schauriges zu berichten wusste. »Auf unserem Marsch durch die Wüste trafen wir sieben unglückliche Perser, die von den Turkomannen gefangen worden waren und die nun nach Buchara gebracht wurden, wo sie verkauft werden sollten. Fünf der Gefangenen waren aneinandergekettet. Sie stapften mühsam durch den tiefen Sand. Als unsere Karawane an diesen bemitleidenswerten Kreaturen vorbeikam, äußerten wir laut unser Mitgefühl. Diese zur Schau getragene Sympathie zeigte Wirkung auf die Gefangenen. Sie begannen bitterlich zu weinen. Mit tränenerfüllten Augen blickten sie uns nach, die wir in Richtung ihrer Heimat davonritten.«6
Nach seinem rauschenden Erfolg in der Londoner High Society entsendet ihn die Regierung als Vertreter Englands nach Afghanistan. Er nimmt jene Nachtigall mit, die er sich nach seinem ersten Besuch in Kabul nach Indien hat bringen lassen, weil er ihrem melodischen Gezwitscher verfallen ist und darauf nicht mehr verzichten will. Als die »Army of the Indus« 1839 in Kabul einmarschiert, ist Burnes auf dem Höhepunkt seines Einflusses angelangt. Er ist der Mann, der das Land angeblich am besten kennt. Er ist es auch, der dazu rät, dass Shah Shuja, der 1810, gerade zwei Jahre nach der Mission Elphinstones, aus Kabul vertrieben worden war, mit einer eigenen Einheit in Afghanistan einreiten zu lassen. Der Anschein will gewahrt werden. Es soll zumindest so aussehen, als hätte Shah Shuja den Thron aus eigener Kraft wiedergewonnen und nicht durch die Gnade Englands. Shah Shuja ist für alle erkennbar eine Marionette, doch glauben die Engländer trotzdem, die Afghanen würden ihn als ihren König akzeptieren. Sie ignorieren das feindselige Schweigen, das sich unter den Bewohnern Kabuls ausbreitet, als Shah Shuja mit seinem prächtigen Gefolge durch die Straßen reitet; sie hören nicht auf die Warnungen, dass dieser König aus dem Exil nicht das Format habe, das schwierige Land zu regieren. Sie wiegen sich in Sicherheit und beginnen in Kabul ein Leben zu leben, wie sie es in ihren Kolonien gewohnt sind.
Der zeitgenössische englische Autor G. R. Gleig beschrieb es mit folgenden Worten: »Wo immer die Engländer hinkommen, bringen sie die Menschen, die sie besuchen, früher oder später auf den Geschmack männlicher Sportarten. Pferderennen und Cricket wurden bald nach der Ankunft vor den Toren Kabuls veranstaltet; die Einheimischen, das einfache Volk wie ihre Khans, entwickelten sehr schnell Leidenschaften dafür. Shah Shuja selbst setzte als Preis für ein Pferderennen ein wertvolles Schwert aus. Pferderennen waren so begehrt, dass auch Afghanen daran teilnahmen. Für Cricket konnten sie sich nicht begeistern. Sie sind zwar leidenschaftliche Spieler und betrachteten staunend das Schlagen, Rennen und Fangen der Engländer; aber sie legten ihre weiten Gewänder und ihre Turbane nicht ab, um das Feld als Mitspieler zu betreten (…).«7